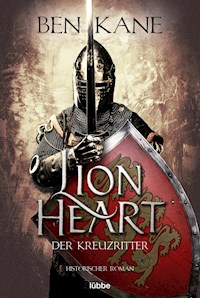8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eagles of Rome
- Sprache: Deutsch
Nur die Götter können den Römern jetzt noch helfen Germania, 9 n. Chr. Einige Stämme östlich des Rheins haben genug von den römischen Eindringlingen und planen einen Überfall. Ihr Anführer ist Arminius, ein Cheruskerfürst, der bereits lange davon träumt, die brutalen Besatzer aus seinem Land zu vertreiben. Dafür hat er sich das Vertrauen des römischen Statthalters Varus erschlichen. Nur Tullus, ein erfahrener Centurio, misstraut Arminius und warnt Varus - vergeblich. Als die drei Männer und mehrere Legionen ihr Sommerlager verlassen, um zu den Festungen am Rhein zurückzumarschieren, weiß allein Arminius, was die Römer im Dunkel des Teutoburger Waldes erwartet: Dreck, Blut und Tod. Die Bestseller-Reihe jetzt endlich auch in deutscher Sprache: "Kampf der Adler" ist der Auftakt von Ben Kanes spektakulärer Trilogie um die Varusschlacht im Teutoburger Wald
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 837
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Dramatis personae
Zitat
PROLOG
TEIL 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
TEIL 2
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
ANMERKUNGEN DES AUTORS
GLOSSAR
Fußnote
Über den Autor
Ben Kane wurde in Kenia geboren und wuchs in Irland auf, dem Heimatland seiner Eltern. Bevor er sich ganz dem Schreiben widmete, arbeitete er als Tierarzt. Schon als Kind übte die Geschichte Roms eine große Faszination auf ihn aus, weshalb mit der Veröffentlichung seines Roman-Debüts DIEVERGESSENE LEGION ein lang gehegter Traum in Erfüllung ging. Mittlerweile ist Ben Kane Bestsellerautor und lebt mit seiner Familie in North Somerset, England.
BEN KANE
KAMPF DERADLER
Roman
Aus dem Englischen vonDr. Holger Hanowell
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2015 by Ben KaneFirst published as Eagles at War by Preface. Preface is an imprint ofCornerstone, part of the Penguin Random House group of companies.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Rainer Delfs, ScheeßelIllustration Karte: Markus Weber, Agentur Guter Punkt, MünchenTitelillustration: © Arcangel/Collaboration JS; © Guter Punkt, Münchenunter Verwendung von Motiven von © shutterstock/Vitalii Gaidukov;Thinkstock/Istock; Thinkstock/HemeraUmschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5003-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Dieses Buch ist für meine Leser – für jeden Einzelnen von euch. Ihr seid auf der ganzen Welt verstreut, auf jedem Kontinent außer der Antarktis.1 Mit eurer Treue gebt ihr mir die Freiheit, von meinem Beruf als Schriftsteller leben zu können und den Job zu machen, den ich so liebe.
DRAMATIS PERSONAE
Es folgt eine Aufstellung der wichtigsten Figuren, wobei die historischen Personen mit einem * gekennzeichnet sind.
Römer und Verbündete
Herrscher in Rom um 9 n.Chr.:
* Augustus (»der Erhabene«), Princeps, Imperator Caesar Augustus. Erster röm. Kaiser (starb 14 n. Chr.).
* Tiberius Claudius Nero, späterer röm. Kaiser (14 n. Chr. bis 37 n. Chr.); von Augustus adoptiert, ab 4 n. Chr. Feldzüge u.a. gegen Germanen, Langobarden und Pannonier.
* Nero Claudius Germanicus; Großneffe des Augustus, röm. Feldherr, kämpfte an der Seite des Tiberius während des Pannonischen Aufstands, starb 19 n. Chr.
* Lucius Cominius Tullus, Centurio, 1. Centurie, Zweite Kohorte, 18. Legion.
* Marcus Crassus Fenestela, Tullus’ Optio.
Marcus Piso, einer von Tullus’ Legionären.
Vitellius, einer von Tullus’ Legionären, Freund von Piso.
Afer, einer von Tullus’ Legionären.
Degmar, Stammeskrieger der Marser, später Tullus’ Sklave.
* Lucius Seius Tubero, römischer Adliger, Tribun, 18. Legion.
* Publius Quinctilius Varus, Statthalter der Provinz Germanien (Legatus augusti pro praetore), Befehlshaber der Legionen am Rhein.
Aristides, griechischer Sklave und Schreiber des Varus.
* Fabricius, Centurio (der Primi Ordines), 2. Centurie, Erste Kohorte, 18. Legion.
* Marcus Aius, einer von Fabricius’ Legionären.
* Cessorinius Ammausias, Ursarius der 18. Legion.
* Gaius Numonius Vala, Legat des Varus.
* Lucius Nonius Asprenas, Legat in Mogontiacum.
* Lucius Caedicius, Lagerpräfekt in Aliso.
* Marcus Caelius, Centurio der 18. Legion.
* Ceionius, Lagerpräfekt.
* Lucius Eggius, Legat des Varus.
die namenlose Frau, das namenlose Mädchen.
Germanen
* Arminius, ein Stammesführer der Cherusker, in römischen Diensten (Präfekt der Reitereinheiten).
* Segimer, Vater des Arminius, Stammesführer der Cherusker.
Maelo, Arminius’ Freund und Vertrauter.
Osbert, einer von Arminius’ besten Kriegern.
Aelwird, Sprecher der Siedler bei Porta Westfalica.
Ecco, ein Sprecher der Marser.
* Flavus, Arminius’ Bruder, in römischen Diensten.
Der »Rotschopf«, Anführer der Usipeter.
* Inguiomerus (Inguiomer, auch Ingomar), mächtiger Anführer der Cherusker, Onkel des Arminius.
* Segestes, Verbündeter Roms, Stammesführer der Cherusker.
* Segimundus, Sohn des Segestes, Priester im Römerlager »apud aram Ubiorum« (»beim Altar der Ubier«).
* Maroboduus (Marbod), König der Markomannen.
»Quintili Vare, legiones redde!«
»Quinctilius Varus, gib mir meine Legionen wieder!«
Sueton, De vita Caesarum, Kaiserbiographien (erschienen nach 120 n.Chr.); in der Biografie über Augustus gibt Sueton anschaulich die Reaktion auf Varus’ Schicksal wieder.
PROLOG
GERMANIEN, 12 V.CHR.
Der Junge hatte fest geschlafen, aber er wachte auf, weil ihn jemand an der Schulter schüttelte. Mühsam öffnete er die Augen und sah eine Gestalt, die sich über ihn beugte. Der Schein des matten Talglichts betonte die Konturen im Gesicht des Mannes – den Bart, die kühnen Augen, die zu beiden Seiten des Kopfs geflochtenen Zöpfe –, aber die Miene seines Vaters machte ihm Angst. Erschrocken zuckte der Junge zusammen.
»Ist schon gut, kleiner Bär. Ich bin kein Geist.«
»Was ist denn, Vater?«, nuschelte er.
»Ich will dir etwas zeigen.«
Erst jetzt sah der Junge, dass seine Mutter halb von der kraftvollen Erscheinung des Vaters verdeckt wurde. Selbst im Zwielicht des Langhauses und noch halb verschlafen, merkte der Junge, dass seine Mutter unglücklich aussah. Sein Blick wanderte zurück zu den Augen des Vaters. »Kommt Mutter nicht mit?«
»Nein. Das ist nur etwas für Männer«, lautete die Antwort.
»Ich bin doch erst sieben …«, tastete sich der Kleine vor.
»Das tut nichts zur Sache. Ich will, dass du das siehst. Steh auf, Junge, und zieh dich an.«
Das Wort seines Vaters war Gesetz. Der Junge verließ die wohlige Wärme unter dem Bärenfell und schlüpfte mit den Füßen, an denen er selbst nachts Fußlappen trug, in seine Lederstiefel, die unmittelbar neben der niedrigen Bettstatt standen. Dann tastete er nach seinem Umhang, den er gern als zweite Decke benutzte, und legte ihn sich um die Schultern. »Fertig«, sagte er leise und schaute erwartungsvoll zu seinem Vater auf.
»Dann komm.«
Als sie an der Mutter vorbeikamen, streckte sie die Hand nach ihrem Mann aus. »Segimer, das ist nicht richtig.«
Sein Vater wirbelte herum, erregt. »Er muss das sehen.«
»Aber er ist doch noch so klein.«
»Stell meine Entscheidung nicht infrage, Weib! Die Götter sehen zu.«
Die Mutter des Jungen schob die Unterlippe vor und trat stumm beiseite.
Der Junge tat so, als habe er den kurzen Wortwechsel der Eltern überhört. Schweigend folgte er seinem Vater durch das düstere Langhaus, gab acht, nicht auf die schlafenden Sklaven zu treten, und machte einen Bogen um die ersterbende Glut der offenen Feuerstelle, um das Kochgeschirr und die hölzernen Vorratstruhen. Die beiden Eingänge des Langhauses lagen einander an den langen Seiten gegenüber. Vom anderen Ende der Wohnstatt strömte warme Luft herüber, die den Geruch der Nutztiere mitbrachte. Rinder, Schweine und Schafe standen dort in ihren Pferchen, raschelten im Stroh und gaben leise Laute von sich.
Sein Vater stellte das Talglicht auf den Boden, ehe er ins Freie trat. Er sah sich nach seinem Sohn um. »Komm.«
Der Junge schlich zur Tür. Am Himmelszelt funkelten die Sterne, aber die Nacht war dunkel und Furcht einflößend. Das behagte dem Kleinen nicht, doch sein Vater gab ihm ungeduldig zu verstehen, ihm zu folgen. Schließlich trat auch der Junge ins Freie und atmete die kühle, feuchte Nachtluft ein. Ein Schauer erfasste ihn, denn schon lagen die Vorboten des Winters in der Luft. Der Herbst neigte sich seinem Ende zu. »Wohin gehen wir?«
»In den Wald.«
Der Junge verspannte sich. Tagsüber liebte er es, zwischen den Bäumen zu spielen. Dann ahmten er und seine Freunde die Jäger nach oder wetteiferten untereinander, wer als Erster die Spuren des Wilds entdeckte und zu deuten vermochte. Aber nachts war er noch nie hier draußen gewesen. Der Wald war nun eine Welt voller Schatten. Geister trieben ihr Unwesen, wilde Tiere streiften durchs Dickicht und nur die Götter wussten, was noch. Oftmals war der Junge nachts vom Heulen der Wölfe aufgewacht. Was, wenn ihnen welche über den Weg liefen?
»Beeil dich!« Sein Vater hatte bereits einen gewissen Vorsprung und eilte über den Pfad, der aus der Siedlung in den dichteren Wald führte.
In diesem Moment war das Gefühl, allein zurückzubleiben, noch schlimmer für den Jungen als die Furcht, was wohl jenseits der Langhäuser liegen mochte. Daher lief er seinem Vater nach, ohne nach rechts oder links zu schauen. Gern hätte er an der Hand seines Vaters Halt gesucht, aber er wusste, dass er danach nicht fragen durfte. Immerhin, neben dem Vater gehen zu dürfen war besser als nichts. Segimers Langschwert, das ihn bei seinem Volk als wohlhabenden Stammeskrieger auswies, wirkte beruhigend auf den Kleinen. Bei jedem Schritt schlug es seinem Vater gegen den Oberschenkel und erinnerte den Jungen daran, dass Segimer ein gefürchteter Krieger war. Kaum einer aus dem Stamm der Cherusker vermochte es mit ihm aufzunehmen.
Nachdem der Junge ein wenig Mut gefasst hatte, traute er sich, eine Frage zu stellen. »Was wollen wir machen?«
Segimer blickte von oben auf seinen Sohn hinab. »Wir werden einer Opfergabe für die Götter beiwohnen, so etwas hast du noch nie gesehen.«
In die Angst, die der Junge tief in seinem Bauch spürte, mischte sich Aufregung. Er wollte mehr erfahren, aber etwas in dem strengen Ton seines Vaters hielt ihn von weiteren Fragen ab. Außerdem war ihm der Vater inzwischen einige Längen voraus, und der Junge hatte Mühe, Schritt zu halten. Der weiche Boden schmatzte unter ihren Ledersohlen, während sie dem Weg folgten, der sich durch die Lang- und Grubenhäuser am Rande des Dorfes schlängelte. Ein Hund schlug an, als sie an einer Wohnstatt vorbeieilten, andere Hunde griffen das Signal auf und fingen ebenfalls zu bellen an. Trotz des Gebells blieb es ruhig im Dorf. Alle schliefen, wie der Junge feststellte. Denn es war sehr spät. Ein Lächeln breitete sich in seinem noch kindlichen Gesicht aus, als er sich bewusst machte, dass er ein Abenteuer an der Seite seines Vaters erleben durfte. Es war eine Sache, gemeinsam mit den Freunden länger aufbleiben zu dürfen, wenn im Dorf ein Fest stattfand, aber mitten in der Nacht in den finsteren Wald zu gehen war wirklich ein Erlebnis. Der Umstand, dass er bei seinem Vater war, den er verehrte, machte den Ausflug umso spannender. Segimer war weder unfreundlich noch gewalttätig – einige Freunde des Jungen litten unter ihren strengen Vätern –, aber er hatte kein besonders enges Verhältnis zu ihm. Sein Vater war oft in sich gekehrt, behielt seine Gedanken und Gefühle für sich, wirkte bisweilen unnahbar. Stets hatte er mit anderen Edlen zu schaffen oder ging auf die Jagd. Oft war er fort, um gegen die Römer zu kämpfen. Diesen Ausflug galt es zu genießen, wie der Junge sich bewusst machte.
Der Pfad führte tiefer in den Wald, der sich südlich der Siedlung erstreckte. Segimer hatte dem Jungen erzählt, das Gebiet der Cherusker sei von Wäldern geprägt, aber unmittelbar bei den Siedlungen war viel gerodet worden, damit der Boden urbar gemacht werden konnte. Weiter im Westen lag der Fluss, der für seinen Fischreichtum bekannt war. Inmitten des Waldgebiets wurden auf kleineren Feldern Getreide und Gemüse wie Ackerbohnen und Erbsen angebaut, das Gras der Weideflächen diente nach der Mahd dem Vieh als Futter. Der Wald bot reichlich Feuerholz für die Stämme, Rehwild und Wildschweine kamen auf die Tafel, aber die Wälder hatten auch eine geheimnisvollere Seite, nämlich heilige Orte, an denen die Priester mit den Göttern in Kontakt traten.
Zu einem dieser geheimnisumwitterten Orte gingen sie offenbar, dachte der Junge, und sein Unbehagen nahm erneut zu. Er war dankbar, dass sein Vater nicht sehen konnte, wie sehr er zitterte. Noch nie hatte der Junge es gewagt, einen der geheiligten Haine zu betreten. Einmal hatten seine Freunde und er sich so weit in den Wald vorgewagt, bis sie den Eingang zu einem der Haine entdeckt hatten. Beim Anblick der Schädelknochen der Rinder an den Baumstämmen hatte die Jungen schließlich der Mut verlassen – schweigend waren sie zurück ins Dorf geschlichen. In dieser Nacht, so glaubte der Junge, würden sie die bleichen Rinderschädel hinter sich lassen. Schweiß begann ihm den Rücken hinabzulaufen, als sie tiefer in den Wald vordrangen. Sei tapfer, redete er sich ein. Jetzt darfst du keine Angst zeigen, auch später nicht. Damit würde er nur Schande über seine Familie bringen, auch über seinen Vater.
Dennoch, so entschlossen er sich auch gab, der Junge fuhr zusammen, als sich aus dem Schatten eines Baums eine Gestalt löste. Der Mann war in einen Umhang gehüllt und hielt einen Speer in der Hand. Die freie Hand hob er zum Gruß. »Segimer.«
»Tudrus.«
Der Junge entspannte sich. Tudrus gehörte zu den verlässlichsten Waffengefährten seines Vaters; der Junge kannte diesen Krieger schon, solange er denken konnte.
»Wie ich sehe, hast du den kleinen Bären geweckt.«
»Ja.« Segimer strich seinem Jungen flüchtig über die Schulter, doch schon für diese Berührung war der Kleine dankbar.
»Und, bist du bereit, Junge?«, fragte ihn Tudrus.
Der Junge nickte eifrig, obwohl er nicht wusste, worauf er sich eigentlich einließ.
»Gut.«
Segimer spähte in Richtung des Pfads, der von Westen auf den Weg stieß, der von der Siedlung in den Wald führte. »Erwarten wir noch andere?«
»Es sind alle hier. Krieger der Brukterer, Chatten, Angrivarier und Tenkterer. Selbst Vertreter der Marser sind gekommen.«
»Es wird Donar milde stimmen, dass sich so viele Edle entschlossen haben, der Opferhandlung beizuwohnen«, sprach Segimer und hob den Blick in den Nachthimmel. »Wir sollten uns beeilen. Der Mond wird bald seinen höchsten Punkt erreicht haben. Dann sollen sie den Tod finden, so haben es die Priester bestimmt.«
Mit einem Grummeln gab Tudrus seine Zustimmung.
… sollen sie den Tod finden. Der Junge versuchte weiterhin mit seinem Vater Schritt zu halten, doch die Worte beschäftigten ihn. Mühsam kämpfte er gegen sein Unbehagen an.
BOOOOOOO!
Der unheimliche Laut fuhr dem Jungen in Mark und Bein. Zwar hatte er sich rasch wieder gefasst, aber er merkte, dass Tudrus, der unmittelbar neben ihm stand, lächelte. Sein Vater runzelte die Stirn und gab seinem Jungen zu verstehen, ruhig stehen zu bleiben.
BOOOOOOO! BOOOOOOO!
Diesmal rührte sich der Junge nicht vom Fleck. Diese tiefen, unheimlichen Töne konnten nur von einem Horn stammen, in das ein Priester blies. Doch in der Nacht hörte es sich an, als trieben böse Geister ihr Unwesen, als kündigte eine Gottheit sein Erscheinen im Hain an. Zehn Herzschläge lang geschah nichts, auch nach weiteren zehn Herzschlägen erschien niemand. Von Unruhe erfasst, ließ der Junge seinen Blick von rechts nach links huschen, in die unermesslichen Schatten, die noch Furcht einflößender waren, als er es sich vorgestellt hatte. Schon der Pfad, der zum Hain führte, hatte ihm Angst eingejagt – ein gewundener, matschiger Weg, auf beiden Seiten eingefasst von Marschland. Der Eingang war noch schlimmer gewesen: ein Bogendurchgang aus verwittertem Holz, verziert mit Schädelknochen von Rindern. Nun wartete er gemeinsam mit seinem Vater, Tudrus und vielen Kriegern auf einer freien Fläche von etwa fünfzig Schritten Durchmesser. Die Lichtung wurde von einem Kreis heiliger Eichen begrenzt. Drohend zeichneten sich die Eichen vor dem Waldgürtel dahinter ab, sodass sich dem Jungen der Magen umdrehte.
In der Mitte des Hains befanden sich zwei Altäre, gewaltige, abgeflachte Steinquader, die aussahen, als hätten Riesen sie behauen. Auf einem der Steine hatte man Holz und Reisig aufgeschichtet. Unheilvolle rötlich braune Flecken überzogen die Oberfläche des anderen Steins. Vor den Altären prasselte ein großes Feuer, das den Hain mit seinem unsteten, flackernden Schein erleuchtete. Auf einem grob gezimmerten Tisch neben der Feuerstelle lag eine eindrucksvolle Auswahl an Werkzeugen mit glatten oder gezähnten Klingen, daneben Zangen und Hämmer. Ein zweiter Tisch war leer. Stricke hingen an den vier Beinen herab, stumme Zeugen, wozu der Tisch diente.
Der Junge hatte damit gerechnet, Tiere dort angebunden zu sehen. Bei den religiösen Zeremonien, an denen er in der Siedlung teilgenommen hatte, waren Rinder oder Schafe den Göttern geopfert worden. Einmal hatte er zugesehen – er glaubte, die Laute noch immer zu hören –, wie ein Eber geopfert worden war. Das Brüllen hatte er noch lange im Kopf gehabt.
BOOOOOOO! BOOOOOOO! BOOOOOOO! Die Laute kamen von der anderen Seite der steinernen Altäre.
»Da kommen sie«, wisperte sein Vater.
Der Junge stellte sich auf die Zehenspitzen und reckte neugierig den Hals.
Im Schein des Feuers war eine Prozession zu erahnen, die den Hain durch den Kreis der Eichen betrat. An der Spitze zwei dunkel gewandete Priester, die in lange Rinderhörner bliesen. Als Nächstes folgten zwei herrliche weiße Pferde, geführt von Jünglingen. Die Pferde wiederum zogen einen Karren, in dem ein vom Alter gebeugter Priester stand. Er hielt den Kopf gesenkt, und der Junge ahnte, dass der Alte den Lauten der heiligen Hörner lauschte. Aus den vielen leisen Zwischentönen und gebrochenen Lauten schien er bedeutsame Botschaften der Götter zu vernehmen. Dem Wagen folgten vier weitere Priester, die ebenfalls in Hörner bliesen, und dann gerieten die jämmerlichen, schlurfenden Gestalten in das Blickfeld des Jungen.
Acht Männer, an Hals und Handgelenken mit Stricken aneinandergebunden. Sieben von ihnen trugen helle Tuniken samt Gürtel, die oberhalb des Knies endeten. Nur der Umhang eines Mannes war rot, und er allein trug einen Helm mit eindrucksvollem, quer verlaufendem Helmbusch aus roten und weißen Federn auf dem Kopf.
»Römer«, entfuhr es dem Jungen in ehrfürchtigem Flüsterton. Nur einmal hatte er bislang tote Feinde seines Stammesverbands gesehen. Sein Vater und die Krieger der Cherusker hatten eine Patrouille überfallen. Doch dies waren die ersten lebenden Römer, die der Junge zu Gesicht bekam. Sie waren indes nicht unversehrt. Selbst auf die Entfernung erahnte der Junge im Schein des Feuers die Prellungen und blutigen Striemen an Armen und Beinen. Hinter den gefangenen Römern folgten stolzen Schrittes weitere Jünglinge, die von den Priestern mit dieser Aufgabe betraut worden waren. Sie waren mit langen Speeren bewaffnet.
Ein mulmiges Gefühl breitete sich im Magen des Jungen aus. Was diesen Männern auch widerfahren würde, es würde tödlich für sie verlaufen.
In diesem Moment spürte er die Hand seines Vaters auf seiner Schulter. Ein fester, harter Griff. Sein Vater beugte sich zu ihm herab. »Siehst du diese Bastarde?«
Der Junge schluckte und nickte stumm.
»Die Römer stehen für all das, wofür wir nicht stehen, Junge. Ihr Reich erstreckt sich über viele Länder und ist größer als die Strecke, die ein Mann in einem Jahr zurücklegen kann, doch sie sind noch immer nicht zufrieden. Stets trachten sie danach, neue Gebiete zu erobern. Seit vielen Jahren schon sehnt sich ihr Herrscher, Augustus …«, sein Vater spie diesen Namen regelrecht aus, »… auch über uns zu herrschen. Über unsere Stammesbrüder, die Chatten, die Marser und Angrivarier. Er will uns unterjochen, auf dass wir unter den Sohlen seiner Soldaten zermalmt werden. Nie darf er damit Erfolg haben!«
»Nie, Vater«, stimmte der Junge hastig zu, erinnerte er sich doch, was geschehen war, als die Römer zuvor im Gebiet seiner Väter eingefallen waren. Ein benachbartes Dorf war niedergebrannt worden, viele Bewohner wurden erschlagen, darunter auch die Tante und zwei Vettern des Jungen. »Wir müssen ihn aufhalten«, flüsterte er in die kühle Nachtluft.
»Ja, wir werden ihm Einhalt gebieten, und auch seinen verfluchten Legionen. Daher lege ich einen Schwur ab, gemeinsam mit den anderen Kriegern. Donar wird unser Zeuge sein.« Er bedachte seinen Sohn mit einem Lächeln, eine Seltenheit in den Augen des Jungen. »Auch du wirst diesen Schwur ablegen.«
Erstaunen erfasste den Jungen. »Ich, Vater?«
»Ja, du, kleiner Bär. Deshalb bist du hier.« Segimer legte einen Finger an seine Lippen, ehe er auf die Prozession zeigte.
Die Hornbläser setzten ihre geschwungenen Instrumente ab und bezogen neben den Altären Aufstellung. Die Augen aller waren auf den alten Priester gerichtet, der in diesem Moment von dem Karren stieg und in gebeugter Haltung zum prasselnden Feuer schlurfte. Zwei der Jünglinge führten die Schimmel von der Lichtung, während die anderen jungen Diener der Priester die Gefangenen vor sich her stießen, bis sie neben den Tischen standen.
»Wir danken Dir, o großer Donar, dass Du über uns wachst.« Die Stimme des alten Priesters klang erstaunlich fest und wollte nicht recht zu der körperlich schwachen Erscheinung passen. »Deine Donnerkeile schützen uns, Deine Sturmwolken bringen uns Regen, ohne den unsere Feldfrüchte verdorren würden. Wenn wir gegen unsere Feinde kämpfen, ist es Deine Kraft, die uns in unserem Kampf die nötige Stärke verleiht. Und dafür sind wir Dir zu ewigem Dank verpflichtet.«
Unterdessen gaben die im Hain versammelten Stammeskrieger murmelnd ihre Zustimmung. Manch einer berührte das Amulett, das er um den Hals trug – von der Form her dem Hammer der Gottheit nachempfunden. Andere waren in Gebete versunken.
»Seit einigen Jahren bedürfen wir jeden Sommer Deiner göttlichen Hilfe. Geschmeiß wie das dort …«, der Priester zeigte mit anklagendem Finger auf die Gefangenen, »… kommt zu Tausenden und bringt nichts als Zerstörung in unsere Siedlungen. Niemand von uns ist mehr sicher vor der Niedertracht der Römer, vor ihrer Mordlust. Männer, Frauen, Kinder, die Alten, die Siechen, sie alle werden erschlagen oder in die Sklaverei geführt. Römer brennen unsere Siedlungen nieder, unsere Felder stehen in Flammen, unser Vieh wird gestohlen.«
Einige Krieger machten ihrem Unmut Luft. Der Junge, der gespannt zuhörte, sah, dass sein Vater den Griff seines Langschwerts umfasste, bis das Weiße an seinen Knöcheln hervortrat. Unweigerlich stieg Zorn in dem Jungen hoch. Seine Tante und ihre Söhne – seine Vettern – waren seine Lieblingsverwandten in der großen Sippe gewesen. Diese Römer mussten wahrlich bestraft werden.
»Heute haben wir uns hier versammelt, um Dir ein Opfer darzubringen, großer Donar«, stimmte der Priester erneut an. »Demütig ersuchen wir Dich um Hilfe bei der Abwehr dieser Eindringlinge. Auf dass wir sicherstellen, dass sie, von uns besiegt, auf die andere Seite des mächtigen Stroms fliehen, den sie Rhenus nennen. Auf dass wir sicherstellen, dass sie niemals von dort wiederkehren, um Dein Land – und das unsere – heimzusuchen.«
»DONAR!«, rief Segimer mit lauter Stimme.
»DO-NAR! DO-NAR! DO-NAR!«, griffen die anderen Krieger den Ruf auf. Auch der Junge erhob die Stimme, aber sein hohes, kindliches Rufen ging in dem ohrenbetäubenden Chor unter. »DO-NAR! DO-NAR! DO-NAR!«
»So schwört in diesem heiligen Hain!«, forderte der Priester die Anwesenden auf, nachdem allmählich wieder Stille eingekehrt war.
Stolz erfüllte den Jungen, als er sah, dass sein Vater als Erster vortrat.
»Ich, Segimer der Cherusker, schwöre bei Donar, dass ich erst ruhen werde, bis wir die Römer für immer von unserem Land vertrieben haben. Mögen die Götter mich mit strafender Hand niederstrecken, wenn ich je von meinem vorgefassten Weg abkomme!«
Der alte Priester sah schweigend zu, wie die Krieger nach und nach einzeln vortraten und gelobten, unermüdlich danach zu streben, die Feinde zu besiegen und über den breiten Strom zurückzudrängen. Als Letzter wurde der Junge aufgerufen. Er war unsicher im Beisein der erwachsenen Krieger, seine Stimme zitterte ein wenig, aber zu seiner Erleichterung lachte niemand, keiner sah verstimmt aus. Der altehrwürdige Priester bedachte den Kleinen mit einem anerkennenden Nicken, und sein Vater legte ihm eine Hand auf die Schulter, als der Junge wieder zu ihm trat.
Der Priester machte eine bedeutungsvolle Geste. Vier Jünglinge packten einen der Gefangenen, einen kleinen Römer mit rundlichem Gesicht, und zerrten ihn zu den Tischen. Mit Händen und Füßen setzte er sich zur Wehr, aber die jungen Männer drückten ihn erbarmungslos auf die Tischfläche und banden ihn an Händen und Füßen.
Ehrfürchtiges Schweigen senkte sich herab, in das sich das Wimmern des Gefangenen mischte.
Trotzdem vermochte der Junge sich noch nicht vorzustellen, was hier vor seinen Augen geschehen würde. Als er jedoch vorsichtig in die verhärteten, entschlossenen Mienen der Krieger sah, erkannte er, dass die kalte Ahnung, die ihn erfasst hatte, nicht mehr zu leugnen war. Sein Blick schweifte wieder zu dem Tisch, auf den man den Gefangenen gebunden hatte.
Der alte Priester griff nach einem Werkzeug mit gebogener Klinge und hielt es hoch. »Ohne Augen werden die Römer blind sein. Sie werden unsere Krieger nicht bemerken, die im Hinterhalt lauern, sie werden unsere geheimen Marschlager nicht sehen …«
Laute des Staunens entrangen sich den Kehlen der Anwesenden. Aber er wird doch nicht …?, durchzuckte es den Jungen.
Zwei kräftige Jünglinge hielten den Kopf des Gefangenen fest, während sich der Priester unaufhaltsam und bedrohlich dem Tisch näherte. Das Klagen des Römers steigerte sich in ängstliche Hilferufe, die der nächtliche Hain verschluckte.
Plötzlich war eine tiefe Stimme zu vernehmen, in einer Sprache, die dem Jungen fremd war. Es war der Römer, der den Helm auf dem Kopf trug. Vehement drängte er vorwärts, soweit die Stricke es erlaubten. Seine Worte waren an den Priester gerichtet, dann an die versammelten Krieger, auch an die Jünglinge.
»Was sagt er, Vater?«, wandte sich der Junge an Segimer.
»Dass sie Soldaten sind«, flüsterte Segimer. »Männer von Ehre, die es nicht verdienen, wie Schlachtvieh behandelt zu werden. Er bittet darum, dass wir sie respektvoll erschlagen, wie es unter Soldaten üblich ist …«
»Und, hat er recht, Vater?«
Segimers Augen verengten sich, Kälte lag in seinem Blick. »Haben sie deine Vettern ehrenvoll getötet? Oder deine Tante? Oder die unzähligen unbewaffneten Dorfbewohner, die ebenfalls an jenem Tag den Tod fanden?«
Der Junge wusste nicht, wie seine Verwandten gestorben waren. Er hatte auch nicht alles verstanden, was sich die älteren Jungen im Dorf über die Grausamkeiten der Römer erzählt hatten, aber er war sich sicher, dass es eine böse Tat war, wenn man einer schwangeren Frau den Bauch aufschlitzte. Er verhärtete sein Herz. »Nein, Vater.«
»Deshalb werden sie wie Vieh sterben.«
Ja, sie haben es nicht besser verdient, dachte der Junge.
Das Rufen des Römers verstummte abrupt, als er von mehreren Jünglingen zu Boden geschlagen wurde. Man knebelte ihn. Kaum war das geschehen, da beugte sich der alte Priester über den Mann, der auf dem Tisch gefesselt lag. Ein grässlicher Schrei stieg in den Nachthimmel. Der Schrei war so laut, dass der Junge zunächst gar nicht glauben wollte, zu welchen Lauten ein Mensch fähig war. Der Priester legte etwas neben dem Gefesselten ab, das klein und rötlich aussah und feucht schimmerte. Die spitzen Schreie ebbten ein wenig ab. Einige Herzschläge später nahm das Schreien wieder an Intensität zu, als der Priester sein scharfes Instrument in die zweite Augenhöhle des Mannes tauchte.
Schließlich hielt der Priester mit blutbesudelten Händen zwei Augäpfel in die Höhe und wandte sich mit dieser Trophäe den Stammeskriegern zu. »Sind sie erst einmal geblendet, können die Römer uns nicht mehr sehen! Nimm diese Opfergabe an, großer Donar!«
»DO-NAR! DO-NAR! DO-NAR!«, rief auch der Junge gemeinsam mit den Männern, bis sich seine Stimme überschlug.
In diesem Moment schleuderte der Priester die Augäpfel ins Feuer.
»DO-NAR!«, brüllten die Krieger.
Behutsam legte der Priester das Instrument zurück auf den anderen Tisch und wählte ein Messer mit langer Klinge aus. Dunkles Blut lief über seine Hände, als er mit dem Dolch im verzerrten Mund des Opfers herumstocherte. Der Gepeinigte stieß einen gurgelnden Schrei aus und versuchte, sich unter seinen Schmerzen in den Fesseln aufzubäumen.
»Ohne eine Zunge können die Römer nicht länger Lügen verbreiten!« Ein noch zuckendes Stück Fleisch landete in den Flammen, die alles gierig verzehrten.
Der Junge schloss die Augen. Der Gefangene muss sterben, dachte er. Immerhin könnte er derjenige gewesen sein, der meine Vettern ermordet hat. Sein Vater stieß ihn unsanft mit dem Ellbogen an, worauf der Junge erschrocken die Augen aufriss.
»DO-NAR!«
Schließlich rammte der Priester dem Gefangenen die Klinge in die Brust. Geschickt drehte er den Dolch, setzte mehrmals gekonnt zu kurzen Schnitten an. Ein letztes Mal bog der Römer unter Qualen den Rücken durch, ehe die dumpfen Laute, die seine bloßen Fersen auf der Tischplatte erzeugten, schwächer wurden. Als der Priester dem Opfer den Brustkorb so weit geöffnet hatte, dass er mühelos das Herz heraustrennen konnte, lag der Gefangene reglos da. Auch den blutigen Muskel präsentierte der Priester den Kriegern wie eine Trophäe aus einer Schlacht. »Ohne ein Herz hat der Römer keinen Mut mehr! Keine Kraft!«
»DO-NAR! DO-NAR! DO-NAR!«
Der Junge war geradezu dankbar für die lauten, rhythmischen Rufe, die durch die Nacht hallten. Trotz des Hasses, den er verspürte, wenn er nur an die Römer dachte, drehte sich ihm bei dem grausigen Spektakel der Magen um. Vorsichtshalber kniff er die Augen zusammen und blinzelte allenfalls durch halb geschlossene Lider, als die Jünglinge den blutüberströmten Römer auf das aufgeschichtete Holz hievten und das trockene Reisig entzündeten.
Dem zweiten, dritten und vierten Römer erging es nicht besser als dem ersten – sie alle starben eines grässlichen Opfertodes.
Als Segimer sah, dass sein Sohn sich vor dem Anblick drückte, fuhr er ihn scharf an. »Sieh es dir bis zum Ende an!«
Widerstrebend gehorchte der Junge.
Segimers Atem wirbelte warm um das Ohr des Kleinen. »Willst du wissen, wie einer deiner Vettern starb?«
Der Junge wollte etwas erwidern, aber die Zunge schien ihm am Gaumen zu kleben, so aufgewühlt war er. Hastig schüttelte er den Kopf.
»Er hatte versucht, seine Mutter zu verteidigen, deine Tante, denn ihr sollte kein Leid geschehen. Er war nur ein Junge, wie du weißt, daher entwaffneten die Römer ihn mühelos. Sie drückten ihn zu Boden, und einer von ihnen trieb ihm einen Speer in den Arsch. Bis es nicht mehr weiterging. Doch der Hund trieb den Speer nicht weit genug in den Leib, um deinen Vetter gleich zu töten. Unter entsetzlichen Qualen musste er mit ansehen, wie die Soldaten erst seinen Bruder ermordeten, ehe sie seine Mutter schändeten.«
Heiße Tränen – des Zorns, der Furcht – liefen dem Kleinen über die Wangen, aber sein Vater war noch nicht fertig.
»Dein armer Vetter lebte noch, als wir das Dorf erreichten, am Abend des Überfalls. Es oblag seinem Vater, deinem Onkel, das Leben des Jungen zu beenden.« Segimer legte seinem Sohn eine Hand unter das Kinn und zwang den Jungen, ihm in die forschenden Augen zu sehen. »Jetzt weißt du, wie die Römer sind. Verstehst du jetzt?«
»Ja, Vater«, hauchte er.
»Möchtest du, dass so etwas deiner Mutter widerfährt, oder deinem jüngeren Bruder? Deiner Großmutter?«
»Nein!«
»Dann nimm hin, dass wir die Römer auf diese Weise Donar opfern. Es ist richtig so. Nötig, unvermeidlich. Mit der Billigung des Donnergottes können wir nicht scheitern und werden die Bastarde besiegen.«
»Ich verstehe, Vater.«
Segimer senkte seinen Blick in die Augen des Kleinen, aber der Junge hielt der Probe stand. Schließlich sah er, wie sein Vater zufrieden nickte.
Bis zum Schluss verfolgte der Junge jede Einzelheit der blutigen Angelegenheit. Geronnenes Blut klebte auf dem Opfertisch, durch die Nacht gellten die furchtbaren, spitzen Schreie der Gefangenen, die Luft war schwer von dem Geruch verbrannten Fleischs. Wann immer der Junge meinte, er müsse sich übergeben, zwang er sich, an seinen Vetter zu denken, den man auf einen Speer gespießt hatte – er hatte den Tod seines Bruders und die Qualen seiner Mutter mit ansehen müssen. Diese schrecklichen Bilder vertrieben alle anderen Gedanken und Gefühle. Diese Bilder waren es, die Zorn in ihm aufwallen ließen, und einmal ertappte sich der Junge bei dem Wunsch, dem Priester den Dolch aus der Hand zu reißen, um dem nächsten Opfer die lange Klinge selbst in den Leib zu rammen.
Diese Nacht werde ich mein Leben lang nicht vergessen, schwor er sich. Eines Tages, Donar sei mein Zeuge, werde ich den Römern eine Lektion erteilen, die sie niemals vergessen werden.
Ich, Ermin der Cherusker, schwöre es.
TEIL 1
FRÜHJAHR 9 N. CHR.
An der Grenze zu Germanien
1. KAPITEL
Arminius saß auf dem Rücken eines edlen kastanienbraunen Pferdes und beobachtete die acht Berittenen seiner Turma, die ihre Pferde auf dem Übungsgelände außerhalb des befestigten Lagers beim Ara Ubiorum, dem Altar der Ubier, in einen leichten Galopp versetzten. Es war ein klarer Morgen, die Luft kühl und frisch. Die letzten Spuren des Winters waren verschwunden, das fruchtbare Land um das Lager der Oppidum Ubiorum schimmerte im ersten Grün der Aussaat. Lerchen flogen über die Köpfe der Reiter hinweg, doch ihr zartes Gezwitscher ging in dem harten Hufschlag der Pferde unter. Arminius’ Offiziere gaben lautstarke Befehle.
Am Beispiel von Arminius’ Kleidung – wie bei seinen Männern auch – zeigte sich die Mischung aus römischer und germanischer Tradition: das Kettenhemd und der Gesichtshelm der Reiter hoben sich ab von dem wollenen Umhang eines Stammeskriegers, der knielangen Tunika, der eng anliegenden gemusterten Hose und den kniehohen Stiefeln. Eine edle Spatha, das lange zweischneidige Schwert der Reitereinheiten, trug Arminius an einem verzierten Lederriemen quer über der Schulter. Der Cherusker war in der Blüte seiner Jahre. Groß gewachsen und breitschultrig, bot er einen eindrucksvollen Anblick, insbesondere die grauen Augen, das auffallend dunkle Haar und der ebenso dunkle Kinnbart.
Die fünfhundert Reiter aus dem Stammesverband der Cherusker bildeten eine Ala oder berittene Abteilung der römischen Armee, zugeteilt waren sie der 17. Legion, der Legio XVII. Sie dienten als Späher und boten den marschierenden Legionären Schutz auf den Flanken, aber die Alae kamen auch in der Schlacht zum Einsatz. Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, mussten die Männer regelmäßig trainieren, und Arminius war gekommen, um die Männer während der Übungen zu beaufsichtigen. Bereits unzählige Male hatte er bei derartigen Übungen zugeschaut, daher kannte er jede taktische Bewegung in- und auswendig. Seinen gut ausgebildeten Reitern unterliefen nur wenige Fehler, daher dauerte es nicht lange, bis er seine Gedanken schweifen ließ. Tags zuvor hatte er ein offenes Ohr für den Sprecher eines Dorfes gehabt, auf der anderen Seite des Rhenus. Der Mann hatte sich lautstark über die neuen Steuern der Römer beschwert. Es war nicht das erste Mal, dass Arminius auf derartigen Groll gestoßen war. Hier in Gallien dienten die Germanen als Hilfstruppen in den Legionen, gut besoldete Männer, die mit ihrem Schicksal zufrieden waren. Auf der anderen Seite des Flusses jedoch, auf Stammesgebiet, sah die Lage ganz anders aus.
Statthalter Varus und dessen Begleiter sahen einfach über die Unzufriedenheit der Leute hinweg, wie Arminius wusste. Aus Sicht der Provinzverwalter verlief die Romanisierung Germaniens genau so wie erwartet. Entlang des Rhenus und tiefer im Inland gab es zahlreiche dauerhaft oder auf begrenzte Zeit angelegte Militärlager – auf einer Länge von dreihundert Meilen und einer Breite von etwa hundertfünfzig Meilen. Mindestens die Hälfte aller Stämme hatte sich eidlich dem Reich verpflichtet oder hatte Bündnisverträge geschlossen. Abgesehen von einigen kleineren Scharmützeln herrschte seit mehreren Jahren Frieden. Die Bautätigkeit der Legionen jeden Sommer führte dazu, dass immer mehr Wege ausgebaut und dauerhaft befestigt wurden. Eine der Siedlungen – Pons Laugona – war auf dem Weg, in absehbarer Zeit die erste römische Siedlung östlich des Rhenus zu werden, samt Forum, städtischen Gebäuden und Abwassersystem. Andere Siedlungsplätze waren erpicht darauf, diesem Beispiel zu folgen. Selbst in den Dörfern war es nicht unüblich, regelmäßig Markttage abzuhalten. Das imperiale Recht drang allmählich bis in die Stammesgesellschaft. Magistrate der Oppidum Ubiorum und aus anderen Lagern westlich des Rhenus überquerten den Fluss regelmäßig, um bei umstrittenen Gebietsansprüchen oder anderen Rechtsstreitigkeiten ein richterliches Urteil zu fällen.
Dieser schleichende Wandel in sozialen Belangen hatte einige Stammesmitglieder nachhaltig verstimmt, andere wiederum führten ein glückliches und zufriedenes Leben, da nicht zuletzt der Lebensstandard gestiegen war. Wo viele Legionäre stationiert waren, wurde auch eine Menge Proviant gebraucht, des Weiteren Getränke und Kleidung. Ackerbauern, die unweit der Lager lebten, verkauften ihr Vieh, Getreide und Gemüse, dazu Rohstoffe wie Wolle und Leder. Frauen der Siedler boten aus Wolle gefertigte Kleidung feil, zum Teil auch ihre rötlich goldenen Haare, die bei den Frauen der römischen Oberschicht sehr begehrt waren. Gefangene, die man nach Zusammenstößen mit anderen Stämmen gemacht hatte, konnte man als Sklaven verkaufen, eingefangene wilde Tiere – sie kamen in den kleinen Amphitheatern der Lager zum Einsatz, etwa im Kastell Vetera – brachten hübsche Summen ein. Junge, aufstrebende Männer hatten die Möglichkeit, in die römische Armee einzutreten und entkamen somit einem langweiligen Leben auf den Höfen ihrer Väter. Geschäftstüchtige Leute eröffneten Tavernen oder Gasthäuser in unmittelbarer Nähe der befestigten Lager, wenn sie nicht sogar Anstellung innerhalb der Castra fanden.
Ja, es konnte von Vorteil sein, Teil des römischen Reichs zu sein, wie Arminius sich eingestehen musste, aber jede Vergünstigung hatte ihren Preis. Als freiheitsliebender Stammeskrieger hatte man fortan einen Herrscher zu akzeptieren, einen sogenannten Imperator – gegenwärtig Augustus. Diesem Herrscher schuldete ein jeder Gehorsam. Augustus wurde beinahe wie eine Gottheit verehrt. Zwar hatten auch germanische Stämme Anführer, aber diese Männer genossen ein anderes Ansehen als Augustus, der »Erhabene«. Die Stammesführer wurden geachtet, dachte Arminius. Auch gefürchtet – mitunter. Verehrt – vielleicht. Geliebt – möglicherweise. Aber standen sie weit über allen anderen? Niemals. Ein Stammesführer, der mit seinem Verhalten erkennen ließ, dass er über allen anderen stand, hielt sich nicht lange an der Spitze eines Stammes. Krieger folgten dem Anführer aus Respekt, aber sobald sie keine hohe Meinung mehr von dem Mann hatten, wandten sie sich von ihm ab oder unterstützten andere Stammesführer. Arminius gehörte zu den Anführern der Cherusker und wusste, dass er auf die Unterstützung seiner Stammesmitglieder angewiesen war, insbesondere deshalb, weil er die meiste Zeit abseits des Stammesverbands bei den römischen Legionen verbrachte.
Wer Teil des Reichs sein wollte, musste noch einen zweiten Kompromiss eingehen – die verfluchten Steuern, die erhoben wurden. Arminius’ Mundwinkel zuckten, denn er persönlich machte sich nicht allzu viel daraus. Es war ein Preis, den er zu zahlen bereit war. Diesen Sommer indes sollten erstmalig Steuern auf der anderen Seite des Rhenus eingetrieben werden. Die offiziell eingesetzten Steuereintreiber, die bare Münze oder Tauschwaren im erforderlichen Wert des Steuersatzes akzeptierten, konnten sich darauf verlassen, die fälligen Beträge auch zu erhalten, hatten sie doch die Soldaten der Legionen im Rücken. Der Stammesführer, mit dem Arminius zuvor gesprochen hatte – der Mann hatte ihn für vertrauenswürdig gehalten, da Arminius selber kein Römer war –, hatte vor Zorn gebebt. »Die Steuer ist unerhört, sage ich! Ich kann es mir zwar leisten, sie zu zahlen, aber vielen meiner Leute wird es schwerfallen, Waren aufzubieten, die dem Münzwert entsprechen, von dem die Rede ist. Und wieso sollten wir uns überhaupt verpflichtet fühlen, Steuern zu zahlen?«
Arminius hatte Ausflüchte gemacht und davon gesprochen, dass die Römer Schutz boten und dass jedermann von den Vorteilen profitierte, die das Zusammenleben mit den Römern mit sich brachte, aber er war nicht mit dem Herzen bei der Sache gewesen. Inzwischen vermutete er, dass der Stammesführer das auch gespürt hatte. Der umstrittene Erlass, Steuern zu erheben, beschränkte sich nicht allein auf die Stammesverbände im Grenzbereich des Rhenus – etwa dreißig Meilen östlich des Flusses –, sondern betraf all diejenigen, die im Einflussgebiet Roms lebten. Die Stämme weiter im Inland waren es gewohnt, ihre Söhne fortzuschicken, auf dass sie bei den Legionen dienten. Die meisten Stämme hatten sich zudem mit Gepflogenheiten der römischen Gesellschaftsordnung und dem alltäglichen Leben abgefunden. Den Einfluss Roms hinzunehmen war eine Sache, dachte Arminius, aber mit der Steuer verhielt es sich anders. Alter Zorn regte sich wieder in seinem Bauch, jener Groll auf Rom, den er von klein auf verinnerlicht hatte.
Hufschlag ließ den Boden erzittern, auf dem Arminius’ Pferd stand. Arminius’ Aufmerksamkeit galt wieder seinen Männern. Die Reiter nutzten das gesamte Areal des Übungsgeländes, preschten vor und zurück und vollführten dieselben Bewegungsabläufe immer und immer wieder. In enger Formation hielten sie geradewegs auf einen Stapel Ausrüstung zu. Sie bildeten die »Speerspitze«, die gefürchtete Formation, mit der Reitereinheiten versuchten, die feindliche Linie aufzubrechen. Die nächste Formation, ein lockeres, umgekehrtes »V«, hatte dieselbe Zielrichtung, wurde indes bei unvorbereiteten Gegnern angewendet, die keine Zeit hatten, ihre Reihen zu schließen. Die dritte Übung war die einfachste: Die Reiter blieben auf einer Höhe, versetzten ihre Pferde zunächst in leichten Trab, ehe sie – Reiter neben Reiter – im Galopp zum Sturmangriff übergingen.
Während des Ritts blies der Hornbläser mit voller Kraft in die Bucina. Ein tief dröhnendes BOOOOOOO! BOOOOOOO! BOOOOOOO! schallte über die Fläche. Ein solcher Angriff, unterstützt von dem Klang der Hörner, versetzte die feindlichen Fußtruppen fast ausnahmslos in Schrecken. Arminius beobachtete seine kleine berittene Einheit und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Ob es nun Wagemut war oder der Wunsch, ihn zu beeindrucken, vermochte Arminius nicht einzuschätzen. Jedenfalls sah es einen Moment so aus, als habe der Offizier dort im Sattel kurzzeitig die Kontrolle über den Sturmangriff verloren. In gestrecktem Galopp donnerten die Reiter über das Gelände und waren nicht mehr weit von einer Kohorte Legionäre entfernt, die sich ebenfalls dort zu Waffenübungen eingefunden hatte. Natürlich wussten die römischen Fußsoldaten, dass die heranpreschenden Reiter freundlich gesinnt waren, dennoch scherten einige der Legionäre aus der taktischen Formation aus und versuchten, sich vor den Reitern in Sicherheit zu bringen – sehr zum Ärger des Centurios. Der Offizier drohte den Reitern mit der Faust und fluchte, aber der Unmut richtete sich ebenso gegen die eigenen Leute, die ihre Position verlassen hatten, ein im Ernstfall tödlicher Fehler. Doch schon bald verliefen die Übungen wieder wie zuvor, der Ärger war verflogen. Arminius hatte aber erneut die Bestätigung, dass der Vorstoß seiner berittenen Einheit äußerst wirkungsvoll war.
Es ist so wirkungsvoll, dachte Arminius mit Befriedigung, da es so Furcht einflößend ist. Viele seiner Männer trugen Gesichtshelme der Reiterei, teils mit Silberblech überzogene eiserne Masken, die mit Scharnieren mit der Helmkalotte verbunden waren. Die Masken waren zwar nicht so verziert wie seine, waren aber von derselben Machart und den Gesichtskonturen nachempfunden. Da bei heruntergeklappter Maske das Sichtfeld eingeschränkt war, griffen nur die geschicktesten Reiter auf den Gesichtshelm zurück. Doch der Effekt der Maske – der Reiter verwandelte sich in ein überirdisch wirkendes Geschöpf, das womöglich der Unterwelt entsprungen war – machte die Einschränkung wieder wett. Selbst wenn bei einem forcierten Angriff mehrerer Alae nur wenige Berittene Gesichtshelme trugen, versetzte der Anblick der strengen, starren Masken – zusammen mit den tiefen Tönen der Bucinae – den tapfersten Gegner in Angst und Schrecken.
Arminius war lange genug im Dienst, er hatte all die erforderlichen Taktiken mehr als verinnerlicht. Er kannte die Wirkung jeder Maßnahme und vermochte einzuschätzen, wann welche Taktik zum Einsatz kommen musste. Die Reiterei war ein bedeutender Bestandteil der eindrucksvollen römischen Kriegsmaschinerie. Doch Kernstück blieben nach wie vor die berüchtigten Linien der gepanzerten Legionäre. Erneut wanderte sein Blick aus grauen Augen zu der Einheit, die seine Reiter eben eingeschüchtert hatten.
Es fühlte sich nach wie vor eigenartig an, die Römer als Verbündete zu sehen. Das hatte sich seit seinem ersten Tag bei der römischen Armee nicht geändert – das war nunmehr acht Jahre her. Die Feldzüge und Schlachten, an denen er seither teilgenommen hatte, bedeuteten, dass er großen Respekt vor den Soldaten und deren Offizieren hatte. Tapferkeit, Disziplin und das Können der Legionäre waren bemerkenswert. Arminius wusste auf die Schnelle nicht, wer es in offener Feldschlacht mit den römischen Legionären und ihrer Kohortentaktik aufnehmen konnte. Bei mehr als einer Gelegenheit waren er und seine Männer durch das rasche Eingreifen einer Kohorte mit dem Leben davongekommen. Arminius hatte bereits lange Märsche mit den Legionen hinter sich, hatte sich ein ums andere Mal mit Offizieren überworfen, dann wiederum mit ihnen gezecht oder bei Prostituierten gelegen. Seine Treue dem Reich gegenüber lohnte man ihm mit der Verleihung des Bürgerrechts, ehe man ihn in den Rang eines Eques erhob, den begehrten Ritterstand.
Trotz all dieser Erfahrungen und Ehrungen fühlte Arminius sich den Römern weitaus weniger verbunden, als man hätte vermuten können. Das lag unter anderem daran, dass er sich nach wie vor mit Stolz als Cherusker fühlte. Das Überlegenheitsgefühl der Römer machte die Sache nicht einfacher. Auch wenn Arminius inzwischen römischer Bürger und Eques war, so war er in den Augen vieler Offiziere nicht viel mehr als ein Wilder, der sich in ein Bärenfell hüllte. Aus Sicht der Römer waren Arminius und seine Männer gerade gut genug, um für Rom zu kämpfen – und zu sterben –, als gleichwertig wurden die Männer aus den verschiedenen Stämmen indes nicht anerkannt. Erfahrungen, die nicht angenehm gewesen waren, wie Arminius während der Einsätze in anderen Teilen des Reichs hatte erleben müssen. Nun war er zwar in der Nähe der alten Stammesgebiete, doch das verschärfte seine Gemütslage nur noch. Keine zwei Meilen vom Lager entfernt, auf der östlichen Seite des Rhenus, begannen die Gebiete der Stämme. Das Siedlungsgebiet seines Volkes, der Cherusker, lag weit entfernt, aber Arminius hatte mit den Usipetern auf der anderen Seite des Flusses mehr gemeinsam als mit den Römern. Mit den Stämmen teilte er dieselben Werte, er sprach eine ähnliche Sprache und verehrte dieselben Gottheiten.
Die Nacht in dem heiligen Hain vor so langer Zeit hatte er nie vergessen, und ein Rinnsal Schweiß lief ihm am Rücken hinab. Wann immer die Legionen den Fluss überquerten, um Stämme zu bestrafen, die sich gegen die Herrschaft des Reichs aufgelehnt hatten, handelte es sich bei denjenigen, die in ihrem Blut lagen, nicht um Dacier, Illyrer oder Thraker. Nein, es waren Angehörige von Stämmen, deren Namen Arminius von klein auf kannte. Strafaktionen hätten die Cherusker treffen können, also auch ihn. Es waren Krieger, die dort erschlagen wurden, wie seine Tante und seine Vettern, die die Römer vor all den Jahren hingeschlachtet hatten. Es handelte sich um Stämme, die das Recht hatten, ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung zu leben. Warum sollten sie Untertanen des Augustus werden, der viele hundert Meilen entfernt in Rom herrschte? Diese und andere Fragen stellte sich Arminius immer wieder. Und warum sollte er sich unterordnen?
Mittlerweile war es einundzwanzig Jahre her, dass er mit seinem Vater im Hain Zeuge der Opferhandlung gewesen war, aber die Worte des Schwurs klangen so lebhaft in seinem Kopf nach wie an jenem Tag, als er den Schwur ablegte. Eines Tages, Donar sei mein Zeuge, werde ich den Römern eine Lektion erteilen, die sie niemals vergessen werden. Ich, Ermin der Cherusker, schwöre es.
Sein Blick wanderte zum blauen Himmel hinauf, an dem hier und da kleine weiße Wolken wie Schafswolle schwebten. Die Sonne wärmte, war aber nicht heiß. Das Trillern der Lerchen war immer noch zu hören, der Frühling neigte sich seinem Ende zu. Bald hielt der Sommer Einzug, und dann würde Publius Quinctilius Varus, der Statthalter des besetzten Teils von Germanien, seine Armee östlich über den Rhenus beordern. Seine Truppen sollten Steuern eintreiben, sogar in der Gegend zu beiden Seiten des Flusses Visurgis. Das mit den Steuern können sich auch nur die verfluchten Römer ausgedacht haben, dachte er. Das Silber, das die Stämme mühsam aus den Bergwerken holten, würden die Römer benutzen, um weitere Statuen ihres Herrschers zu gießen. Straßen würden sie bauen, auf denen ihre Armeen schneller vorankamen. Großer Donar, betete er, ich habe viele Jahre gewartet, um meinen Eid zu erfüllen. Ich gelobe, Vergeltung zu üben an denen, die Angehörige meines Stammes erschlagen haben. Ich habe Dich ersucht, Du mögest mir im kommenden Sommer die Gelegenheit für meine Rache gewähren.
Diesen Sommer.
»Sei gegrüßt!«, rief ein gestandener Centurio. Der Offizier trug einen Schuppenpanzer und einen Helm mit quer verlaufendem Busch aus roten Federn und eilte über das Übungsgelände in Arminius’ Richtung.
Das muss der Offizier sein, der versucht hat, die Kohorte zusammenzuhalten, dachte Arminius belustigt. Aber der Mann sah keineswegs zufrieden aus.
»Centurio.« Arminius nickte dem Mann kurz zu, das musste als Gruß reichen. Als Eques stand er weit über einem gewöhnlichen Centurio, was dieser wiederum wusste. Arminius sah es dem Römer an, dass es ihm nicht leichtfiel, den Rangunterschied zu akzeptieren. Aus Sicht vieler Römer war Arminius ein Emporkömmling aus dem Land der Barbaren. Arminius hatte sich stets große Mühe gegeben, mit den Centurionen auszukommen, mit denen er zu tun hatte. Mit den meisten herrschte Einvernehmen, bei diesem indes würde es nicht so einfach werden. Bittere Erinnerungen stiegen in ihm hoch. Einst hatte sein Vater ihn nach Rom geschickt, einen Jungen von zehn Jahren. Das gehörte zu Segimers Plan, ebenso wie Arminius’ Eintritt in die Legion Jahre später. Der Junge sollte die römische Lebensart aus unmittelbarer Nähe erleben und alles lernen, was ein Junge seines Alters aufnehmen konnte – dabei sollte er seine Stammeswurzeln und seine wahre Loyalität nie vergessen.
Doch für die römischen Jungen – viele stammten aus wohlhabenden Familien –, mit denen Arminius fortan klarkommen musste, war ein Junge aus dem Land der Barbaren nicht viel mehr als ein Sklave. Nach etlichen blutigen Schlägereien, aus denen Arminius mitunter als Verlierer hervorgegangen war, respektierten die Jungen zumindest seine Fäuste und Stiefel. Endlich hielten sie auch den Mund, wenn er vorbeikam. Fortan fürchteten sich die meisten vor ihm, aber nur wenige hatten den Schritt gewagt, ihm die Hand zu reichen und ihre Freundschaft anzubieten. Arminius hatte lernen müssen, dass er sich selbst der Nächste war. Er traute niemandem über den Weg.
Jetzt merkte er, dass der herannahende Centurio Arminius’ Kinnbart mit verächtlichem Blick musterte. Einmal mehr ahnte er die Gedanken seines Gegenübers, ehe überhaupt ein Wort gewechselt worden war. Du fühlst dich so überlegen, nicht wahr, du Hurensohn? Absichtlich strich sich Arminius den Bart, den die Römer als Ausdruck der Unkultiviertheit sahen. Für ihn, Arminius, bedeutete der Kinnbart ein Symbol seiner Kultur. »Kann ich Euch behilflich sein?«
»Ich wäre Euch sehr verbunden, wenn Ihr Eure Männer ein klein wenig besser unter Kontrolle hättet.«
»Ich verstehe nicht recht, wovon Ihr sprecht, Centurio«, log Arminius mit stiller Genugtuung.
»Eure Einheit ist eben erst in gestrecktem Galopp über die Fläche dort drüben gesprengt. Fast hätte es einen Zusammenprall mit meinen Männern gegeben! Das hat für große …«, offenbar suchte der Centurio nach einem Wort, das nichts mit Furcht zu tun hatte, »… Verwirrung gesorgt.«
»Nun, so nah sind meine Leute Eurer Kohorte auch wieder nicht gekommen«, wiegelte Arminius ab.
»Nah genug, um Panik auszulösen …« Arminius sah, dass der Centurio seine Worte bereute und sofort erklärend hinzufügte: »Zumindest bei den Rekruten.«
Arminius zog die Augenbrauen hoch. »Panik, sagt Ihr? Seit wann zeigen die Legionäre der 17. Legion Anzeichen von Panik?«
»Das ist nicht ungewöhnlich bei Männern, die bislang noch keine heranpreschende Reiterei mit eigenen Augen gesehen haben«, erwiderte der Centurio und kochte sichtlich vor Wut.
»Wenn Ihr noch einmal den Mund aufmacht, Centurio, dann werdet Ihr mich mit Herr anreden«, beschied Arminius ihm, inzwischen gleichermaßen erbost.
Dem Centurio blieb die Spucke weg, er schluckte. »Herr«, stieß er widerwillig hervor.
»Zuerst habe ich Eurer übermäßigen Vertraulichkeit keine Beachtung geschenkt, Centurio, weil ich nicht viel auf Zeremonielles gebe. Wenn sich jemand jedoch respektlos benimmt, so erinnere ich ihn daran, dass ich es bin, der die Ala der 17. Legion befehligt. Ich bin nicht nur Bürger Roms wie Ihr, ich gehöre dem Stand der Equites an. Hattet Ihr das vergessen?« Arminius fixierte den Mann mit bohrendem Blick.
»Nein, Herr. Bitte um Nachsicht, Herr«, antwortete der Centurio und errötete.
Arminius wartete einige Herzschläge ab, um seine Autorität zu untermauern. »Ihr wolltet also was sagen …?«
»Einige meiner Leute sind nicht an Reitereinheiten gewöhnt, Herr. Dennoch«, fügte er rasch hinzu, »wenn Eure Reiter beim nächsten Mal nicht so nah kämen, wäre ich Euch sehr dankbar.«
»Ich kann nichts versprechen, Centurio. Stattdessen schlage ich vor, dass Ihr woanders übt, und zwar mit weiteren Reitern, damit Eure Leute etwas dazulernen. Denn sonst werden sie niedergemacht, wenn sie erst im Kampf feindlichen Reitern ausgesetzt sind.« Arminius ließ ein kaltes Lächeln folgen. »Ihr dürft Euch entfernen.«
»Herr.« Dem Centurio gelang es trotzdem, seine Abneigung gegenüber dem Eques im Tonfall anklingen zu lassen. Ein gewagter Schritt, mit dem der Centurio Arminius um einen Teil seiner Genugtuung brachte. Im Gegenzug wies Arminius seine Männer an, das halsbrecherische Manöver, vor dem einige der Legionäre Reißaus genommen hatten, erneut durchzuführen. Nach dem dritten Sturmangriff hatte der Centurio genug, gab sich geschlagen und verzog sich mit den Männern seiner Centurie in eine andere Ecke des Übungsgeländes. Arminius sah den Soldaten mit kalter Freude nach. Neue Freunde im Kreis der Centurionen hatte er sich mit dieser Entscheidung indes nicht gemacht. Falls der Kerl sich beim Legaten beschwerte, könnte es zu einer Zurechtweisung kommen. Arminius war es gleich. Der Versuch war es wert gewesen, und zumindest dieser Centurio würde ihm nicht mehr in die Quere kommen.
Einige Stunden später hielt sich Arminius in seiner Unterkunft auf und überlegte angespannt, welchen Kurs er einschlagen sollte. Immer und immer wieder schritt er in dem schlichten Raum auf und ab. Zehn Schritte von einer Wand zur anderen, dann die gleiche Strecke noch einmal. Die Büste des Augustus, die er dort hatte hinstellen lassen, um den Eindruck zu erwecken, er verehre den Herrscher wie jeder andere auch, bedachte er mit finsterer Miene. Mehr als einmal wanderte sein Blick auf die Militär-Karte, die er auf seinem Arbeitstisch entrollt hatte, an den Ecken beschwert mit kleinen Öllampen aus Ton. In diesem Dokument waren die Militärlager und die Entfernungsangaben in Meilen angegeben. Der Rhenus war wie ein breites Band, das sich in nordsüdlicher Richtung über das Pergament schlängelte. Kleinere Flüsse flossen aus germanischem Stammesgebiet in den breiten Strom. Schwarze Rechtecke markierten die Positionen der Lager zu beiden Seiten des Rhenus. Östlich des Flusses gab es nur einige wenige Marsch- bzw. Winterlager, was nicht verwunderlich war, aber die Dinge waren im Wandel begriffen, wie Arminius sich voller Zorn bewusst machte. Mit jedem Jahr, das verstrich, erweiterte Rom sein Einflussgebiet, und die Möglichkeiten, eine groß angelegte Rebellion anzuzetteln, wurden geringer. Wenn es diesen Sommer nichts würde, dann nie, machte er sich bewusst.
Es war an der Zeit, den Anführern der anderen Stämme auf den Zahn zu fühlen, um herauszufinden, wo die Loyalität der Männer lag. In den kommenden Tagen sollte er Gelegenheit dazu erhalten. Varus, der Statthalter des besetzten Germaniens, hatte Arminius nach Vetera beordert, in das befestigte Lager, das ungefähr sechzig Meilen weiter nördlich lag, ebenfalls unmittelbar am Rhenus. Es bot sich an, dem Verlauf der Straßen zu folgen, die die Römer westlich des Rhenus angelegt hatten, aber als Anführer von Hilfstruppen konnte Arminius es sich erlauben, die Strecke bis Vetera auf der anderen Seite des Flusses zurückzulegen. Ein Abstecher zu seinem Stammesverband würde jedoch zu lange dauern. Dafür lag das Gebiet der Cherusker zu weit im Osten. Doch es wäre ihm möglich, unterwegs einige Stammesführer zu treffen, die er mit etwas Glück für seine Sache gewinnen könnte.
Sein Vorhaben war indes nicht ohne Risiken. Jedes dahergelaufene Stammesoberhaupt, das erpicht darauf war, seine Bündnistreue zu Rom unter Beweis zu stellen, könnte ihn verraten. Und wenn Varus oder andere hohe Offiziere einem solchen Mann Glauben schenkten, wäre Arminius’ Leben in Gefahr. Verflucht seien die Risiken, dachte er grimmig, denn vor Augen hatte er das schreckliche Schicksal seiner Tante und seiner Vettern, die auf grausame Weise von den Römern ermordet worden waren. Ihre Schatten würden ihn im jenseitigen Leben heimsuchen, wenn es ihm nicht gelang, sie in diesem Leben zu rächen. Es war eine Schande, dass sein eigener Bruder Flavus nicht so dachte wie er, aber daran konnte Arminius nichts ändern. Flavus war etliche Jahre jünger und besaß ein unberechenbares Temperament. Schon als Kinder hatten sie sich nicht verstanden, daher wunderte es Arminius nicht, dass sein Bruder loyal zu Rom stand, mit ganzem Herzen. Einmal, vor Jahren, hatte Arminius in Flavus’ Beisein durchblicken lassen, wie sehr er es hasste, dass Rom seine Herrschaft auf die Stammesgebiete rechts des Rhenus auszuweiten versuchte. Flavus hatte empört reagiert, sodass Arminius seither nie wieder davon gesprochen hatte. Er würde sich auch jetzt bedeckt halten, aus Vorsicht.
Lautes Klopfen an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken. »Wer da?«
»Osbert.«
Selbst wenn der Name des Sprechers nicht cheruskisch gewesen wäre, hätte der Mann nie ein Römer sein können. Er hatte kein »Herr« nachgeschoben. Arminius wäre bass erstaunt gewesen, wenn ihn plötzlich einer seiner Gefolgsleute so angeredet hätte. Es war wieder eine Eigenart seines Volkes, dass sich die Männer untereinander stets auf Augenhöhe begegneten – was wiederum vielen römischen Offizieren aufstieß und Anlass bot, auf die germanischen Hilfstruppen herabzublicken. Aber die Römer begreifen einfach nicht, worum es geht, dachte Arminius: Stammesführer betrachten ihre Gefolgsleute nicht als Untergebene. »Herein.«
Der Krieger, der eintrat, hatte seinen Bart genauso gestutzt wie Arminius. Osbert war klein und kräftig, hielt bei Trinkgelagen lange durch und konnte im Faustkampf ebenso gut austeilen wie einstecken, kurzum, er zählte zu Arminius’ verlässlichsten Leuten. »Arminius.« Wie selbstverständlich trat er zu dem Tisch, warf einen Blick auf die Karte, gab einen Laut des Unmuts von sich und fuhr mit einem Finger über die Straße, die nach Osten führte. »Mit den Gedanken schon bei der Reise?«
»Genau.«
»Sollte keine besonderen Schwierigkeiten machen, so Donar will.«
»Du sagst es.« Wenn du wüsstest, was ich im Sinn habe, dachte Arminius. Sosehr er sich wünschte, Osbert in seinen Plan einzuweihen, vorerst musste er Stillschweigen bewahren. »Was führt dich zu mir?«
»Der Priester am Ara Ubiorum, Segimundus, bringt am Altar ein Opfer dar, zu Ehren Augustus’. Er würde sich freuen, weitere Opfergaben entgegennehmen zu können, wenn er mit seinem Opfer fertig ist. Also wollen einige von uns ihm ein paar Widder bringen. Ich weiß, dass du dir nicht allzu viel daraus machst, die Götter um ihr Wohlwollen zu bitten, aber die Männer würden sich freuen, wenn Segimundus sie segnet, ehe wir das Lager verlassen.«
Ja, es wäre gut für die Moral, an der Zeremonie teilzunehmen, dachte Arminius. »Ich bin dabei. Es schadet keinem von uns, zu wissen, dass die Götter auf unserer Seite sind.«
Der große Altar zu Ehren Roms und Augustus’ war vor nunmehr acht Jahren auf Geheiß des Lucius Domitius Ahenobarbus errichtet worden, des ersten offiziellen Statthalters der angestrebten Provinz Germanien. Um die Erhebung zum kultischen Zentrum gebührend in Erinnerung zu behalten, war der Name Ara Ubiorum gleichbedeutend mit dem Siedlungsnamen Oppidum Ubiorum. Die große Steinsäule ragte aus einem Sockel hervor, in den Szenen aus dem Leben des Augustus und dessen Familie gemeißelt worden waren. Im Mittelpunkt standen die den Göttern zugedachten Opfergaben der Herrscherfamilie. Die üblichen Steinsockel außerhalb der Tempel wirkten geradezu klein im Vergleich zu diesem Heiligtum. Die Stele war in der Tat so hoch, dass der Augustus gewidmete Schrein, der dahinter stand, ebenfalls klein wirkte. Dennoch war auch dieser Gebäudekomplex groß angelegt, sechs Säulen bildeten die breite Front des Portikus.
Der Bereich, der für die Ausübung der Religion vorgesehen war – ein großes, von einer niedrigen Mauer eingefasstes Areal –, befand sich außerhalb der Siedlung Oppidum Ubiorum, unweit des Rhenus. Neben dem Haupttempel und dem großen Altar gab es kleinere Schreine, die Unterkünfte für die Priester, Unterrichtsräume für die Ausbildung der Akolythen, des Weiteren Stallungen für das Vieh. Eigens für Pilger, die von weither kamen, gab es eine Unterkunft und eine Taverne.
Der Ort konnte sich kaum retten vor Verehrern der Götter.
In Begleitung von Osbert, einigen Männern und drei Opfertieren bahnte sich Arminius seinen Weg durch die Menge in Richtung Altar. Vor der Stele und dem Sockel hatten sich einige Hundert Legionäre und Offiziere versammelt, darunter auch der Legat, der von offizieller Seite verfolgte, wie der Priester Segimundus die Opfer für Augustus darbrachte. Während des ganzen Jahres gab es ähnliche Opferungen. Arminius nahm jedoch nur an den Zeremonien teil, bei denen seine Anwesenheit unerlässlich war. Gelegentlich bekam er eine Einladung von der Principia. Die heiligen Tage waren gewiss klug ersonnen, halfen sie doch, die Autorität des Herrschers zu untermauern. Auf diese Weise unterstrichen die Priester, dass Augustus ein göttliches Geschöpf war.
Die meisten Leute würden sich damit zufriedengeben, über den halben Erdkreis zu herrschen, dachte Arminius, der wie immer verärgert war angesichts der Zurschaustellung römischer Stärke. Warum musste sich Augustus obendrein zu einer Gottheit aufschwingen? Arminius vermutete, dass viele Römer so dachten wie er, jedoch nie etwas verlauten ließen. Es stand niemandem gut an, der in der Armee diente, abschätzig über den Herrscher zu reden.
Als Arminius sich dem Priester näherte, spürte er, dass etwas nicht stimmte. Keiner der hier versammelten Offiziere sah zufrieden aus. Die Männer tuschelten hinter vorgehaltener Hand. Auf den ersten Blick konnte er mit den Kadavern der Widder vor dem Altar – sechs an der Zahl – nicht viel anfangen. Der Herrscher war so bedeutend, da bedurfte es einer beträchtlichen Anzahl Opfergaben. Segimundus, wie immer gut zu erkennen an seinem wirren Schopf blonder Haare, beugte sich gerade über eines der noch lebenden Opfertiere, das zwei Akolythen mühsam an Stricken hielten. Andere Gehilfen hatten derweil dafür zu sorgen, dass weitere Tiere nicht in Panik gerieten. Ein Schwall Blut ergoss sich über den Boden, als Segimundus dem Widder mit scharfer Klinge die Kehle aufschlitzte. Das Tier knickte ein, doch eine Weile zuckten die Beine noch und erzeugten einen eigenartigen Rhythmus auf dem Boden.
»Das Tier erfuhr sein Ende wie erwartet«, sprach Segimundus. »Das ist ein gutes Zeichen.«
»Das habt Ihr auch bei den anderen behauptet, verflucht«, ließ sich einer der Offiziere vernehmen.
»Macht weiter, werft einen Blick auf die Leber!«, rief ein anderer.