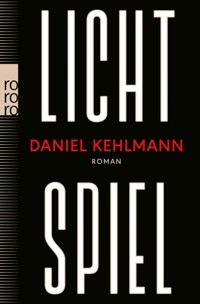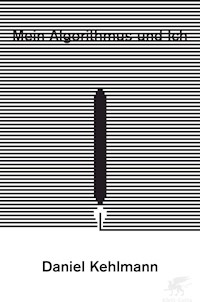7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Daniel Kehlmann schreibt mit Verve und Hingabe nicht nur Romane, sondern auch über sie. Lob versammelt seine jüngsten Texte – Reden, Essays, Rezensionen –, die von Literatur erzählen und, mal mit Bewunderung, mal mit Humor, von ihren jungen und alten Meistern. Doch klug und kenntnisreich von Shakespeare, Kleist und Thomas Mann, von Beckett, Hamsun und Thomas Bernhard, von Imre Kertész, Max Goldt und Stephen King zu reden ist das eine. Das andere sind die «sehr ernsten Scherze» über alltägliche wie ästhetische Fragen: Soll man von der wohlgepolsterten Demütigung der ersten Lesereisen berichten? Und zugeben, daß alles, was in Büchern steht, einem sowohl wirklicher als auch wahrer erscheint als die aufdringliche, laute und auch ein wenig Angst einflößende Welt? Man soll und muß – auch das zeigt dieses Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Daniel Kehlmann
Lob
Über Literatur
Inhaltsverzeichnis
I
Der melancholische Lobbyist
Der Reporter Truman Capote
Der alte Mann und das Buch
Kein ehrlicher Rock ’n’ Roll
... und hör’n die herrlichste Musik
Vier Kritiker bereisen die Hölle
Imre Kertész, 80
II
Kleist und die Sehnsucht, kein Selbst zu sein
Der Held ohne Motiv
Dionysos und der Buchhalter
Es war nicht Mitternacht. Es regnete nicht
Shakespeare und das Talent
III
Diese sehr ernsten Scherze
Die Katastrophe des Glücks
Die Lichtprobe
Nachweise
I
Der melancholische Lobbyist
Thomas Bernhard: Holzfällen
Ein österreichischer Schriftsteller, eben zurückgekehrt aus London, wird auf dem Wiener Graben von einem Ehepaar, mit dem er vor vielen Jahren befreundet war und ohne dessen Förderung seine Karriere nie in Gang gekommen wäre, angesprochen und zu einem «künstlerischen Abendessen» eingeladen. Gegen seinen Willen und hauptsächlich deshalb, weil er noch erschüttert ist vom Begräbnis einer Jugendfreundin, sagt er zu und erscheint auch tatsächlich in der gutbürgerlichen Wohnung der Gastgeber. Eingeladen sind schreckliche Leute aus dem Wiener Kulturleben: die Dichterin Jeannie Billroth, die mit Literaturpreisen überhäufte Gymnasiallehrerin Anna Schreker mitsamt ihrem Lebensgefährten, dem Autor platter Lautgedichte, zwei abstoßende Jungschriftsteller und, mit großer Verspätung eintreffend, ein gefeierter Burgschauspieler, der sich sogleich in Pose wirft und blamiert. Die ganze Zeit sitzt der Erzähler, der mit seinem Autor Thomas Bernhard alles außer dem Wohnort teilt (statt in Ohlsdorf lebt er im fernen England), in einem Ohrensessel und lauscht angewidert. Am Ende – die Gastgeber sind schon betrunken und alle anderen todmüde – kommt es zu einem Streit zwischen der Dichterin Jeannie Billroth und dem Burgschauspieler, der sich beleidigt fühlt, ausfällig wird und mit einemmal menschliche Züge offenbart: Er gesteht seine Sehnsucht nach «Wald, Hochwald, Holzfällen», nach einem Leben in der Natur fern der verlogenen Gesellschaft. Man verabschiedet sich, und der Erzähler läuft in Verwirrung und Wut durch die nächtlichen Straßen der Innenstadt. Er beschließt, über all das zu schreiben.
So die Handlung jenes Buches, das 1984Thomas Bernhards Ruf als Skandalautor endgültig festigte: Holzfällen, eine Erregung. Es trägt nicht die Bezeichnung «Roman», und es war sicher auch das teils kunstvolle, teils bewußt offensichtliche Spiel mit autobiographischen Elementen, das nach dem Erscheinen zum Auslieferungsverbot führte: Der Komponist Gerhard Lampersberg, ehemals ein enger Freund Bernhards, fühlte sich in der Figur des Gastgebers, dem kläglich versoffenen Komponisten Auersberger, zugleich wiedererkennbar und bösartig verzerrt dargestellt, klagte und bekam in erster Instanz recht. Erst nach komplizierten Verhandlungen konnte das Buch wieder in den österreichischen Buchhandel gelangen – seltsamerweise, als wäre sein Ruf in der Bundesrepublik ihm völlig gleichgültig, war es Lampersberg offenbar gar nicht eingefallen, auch in Deutschland zu klagen; ein interessanter Fall von juristischem Provinzialismus.
Nun legt der Suhrkamp Verlag das Skandalbuch als siebten Band der Bernhard-Werkausgabe, ausgestattet mit einem ausführlichen Anhang zur Text- und Prozessgeschichte, neu auf. Ein Anlaß, um Holzfällen aus der Entfernung von dreiundzwanzig Jahren so zu lesen, wie Bernhard es ausdrücklich gelesen haben wollte: nicht als Schlüsselroman, nicht als Buch über reale Personen, sondern als Literatur.
Aber so leicht ist das gar nicht. Die Spiegelung zwischen Fiktion und Realität und die Frage, wie die Figuren sich zu ihren Vorbildern verhalten, ist tief in den Text eingelassen. Mit Grund heißt das Werk nicht «Roman», mit Grund gibt es in der Biographie des Erzählers bis auf den Londoner Wohnort nicht ein Detail, das sich von jener Bernhards unterscheidet. Der Erzähler beschließt, das Erlebte in Literatur umzuwandeln, und eben durch die wiederholte Thematisierung solcher Umwandlung wird der Leser immer von neuem zurückverwiesen auf die Tatsache, daß hier nicht bloß fabuliert wird, sondern daß von wirklichen Menschen, von außertextlicher Wirklichkeit die Rede ist. Daran ist noch nichts Problematisches, so macht es die literarische Satire seit alters, von Juvenal über Voltaire bis hin zu Karl Kraus. Holzfällen ist ein Prosakunstwerk über die Wirklichkeit und deren Verzerrung, bestimmt von Witz und Brillanz, bestimmt aber auch von seltener Gehässigkeit und einer Reihe außerliterarischer Zwecke.
Wann immer von Thomas Bernhards Stil die Rede ist, fällt zuverlässig das Wort Musikalität. Gemeint ist wohl sein perfektes Rhythmusgefühl, die in seinen besten Büchern nie fehlgehende Intuition, wie viele Parenthesen man einem Satz zumuten darf, ohne daß dieser zerfällt: Bernhards wichtigste Stilmittel – die Wiederholung, der Einschub, die Wiederholung des Einschubs und die Dehnung einer Phrase durch zum Superlativ gesteigerte Adjektive – sind in ihrer Anzahl beschränkt, aber er meistert sie perfekt. Ein Vorbild ist ganz offensichtlich der im Buch immer wieder genannte Boléro Maurice Ravels: eine Komposition, die ihren Reiz daraus bezieht, daß ein solcher Mut zur Wiederholung zuvor unmöglich schien, und die zum Schluß hin eine Steigerung zu heller Wut und Leidenschaft erfährt. Man liest das atemlos, und langweilig wird es nie.
Das ist der eine Grund dafür, daß man Holzfällen schwer unterbrechen oder weglegen kann. Der andere Grund ist problematischer: Bernhards Wut wie auch die des Erzählers wird nie begründet, sie ist von Anfang an da, und die Schrecklichkeit all der menschlichen Fratzen ist ein nie in Zweifel gezogenes Axiom. Das Postulat, daß der Dichter nicht behaupten, sondern darstellen solle, kümmert Bernhard nicht. Seine Figuren bekommen kaum die Chance, ihre Scheußlichkeit empirisch unter Beweis zu stellen, sie sind vor dem ersten Auftritt schon verurteilt, der Leser sitzt gleichsam mit dem Erzähler im Ohrensessel und blickt mit dem Grinsen des Eingeweihten auf eine menschliche Gräßlichkeit, die, da sie immer schon als selbstverständlich vorausgesetzt wird, nie zur Darstellung kommen muß; man darf den Hohn teilen und sich erhoben fühlen. Vor kurzem hat Arnold Stadler geschrieben, daß Leute, die Freude an Bernhards Ausfällen haben, wohl auch gerne das literarische Quartett gesehen haben – besser kann man den Reiz wie die Problematik dieser Technik nicht auf den Punkt bringen.
Aber eine Frage läßt sich, bei aller Faszination für den Witz dieser Prosa, nicht ganz beiseite schieben, und sie führt tief ins komplexe Verhältnis von Fiktion und Realität. Diese Prosa lebt natürlich nicht von der Wiedererkennung der wirklichen Personen durch den Leser. Sie lebt aber durchaus von dem Versprechen, daß diese Leute existieren und daß der Leser sie wiedererkennen würde, würde er sie nur kennen. Ohne das verlöre Holzfällen viel von seiner Verve und seinem Reiz.
Die Dichterin, der so eindeutig Jeannie Ebner Modell gestanden hat, heißt ja eben nicht Melanie, sondern Jeannie, die aus Lampersberg entstandene Figur heißt nicht Müller, sondern Auersberger, alle Lebensdaten und sogar die Adressen der Charaktere entsprechen genau denen ihrer realen Vorbilder, und das Burgtheater, dessen schlechte Führung und jämmerliche Aufführungen ein Hauptthema von Holzfällen sind, gibt es bekanntlich auch. Die Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts ist wesentlich bestimmt von der Tradition des Formalismus, die danach verlangt, werkimmanent zu lesen und nicht von der Buchseite auf die Wirklichkeit zu schielen (und wann immer die Gerichte sich einmischen, gilt es natürlich, diese Tradition zu verteidigen) – aber die Satire, die es nach Schillers Definition immer mit der Kluft zwischen Wirklichkeit und Ideal zu tun hat, muß sich doch fragen lassen, von welcher Wirklichkeit und welchem Ideal sie spricht, und was ihre Absichten sind. Wenn der Erzähler etwa einer Schriftstellerin, die im veröffentlichen Buch Anna Schreker heißt, deren Name in der ersten Fassung aber noch Juniröcker war, vorwirft, daß sie und ihr Lebensgefährte, der Autor hochdekorierter Lautpoesie und Träger des Staatspreises, eine «Staatspfründerexistenz» führten – ist es dann von Bedeutung oder ganz unwichtig, daß der Autor dieser Invektive, selbst Träger des Staatspreises, nachweislich mehr Geld von der Republik Österreich erhalten hat als die hinter Frau Schreker so deutlich erkennbare Friederike Mayröcker? Und ist es von Belang, ob der ständig wiederholte Vorwurf, daß das Burgtheater nur veraltetes Zeug und hauptsächlich Grillparzer spiele, zur Zeit der Abfassung des Buches überhaupt noch zutraf?
Ja, das Burgtheater. Der geheime Held, das wiederkehrende Leitmotiv, das ständig von neuem aufgerufene Thema. Man liest gerade diese Stellen mit hämischer Freude. Aber könnte es sein, daß Bernhard hier das Burgtheater der fünfziger Jahre für das der frühen achtziger setzte und darauf vertraute, daß man das so langsam aus dem Bewußtsein weichende Klischee schon für die Wirklichkeit nehmen würde?
Es ist bezeichnend, daß der sonst so kundige Kommentarteil mit keinem Wort auf die Situation an diesem Haus eingeht. Zur Zeit der Niederschrift von Holzfällen wurden dort Václav Havel, Botho Strauß, Peter Shaffer, Heinar Kipphardt und Harold Pinter gespielt, ein Schwerpunkt galt den Werken osteuropäischer Dissidenten. Der damals im Gefängnis sitzende Václav Havel, der die Burg sein «Muttertheater» nannte, verdankte es nicht zuletzt den vielen, oft im Fernsehen übertragenen Aufführungen seiner Werke am Burgtheater, daß sein Name nicht aus dem Gedächtnis der Weltöffentlichkeit verschwand. Es gab Uraufführungen von Martin Sperr, Rolf Hochhuth, Martin Walser, Max Frisch, Botho Strauß und Herbert Achternbusch. Das Burgtheater stand unter heftigen Angriffen von seiten der mächtigen Kronen-Zeitung, weil es angeblich das nationale Erbe zuwenig pflegte, der ÖVP-Politiker Erhard Busek bezeichnete es öffentlich als «Hort des Linksfaschismus». Von 1975 bis Mitte 1984, also dem Jahr, als Holzfällen erschien und darin über die Grillparzer-Verliebtheit der Burgtheaterführung gespottet wurde, waren dort nicht mehr als zwei Grillparzer-Inszenierungen zu sehen gewesen.
Man muß nicht lange recherchieren, um auf die Tatsache zu stoßen, daß Thomas Bernhard 1975Gespräche mit Unterrichtsminister Sinowatz und dem Generaldirektor des Bundestheaterverbandes Jungbluth geführt hatte, um die Direktion des Burgtheaters zu übernehmen. Auch seine Dramaturgie war bereits besetzt, unter anderem mit der Schriftstellerin Hilde Spiel. Mehrere Zeugen haben darüber berichtet, ja in Bernhards Nachlaß findet sich sogar ein Typoskript aus diesem Jahr mit dem Titel Wie ich Burgtheaterdirektor werden sollte. Statt Bernhard wurde es aber dann der Regisseur und Schauspieler Achim Benning – auch er kein Vertreter der österreichischen Kulturschickeria, sondern ein zurückhaltender und in der lauten Selbstvermarktung wenig versierter Deutscher–, woraufhin Bernhard alle Aufführungen seiner Stücke am Burgtheater verbot. Erst als Benning dem Bernhard freundschaftlich verbundenen Claus Peymann gewichen war, hob er das Verbot wieder auf. Diese Umstände sind gut dokumentiert, doch im aufgeheizten Klima späterer Jahre wollte es kaum einer von ihnen wissen: Bernhards Bewunderern war es unangenehm, daß sein Burgtheaterhaß solch persönliche Ursachen haben mochte, und seine konservativen Gegner wollten nicht gerne daran erinnert werden, daß ausgerechnet das Kulturministerium diesen Mann so nahe ans Heiligtum der Wiener Kunstreligion hatte herankommen lassen.
Berührt das den literarischen Rang von Holzfällen? Vielleicht doch. Literatur ist eben nicht nur Sprache und Form, sie ist gestalteter Inhalt, und wenn ein Werk seine Wirkung so sehr dem Abscheu verdankt, ist es nicht völlig unwichtig, ob der Gegenstand dieses Abscheus etwas mit den Verhältnissen der realen Welt zu tun hat oder nicht. Bernhards Beschreibung eines abgestumpft in der Selbstbestätigung dahinbrütenden Kulturbürgertums, das seine Provinz für den Mittelpunkt der Welt hält, ist überaus witzig, zum Teil, weil eingestandenerweise dieses Milieu auch das seine war, weil «diese Menschen meine Menschen sind und immer meine Menschen sein werden», wie es am furiosen Schluß heißt. Zugleich aber liest sich seine eloquente Verachtung gegenüber einem deklamatorisch-hohlen Burgtheaterstil ganz anders, wenn man weiß, daß dieser zum Zeitpunkt der Abfassung lange schon Vergangenheit war, daß die Burgtheaterautoren der Stunde Havel, Mrożek, Stoppard und Pinter hießen und daß in jenen Absätzen, in denen von der künftigen besseren Direktion die Rede ist, die das Grillparzer-Deklamieren abschaffen und frischen Wind bringen werde, nicht der apokalyptische Gesellschaftssatiriker spricht, sondern ein kühler Lobbyist, eben jener Mann, der laut den Erinnerungen seines Freundes Hennetmair vor dem Fernseher in Freudentaumel verfiel, als er vom Tod Heimito von Doderers erfuhr: «Jetzt ist die Bahn frei, jetzt komme ich.»
So scheint dieses Buch gleichsam von zwei kooperierenden Autoren geschrieben: einem abgründig humorvollen Beobachter der menschlichen Hinfälligkeit auf der einen Seite und einem versierten kulturpolitischen Fädenzieher auf der anderen. Wenn dieser spricht, mischen sich falsche Töne in die vielgerühmte Musikalität, und das Angebot zur Identifikation mit dem geistig weit über allen anderen Menschen stehenden Erzähler ist nur allzu billig. Wann immer aber jener an der Reihe ist, wird Holzfällen reich und grandios. Dann haben wir es etwa mit einem unvergeßlichen Bericht über ein Begräbnis in der Provinz, über Trauer und Gulaschsuppe, zu tun oder mit tief wehmütigen Sätzen über die Verluste der Freundschaften der jungen Jahre. Man wächst heran, man trennt sich von den Menschen, die einem einst alles bedeutet haben, man beginnt sie zu hassen und schreibt wutschäumende Bücher gegen sie. Diese emotionale Bewegung von der Liebe zur Verleumdung wird in den besten Momenten von Holzfällen selbst zum Thema: «Um uns aus einer Notsituation zu erretten, denke ich, sind wir selbst genauso verlogen wie die, denen wir diese Verlogenheit andauernd vorwerfen und derentwegen wir alle diese Leute fortwährend in den Schmutz ziehen und verachten, das ist die Wahrheit; wir sind überhaupt um nichts besser als diese Leute, die wir andauernd nur als unerträgliche und widerliche Leute empfinden, als abstoßende Menschen, mit welchen wir möglichst wenig zu tun haben wollen, während wir doch, wenn wir ehrlich sind, andauernd mit ihnen zu tun haben und genauso sind wie sie.» An solchen Stellen ergeht es dem Erzähler wie dem Burgschauspieler. Seine Stimme verliert alles Schrille, und ein prekäres Buch voller Ausfälle gegen alte Freunde wird unversehens zu Kunst.
Der Reporter Truman Capote
Die Geschichte steht in den Lehrbüchern und wird bis zur Ermüdung wiedergegeben in Journalismusseminaren: Anfang der sechziger Jahre erfand Truman Capote mit dem Dokumentarroman Kaltblütig eine neue Mischform, ihm schlossen sich Norman Mailer, Tom Wolfe und Hunter S.Thompson an, die daraus entstandene Bewegung heißt «New Journalism» und zeichnet sich durch radikalen Subjektivismus aus: Rhythmus und Schwung zählen mehr als Objektivität, eine gute Story ist interessanter als die Vollständigkeit der Fakten, und im Mittelpunkt steht immer die Figur des Berichterstatters. Generationen von Magazinjournalisten haben es so gelernt und verfassen nach diesem Rezept Reportagen im globalisierten Einheitsstil, ob aus Kapstadt oder vom Südpol, ob über Autorennen oder Kriminelle in Afrika, ob aus dem Krieg oder von einer Modenschau.
Aber Truman Capote ist nicht schuld daran. Sein Weg vom Roman in den Journalismus war ein Experiment von weltliterarischem Rang, und noch immer verstellt das Bild von ihm als Society-Figur, als Gastgeber exzentrischer Partys und Freund der Jet-Set-Prominenz, den Blick auf seine Bedeutung als Schriftsteller. Anders als Wolfe und Thompson, die nach ihm kamen, ging es ihm nicht darum, die Faktenhaltigkeit des Journalismus in die Literatur zu tragen, er wollte vielmehr das Instrumentarium seines an Flaubert geschulten Stils, seine Beschreibungskunst, die psychologische Feinheit seiner Figurenzeichnung auf Bereiche anwenden, die bislang nur der Journalismus berührt hatte. Dieses Experiment glückte so fabelhaft, daß man heute das Gewagte daran nicht mehr erkennt: Was als avantgardistische Literatur begann, prägt nun den Mainstream der Magazine.
Bewußt nahm sich Capote zunächst das zweifelhafteste aller Genres vor, das Starporträt. «Ich ging von folgender Überlegung aus: Was ist die niederste Stufe des Journalismus? Anders gefragt, welcher Dreck läßt sich am schwersten zu Gold machen?» In Japan traf er den jungen Marlon Brando, damals noch kein verfetteter Riese, sondern ein junger Mann von engelhafter Schönheit, genialer Begabung und mittelmäßiger Intelligenz. Brando ißt viel und spricht noch mehr, sein chaotisches Hotelzimmer wird ebenso beschrieben wie die verehrungsvollen Zimmermädchen, die japanischen Gärten und die nächtlichen Lichter der leeren Stadt. Dieser Text, Der Fürst in seinem Reich, mit dem die neue deutsche Gesamtausgabe von Capotes Reportagen beginnt, gilt heute als Klassiker und als eines seiner Meisterwerke.
Nicht ganz zu Recht vielleicht. Liest man die Texte in der Reihenfolge ihres Entstehens, so scheint das Brando-Porträt noch ein wenig tastend, fast konventionell im Vergleich zu späteren Reportagen, in denen sich knappste Beschreibungen mit seitenlangen Dialogsequenzen abwechseln, Dialogen, von denen klar ist, daß sie von keinem Aufnahmegerät mitgeschnitten wurden. So etwa in seinem dem Brando-Artikel weit überlegenen Porträt von Marilyn Monroe, das sich am Schluß unvermittelt in die Höhen reiner Lyrik aufschwingt – «Ich wollte meine Stimme über das Geschrei der Möwen erheben und sie zurückrufen: Marilyn! Marilyn, warum muß eigentlich alles immer so ausgehen? Warum ist das Leben so unglaublich beschissen?»–, oder in Ein Tagwerk, der wohl lustigsten Reportage aller Zeiten: Capote begleitet seine Putzfrau Mary Sanchez auf ihrer Tagestour durch verschmutzte Wohnungen, die beiden rauchen Haschisch, und ihre Gespräche werden immer absurder, bis alles in einem Eklat endet. Ob das noch Bericht ist oder schon reine Dichtung, könnte nicht unwichtiger sein.
Das Erstaunlichste an diesen Texten ist ihre Bandbreite. Ist jener frivole Plauderer, der mit Schauspielerinnen über Mode streitet, zugleich der Mann, der eine Serienmörderreportage wie Handgeschnitzte Särge schreiben konnte, der Mann, der obsessiv Gewalttäter in ihren Zellen befragte und über sie Berichte verfaßte, deren Eiseskälte einen schaudern macht? Was war das für ein Mensch, fragt man sich, und erst dann fällt einem auf, wie zurückhaltend er mit sich selbst umgeht: Zwar ist Capote stets anwesend, aber er steht am Rand und gibt zugleich viel und gar nichts von sich preis – eben darin liegt seine Kunst, und an dieser Herausforderung scheiterten von Anfang an die Nachahmer.
Die Rolle des unauffälligen, wenn auch nicht tatenlosen Beobachters spielt Capote auch in Die Musen sprechen, seiner Schilderung des ersten Rußlandgastspiels einer amerikanischen Musicaltruppe. Er gibt darin ein Gespräch mit dem Reporter Ira Wolfert wieder. «‹Das Problem ist: Ich sehe hier einfach keine Story›, sagte er. ‹Alles wiederholt sich immer nur. Und vernünftig reden kann man auch mit niemandem.›» Die Pointe liegt natürlich darin, daß der Leser das Buch in Händen hält, dessen Möglichkeit Wolfert leugnet. Tatsächlich geschieht in ihm nichts Spektakuläres, es gibt kaum Verwicklungen, und große Katastrophen bleiben aus. Wo also ist die Story, warum ist das so funkelnd geistreich und berührend? Er habe, erklärte Capote, ein Buch nach Art eines Fabergé-Eis oder einer klimpernden Spieluhr schreiben wollen, «die mit großer Präzision kleine, freche Melodien herausklimpert». Was immer das auch heißen soll (und man vermutet: nicht sehr viel), das Ergebnis ist ein kleines Wunder, so zweckfrei verspielt wie unnachahmlich.
Capotes bestes Buch ist wohl weder Frühstück bei Tiffany, noch Kaltblütig, sondern Musik für Chamäleons, die von ihm selbst herausgegebene Auswahl seiner journalistischen Texte. Hier finden wir alle Genres versammelt, hier hat er seine Technik der nacherfindenden Reportage und der Auflösung eines Berichtes ins Dialogische am weitesten vorangetrieben. Nicht unproblematisch darum die Entscheidung des deutschen Verlages, die Texte nicht chronologisch, sondern thematisch anzuordnen, also in «Konversationen», «Berühmtheiten», «Begegnungen», «Orte» aufzuteilen. Capotes Genialität besteht in der Aufhebung solcher Genres, und eine Ordnung nach Themen schafft rückwirkend eine Konventionalität, die seinem Ansatz fremd ist.
Und noch einen anderen Grund zur Unzufriedenheit gibt diese Ausgabe, und das ist leider die Übersetzung. In der ersten Hälfte, und seltsamerweise nur dort, als hätte der Übersetzer Marcus Ingendaay in der Mitte unvermittelt an einen Kollegen abgegeben, sind die Dialoge von einer bedrückenden neudeutschen Flapsigkeit – so etwa, wenn Capote Marilyn Monroe «du Träne» nennt, wenn das schlichte Wort «eat» hartnäckig mit «sich einverleiben» übersetzt wird, wenn überhaupt mehrmals gegessen wird, «bis die Plautze kracht». «He spouted an intellectual rigmarole» übersetzt Ingendaay mit «er hielt die Leute mit pseudointellektuellem Gefasel zum Narren» und wandelt damit Capotes sachlich kühle Ironie gegenüber James Dean in eine platte und eindeutige Wertung um, noch dazu unter Verwendung des gräßlichen Ausdrucks «pseudointellektuell», dessen Gebrauch Max Goldt schon vor Jahren zu Recht verboten hat. Im zweiten Teil findet die Übersetzung immer mehr zu einem dem Original angemessenen Ton, und solche Ausrutscher werden selten – aber zuvor muß man sich durch reichlich Passagen kämpfen, in denen Leute mit «du Herzchen» oder «Schwachstruller» angeredet werden, in denen es «Null Problemo, du Spiegelwichser» heißt, in denen auch mal ein «großes Pfadfinder-Ehrenwort» gegeben wird und überhaupt die Dialoge des an Flaubert orientierten Meisterstilisten Capote übertragen werden in eine Umgangssprache von so papierenem Klang, daß man sich fragt, ob sie außerhalb der Synchronfassungen amerikanischer Fernsehserien je irgendwo gesprochen wurde. Immer wieder zeigt Ingendaay, daß er der lyrischen Zartheit von Capotes Beschreibungen gewachsen ist, was er aber mit den Dialogen anstellt, fügt dem Autor Unrecht und dem Leser Schmerzen zu.
«Marilyn! Marilyn, warum muß eigentlich alles immer so ausgehen?» So viel klingt in diesem Ausruf mit – auch das Vorwissen des erschöpften, lange schon drogenabhängigen Schriftstellers darum, daß auf ihn kein Alter voll Ehrungen und Würden warten werde, sondern nur das blasse Fortleben als toter Klassiker. Und dabei müßte es nicht so sein: Er war Jahrgang 1924, und so fern er uns auch schon scheint, er könnte noch dasein und makellose Prosa über die demokratischen Vorwahlen oder über Madonna verfassen. Er wäre ein gesuchter Interviewpartner und einer, von dem es jedes Jahr wieder hieße, der Nobelpreis für ihn sei überfällig. Denn auch das ist eine Lehre von Capotes Reportagen: Nichts muß so sein, wie es ist, nichts ist notwendig, nichts vorherbestimmt.
«Als was wollen Sie selbst reinkarniert werden?» fragt sich Capote einmal im Selbstinterview, um zu antworten: «Als Vogel, am liebsten als Bussard. Ein Bussard braucht sich keine Gedanken um sein Aussehen oder um seine Wirkung auf andere Menschen zu machen, er muß keine Show abziehen, ihn mag ohnehin niemand. Er ist häßlich und nirgendwo willkommen. Man kann die Freiheit, die einem eine solche Existenz gewährt, gar nicht überschätzen. Gut wäre auch eine Meeresschildkröte. Sie kann an Land gehen, kennt aber auch die Geheimnisse in der Tiefe des Meeres. Außerdem leben Meeresschildkröten lange, und in ihren gut geschützten Augen sammelt sich eine Menge Weisheit.»
Der alte Mann und das Buch
J.M.Coetzee: Tagebuch eines schlimmen Jahres