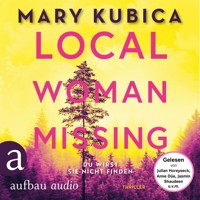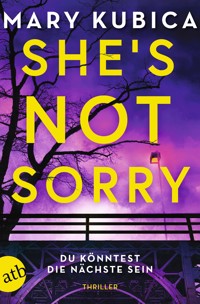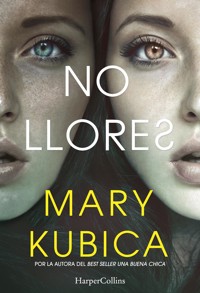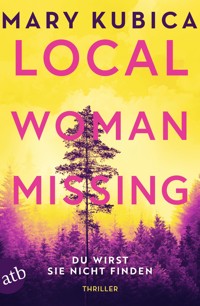
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Du wirst sie nicht finden. Versuch es gar nicht erst.
Als die sechsjährige Delilah und ihre Mutter spurlos verschwinden, wird ihre friedliche Vorstadt von Angst und Misstrauen zerfressen. Elf Jahre später taucht Delilah plötzlich wie aus dem Nichts wieder auf. Ihre Nachbarn wollen Antworten: Wo war sie so lange? Wo ist ihre Mutter? Ist der Täter noch unter ihnen? Niemand ist auf die erschreckende Wahrheit vorbereitet, die nun unvermeidlich ans Licht kommt ...
Nervenzerreißend spannend bis zur letzten Seite – von der Autorin des Megahits und New-York-Times-Bestsellers »She’s Not Sorry«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Menschen verschwinden nicht einfach so spurlos …
Shelby Tebow ist die Erste, die verschwindet. Kurz darauf sind auch Meredith Dickey und ihre sechsjährige Tochter Delilah wie vom Erdboden verschluckt – nur wenige Blocks von dem Ort entfernt, an dem Shelby zuletzt gesehen wurde. In ihrer einst friedlichen Gemeinde verbreitet sich die Angst wie Lauffeuer. Haben ihre Schicksale miteinander zu tun? Nach einer langwierigen Suche, die mehr Fragen als Antworten aufwirft, wird der tragische Fall schließlich zu den Akten gelegt.
Elf Jahre später taucht Delilah plötzlich wieder auf. Alle wollen wissen, was mit ihr geschehen ist – doch niemand ist auf das Grauen gefasst, das sich nun enthüllt.
Über Mary Kubica
Mary Kubica hat Geschichte und Amerikanische Literatur studiert. Ihre packenden Thriller sind New-York-Times- und USA-Today-Bestseller, waren nominiert für die Goodreads Choice Awards und werden von der Presse hochgelobt. Sie wurden in über dreißig Sprachen übersetzt und haben sich weltweit über fünf Millionen Mal verkauft. Mary Kubica lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in der Nähe von Chicago.
Im Aufbau Taschenbuch ist von ihr außerdem »She’s Not Sorry – Du könntest die Nächste sein« lieferbar.
Gabriele Weber-Jarić lebt als Autorin und Übersetzerin in Berlin. Sie übertrug u. a. Kristin Hannah, Mary Morris, Ronald H. Balson, Imogen Kealey und Allison Pataki ins Deutsche.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Mary Kubica
Local Woman Missing – Du wirst sie nicht finden
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Gabriele Weber-Jarić
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Prolog — Elf Jahre zuvor
Teil I
Delilah — Heute
Teil II
Kate — Elf Jahre zuvor Mai
Meredith — Elf Jahre zuvor März
Leo — Heute
Kate — Elf Jahre zuvor Mai
Meredith — Elf Jahre zuvor März
Leo — Heute
Meredith — Elf Jahre zuvor März
Kate — Elf Jahre zuvor Mai
Leo — Heute
Meredith — Elf Jahre zuvor März
Kate — Elf Jahre zuvor Mai
Meredith — Elf Jahre zuvor März
Kate — Elf Jahre zuvor Mai
Leo — Heute
Meredith — Elf Jahre zuvor März
Leo — Heute
Kate — Elf Jahre zuvor Mai
Meredith — Elf Jahre zuvor März
Leo — Heute
Meredith — Elf Jahre zuvor März
Kate — Elf Jahre zuvor Mai
Meredith — Elf Jahre zuvor April
Kate — Elf Jahre zuvor Mai
Meredith — Elf Jahre zuvor April
Kate — Elf Jahre zuvor Mai
Leo — Heute
Meredith — Elf Jahre zuvor Mai
Leo — Heute
Meredith — Elf Jahre zuvor Mai
Leo — Heute
Kate — Elf Jahre zuvor Mai
Meredith — Elf Jahre zuvor Mai
Kate — Elf Jahre zuvor Mai
Meredith — Elf Jahre zuvor Mai
Leo — Heute
Meredith — Elf Jahre zuvor Mai
Leo — Heute
Meredith — Elf Jahre zuvor Mai
Leo — Heute
Meredith — Elf Jahre zuvor Mai
Leo — Heute
Meredith — Elf Jahre zuvor Mai
Leo — Heute
Meredith — Elf Jahre zuvor Mai
Kate — Heute
Dank
Impressum
Für Addison und Aidan
Prolog
Elf Jahre zuvor
Auf dem Hemdkragen hat er Lippenstiftspuren. Sie sieht es, sagt aber nichts. Stattdessen wippt sie das weinende Baby – auf und ab, wie die Nadel einer Nähmaschine auf einem Stück Stoff – und hört sich seine lahme Ausrede an. Tut mir leid, dass ich jetzt erst komme, aber … was er so gut wie jeden Abend abspult. Er hat ein ganzes Arsenal an Ausreden, die er rotieren lässt: ein Stau auf der Schnellstraße, eine Kollegin, die ein Problem mit dem Wagen hatte, ein Endlostelefonat mit einem aufgebrachten Versicherungsnehmer, bei dem der Hausbrand aufgrund mangelhafter Dokumentation der Schäden nicht gedeckt war. Je mehr er sich in Einzelheiten verliert, desto sicherer ist sie, dass er bei einer anderen Frau war. Doch sie hält den Mund. Wenn sie nachhakt, wird er wütend. Dreht den Spieß um. Nennst du mich jetzt einen Lügner? Deshalb lässt sie es durchgehen. Außerdem wäre es scheinheilig, wenn sie wegen des Lippenstifts Theater machen würde.
»Alles gut«, sagt sie und wendet den Blick von dem Hemdkragen ab.
Sie essen zusammen zu Abend. Sehen ein bisschen fern.
Später legt sie das Baby schlafen, füttert es vorher noch, damit der Hunger es nicht weckt, wenn sie aus dem Haus ist.
Als sie ihm sagt, dass sie noch eine Runde laufen will, fragt er: »Jetzt noch?« Es ist nach zweiundzwanzig Uhr, als sie in Joggingsachen aus dem Schlafzimmer kommt.
»Warum nicht?«, fragt sie.
Er starrt sie an, zu lange, aber seine Miene lässt sich nicht deuten. »Wenn Leute so einen Scheiß machen, war’s das irgendwann für sie.«
Sie weiß nicht, was er damit sagen will. Meint er, wenn sie so spät noch läuft oder den Ehemann betrügt? Sie entscheidet sich für Ersteres.
Als sie schluckt, ist ihr Speichel dickflüssig. Den ganzen Tag hat sie auf diesen Moment gewartet, und ihr Entschluss steht fest. »Wann soll ich denn sonst laufen?«
Von frühmorgens bis spätabends muss sie sich um das Baby kümmern und hat für sich keine Zeit.
Er zuckt mit den Schultern. »Mach, was du willst.« Dann steht er vom Sofa auf und streckt sich, auf dem Weg ins Bett.
Sie verlässt das Haus durch die Vordertür, verschließt sie nicht, um den Schlüssel nicht mitnehmen zu müssen. Doch sie joggt nur den Block hinunter; bloß, solange er sie sehen kann, sollte er einen Blick aus dem Schlafzimmerfenster werfen.
An der Ecke bleibt sie stehen und schreibt: Bin unterwegs.
Die Antwort kommt sofort. Bis gleich.
Sie löscht die Nachrichten auf ihrem Handy und fragt sich, ob sie genauso durchschaubar ist wie ihr Mann. Ist ihr Benehmen so verräterisch wie der Lippenstiftfleck an seinem Kragen? Wahrscheinlich nicht. Ihr Mann ist jähzornig und hätte sie längst halb tot geprügelt, wenn er den Verdacht hätte, sie würde sich abends mit einem anderen in dessen Auto auf der 4th Avenue vergnügen, einer Sackgasse, die dreißig Meter nach dem letzten Haus endet.
Sie geht weiter. Alles ist ruhig. Die späte Stunde ist die einzige Tageszeit, auf die sie sich freut, dann, wenn ein Mann, den sie kaum kennt, tut, was sie will, und dafür sorgt, dass sie sich gut fühlt.
Der Mann heute Abend ist weder der erste, mit dem sie ihren Ehemann betrügt, noch wird er der letzte sein.
Nach der Geburt des Babys hat sie versucht, aufzuhören und treu zu sein, es war die Mühe nicht wert.
Er hat gesagt, sein Name sei Sam, doch sie weiß nicht, ob sie ihm glauben soll. Sie treffen sich seit Monaten, wann immer das Verlangen sie oder ihn überkommt. Als sie sich kennenlernten, war sie schwanger. Ausgerechnet. Aber manche Typen macht das an. Er gab ihr das Gefühl, sexy zu sein, was sie von ihrem Mann weiß Gott nicht behaupten kann.
Wie sie ist er verheiratet; und nicht der Einzige, mit dem sie was nebenher laufen hat.
Wenn sie zusammen sind, nimmt »Sam« seinen Ehering ab und legt ihn aufs Armaturenbrett, als würde das, was er mit ihr macht, dadurch weniger verwerflich. Sie tut das nicht, Schuldgefühle sind nicht ihr Ding. Vielmehr redet sie sich ein, dass ihr Mann schuld an ihrem Verhalten ist und sie ihm seine Seitensprünge bloß mit gleicher Münze heimzahlt.
Am Sternenhimmel entdeckt sie den Abendstern. Es ist kalt, auf ihren Armen hat sich Gänsehaut gebildet, und sie stellt sich den warmen Wagen vor, der auf sie wartet.
Noch während sie nach oben sieht, hört sie etwas von hinten kommen. Sie fährt herum, ihr Blick streicht suchend über die Straße, doch in der Dunkelheit ist nichts zu erkennen. Ein streunendes Tier, das irgendwo im Müll wühlt, denkt sie, aber sicher ist sie sich nicht. Obwohl sie kein Angsthase ist, beschleunigt sie ihre Schritte und fragt sich plötzlich, was wäre, wenn. Was, wenn ihr Mann doch Verdacht geschöpft hat? Was, wenn er ihr gefolgt ist? Was, wenn er ihr auf die Schliche gekommen ist?
Nein, er weiß nichts, kann gar nichts wissen, dazu lügt sie viel zu gut, hat gelernt, alle verräterischen Spuren zu verwischen.
Aber was, wenn Sams Frau dahintergekommen ist?
Sie weiß nicht, was Sam seiner Frau erzählt, bevor er losfährt. Über solche Dinge sprechen sie nicht. Eigentlich reden sie überhaupt nicht viel, bis auf ein paar einleitende Sätze, um die Sache in Schwung zu bringen.
Wie hübsch du aussiehst.
Darauf hab ich den ganzen Tag gewartet.
Verliebt sind sie nicht, keiner hat vor, seinen Ehepartner in absehbarer Zeit zu verlassen. Um solche Dinge geht es nicht. Für sie ist es eine Art Flucht, eine Form der Befreiung und der Rache.
Da ist wieder das Geräusch. Sie blickt zurück, starrt in die Dunkelheit – diesmal wirklich voller Angst –, sieht aber nichts. Trotzdem wird sie das Gefühl nicht los, dass da jemand ist, der sie beobachtet.
Nervös und unkoordiniert stolpert sie über einen losen Schnürsenkel, als sie ihren Gang beschleunigt. Sie trabt fast, um schnell bei ihm im Wagen zu sein und nicht mutterseelenallein auf einer viel zu dunklen Straße.
Aus dem Augenwinkel nimmt sie eine Bewegung wahr. Ist da etwas? Ist da jemand? »Wer ist da?«, fragt sie.
Keine Antwort. Alles bleibt ruhig.
Sie versucht sich mit Gedanken an Sam abzulenken, stellt sich seine warmen, sanften Hände auf ihrem Körper vor.
Dann bückt sie sich, um den Schuh richtig zuzubinden. Wieder kommt von hinten ein Geräusch. Als sie sich wieder umdreht, tauchen am anderen Ende der Straße Autoscheinwerfer auf und nähern sich zu schnell, als dass sie sich noch ins Dunkle retten könnte.
Teil I
Delilah
Heute
Ich höre Schritte. Sie bewegen sich oben über den Fußboden. Ich folge ihnen mit meinem Blick, was Blödsinn ist, wie soll ich Schritte über mir sehen können. Aber allein bei dem Geräusch fängt mein Herz an zu rasen, schlägt mir bis zum Hals, und meine Beine werden zittrig.
Es muss die Frau sein, auf bloßen Füßen, der Mann läuft immer mit Schuhen. Außerdem sind ihre Schritte leichter, trampeln nicht wie seine über den Boden, laut und dumpf wie ein Donnergrollen in der Nacht.
Jetzt ist auch der Mann da, die Frau redet mit ihm, sagt mit ihrer hässlichen, missmutigen Stimme, es sei Zeit, uns was zu essen zu bringen. Und dass sie wegen irgendetwas, das wir getan haben, sauer ist. Soweit ich weiß, haben wir rein gar nichts getan.
Oben an der Treppe wird die Tür entriegelt und springt auf. Ein Lichtstreifen blitzt auf und tut mir in den Augen weh. Blinzelnd sehe ich sie da oben stehen, in ihrem scheußlichen Bademantel, mit den scheußlichen Schlappen, den dünnen, fleckigen Beinen und knubbligen Knien. Haare wie ein Haufen Heu und die Miene verdrossen, weil sie Gus und mir Essen bringen muss.
Der Kellerraum, in dem sie uns gefangen halten, ist schachtelartig, die Wände sind aus Beton. Die Treppe teilt den Raum exakt in der Mitte. Das kann ich so genau sagen, weil ich auf der Suche nach einem Fluchtweg jeden Zentimeter der rauen, rissigen Wände mit den Händen abgetastet und die Schritte von einer Seite zur anderen gezählt habe. Es sind fünfzehn, plus/minus ein paar, je nachdem, wie groß meine Schritte und Füße waren. Meine Füße sind gewachsen, die Schuhe, mit denen ich hier angekommen bin, passen mir nicht mehr. Passen seit Langem nicht mehr, den großen Zeh bringe ich kaum noch unter und wenn, tut er mir weh. Also laufe ich ohne Schuhe. Ich besitze nur die Kleidung, die ich anhabe. Keine Ahnung, woher die Sachen kommen, ich weiß bloß, dass ich bei meiner Ankunft hier was anderes anhatte. Als es mir zu klein geworden war – auch das vor langer Zeit –, hat die Frau mir was Neues besorgt. Hat sie genauso wütend gemacht, wie Gus und mir Essen bringen zu müssen.
Seitdem trage ich immer dasselbe. Wie die Sachen aussehen, kann ich nicht sagen, dafür ist es hier zu dunkel. Ich weiß nur, dass die Hose weit ist und das Shirt zu kurze Ärmel hat. Wenn ich friere, versuche ich vergeblich, sie über die Hände zu ziehen. Und wenn der Frau mein Gestank zu viel wird, wäscht sie meine Hose und das Shirt. Solange zwingt sie mich, nackt und frierend vor Gus zu stehen. Danach mault sie in einer Tour, nennt mich »undankbares kleines Blag« und ist angefressen, weil sie meine Klamotten waschen musste.
Hier unten ist es stockdunkel, so stockdunkel, dass die Augen sich nicht daran gewöhnen. Manchmal bewege ich die Hand vor meinen Augen, will was erkennen, aber da ist nichts. Wüsste ich es nicht besser, würde ich glauben, meine Hand wäre ab, hätte sich gelöst und davongemacht. Nur hätte das mörderisch wehgetan und geblutet. Das Blut hätte ich zwar nicht sehen können, aber die Schmerzen und die Flüssigkeit gespürt.
Hin und wieder machen Gus und ich Mutproben, laufen von einer Wand zur anderen, um zu sehen, ob wir kneifen, bevor wir gegen die Wand knallen. Die Hände müssen wir an den Seiten runterhängen lassen. Wer mit der Hand nach der Wand tastet, hat gemogelt.
Die Frau ruft die Treppe herunter, ihre Stimme ist schneidend wie ein Messer. »Du bist hier nicht im Restaurant, und ich bin keine Kellnerin. Wenn du das Essen willst, kommst du es dir gefälligst holen.«
Die Tür fliegt zu, der Riegel wird vorgeschoben, die Schritte entfernen sich.
Die Frau würde uns verhungern lassen, aber der Mann hat ihr befohlen, uns zu versorgen. Ich habe gehört, wie er gesagt hat, er will kein Blut an den Händen haben. Eine Zeit lang habe ich versucht, nichts zu essen, aber da ist mir schwindlig geworden, und ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Zu guter Letzt hatte ich so furchtbare Bauchschmerzen, dass ich einfach essen musste. Danach habe ich mir gesagt, dass es bessere Möglichkeiten geben muss, sich umzubringen, als sich zu Tode zu hungern.
Das war, bevor Gus kam. Seit er hier ist, will ich nicht mehr sterben. Er wäre dann ja allein und das kann ich ihm nicht antun.
Ich stemme mich von dem kalten Betonboden hoch. Er ist so hart, dass mein Hintern taub wird, wenn ich zu lange auf einer Stelle sitze. Stehe ich danach auf, fängt er an zu kribbeln. Meine Beine sind wie Pudding, was mehr als sonderbar ist, ich mache ja kaum was mit ihnen, sitze nur rum. Aber vielleicht sind sie deshalb so schwach, sind es nicht mehr gewöhnt sich zu bewegen.
Ich schleppe mich zur Treppe, setze einen Fuß vor den anderen. Auch unter der Tür oben dringt kein Licht durch. Der Mann und die Frau behalten alles Licht für sich, lassen Gus und mir nicht mal einen dünnen hellen Streifen.
Ich taste mich mit den Füßen die Stufen hinauf. Das habe ich so oft getan, dass ich es im Dunkeln kann, muss nur die Stufen zählen. Es sind zwölf, alle aus so rauem Holz, dass ich schon Splitter in den Füßen hatte. Sehen kann ich die natürlich nicht, aber sie tun weh. Früher hat Momma mir Splitter mit einer Pinzette aus der Hand oder dem Fuß gezogen; jetzt weiß ich nicht, ob sie von allein rausgekommen oder eingewachsen sind und meine Füße unter der Haut wie Igel sind.
Oben an der Treppe steht der Hundenapf, dessen Inhalt Gus und ich uns teilen müssen. Meine Hand fasst das glatte, runde Behältnis. Irgendwann war ein Hund im Haus, jetzt nicht mehr. Ich habe ihn bellen hören und die Krallen auf dem Fußboden über mir. Manchmal habe ich mir vorgestellt, dass er die Tür öffnet und mich rauslässt. Aber er hat bissig geklungen, wahrscheinlich hätte er mich anschließend gefressen.
Die Frau hat das Bellen kirregemacht. Sie hat dem Mann gesagt, entweder du sorgst dafür, dass er das Maul hält, oder ich mache es. Eines Tages war nichts mehr von ihm zu hören. Kein Bellen, keine Krallen auf dem Boden. Einfach so. Und jetzt ist der Hund weg. Ich stelle mir vor, dass er groß und rot war wie Clifford, weil er genauso laut genauso laut gebellt hat wie er.
Diesmal ist im Hundenapf was Pampiges, wahrscheinlich Haferbrei. Ich gehe wieder nach unten, setze mich auf den Boden und lehne mich gegen die Wand. Gus sagt, dass er keinen Hunger hat. Ich versuche, den Brei zu essen, obwohl er so eklig schmeckt, dass sich mir der Magen umdreht, und ich mich zu jedem Löffel zwingen muss. Aber wenn ich nichts esse, kriege ich später Bauchweh. Und keiner weiß, wann die Frau uns wieder was bringt.
In meinem Mund sammelt sich Speichel. Nicht weil es mir plötzlich so gut schmeckt, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft, sondern weil ich mich übergeben muss. Ich würge, behalte das, was hochkommt, im Mund und schlucke es wieder runter. Gus will noch immer nichts. Vielleicht hat er recht. Manchmal ist es besser zu hungern, als das, was die Frau uns bringt, zu essen.
Wir haben ein kleines Klo. Wenn wir es benutzen, beten wir, dass die Frau oder der Mann nicht in den Keller kommt. Gus und ich haben eine Abmachung: Wenn er muss, verziehe ich mich in die andere Ecke und summe, damit ich nichts höre, und er tut das Gleiche bei mir. Klopapier gibt es nicht, auch keine Möglichkeit, sich die Hände oder andere Körperteile zu waschen. Wir sind völlig verdreckt, was uns inzwischen egal ist, außer, die Frau regt sich darüber auf.
Richtig baden dürfen wir nie. Ab und zu bringt sie uns einen Eimer mit kaltem Seifenwasser. Dann müssen wir uns nackt ausziehen, mit den Händen sauber schrubben und kalt und nass warten, bis wir trocken sind.
Es ist klamm hier unten, eine kalte, klebrige Feuchtigkeit, die sich wie Schweiß auf die Haut legt und nie weggeht. Es liegt am Regen, der durch die Außenmauern sickert und auf dem Boden Pfützen bildet, in die ich mit bloßen Füßen trete.
Manchmal höre ich etwas anderes durch die Pfützen platschen und mit winzigen Krallen an Boden und Wänden kratzen. Ich weiß nicht genau, was es ist, kann es mir aber denken.
Wahrscheinlich sind hier auch Spinnen und Silberfische. Wenn ich versuche einzuschlafen, spüre ich, wie sie über mein Gesicht krabbeln. Schreien würde mir nichts bringen, also lasse ich sie gewähren und sage mir, dass sie sicherlich genauso wenig wie ich hier unten sein wollen.
Seit Gus da ist, fühle ich mich nicht mehr ganz so verloren. Jetzt sieht wenigstens jemand, was die Frau mir antut. Meistens ist sie es, die mich quält, denn sie ist durch und durch schlecht. Der Mann hat vielleicht noch einen Hauch Gutes in sich; wenn sie nicht da ist, bringt er uns eine Leckerei, ein Bonbon oder so. Gus und ich sind ihm jedes Mal dankbar, doch ich frage mich dann insgeheim, warum er plötzlich so scheißfreundlich ist.
Keine Ahnung, wie alt ich bin und seit wann sie mich hier gefangen halten.
Immer ist mir kalt, was der Frau piepegal ist. Einmal habe ich es ihr gesagt, und sofort ist sie ausgerastet, hat mich verzogen und ungehörig genannt, Wörter, die ich nicht mal richtig verstanden habe.
Sie hat alle möglichen Namen für mich. Wüsste ich es nicht besser, könnte ich annehmen, mein Name wäre Heulsuse oder dummes Huhn.
Hol dir dein Essen, dummes Huhn.
Hör auf zu flennen, Heulsuse.
Der Mann hat mir mal eine Decke gebracht und mich eine Nacht darin eingehüllt schlafen lassen. Aber dann hat er sie mir wieder weggenommen, wahrscheinlich sollte die Frau nichts davon mitkriegen.
Ob es Tag oder Nacht ist, kann ich nie sagen. Früher bedeutete Helligkeit Tag und Dunkelheit Abend oder Nacht, aber diesen Unterschied gibt es für mich nicht mehr.
Ich schlafe so viel wie möglich. Was soll ich auch sonst mit meiner Zeit anfangen, ich kann ja nur mit Gus reden oder Mutproben machen. Manchmal platzt der Frau der Kragen, wenn ich mit ihm rede. Dann schreit sie die Treppe runter, ich soll die Klappe halten oder sie bringt mich ein für alle Mal zum Schweigen. Gus ist ein Angsthase und flüstert nur, aber das ist in Ordnung. Er ist ein Lieber. Ich bin die Schlimme, die Ärger macht.
Anfangs habe ich versucht, die Tage hier unten zu zählen, aber wie soll das gehen, wenn ich nicht weiß, wann Tag ist und wann Nacht. Irgendwann habe ich es aufgegeben. Das war vor langer Zeit.
Anhand der Geräusche oben kann ich mir noch am besten ausrechnen, wie spät es gerade ist. Im Moment sind die beiden laut, machen sich gegenseitig nieder. Sie sind nie nett zueinander. Ist mir aber ganz recht; wenn sie sich anbrüllen, achten sie nicht auf Gus und mich. Nur wenn sie still sind, wird mir mulmig zumute.
Ich stelle den Hundenapf zur Seite, habe mein Bestes versucht. Würde ich noch mehr essen, müsste ich mich ernsthaft übergeben. Noch einmal frage ich Gus, ob er was will. Er sagt Nein. Ich wundere mich, dass er bei dem wenigen, was er isst, überhaupt noch lebt. Wahrscheinlich besteht er nur noch aus Haut und Knochen. Wenn sich die Tür oben öffnet, und das Licht kurz aufscheint, erhasche ich mitunter einen Blick auf ihn. Er hat braune Haare und ist größer als ich. Wenn er lächeln würde, hätte er sicher ein liebes Lächeln, aber das tut er genauso wenig wie ich.
Ich lege den Löffel in den Napf – nehme ihn wieder raus. Mir ist eingefallen, dass die Frau an manchen Tagen die Treppe runterkommt. Das mag ich nicht, das tut sie nur, wenn sie auf hundertachtzig ist und jemanden sucht, an dem sie ihre Wut auslassen kann.
Gus muss das Klappern des Löffels gehört haben, er will wissen, was ich damit vorhabe. Manchmal glaube ich, dass er meine Gedanken lesen kann.
»Den behalte ich.«
Gus sagt, mit einem Löffel könne man niemanden verletzen, sollte ich mit so einem Gedanken spielen. Tue ich.
»Wenn du ihr den Löffel nicht zurückgibst, ist der Teufel los«, sagt er. Ich wünschte, ich könnte seinen Gesichtsausdruck sehen. Ich schätze, er guckt sorgenvoll. Gus macht sich ständig Sorgen.
»Wenn ich eine Möglichkeit finde, den Löffel scharfzumachen, kann ich jemanden damit verletzen.«
Ich hoffe, die Frau ist so trottelig, dass sie nicht nach dem Löffel sucht, wenn sie den Napf holt. Damit sie uns nicht rundmacht, weil wir ihr Gekochtes nicht aufgegessen haben, kippe ich den Rest ins Klo. Den leeren Napf stelle ich auf die oberste Treppenstufe. Danach überlege ich, wie ich aus dem Löffelstiel einen Spieß machen kann.
*
Hier ist nicht gerade viel, womit ich arbeiten könnte; außer den Klamotten, die wir tragen, haben sie uns ja nichts gegeben. Wir haben nur uns, den Boden, die Wände, die Treppe und das eklige Klo in der Ecke des Raums.
Zuerst versuche ich, den Löffelstiel an den Wänden und am Boden zu schärfen, was aber nichts bringt. Danach probiere ich es am Klo.
Über Klos weiß ich nur, wie man sie benutzt, und dass unseres noch nie geputzt wurde. In dem Punkt ist die Dunkelheit ein Segen; nachdem wir seit so langer Zeit hineingemacht haben, will ich nicht wissen, wie es darin aussieht. Manchmal lässt mich allein der Gestank würgen.
»Wo willst du hin?«, fragt Gus, als ich mit dem Löffel zum Klo gehe. Ohne dass wir einander sehen können, wissen wir, was der andere tut, sind hier unten schon so lange zusammen, dass jeder die Gewohnheiten des anderen kennt.
»Wirst du gleich sehen.« Wir flüstern, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass oben keiner ist. Vorhin habe ich Türen gehört, dann laute Schritte und danach wurde es still. Niemand unterhält sich oder brüllt, auch der Fernseher läuft nicht.
Aber hundertprozentig sicher bin ich nicht, und sollten sie doch da sein, will ich nicht, dass sie Gus und mich belauschen und mitkriegen, was ich mit dem Löffel vorhabe. Sie würden mich windelweich schlagen oder noch Schlimmeres tun. Bisher habe ich weder versucht zu fliehen noch mir eine Waffe anzufertigen, aber ich kann mir an fünf Fingern abzählen, dass es für so was härtere Strafen gibt, als wenn ich das Essen der Frau stehen lasse oder sage, dass mir kalt ist.
Ich taste das Klo ab, suche nach etwas Scharfem. Es ist glatt wie ein Kinderpopo und aus einem Guss, mit Ausnahme des Sitzes, der sich, wie ich feststelle, abnehmen lässt. Er ist schwerer als gedacht, beinahe hätte ich ihn fallen lassen.
»Was machst du da?« Gus hört mich hantieren und wird panisch. Er ist zwar größer als ich, aber aufgrund seiner Ängstlichkeit denke ich, dass er jünger sein muss. Obwohl jeder Mensch ängstlich sein kann, egal, wie groß oder alt er ist.
»Nichts.« Ich will mir nicht ausmalen, wie Gus reagiert hätte, wäre mir der Klodeckel aus den Händen gerutscht. Ich lege ihn vorsichtig ab. »Alles gut. Kein Grund zur Panik.«
Ich frage mich, ob Gus schon immer ein Hosenscheißer war oder der Mann und die Frau ihn erst dazu gemacht haben. Was für ein Junge war er, bevor er herkam? Ist er auf Bäume geklettert, hat Frösche gefangen, sich als Gespenst verkleidet und nachts auf Friedhöfen gespukt? Oder war er ein Bücherwurm und hat sich vor der Dunkelheit gegrault? Einmal haben wir versucht, uns von früher zu erzählen, aber das hat mich traurig gemacht, bis ich schließlich gesagt habe, ich wolle nicht mehr darüber reden. Sogar in meinen frühesten Erinnerungen kommen der Mann und die Frau vor und tun mir Schlimmes an, Dinge, die ich nicht mag.
Die beiden haben eine Zeitung aufgehoben, in der stand, dass ich vermisst werde. Die Frau hat mir daraus vorgelesen, mir erzählt, was mit Momma passiert ist, und dass die Polizei nach mir sucht. Sie hat mir ein Foto gezeigt, auf dem Daddy weinend vor unserem großen blauen Haus stand. Später hat sie gesagt, dass die Polizei die Suche nach mir aufgegeben habe, ich sei ein alter Hut. Das hat sie mir voller Schadenfreude unter die Nase gerieben und sich darin geaalt, dass sie und der Mann mit meiner Entführung durchgekommen sind.
»Nichts auf der Welt ist so leicht wie ein Kind zu entführen«, hat sie gesagt.
Wie auch immer, ich muss das Klo weiter untersuchen. Der Tank ist mit ekligem Wasser gefüllt, womöglich mit Urin oder so was in der Art. Als mir der Arm hineinrutscht, reicht es mir bis zum Ellbogen. Ich reiße ihn heraus, schüttle ihn trocken und setze mich, um die Innenseite des Deckels abzutasten. Die ist nicht glatt wie ein Kinderpopo, sondern rau und krisslig, und an einer Kante steht ein Zacken vor. Der könnte genau richtig sein.
Gus ist jetzt schon krank vor Sorge, dass das, was ich vorhabe, nicht gut ausgeht. Seit ewigen Zeiten versuche ich ihm klarzumachen, dass wir hier nicht rauskommen, wenn wir nichts unternehmen. Er will lieber hierbleiben, statt einen Fluchtversuch zu wagen und zu riskieren, dass wir erwischt werden.
Ich reibe mit der Löffelkante über den Zacken, immer hin und her. Manchmal bleibe ich mit den Fingerknöcheln hängen und scheure sie auf. Tut höllisch weh, aber ich mache weiter. Nach einer Weile spüre ich, dass ich eine dünne Metallschicht abgefeilt habe. Es ist noch kein Spieß, wird aber vielleicht einer, wenn ich weiter schmirgele.
»Das darfst du nicht«, sagt Gus.
»Warum nicht?«
»Die bringen dich um.«
Ich fahre mit dem Finger über die aufgeraute Kante und zum ersten Mal seit langer Zeit spüre ich noch mal so etwas wie Hoffnung.
»Nicht, wenn ich sie zuerst umbringe.«
*
Ich hatte nie vor, einen Menschen zu verletzen oder sogar zu töten. So eine bin ich nicht, in mir steckt nichts Böses, oder zumindest glaube ich, dass es früher so war, bevor ich herkam. Doch im Dunkeln eingesperrt zu sein, macht was mit dem Verstand, verdreht ihn, bis er nicht wiederzuerkennen ist. Ich bin nicht mehr die, die ich war, bevor der Mann und die Frau mich entführt haben.
Ohne Gus hätte ich hier unten nicht überlebt. Er ist das Beste, was mir passieren konnte.
Ich kann mich nicht erinnern, wann er kam, weiß nur, dass er plötzlich da war. Mitten in der Nacht. Ich habe geschlafen. Als ich wach wurde, hockte er weinend in einer Ecke, war noch schlimmer dran als ich.
Der Mann und die Frau haben die Kellertür oben geöffnet, ihn die Treppe runtergestoßen und die Tür verriegelt. Damals war Gus zwölf, der Himmel weiß, wie alt er jetzt ist.
Als er aufgehört hat zu weinen, hat er gesagt, die beiden hätten ihn mit einem Hund in ihren Wagen gelockt. Der Hund war so was wie der Wurm am Angelhaken, denn der arme Gus liebt Hunde. Als der Hund ihn aus dem Wagenfenster angesehen hat und die Frau ihn mit einem freundlichen Lächeln gefragt hat, ob er den mal streicheln will, konnte er nicht widerstehen.
Gus war an dem Tag allein auf einem Spielplatz, hat mit sich selbst Basketball gespielt und Würfe geübt. Niemand hat gesehen, wie er geschnappt wurde. Der Ball blieb irgendwo liegen. Damals habe ich überlegt, warum er allein gespielt hat, ob das bedeutet, dass er keine Freunde hatte, aber ich habe ihn nicht danach gefragt. Solche Dinge spielen keine Rolle mehr, schließlich hat er jetzt mich.
*
Tag und Nacht arbeite ich an meinem Löffel. Wie lange schon, weiß ich nicht, aber ich spüre, dass der Stiel spitz geworden ist. Es ist keine richtige Spitze, dazu ist sie zu bucklig, aber sie ist vorhanden, und wenn ich sie mir in den Finger drücke, tut es weh. Noch traue ich mich nicht, zuzustechen, bis es blutet, doch bald muss ich mich dazu überwinden, muss die Spitze testen.
Ich habe gefeilt, bis meine Hand sich verkrampft hat und Gus mich schon ablösen wollte. Ich habe Nein gesagt, ich will nicht, dass er Ärger kriegt. In Wahrheit wollte er auch nicht helfen, er hat ja schon Heidenangst, wenn ich nur feile. Er wollte nett sein, aber falls einer die Sache mit dem Löffel ausbaden muss, dann will ich es sein.
Bin ich mit dem Löffel nicht zugange, verstecke ich ihn im Tank.
Im Moment arbeite ich mit ihm, obwohl der Mann und die Frau oben sind. Wenn wir hier jemals rauskommen wollen, muss ich dranbleiben. Der Deckel des Tanks liegt auf dem Boden, und ich schabe mit dem Löffel wie verrückt hin und her, bis ich die Frau oben sagen höre, dass sie uns was zu essen bringen muss. Schon im nächsten Augenblick reißt sie die Kellertür auf. Ich schaue hoch und der Lichtstrahl sticht mir in die Augen.
Sie steht oben an der Treppe und ruft: »Los, hol dein Essen.« Ich rege mich nicht. Normalerweise stellt sie den Napf auf die oberste Stufe und verschwindet. Heute nicht. Heute wartet sie, und als keiner von uns die Treppe raufkommt, fragt sie: »Wie oft soll ich noch sagen, dass ich nicht deine verdammte Kellnerin bin und das hier kein verdammtes Restaurant ist? Schwing deinen Hintern hoch und hol dein Essen. Ich zähle von fünf runter. Fünf …«
Gus ist starr vor Angst, also muss ich mich in Bewegung setzen.
»Vier.« Sie zählt schnell. Ich bringe den Löffel im Tank unter, lege den Deckel leise drauf, stehe auf, und obwohl meine Beine halb eingeschlafen sind, spurte ich los.
Ich bin nicht verblödet, ich kann rechnen und weiß, wie schnell sie bei eins sein wird; wenn meine Langeweile überhandnimmt, gehe ich im Kopf die Übungsblätter mit den Rechenaufgaben aus der Schule durch.
»Drei.« Das schaffe ich nicht, ich zittere am ganzen Körper, mein Herz hämmert. Aus dem Augenwinkel sehe ich Gus. Er sitzt zusammengekauert auf dem Boden und ist kurz davor, zu weinen.
Als sie bei »eins« ist, bin ich auf der untersten Stufe. Sie schaut zu mir herab, hält den Hundenapf in der Hand. Ich blinzele ins Licht.
Sie erkennt meine Angst und stößt ihr widerliches Lachen aus.
»Hast du keinen Hunger?«, fragt sie und ist von ihrer Bosheit ganz angetan. Meine Antwort wartet sie nicht ab. »Glaubst du, ich habe den ganzen Tag Zeit, um hier zu stehen und auf dich zu warten?«
»Nein, Ma’am«, erwidere ich unterwürfig.
»Nein, Ma’am’, was?« Ihr Ton ist scharf.
»Nein, Ma’am, ich glaube nicht, dass Sie den ganzen Tag Zeit haben, um da oben zu stehen und auf mich zu warten«, antworte ich mit rauer Stimme.
Wieder fragt sie: »Hast du keinen Hunger?«, und ich überlege, wie die richtige Antwort lautet. Ich habe Hunger, nur nicht auf ihr Essen. Aber wenn ich das sage, fährt sie aus der Haut, schließlich hat sie extra für uns gekocht.
»Ich habe Hunger, Ma’am.«
»Wäre schön, wenn du ab und zu ein bisschen Dankbarkeit zeigen würdest. Ich muss dir nichts zu essen geben, weißt du, ich könnte dich auch verhungern lassen.«
»Tut mir leid, Ma’am.« Ich gucke auf den Boden, will ihr abstoßendes Gesicht nicht sehen.
»Warum hat es so lange gedauert, bis du an der Treppe warst? Was hast du da hinten gemacht?«
Jetzt muss ich sie doch ansehen und stelle fest, dass mir ihr Blick nicht gefällt. Es ist, als ahnte sie was, und mir dreht sich der Magen um. Vielleicht spürt sie, dass ich was Verbotenes getan habe. Vor Angst verkrampft sich alles in mir, doch dann sage ich mir, dass der Löffel sicher im Tank liegt und sie ihn niemals finden wird. Also kann mir nichts passieren, zumindest nicht in diesem Moment.
»Ich hab geschlafen.«
»Wie war das?«, fährt sie mich an und wird so wütend, dass ihr Gesicht dunkelrot anläuft.
Zu spät fällt mir ein, dass ich was vergessen habe. »Ich habe geschlafen, Ma’am.« Am Ende eines Satzes muss ich »Ma’am« sagen, als Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit, weil sie so viel für mich tut. Wenn nicht, werde ich bestraft.
Jetzt schweigt sie, stiert mich dabei an. Das mag ich nicht; wenn sie so still ist, gefriert mir das Blut in den Adern.
»Sieht aus, als würde es heute kein Essen geben«, sagt sie schließlich und murmelt: »Undankbare Rotzgöre.«
Sie wendet sich ab, knallt die Tür zu und verriegelt sie. Ich springe zurück auf den Boden und sage mir, wenn das gestrichene Essen die schlimmste Strafe war, die ihr eingefallen ist, bin ich noch mal heil davongekommen.
Aber ich bin nicht schwachsinnig und weiß, dass es nicht dabei bleibt. Das wäre zu schön, um wahr zu sein.
*
Seit dem Tag, an dem ich vergessen habe, »Ma’am« zu sagen, gibt es nichts mehr zu essen. Zwar ist mir der Fraß der Frau zuwider, aber das bedeutet nicht, dass ich keinen Hunger habe. Bedeutet nicht, dass ich nicht essen muss. Inzwischen weiß ich nicht einmal mehr, seit wie vielen Tagen ich schon hungere. Kommt mir vor wie Wochen.
Anfangs war ich nur verdammt hungrig, aber dieses Gefühl verging komischerweise und wurde durch etwas anderes ersetzt. Etwas Schlimmeres. In den ersten Tagen konnte ich nur an Essen denken, irgendwann konnte ich Mahlzeiten sogar riechen und schmecken. Das ist jetzt vorbei, jetzt stelle ich mir nur noch vor, wie es ist, wenn ich verhungere. Sterbe ich dann im Schlaf oder spüre ich es, wenn mein Atem aufhört und mein Herz stillsteht? Ringe ich dann nach Luft?
Die Frau hat uns auch nichts zu trinken gebracht, und ich komme um vor Durst. Inzwischen haben Gus und ich angefangen, das eklige Wasser aus dem Toilettentank zu trinken. Weil wir nicht wissen, wie lange wir damit auskommen müssen, nehmen wir nur winzige Schlucke und nie genug, um unseren Durst zu löschen.
Gus hat ebenfalls Hunger, ich höre seinen Magen knurren. Aber er sagt nichts, obwohl er weiß, wer daran schuld ist.
Im Moment schläft er. Auch ich versuche zu schlafen, aber mir geht zu viel durch den Kopf. Wenn die Frau vorhat, uns verhungern zu lassen, wir aber nicht sterben wollen, müssen wir hier raus und dazu die erstbeste Gelegenheit nutzen, die sich uns bietet. Deshalb mache ich seit Neuestem Fitnessübungen, was nicht einfach ist, ich habe ja kaum noch Kraft, und meine Beine gehorchen mir nicht richtig, die muss ich besonders trainieren. Also laufe ich auf der Stelle, beuge mich vor und berühre die Fußspitzen mit den Händen, drehe Runden um Gus herum. Er sieht mir zu, fragt, was das soll, und bittet mich aufzuhören. Der Gedanke, von hier wegzulaufen, gefällt ihm nicht, er hat zu große Angst, wir könnten erwischt werden.
Als er mir das gestanden hat, habe ich mit den Schultern gezuckt und gesagt: »Vielleicht schnappen sie uns, vielleicht nicht. Das wissen wir erst, wenn wir es probiert haben.« Ich habe ihm eingeschärft, bei unserer Flucht dicht hinter mir zu bleiben und nicht zu trödeln, denn ich bin lieber tot, als erwischt zu werden.
Ich sitze auf dem Boden, der Löffel liegt auf meinem Schoß, damit ich ihn griffbereit habe. Er ist kein Spieß, wird auch nie einer werden, aber er hat eine Spitze. Damit kann ich zwar niemanden umbringen, vielleicht aber jemandem wehtun. Wehtun ist besser als nichts.
*
Plötzlich öffnet sich die Tür mit einem Knarren, und ich halte die Luft an. Es ist aber nicht die Frau, die kommt, sondern der Mann, dass verraten mir die Schritte. Allerdings versucht er, leise zu sein, was bedeutet, dass die Frau irgendwo ist, aber nicht wissen darf, dass er uns besuchen kommt.
Ich packe meinen Löffel. Ich möchte den Mann nicht verletzen, er war immer nett zu mir – zumindest netter als die Frau, obwohl Kinder im Keller festzuhalten, so oder so nicht nett ist, selbst wenn man sie nicht schlägt. Jetzt kommt es darauf an, der Mann ist nämlich nicht so misstrauisch wie die Frau. Ich bin bereit oder zumindest so bereit, wie ich sein kann, habe in Gedanken alles eine Million Mal durchgespielt. Im Kopf weiß ich, was zu tun ist, nur fängt mein Herz jetzt dummerweise an zu galoppieren, und meine Arme und Beine zittern wie Espenlaub. Das muss ich in den Griff kriegen, sonst klappt das, was ich vorhabe, nicht. Ich atme tief ein, zähle bis zehn und atme aus.
»Wo steckst du?«, flüstert der Mann.
Gus bringt keinen Ton heraus. »Hier«, sage ich und packe meinen Löffel so fest, dass es wehtut.
Er kommt näher und sagt, er hat einen Schokoriegel für mich. Ich höre, wie er ihn aus dem Papier wickelt. »Wenn es nach ihr ginge, könntest du hier unten verrecken. Aber das lasse ich nicht zu, keine Sorge.« Er versucht, freundlich zu sein, will die lange Zeit, in der ich nichts zu essen gekriegt habe, wettmachen und drückt mir den Schokoriegel in die Hand. »Na los, iss.« Es ist nicht das erste Mal, dass er mir so was Gutes bringt. Einmal war es ein Cupcake. Da hat er gesagt, der wäre für meinen Geburtstag, aber ob ich da wirklich Geburtstag hatte, weiß der Kuckuck.
Ich führe den Schokoriegel an meinen Mund, lecke daran und schmecke die Schokolade, süßer als alles, was ich hier jemals gekostet habe. Langsam beiße ich hinein, stoße auf Nüsse und etwas Dickflüssiges. Als ein Tropfen auf mein Kinn fällt, wische ich ihn ab und lecke an meinem Finger. Es schmeckt so wundervoll, dass ich weinen will. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal etwas so Leckeres gegessen habe. Danach knabbere ich nur noch an dem Riegel, will ihn mir einteilen und wünschte, er würde ewig halten. Aber ich muss etwas für Gus aufheben, er wird den Schokoriegel ebenfalls lieben. Er muss dringender als ich etwas essen, eine Mücke hat mehr Kraft als er. Doch wenn ich den Schokoriegel nicht aufesse, wird der Mann mich für undankbar halten, und das will ich nicht. Wahrscheinlich hat er auch für Gus etwas Süßes dabei.
Ich nehme noch einen Bissen und seufze zuckerselig.
»Schmeckt es dir?« Der Mann steht so dicht vor mir, dass ich seinen Atem rieche. Er stinkt.
»Schmeckt super«, sage ich mit dem Mund voller Schokolade und von der weichen Füllung verklebten Zähnen.
Mir ist klar, dass der Mann sich bei mir einschmeicheln will, die Frage ist bloß, warum. Vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen, weil wir so lange hungern mussten, oder es steckt etwas anderes dahinter.
»Ich habe noch mehr. Wenn du noch etwas willst, musst du es nur sagen.«
Ich wünschte, er wäre mir nicht so nahe gerückt. Die Frau weiß mit Sicherheit nicht, dass er hier ist.
Aber vielleicht gibt es nie wieder eine so gute Gelegenheit wie jetzt.
Ich werde nervös, muss an all das denken, was schiefgehen kann, wenn ich mit dem Löffel zusteche, und mir bricht der kalte Schweiß aus. Vielleicht ist es doch keine so großartige Idee.
Dann stelle ich mir Gus vor, wie er den Rest seines Lebens hier unten rumkrebst, und ich weiß, dass ich ihn rausholen muss, selbst wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue.
Noch einmal schließe ich meine Hand fest um den Löffelstiel und erinnere mich daran, dass ich nur einen einzigen Versuch habe, um es richtig zu machen. Genau zielen kann ich in der Dunkelheit nicht, ich muss einfach zustechen und aufs Beste hoffen.
Der Mann sagt, ich sei ein hübsches Mädchen. Ich atme tief ein, hole mit dem Arm aus und ramme den Löffel in ihn hinein. Ich treffe ihn irgendwo am Hals und spüre, dass die ganze Stielspitze eingedrungen ist. Er stößt einen Schrei aus.
Doch der Löffel ist kein Messer, einmal zustechen reicht nicht, also reiße ich ihn heraus und stoße wieder und wieder zu. Ich weiß nicht, wie groß die Wunden sind, die ich ihm zufüge, aber dass er Probleme hat, ist deutlich zu hören.
Er geht zu Boden, ich falle mit ihm, höre ihn stöhnen und mich verfluchen. Als ich aufstehen will, packt er mich an den Haaren. Ich reiße meinen Kopf zurück, verliere ein Büschel Haare und raffe mich auf.
Er langt nach mir, erwischt aber nur mein Bein. Obwohl ich nur barfuß bin, trete ich mit aller Kraft nach ihm, und seine Hand löst sich. Wieder stöhnt er, bleibt aber liegen. So schnell wird er mir also nicht nachlaufen.
»Gus, komm«, rufe ich, während ich die Treppe hinaufhaste. Mein Löffel ist fort, den muss ich fallen gelassen haben.
Oben angekommen höre ich Gus’ zaghafte Schritte. Ich will, dass er rennt, und zische, dass er sich beeilen soll. In meinem Kopf dröhnt es, und in meinen Ohren ist ein Klingelton. Gus weint.
Wieder gibt der Mann ein Geräusch von sich, lauter dieses Mal, fast schon heulend, und ich frage mich, ob die Frau ihn hören kann.
Ich öffne die Tür, weiß weder, wo ich bin, noch, wohin ich mich wenden soll. Ich war hier oben nur, als sie mich hergebracht haben und dann auch bloß für vielleicht zwei Sekunden, bevor sie mich die Treppe runtergestoßen und die Tür verriegelt haben. Deshalb erinnere ich mich an nichts. Außerdem ist es auch hier dunkel, nur nicht so stockfinster wie im Keller. Ein schwacher Schein von irgendwoher verbreitet ein wenig Licht.
Ich weiß nicht, wie weit Gus hinter mir ist, rufe, er soll schneller machen, und drehe mich kurz nach ihm um. Er schleicht mir nach, steht wahrscheinlich Todesängste aus. Ich versichere ihm, dass alles gut wird. »Du kannst jetzt nicht schlappmachen, dafür haben wir keine Zeit«, sage ich und versuche, nicht genervt zu klingen. »Komm, wir müssen rennen.« Ich nehme seine Hand, die eiskalt ist, und ziehe ihn mir nach. Gus weint, ansonsten gibt er keinen Ton von sich.
Dann ertönt von irgendwo die Stimme der Frau. Sie hört sich verschlafen und noch leicht neben der Spur an. »Eddie?«, ruft sie, »Eddie, was ist los?«
Vor mir liegt ein langer Flur.
Plötzlich höre ich den Mann stöhnend die Treppe hinaufsteigen und laufe los. Schwer atmend und wütend ruft er: »Das kleine Biest ist abgehauen.«
»Was?«, antwortet die Frau. »Wie zum Teufel konnte das denn passieren?«
»Weiß der Henker«, erwidert er und ruft, sie müssen mich finden, dürfen mich nicht entkommen lassen.
In dem trüben Licht entdecke ich eine Tür, eigentlich nur ihren Umriss. Ich drehe den Knauf, die Tür ist verschlossen. Mit schweißfeuchten Händen taste ich nach dem Riegel.
Die beiden sind dicht hinter mir, brüllen sich an, Licht zu machen. Er will auf der einen Seite nach mir suchen, sie auf der anderen, und einer nennt den anderen Idiot. Die Stimmen sind nah, gleich werde ich den Atem der beiden heiß im Nacken spüren.
Jetzt wollen sie mit mir handeln. »Wenn du uns sagst, wo du bist, kriegst du ein Plätzchen«, sagt er, als wäre ich so dämlich, darauf reinzufallen, um dann wegen einem Plätzchen den Rest meines Lebens im Keller zu verbringen.
Die freundliche Tour hält auch nicht lange, gleich nach dem Plätzchenangebot heißt es wieder: »Warte, bis wir dich in die Finger kriegen, wir drehen dir den Hals um, du ausgekochtes Luder.«
Sie wissen, dass ich die Schuldige bin und Gus nie gewagt hätte, aus dem Keller auszubrechen.
Leise schiebe ich den Riegel zurück, die Tür geht auf. Vor mir steht die Dunkelheit wie eine Wand, und warme, feuchte Luft schlägt mir entgegen. Sie nimmt mir den Atem und lässt mich kurz verharren. Seit Jahren habe ich so etwas nicht mehr gerochen. Gute reine Luft.
Dann reiße ich mich zusammen, ich muss weiter. Die Tür war mit einer Alarmanlage verbunden und eine Sirene geht los. Jetzt müssen die beiden sich wohl kaum noch fragen, wo Gus und ich gerade sind.
Ich höre sie brüllen, dass wir ihnen entwischen, und setze mich in Trab. Wieder greife ich nach Gus’ Hand und ziehe ihn mit. Doch draußen zu sein, macht mir beinahe genauso viel Angst, wie drinnen zu bleiben. Ich bin schon so lange nicht mehr im Freien gewesen, weiß kaum noch, wie das ist.
Aber dann sehe ich zu, dass mich die Dunkelheit verschluckt, und renne schneller als jemals zuvor. Gus’ Hand entschlüpft mir, ich bete, dass er mithalten kann. Er hat nie mit mir trainiert, der Geier weiß, wie schnell er laufen kann. Aber manchmal gibt einem die Angst so viel Kraft, dass man Dinge schafft, die man sich nie hätte träumen lassen.
Ich laufe über Kies, das tut weh, vielleicht bluten meine Füße, spielt aber keine Rolle. Danach kommt weiches, feuchtes Gras, das einen Moment lang kitzelt, ich hetze darüber weg.
Über mir leuchtet der Mond und funkeln die Sterne und um mich herum summen Nachtinsekten. All das hatte ich fast vergessen, und am liebsten bliebe ich stehen, um mir den Himmel in Ruhe anzugucken und dem Summen zuzuhören, aber das geht natürlich nicht. Noch nicht.
»Gus, halte durch«, rufe ich über die Schulter zurück. Wir können uns erst richtig umsehen, wenn wir das Haus ein gutes Stück hinter uns haben. Im Moment sind der Mann und die Frau uns noch auf den Fersen, der Abstand dürfte nicht mal besonders groß sein. Würden wir eine Pause einlegen und verschnaufen, wäre es um uns geschehen. Ich frage Gus, ob mit ihm alles in Ordnung ist, schärfe ihm noch mal ein, jetzt bloß nicht zu schwächeln. »Gleich haben wir es geschafft. Wir sind schon so gut wie frei.«
Anfangs haben der Mann und die Frau nach uns gerufen, jetzt geben sie keinen Pieps mehr von sich, wahrscheinlich sollen wir nicht mitkriegen, wo sie sind. Allerdings haben sie Taschenlampen dabei, deren Licht durch die Bäume tanzt. Wenn es sich uns nähert, ducken wir uns schnell weg und schlagen einen Haken. Mittlerweile haben wir so oft die Richtung gewechselt, dass ich das Haus nicht mal wiederfinden würde, wenn ich wollte.
Irgendwann höre ich die Schritte der beiden nicht mehr, auch das Licht der Taschenlampen ist mit einem Mal verschwunden, was mich zuerst erleichtert, dann aber panisch macht, denn jetzt weiß ich nicht, wo sie sind. Haben wir sie abgehängt oder verbergen sie sich mucksmäuschenstill hinter Bäumen und lauern uns auf?
Der Mond und die Sterne erhellen die Umgebung nur schwach, aber nach der langen Zeit im Keller, sind Gus’ und meine Augen an Dunkelheit gewöhnt. Das ist unser Vorteil gegenüber unseren Verfolgern.
Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo wir sind. Vor uns liegt eine Straße, rechts und links stehen Häuser, umgeben von hohen Bäumen, von denen nur keiner dick genug ist, um sich dahinter zu verstecken. Und nirgends brennt Licht. Wir überqueren eine Wiese. Das Gras reicht bis zu meinen Knien, dazwischen wächst struppiges Unkraut, das mich sticht und kratzt.
Ich renne weiter, knalle mit dem Kopf gegen einen Ast, und mir wird so schwindlig, dass ich einen Moment brauche, bis ich wieder klar sehe. »Was ist passiert?«, fragt Gus, doch bevor ich antworten kann, knackt hinter uns ein Zweig und mir läuft es kalt den Rücken hinunter.
»Wir müssen weiter«, flüstere ich und sprinte wieder los. Gus fängt an zu hecheln. Deshalb halten wir jetzt besser den Mund, wir brauchen unsere Puste zum Laufen.
Ich stolpere über einen gefällten Baum und lande auf allen vieren. Tut gemein weh, vor allem an den Knien, aber ich habe keine Zeit zu jammern, deshalb raffe ich mich auf und laufe weiter. »Pass auf den Baum auf«, flüstere ich Gus zu, der noch immer hinter mir ist. Allerdings keuche ich jetzt lauter als er.
Allmählich werden meine Beine schwer, meine Füße schmerzen, und mein Herz verkrampft sich vor Angst, die beiden könnten uns finden und totprügeln.
Aber ich habe einen kleinen Vorgeschmack auf die Freiheit erhascht und will nicht sterben.
Ich renne an Häusern vorbei, durch Gärten, ein Stück die Straße hinunter und wieder durch Gärten.
Meine Beine sind jetzt schwer wie Mehlsäcke, und ich muss überlegen, welche Möglichkeiten Gus und ich haben. Viele sind es nicht. Ich könnte bei einem der Häuser an die Tür klopfen, aber wie groß ist die Chance, dass uns einer mitten in der Nacht aufmacht? Es wäre zu riskant, für jeden sichtbar vor einer Tür zu stehen und zu warten.
Wir müssen irgendwo in Deckung gehen. Ich blicke mich nach einem Versteck um und werde langsamer. Von den Lichtern der Taschenlampen ist nichts mehr zu sehen, aber ich bin nicht so dumm, mir einzureden, die beiden hätten aufgegeben und wären wieder nach Hause gegangen. Eher treiben sie ihre Spielchen mit uns.
Im Garten hinter einem der Häuser steht ein Schuppen unter einem knorrigen Baum. Ein gutes Versteck.
»Komm, Gus«, rufe ich, »hier rein.« An der Tür hängt ein offenes Vorhängeschloss.
Ich nehme das Schloss aus dem Halter und schiebe die Tür ein Stückchen auf. Das Knarren geht mir durch Mark und Bein, aber der schmale Spalt reicht mir schon, um rasch hindurchzuschlüpfen. Ich spähe nach draußen, versuche, meinen Freund irgendwo zu entdecken; er ist nicht da, ist anscheinend weiter zurückgefallen, als ich dachte.
Halb hinter der Tür verborgen starre ich in die Dunkelheit, warte mit angehaltenem Atem, dass Gus auftaucht und zu mir findet.
Leise rufe ich seinen Namen, aber Gus ist wie vom Erdboden verschluckt.
*