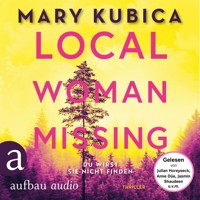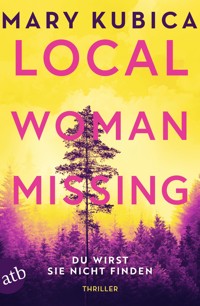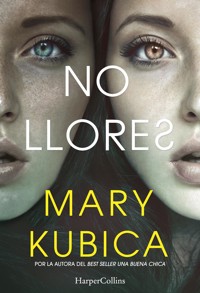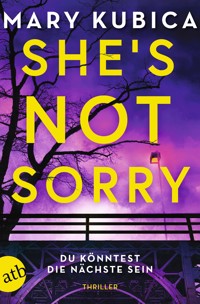
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein schrecklicher Unfall.
Eine schockierende Entdeckung.
Niemand ist sicher.
Als Intensivkrankenschwester hat Meghan mit schockierenden Schicksalen zu tun. Als die Komapatientin Caitlin eingeliefert wird, ist sie zutiefst erschüttert: Caitlin soll von einer Brücke gesprungen sein. Meghan fragt sich, was die junge Frau zu dieser Verzweiflungstat getrieben haben könnte. Als ein Zeuge berichtet, Caitlin sei gar nicht selbst gesprungen, sondern wurde von der Brücke gestoßen, wird es für Meghan gefährlich. Viel zu spät begreift sie, dass sie und ihre Tochter die Nächsten sein könnten ...
Spannend, twisty, atemlos: Mary Kubica ist nichts für schwache Nerven!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Meghan ist besorgt: In letzter Zeit häufen sich erschreckende Nachrichten über einen Unbekannten, der in ihrer Nachbarschaft Frauen angreift. Besonders um ihre sechzehnjährige Tochter Sienna macht sie sich Gedanken. Dann wird Meghan bei der Arbeit auch noch mit dem furchtbaren Schicksal einer jungen Komapatientin konfrontiert. Als Intensivkrankenschwester ist sie solche Fälle eigentlich gewöhnt, doch etwas an der jungen Caitlin, die von einer Brücke gesprungen sein soll, lässt sie nicht los. An wen erinnert Caitlin sie? Und wer ist der unheimliche Mann, der die wehrlose Frau plötzlich besucht? Hat er etwas mit dem Mann aus den Nachrichten zu tun? Immer tiefer wird Meghan in einen Strudel aus Ereignissen gerissen, die alle eins gemeinsam zu haben scheinen: Caitlin. Als ihr klar wird, dass damit auch ihr eigenes dunkelstes Geheimnis an Licht zu kommen droht, ist es bereits zu spät.
Über Mary Kubica
Mary Kubica hat Geschichte und Amerikanische Literatur studiert. Ihre packenden Thriller sind New-York-Times- und USA-Today-Bestseller, waren nominiert für die Goodreads Choice Awards und werden von der Presse hochgelobt. Sie wurden in über dreißig Sprachen übersetzt und haben sich weltweit über fünf Millionen Mal verkauft. Mary Kubica lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in der Nähe von Chicago.
Gabriele Weber-Jarić lebt als Autorin und Übersetzerin in Berlin. Sie übertrug u. a. Kristin Hannah, Imogen Kealey und Allison Pataki ins Deutsche.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Mary Kubica
She’s Not Sorry – Du könntest die Nächste sein
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Gabriele Weber-Jarić
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Prolog
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Teil II
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Epilog
Dank
Impressum
Für meine Familie und meine Freunde
Prolog
Genau in dem Moment, als ich die Tür öffne, um das Geschäft zu betreten, klingelt mein Handy. Es steckt irgendwo in den Tiefen meiner Umhängetasche. Ich schiebe Geldbörse und Kosmetiktasche zur Seite und weiß schon, dass ich das Ding nicht rechtzeitig finden werde.
Beim dritten oder vierten Klingeln finde ich das Telefon endlich und wühle es aus der Tasche heraus. Kaum habe ich es in der Hand, hört das Klingeln auf. Ich war nicht schnell genug. Auf dem Display steht ein verpasster Anruf von Sienna.
Ich stutze, bleibe in der offenen Ladentür stehen und starre auf die Telefonnummer. Verunsichert und verwirrt sage ich mir, dass es zehn Uhr morgens ist. Sienna ist in der Schule oder sollte es zumindest sein. Hin und wieder schickt sie mir während des Unterrichts eine Nachricht, tippt heimlich auf ihrem Handy, wenn die Lehrerin woanders hinschaut – Darf ich heute noch bei Gianna bleiben? Ich habe meine Wasserflasche verloren. Hast du Tampons gekauft? Mein blöder Taschenrechner funktioniert nicht –, aber sie ruft nie an. Meine Gedanken laufen in hundert verschiedene Richtungen. Wäre Sienna krank geworden, hätte die Schulkrankenschwester angerufen; hätte sie wegen irgendetwas Ärger bekommen, hätte der Schulleiter sich gemeldet. Sienna hätte sich in keinem der Fälle bemerkbar gemacht.
Bevor ich zurückrufen kann, kommt meine Tochter mir zuvor.
»Sienna? Was ist passiert?« Ich drücke mir das Handy ans Ohr, betrete das Geschäft und lasse die Tür hinter mir zufallen, der Lärm der vorbeifahrenden Autos und telefonierenden Passanten ist nur noch gedämpft zu hören. In meiner Panik ist meine Stimme schrill geworden, und ich stelle mir vor, wie genervt Sienna gleich reagieren wird, weil ich überreagiert habe, wegen nichts ausgeflippt bin. Mensch, Mom. Bleib locker. Mir geht’s gut, wird sie sagen und das letzte Wort zur Bekräftigung in die Länge ziehen.
Doch das geschieht nicht.
Zuerst ist es still. Kaum wahrnehmbar kann ich das Geräusch von etwas Leichtem ausmachen, von einer Bewegung oder einem Windhauch. Es dauert ein paar Sekunden, und ich komme zu dem Schluss, dass Sienna mich gar nicht anrufen wollte. Ihr Handy steckt in ihrer Jeanstasche oder in ihrem Rucksack, und der Anruf wurde versehentlich ausgelöst. Sienna wird nicht einmal wissen, dass von ihrem Handy zwei Anrufe an mich gegangen sind. Ich lausche, versuche zu erraten, wo sie ist, doch ich höre immer nur das Gleiche. Nichts, was mir Aufschluss gibt. Nichts Verräterisches.
Dann durchschneidet eine Männerstimme die Stille. Die Worte klingen kalt und hart, zudem scheint er mithilfe eines Stimmenverzerrers zu sprechen. »Wenn Sie Ihre Tochter jemals wiedersehen wollen, machen Sie exakt das, was ich sage.«
Ich ringe nach Luft, reiße die Augen auf. Verliere den Halt, taumele rückwärts gegen die geschlossene Tür. Ich schlage mir die Hand vor den Mund, kann noch immer nicht atmen. Kann nicht denken, mein Verstand kann das Gehörte nicht verarbeiten. Ich schaue auf das Display, will feststellen, ob ich mich geirrt habe und der Anruf nicht von Siennas, sondern von einem anderen Handy gekommen ist. Ob jemand falsch verbunden ist. Etwas anderes kann nicht sein, ist undenkbar. Ist in meinem Leben undenkbar.
Und doch ist es so. Vom Display starrt mich Siennas Handynummer an.
»Wer ist da?« Ich presse das Handy ans Ohr. »Warum haben Sie das Handy meiner Tochter?«
Und dann höre ich im Hintergrund Sienna gellend schreien:
»Mommy!« Es klingt markerschütternd, wild, verzweifelt. In diesem Moment weiß ich, dass der Mann nicht nur Siennas Handy hat. Er hat auch Sienna.
Mich packt das nackte Grauen. Sienna hat mich seit mindestens zehn Jahren nicht mehr »Mommy« genannt. Etwas wirklich Furchtbares muss geschehen sein, dass sie sich wieder wie ein kleines Kind fühlt und nach ihrer Mommy ruft. Und ich bin vollkommen machtlos. Ich weiß nicht, wo sie ist, weiß nicht, wie ich zu ihr kommen, ihr helfen und das, was abläuft, beenden kann.
»Gehen Sie weg!«, sagt Sienna. Ihre Stimme zittert, klingt nicht nach meiner sonst so rebellischen und selbstbewussten Tochter. Ihre Angst ist unverkennbar. »Fassen Sie mich nicht an!« Ihre Worte kommen stockend, unterbrochen vom Weinen, ihre Stimme klingt brüchig und kraftlos.
Sienna ist in Panik, ebenso wie ich.
»Sienna, Baby«, rufe ich. Es entsteht Unruhe, ich höre gedämpfte Laute, stelle mir vor, wie dieser Mann Sienna überwältigt und knebelt, damit sie weder schreien noch sprechen kann. Es klingt, als würde Sienna sich wehren, sich ihm widersetzen.
Ich stehe da, ohne zu blinzeln. Ohne zu atmen.
Tränen brennen in meinen Augen. »Was machen Sie mit ihr? Wer sind Sie?«, frage ich den Mann so laut, dass alle im Geschäft innehalten und mich anstarren. Vor Schreck raubt es einigen den Atem, andere sind in eine Art Schockstarre verfallen, als befänden wir uns alle im selben Albtraum. »Was haben Sie mit meiner Tochter gemacht? Was wollen Sie von mir?«
»Sie hören mir jetzt zu«, erwidert der Mann, dessen verzerrte Stimme, anders als meine, ruhig und gelassen klingt. Noch immer höre ich im Hintergrund Siennas Stimme. Ich weiß nicht, was schlimmer ist: ihr herzzerreißendes Weinen oder mitzubekommen, wie es langsam verebbt. Ihre Qual zwingt mich in die Knie.
»Wo ist Sienna? Was haben Sie ihr angetan? Warum kann ich sie nicht mehr hören?«
»Sie müssen genau das tun, was ich Ihnen sage. Ganz genau. Haben Sie mich verstanden?«
»Ich möchte mit meiner Tochter sprechen. Lassen Sie mich mit meiner Tochter sprechen. Ich muss wissen, dass mit ihr alles in Ordnung ist. Was haben Sie mit ihr gemacht?«
»Ich habe nichts zu verlieren«, sagt der Mann. »Sie sind die Einzige, die etwas zu verlieren hat, Ms. Michaels. Deshalb sollten Sie jetzt die Klappe halten und mir zuhören, denn mir ist es egal, ob Ihre Tochter lebt oder stirbt. Was mit ihr geschieht, hängt einzig und allein von Ihnen ab.«
Teil I
Kapitel 1
Im Krankenhaus sehe ich sie zum ersten Mal auf der Intensivstation, kurz nachdem sie operiert worden war. Ich stehe an den Glasschiebetüren zu ihrem Zimmer, sie liegt im Krankenhausbett, ist an einen zentralen Venenkatheter, einen Trachealtubus, ein Hirndruck-Messgerät und eine nasogastrale Sonde angeschlossen. Aus einem Tropf werden ihr Flüssigkeiten zugeführt, Medikamente wie Diuretika, Antikonvulsiva und wahrscheinlich Morphium. Der Kopf ist mit Gaze eingebunden. Mir wurde gesagt, dass während der OP Stücke des Schädelknochens entfernt wurden, um den Druck auf das Gehirn zu verringern. Wegen des Verbands und der zahlreichen Schläuche ist von ihrem Gesicht nicht viel zu erkennen, nur dass sie die Augen geschlossen hat und das wenige, was zum Vorschein kommt, aufgeplatzt oder geschwollen und verfärbt ist.
Sie ist nicht meine Patientin. Eine andere Krankenschwester namens Bridget steht bei ihr, kümmert sich um sie, tut, was erforderlich ist. Beim Anblick dieser Schwerverletzten dreht sich mir der Magen um. Ich habe das Geraune auf der Station gehört, das Getuschel über das, was vorgefallen ist, was sie hierhergebracht hat.
Ich wurde für diesen Tag anderen Patienten zugewiesen. Auf der Intensivstation gibt es dreißig Betten. Sie sind in Zehnergruppen unterteilt, in deren Mitte sich je eine Schwesternstation befindet. Das Verhältnis von Pflegekraft zu Patient hängt davon ab, wie kritisch der Zustand eines Patienten ist. Bei denjenigen, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind oder zwischen Leben und Tod schweben, beträgt das Verhältnis zwei zu eins, bei Patienten, die weniger gefährdet sind, kann es vier zu eins betragen. Die Anforderungen an die Pflegekräfte sind hoch und vielfältig, was bedeutet, dass es zu Fehlern kommen kann, selbst wenn alle ihr Bestes geben. So war es vor einer Woche, als eine Krankenschwester einer Patientin versehentlich die morgendlichen Medikamente einer anderen verabreichte. Sie bemerkte es sofort, informierte den Arzt, und alles konnte geregelt werden, Gott sei Dank. Manchmal geht es weniger gut aus.
Bridgets Blick fällt auf mich. Sie unterbricht ihre Arbeit, verlässt den Raum und gesellt sich zu mir.
»Hey«, sagt sie, während sich die Türen vor uns wieder schließen, »hast du schon gehört?« Wie immer, wenn sie tratschen will, rückt sie dicht an mich heran.
»Was gehört?« Mein Herz schlägt schneller, als wolle es sich auf das vorbereiten, was Bridget mir gleich erzählen wird. Wegen eines Arzttermins bin ich erst zur Mittagszeit im Krankenhaus eingetroffen. Ich hätte früher hier sein können – habe die Arztpraxis bereits um halb zehn verlassen –, doch dann ist etwas passiert, und ich bin lange durch die Straßen gelaufen. Ich war kurz davor, mir den ganzen Tag frei zu nehmen und mich vertreten zu lassen, dabei habe ich heute nur eine Schicht von wenigen Stunden. Zu guter Letzt bin ich doch hier erschienen. Ich musste mich dazu zwingen, obwohl es genau die richtige Entscheidung war. Ich muss tun, als wäre nichts. Wenn nicht, könnte man mir Fragen stellen. Jeder würde wissen wollen, wo ich war und warum ich meinen Dienst nicht angetreten habe. Außerdem hatte ich gehofft, die Arbeit könnte eine willkommene Ablenkung sein. Das war ein Irrtum.
»Sie ist gesprungen«, sagt Bridget. »Von einer Fußgängerbrücke.«
Mein Magen verkrampft sich. Darüber reden hier alle: von der Frau, die von einer Brücke sieben Meter in die Tiefe gestürzt ist und nur ganz knapp überlebt hat. »Ich weiß, ich habe davon gehört. Furchtbar. Wie heißt sie?«
»Caitlin«, sagt Bridget, und ich speichere den Namen, mache mich mit ihm vertraut.
»Und wie weiter?«
»Beckett. Caitlin Beckett.«
Und dann berichtet Bridget, als würde sie nach einer Schicht die Übergabe machen, obwohl Caitlin nicht meine Patientin ist und wir nicht beim Schichtwechsel sind. Bridget sagt, dass die Patientin zweiunddreißig Jahre alt und aus der Chirurgie auf die Intensivstation gekommen sei. Zuerst sei sie in der Notaufnahme gewesen, anschließend wegen eines Hirnödems infolge eines Schädel-Hirn-Traumas eine dekompressive Kraniektomie durchgeführt worden. Mit anderen Worten, die Gehirnschwellung war so stark, dass ein Ausgleichsraum geschaffen werden musste, um den Hirndruck zu senken. Sonst wäre Caitlin jetzt tot.
Bridget redet und redet. Ab irgendeinem Punkt höre ich nicht mehr zu, bin nur noch in den Anblick dieser Patientin versunken. Caitlin Beckett. Meine Gedanken bleiben an ihrem Alter hängen, daran, dass sie erst zweiunddreißig ist. Noch so jung. Ich schüttle entsetzt den Kopf. Ich bin vierzig Jahre alt. Als ich zweiunddreißig war, hatte ich gerade erst zu mir gefunden. Damals dachte ich, das wäre die beste Zeit meines Lebens. Ich war verheiratet, hatte ein Kind und mehr Selbstvertrauen als jemals zuvor. Ich wusste, wer ich war, und musste mir nicht mehr ein Bein ausreißen, um anderen zu imponieren.
Caitlin trägt den üblichen Krankenhauskittel – gestärkt, weiß, mit Sternenmuster – und ist zugedeckt, die Arme liegen ausgestreckt an den Seiten, was unnatürlich wirkt. Mit einem Mal wird mir übel, dabei habe ich auf der Intensivstation schon alles gesehen, was es zu sehen gibt. Diese Patientin sollte mir nicht stärker zusetzen als andere, die hierhergebracht werden, doch sie tut es, und das aus verschiedenen Gründen.
»Glaubst du, dass sie es schafft?«, frage ich Bridget.
»Wer weiß?« Vor ihrer Antwort hat Bridget sich umgeblickt, um sich zu vergewissern, dass wir allein sind. Für das Pflegepersonal steht die Hoffnung an erster Stelle. Wir müssen davon ausgehen, dass unsere Patientinnen überleben werden, auch wenn die Chancen bei jemandem wie Caitlin eher schlecht stehen. Die meisten in diesem Zustand schaffen es nicht. Und selbst wenn, sind die Aussichten, wieder ein gutes Leben führen zu können, minimal.
»Sind Angehörige von ihr da?«, frage ich und vertraue darauf, dass Caitlin entweder stirbt oder, falls sie aus dem Koma erwacht, nur noch eine leere Hülle sein wird.
»Noch nicht. Die nächsten Verwandten werden noch gesucht.«
Durch die Glasscheibe starre ich auf das, was von Caitlins Gesicht erkennbar ist. Im Schlaf wirkt sie friedlich, doch das ist ein Trugschluss. Das Kopfteil des Betts ist hochgekurbelt, damit ihr Kopf und ihr Oberkörper leicht aufgerichtet sind. Ihr Kopf dürfte vor der Kraniektomie geschoren worden sein, zumindest teilweise. Ich stelle mir Caitlin kahl vor. Ihre Lippen schließen sich um den Trachealtubus, der die Atemwege offen hält, damit die Luft aus dem Beatmungsgerät in Caitlins Lunge gelangt. An den Stellen, an denen ihr Gesicht nicht zerschunden ist, ist es wächsern und bleich. Ihre Verletzungen sind schwerwiegend. Es wurde von einer gebrochenen Hüfte, einem gebrochenen Bein, gebrochenen Armen und Rippen gesprochen.
»Sie ist hübsch, nicht?«, sagt Bridget.
Ich runzele die Stirn. »Wie kommst du darauf?« Man erkennt doch nichts. Woher will Bridget wissen, wie Caitlin unter den Schwellungen, Blutergüssen und dem Verband aussieht?
»Weiß nicht«, sagt sie. »Ich sehe es eben. Es ist furchtbar, was passiert ist.«
Ich schlucke, was nicht ganz einfach ist, mein Speichel ist dickflüssig und zieht Fäden. »Tragisch.«
»Warum tut jemand so etwas?« Ich kann nicht fassen, dass Bridget diese Frage ausgerechnet mir stellt. Aber sie kennt ja meine Geschichte nicht, weiß nicht, was zuvor geschehen ist. Weiß nicht, wie sehr mich das aufregt.
Da ich nicht schnell genug antworte, spricht sie weiter. »Ich meine, wer springt von einer Brücke, um sich das Leben zu nehmen?«
Die Vorstellung lässt mich schaudern. Ich schüttle den Kopf, spüre Bridgets Blick, mit dem sie in meiner Miene forscht, spüre, wie die Röte in meine Wangen und Ohren kriecht. »Keine Ahnung.«
»Warum auf diese Weise, obwohl es so viele andere Möglichkeiten gibt?«, fragt Bridget. Ich wünschte, sie würde das Thema fallenlassen, doch das tut sie nicht. Leise, damit uns niemand hört, sagt sie: »Was ist mit Kohlenmonoxid oder einer tödlichen Dosis Morphium? Wäre das nicht einfacher, weniger schmerzhaft?«
Sie ist nicht mit Absicht gefühllos. Nicht jeder weiß, was ein Selbstmord in mir auslöst.
Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Ich sage nichts, habe auf Bridgets Frage keine Antwort, muss nur immerzu daran denken, wie dieser Sturz wohl für Caitlin gewesen ist – der Aufschlag von der hohen Brücke auf der Erde. Mit einem Mal habe ich einen metallischen Geschmack im Mund. Ich drücke mir eine Hand auf die Lippen, will, dass der Geschmack vergeht. Ich frage mich, ob sie im Fallen das Bewusstsein verloren oder den Aufprall noch mitbekommen hat. Hat sie gespürt, wie ihr der Magen in die Brust gerutscht ist, die Organe Karussell gefahren sind, oder hat sie nur den aberwitzigen Schmerz empfunden, als sie auf die Erde knallte?
Bridget entschuldigt sich und schlüpft durch die Tür zurück zu ihrer Patientin. Ich verharre noch einen Moment und beobachte, wie sie Caitlins Hände beinahe liebevoll auf ihren Bauch legt, die Finger ausstreckt und ihre Hand darauf ruhen lässt. Sie beugt sich über Caitlin, und ich lese von ihren Lippen ab, dass sie fragt: »Was hast du gemacht, Kleine? Was hast du gemacht?«
Und ich kann nur denken: Ein Wunder, dass sie so lange überlebt hat.
Kapitel 2
Neunzehn Uhr ist meine Schicht zu Ende. Ich verlasse das Krankenhaus und wende mich nach Osten, laufe über die Wellington Avenue zur Halsted Street. Wie immer versuche ich, die Schicksale der Patienten auf dem Heimweg hinter mir zu lassen, sie nicht mit nach Hause zu nehmen. Das ist leichter gesagt als getan. Ganz gleich, wie gern ich sie abschütteln würde, sie lassen mich nicht los. Als Pflegepersonal sind wir angehalten, Distanz zu wahren, Berufsleben und Privatleben zu trennen, so wie man Medikamente in einen Tablettendosierer sortiert. Diese Einstellung wird uns bereits während der Ausbildung eingetrichtert, aber so einfach ist das nicht, man kann es nicht lehren. Wie soll man jemanden versorgen, ihn betreuen können, ohne dabei mitfühlend zu sein? Doch Mitgefühl führe zu Burnout, heißt es – ein Mantra, das von der Angst der Krankenhäuser zeugt, irgendwann würden alle Pflegekräfte ihren Beruf an den Nagel hängen, weil sie mit der Belastung nicht mehr zurechtkommen. Aber wir sind von Natur aus teilnahmsvoll, und Anteilnahme ist das genaue Gegenteil von Distanziertheit.
Die Sonne ist vor Stunden untergegangen. In dieser Jahreszeit wird es schnell und früh dunkel. An den Tagen, an denen ich einen längeren Dienst als heute habe, bekomme ich die Sonne nur selten zu Gesicht. Wenn ich das Haus morgens verlasse, ist es dunkel, wenn ich abends zurückkehre, genauso.
Auf dem Weg schreibe ich Sienna, um sie daran zu erinnern, dass ich heute später heimkomme. Sie antwortet mit einem knappen »Kay«. Ich frage, ob sie die Wohnungstür hinter sich zugezogen hat, sie schreibt »ja«. Seit einigen Tagen schnappt die Verriegelung der Tür nicht mehr richtig ein, springt manchmal wieder auf, und man muss sich vergewissern, dass die Tür zu ist.
Damit könnte ich vielleicht noch leben, hätte es in letzter Zeit in unserem Viertel nicht mehrere Einbrüche und Überfälle gegeben. Überhaupt hat die Kriminalität in der Stadt zugenommen: Autodiebstähle, bewaffnete Raubüberfälle. Vor ein paar Tagen ist ein Mann einer Frau auf der Fremont Street bis nach Hause gefolgt. Im Treppenhaus hat er sie angegriffen, ihr Nase und Arm gebrochen und die Handtasche entrissen. Sie kann froh sein, dass er sie nicht umgebracht hat.
Noch immer sucht die Polizei nach dem Täter, was mich hypernervös macht, schließlich läuft er noch frei herum, und wer weiß, ob seine Beute ihm vorerst genügt oder er bereits auf der Jagd nach dem nächsten Opfer ist. Allein der Gedanke, dass er wieder suchend umherstreunt, hat das Zeug, mir den Schlaf zu rauben, zumal die Fremont nur zwei Blocks von uns entfernt liegt. Zweimal habe ich den Vermieter schon gebeten, das Schloss an unserer Wohnungstür reparieren zu lassen. Zweimal hat er es versprochen, und dann ist doch nichts passiert.
»Hast du die Tür auch abgeschlossen?«, texte ich Sienna.
»Ja«, antwortet sie. Am liebsten würde ich fragen, ob sie ganz sicher sei, und sie bitten, noch einmal nachzusehen, doch dann würde ich paranoid klingen oder Sienna Angst machen, also lasse ich es bleiben.
»Bis später«, schreibe ich und stecke mein Handy ein. Auf der Halsted geht es geschäftig zu, überall sind Menschen auf dem Heimweg, zahllose Stimmen, die mit dem Lärm vorbeifahrender Autos zu einem Summen verschmelzen, als wäre die Luft elektrisiert.
Plötzlich fängt es an zu schneien, dicke, große Schneeflocken rieseln herab. Wahrscheinlich ist es deshalb nicht so kalt wie an den vergangenen Tagen. Ich ziehe meine Kapuze über den Kopf, drücke mein Kinn tiefer in den Jackenkragen, stecke die Hände in die Jackentaschen und lege einen Schritt zu.
Wie ehrwürdig und majestätisch die Kirche Our Lady of Mount Carmel im Schneegestöber wirkt, wie aus einem Thomas-Kinkade-Gemälde. Ich lasse den 77er-Bus vorbeifahren, überquere die Belmont Avenue zur Kirche, ein Gebäude im Tudor-Stil mit Ecktürmen und einer breiten Steintreppe. Drei schwere Spitzbogentüren werden von Buntglasfenstern flankiert. Der Kirche schließt sich eine katholische Schule an, beide zusammen beanspruchen fast einen ganzen Straßenabschnitt.
Ich steige die Treppe hinauf und bin froh, den Lärm der Stadt in der Vorhalle hinter mir zu lassen. Hier ist es ruhig und warm, das Licht gedämpft, die Atmosphäre still und weihevoll. Eine weitere Tür führt in das Kirchenschiff, an dessen schönen Buntglasfenstern ich mich kaum sattsehen kann.
Es ist noch jemand in der Vorhalle: eine schick gekleidete Frau in weißer, dreiviertellanger Winterjacke und mit schwarzer Mütze. Ich hingegen trage unter meiner Jacke noch meine schiefergraue Berufskleidung und Turnschuhe. Die Sachen sind bequem, aber modisch geht anders. Wahrscheinlich regt Sienna sich wieder auf, wenn sie nachher sieht, dass ich so draußen herumgelaufen bin.
»Haben Sie sich verirrt?«, frage ich die Frau und trete auf der Fußmatte meine nassen Schuhe ab.
Sie dreht sich um. Ich schätze, sie ist in meinem Alter, vielleicht etwas jünger, brünett, mit dunklen Augen und olivfarbenem Teint, der sich hübsch von der weißen Jacke abhebt. Die engen Hosenbeine der Jeans stecken in schweren Winterstiefeln, mit Gummisohlen und einem flauschigen Besatz um die Ränder. Das ist etwas anderes als meine Turnschuhe, die, falls noch mehr Schnee fällt, durchweicht sein werden, wenn ich zu Hause bin.
Die Frau lacht auf, ein nervöses Lachen, eigentlich mehr ein Kichern. »Wahrscheinlich«, sagt sie und blickt sich suchend um, doch in der Vorhalle gibt es weder eine Auskunft noch Hinweisschilder. »Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin.«
»Möchten Sie zu der Selbsthilfegruppe der Geschiedenen?«
Wieder dieses nervöse Lachen, diesmal klingt es, als würde sie über sich selbst lachen. »Ist es so offensichtlich?«
»Ganz und gar nicht«, versichere ich ihr. »Ich bin auch auf dem Weg dorthin, und soweit ich weiß, gibt es heute Abend keine anderen Treffen. In der Regel sind nur wir hier. Sie brauchen nicht nervös zu sein.« Ich hoffe, ich trete ihr nicht zu nahe und habe ihr Lachen und ihre Körpersprache richtig interpretiert. »Aber nervös sein ist okay. Beim ersten Mal sind alle ein wenig angespannt, selbst wenn es gar nicht nötig ist. Ich bin übrigens Meghan.« Ich trete auf die Frau zu und strecke meine Hand aus. Sie ergreift sie, und ich wundere mich, wie warm ihre Hand trotz des Wetters draußen ist, aber wer weiß, seit wann sie schon hier steht und auf jemanden wartet, der ihr weiterhilft. »Meghan Michaels.« Ich lasse ihre Hand los.
Die Frau legt den Kopf schief und zieht die Augenbrauen zusammen, als müsse sie nachdenken. Dann werden ihre Augen groß. »Meghan Michaels? Barrington Highschool, Jahrgang 2002?«, fragt sie.
Ich deute ein Nicken an. Mein Gehirn beginnt zu arbeiten, versucht Verbindungen zu dieser Frau herzustellen. Ich war tatsächlich auf dieser Highschool, doch das ist lange her. Sie liegt in Barrington, einem Ort nördlich von Chicago, etwa eine Stunde von meiner derzeitigen Wohnung entfernt. Ein Jahr nach meinem Abschluss sind meine Eltern und ich von dort weggezogen, und ich bin selten zurückgekehrt. Auch den Kontakt mit meinen Schulfreunden habe ich nicht gepflegt.
»Du bist es wirklich«, sagt sie, als könne sie die Ähnlichkeit zwischen meinem jetzigen und früheren Aussehen nun ohne jeden Zweifel erkennen. »Ich bin’s.« Sie legt sich eine Hand auf die Brust. »Nat Cohen. Natalie. Wir waren auf derselben Schule.«
»O Gott«, sage ich freudig überrascht. Natalie Cohen. Nat. Den Namen habe ich seit über zwanzig Jahren nicht mehr gehört. Nat sieht anders aus als früher, aber nach so langer Zeit tun wir das wohl alle. Ihr Gesicht ist schmaler geworden, das Haar, das unter der Mütze hervorkommt, ist länger, als ich es in Erinnerung habe. Ich kannte sie nur mit einem kurzen, gerade geschnittenen Bob und frage mich, wann sie sich für die neue Frisur entschieden hat, die ihr aber hervorragend steht. Überhaupt sieht sie großartig aus. Zwar war sie schon während unserer Schulzeit attraktiv, doch damals hatte sie etwas Burschikoses, das nun verschwunden ist. Sie ist unglaublich gut gealtert. Im Gegensatz zu meinem ist ihr Gesicht faltenfrei, und einen Moment lang überlege ich, ob sie vielleicht mit Botox nachgeholfen hat oder einfach mit guten Genen gesegnet ist. Wir waren in derselben Abschlussklasse, haben zusammen Tennis gespielt, sie sehr viel besser als ich.
Ich umarme sie und genieße das Gefühl, jemanden aus meiner Vergangenheit an mich zu drücken. Wahrscheinlich halte ich Nat deshalb viel zu lange fest. Bilder aus der Schulzeit tauchen vor meinem inneren Auge auf, und ich werde nostalgisch. Es war eine einfachere und glücklichere Zeit als heute. Ich löse mich von Nat. »Ich kann nicht glauben, dass du es bist. Wie geht es dir? Wo wohnst du? Spielst du noch Tennis?« Die Fragen sprudeln aus mir heraus. Ich möchte noch mehr fragen, aber wie soll man zwanzig Jahre zusammenfassen, erst recht vor einem Treffen, das in wenigen Minuten beginnt?
»Mir ist es schon mal besser gegangen«, sagt Nat.
»O Gott, ja natürlich. Das war eine blöde Frage.« Wie unsensibel von mir, schließlich sind wir auf dem Weg zur Gruppe der Geschiedenen, und keiner von uns geht es blendend. Stattdessen befinden wir uns in einem Schwebezustand und versuchen, Wege zu finden, um mit unserem Leben weiterzumachen und wieder glücklich zu werden.
»Du hast dein Haar wachsen lassen.« Es reicht bis zu ihrem Schlüsselbein. »Sieht toll aus. Passt zu dir.«
»Danke«, sagt sie. »Den alten, zotteligen Bob wollte ich nicht mehr.«
»Du siehst fabelhaft aus. Wirklich. Seit wann stehst du hier schon?«
»Seit zehn oder fünfzehn Minuten.« Inzwischen wirkt Nat um einiges entspannter. »Ich weiß nur nicht so recht, was ich hier tue. Ob ich hier sein will.«
»Verständlich. Die Frage stellen sich wahrscheinlich alle. Ich bin beim ersten Mal nicht einmal bis hierhergekommen, habe es nur bis zur Kirche geschafft. Als ich davorstand, habe ich kalte Füße gekriegt und bin wieder nach Hause gegangen. Ich war mir sicher, dass die Gruppe fürchterlich ist und es zwischen den anderen und mir außer der Scheidung keine Gemeinsamkeiten geben würde. Ein paar Wochen später war ich wieder hier und bin geblieben. Es gefällt mir, ich mag die Leute. Keiner von ihnen ist fürchterlich, alle sind nett und freundlich. Ich glaube, du wirst sie auch mögen. Komm, es geht hier lang.« Ich wende mich der Treppe zu, die nach unten führt. »Danach können wir uns auf den neuesten Stand bringen, da haben wir mehr Zeit. Es gibt so vieles, was ich dich fragen möchte.«
Hinter uns öffnet sich eine der schweren Eingangstüren. Der Lärm der Stadt ergießt sich in die Stille. Ich drehe mich um. Lewis ist da, einer der anderen aus der Gruppe. Aus dem Augenwinkel bekomme ich mit, wie Nat bei dem anbrandenden Lärm zusammenzuckt, eine Reaktion, die ich übertrieben finde. Ich schaue sie verwundert an, doch sie fixiert Lewis, der auf der Fußmatte steht und mit den Füßen stampft, um den Schnee an seinen Stiefeln loszuwerden. Dann streift er seine Kapuze ab, und Nat sieht sein rundes Babyface und den sanftmütigen Blick, der im Kontrast zu seinem bulligen Äußeren steht. Ihre Schultern lockern sich, die Hände, die sie zu Fäusten geballt hatte, öffnen sich. Warum hat er ihr Angst gemacht?
Lewis versucht immer noch, den Schnee von den Stiefeln zu stampfen. In der Vorhersage hieß es, es könnten zehn Zentimeter fallen, aber auf so etwas ist nie Verlass. Es könnten auch nur zwei Zentimeter sein.
»Super Wetter«, sagt Lewis, als er an uns vorbeigeht. Vielleicht ist es spöttisch gemeint, obwohl der erste Schnee für mich immer etwas Magisches hat.
Lewis nimmt die Treppe nach unten und verschwindet. »Das war Lewis«, erkläre ich Nat. »Ein sehr lieber Mensch. Als er eine hochdotierte Managementposition aufgegeben hat, um einen Job zu übernehmen, der für ihn erfüllender ist, hat seine Frau ihn für einen anderen verlassen. Offenbar hat sie sein Geld mehr geliebt als ihn.« Ich deute mit dem Kopf auf die Treppe. »Was meinst du, willst du es versuchen? Du musst auch nichts sagen. Wenn du nur zuhören willst, ist es vollkommen okay.«
Faye, unsere Gruppenleiterin, ist Psychotherapeutin und wie wir anderen auch geschieden. Ihre Devise lautet, dass unsere Treffen einen sicheren Ort darstellen, an dem wir einander zuhören, unterstützen und Kraft geben und an dem sich Geschiedene weniger allein fühlen sollen.
Doch als ich das erste Mal hier war, wusste ich nicht, ob ich den anderen von mir erzählen wollte. Eigentlich hatte ich vor, den Leuten in der Gruppe zuzuhören und sie zu beobachten. Ich erinnere mich, wie ich auf meinem Stuhl saß und in den Kreis der Gesichter ringsum blickte, die freundlich, offen und einladend wirkten. Meine Anspannung legte sich, und als Faye fragte, ob jemand seine Geschichte mit der Gruppe teilen wolle, hob ich ganz automatisch die Hand.
»Ich bin geschieden«, sagte ich, hörte das leichte Zittern meiner Stimme und fragte mich, ob die Gruppe es ebenfalls wahrgenommen hatte. »Aber das könnt ihr euch sicherlich denken, sonst wäre ich ja nicht hier.« Ich lachte über mich selbst. Auch andere lachten – mit mir, nicht über mich –, und das fand ich ermutigend. Danach sprach ich freier und erklärte, dass ich die Scheidung vor Monaten eingereicht hatte. »Zu sagen, dass ich eine harte Zeit hinter mir habe, wäre reichlich untertrieben, dabei war ich diejenige, die gegangen ist. In gewisser Weise habe ich es mir also selbst zuzuschreiben.« Ich holte Luft, stellte fest, dass meine Stimme nicht mehr zitterte. »Ich kenne keine anderen Geschiedenen, ich glaube, das macht es für mich so schwer. Was eigentlich merkwürdig ist, schließlich werden in unserem Land fünfzig Prozent aller Ehen geschieden, oder? Wie kann es sein, dass die Leute, die ich kenne, davon ausgenommen sind? Es fühlt sich an, als wäre ich nicht normal. Niemand in meinem Bekanntenkreis kann aus eigener Erfahrung nachvollziehen, was ich durchmache. Ich habe wundervolle Freunde, sie fühlen ehrlich mit mir mit, aber ich merke, wie ich mich von ihnen entferne. Wir haben einfach keine Gemeinsamkeiten mehr. Ich muss mich mit so vielem herumschlagen, ein Kind allein großziehen, Sorgerecht und Besuchsrecht regeln, Testament und Namen ändern lassen, das gemeinsame Konto auflösen, meine Kreditwürdigkeit aufbauen – denn alles, was uns gehörte, lief auf Bens Namen, und wie soll nun jemand meine Bonität bewerten können?«
An dem Punkt hielt ich verlegen inne. Ich hatte mehr als geplant von mir preisgegeben. Doch es hatte etwas Befreiendes gehabt. »Entschuldigung, ich habe zu viel geredet.«
»Nein«, sagte Faye, »du musst dich nicht entschuldigen. Tu das nie, Meghan. Wir sind hier, um einander zuzuhören und beizustehen. Jeder in diesem Raum muss mit den gleichen Problemen wie du fertigwerden.«
Alle nickten.
Dann bat Faye mich, der Gruppe etwas über meinen Ex-Mann zu erzählen. Aber wie sollte ich Ben beschreiben? Wir waren auf derselben Schule. Ich hatte ihn einfach umwerfend gefunden. Karriere, Kinder, all das war anfangs ewig weit entfernt, hatte mit uns nichts zu tun, nicht einmal in unseren wildesten Träumen. Und dann, zwanzig Jahre später, waren wir verheiratet, keiner von uns war glücklich, und damit auch Sienna nicht. Ständig gerieten Ben und ich uns in die Haare. Nur seine Arbeit schien für ihn eine Rolle zu spielen, und als ich ihn bat, sich auch seiner Familie zu widmen, warf er mir vor, ich sei rücksichtlos, würde weder ihn noch seine Karriere unterstützen, obwohl das nicht zutraf und auch nicht das Thema gewesen war. Ich wollte bloß, dass er Sienna und mir mehr Aufmerksamkeit schenkte. Und dann dachte ich immer öfter, dass es mir ohne Ben besser gehen und ich lieber eine alleinstehende Mutter als eine vernachlässigte und unverstandene Ehefrau sein würde. Nur die Angst vor dem Ungewissen hielt mich davon ab, Ben zu verlassen. Schließlich tat ich es für Sienna. Sie sollte nicht denken, jede Ehe müsse so wie unsere sein, sondern erkennen können, dass es auch andere Beziehungen gab, voller Liebe, Glück und gegenseitigem Respekt.
Noch einmal wende ich mich Nat zu. »Bevor ich hierhergekommen bin, konnte ich mir kaum etwas Schlimmeres vorstellen, als einen Raum voll fremder Menschen zu betreten und mit ihnen über eine meiner schmerzhaftesten Erfahrungen zu sprechen. Aber noch schlimmer ist das Gefühl, dass man mit dieser Erfahrung allein ist.« Ich warte einen Moment, um die Worte auf Nat wirken zu lassen. Wieder deute ich auf die Treppe. »Na, was sagst du?«
»Also gut«, sagt Nat.
Wir gehen die Treppe hinunter in den Gemeindesaal. Die runden Tische sind an die Wände geschoben worden, in einem Kreis in der Mitte sitzt die Gruppe auf schwarzen Klappstühlen. Faye hat schon angefangen. Nat und ich lassen uns auf den letzten freien Plätzen nieder, die einander gegenüberliegen. Nat windet sich aus ihrer Jacke heraus und hängt sie über die Stuhllehne. Während des Treffens schweigt sie, hört nur zu. Ich kann es ihr nicht verdenken.
Irgendwann streift Nat ihre Mütze ab. Als sie mit den Fingern durch ihr Haar fährt und sich Strähnen aus den Augen wischt, fällt mein Blick auf ihre Stirn und den Bluterguss direkt unter ihrem Haaransatz. Ich muss zweimal hinschauen, kann nicht fassen, wie groß dieses Hämatom ist und so leuchtend rot, als wäre es noch ganz frisch. Also muss es gerade erst zu der Verletzung gekommen sein, vielleicht heute. Ich starre zu lange auf den Fleck, überlege, wie er entstanden sein könnte. Dann fällt mir ein, wie ungeschickt ich bin, ständig stoße ich mich irgendwo. Vielleicht steckt auch bei Nat nicht mehr dahinter.
Oder doch?
Unsere Blicke treffen sich. Ich lächle betreten. Wie peinlich, dass Nat gesehen hat, wie ich sie anstarre. Ihre Hand fährt zu dem Bluterguss. Sie betastet ihn, zieht Haarsträhnen darüber, doch das scheint ihr nicht zu genügen, also setzt sie die Mütze wieder auf.
Ich schaue zur Seite, versuche demjenigen, der spricht, zuzuhören. Doch ein ums andere Mal kehrt mein Blick zu Nat zurück, deren Bluterguss unter der Mütze verschwunden ist und den ich nicht vergessen kann.
Dann ist das Treffen zu Ende. Ich greife nach meiner Jacke und will zu Nat, doch eine Frau namens Melinda fängt mich ab. »Hast du einen Moment?« Ohne meine Antwort abzuwarten, spricht sie weiter. Nat wirft mir einen kurzen Blick zu, schlüpft in ihre Jacke und steuert die Treppe an. »Es geht um die Schule, in der deine Tochter ist«, sagt Melinda. »Mich interessiert der Aufnahmeprozess, insbesondere die Aufnahmeprüfung. Meine älteste Tochter kommt bald auf die Highschool, und wir sind dabei, uns die Privatschulen unserer Gegend anzusehen, was uns, gelinde gesagt, leicht überfordert.«
Als ich es endlich nach oben schaffe, steht Nat schon am Ausgang. Ich kann nur noch zusehen, wie sie eine der schweren Holztüren aufstößt und der Wind den Schnee von der Seite in die Vorhalle treibt. Nat verharrt kurz, man könnte meinen, sie prüfe die Gesichter der Passanten auf dem Bürgersteig. Dann zieht sie ihre Kapuze über den Kopf und tritt durch die Tür. Noch bevor diese sich langsam hinter ihr schließt, ist Nat schon die Treppe hinuntergelaufen und verschwindet zwischen den Menschen, die unten vorbeigehen.
Ich verlasse die Kirche als Letzte. Draußen schlägt mir die Kälte entgegen, der Schnee weht mir ins Gesicht, und mein Atem bildet Dampfwolken. Ich frage mich, ob ich Nat wiederbegegne und sie auch zu den nächsten Treffen kommt.
Dann denke ich über ihren Bluterguss nach oder vielmehr über die Eile, mit der Nat ihn verdeckt hat. Ich mache mir Sorgen um sie, frage mich, wohin sie an diesem Abend geht und zu wem.
Während des Treffens hat sich auf Bürgersteig und Straße eine dicke Schneeschicht gebildet, Busse und Autos fahren langsamer. Für die Nacht wird es auf einigen Straßen ein Parkverbot geben, die Schneepflüge müssen dort ungehindert räumen können, bevor am Morgen der Stoßverkehr beginnt.
Ich fahre mit der Hochbahn nach Hause, nehme die Red Line Richtung Norden. Es ist kurz vor neun, zu der Zeit bin ich nicht mehr gern unterwegs, mag es auch nicht, dass Sienna dann allein in der Wohnung ist. Früher hatte ich in dieser Stadt keine Angst, das hat erst mit der jüngsten Welle von Raubüberfällen begonnen, die nicht nur mich, sondern unser ganzes Viertel in Unruhe versetzen.
An der Station Sheridan steige ich aus und laufe los. Ich will nur noch nach Hause kommen und mich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass unsere Wohnungstür verschlossen und Sienna gesund und munter ist.
Kapitel 3
Am nächsten Tag melde ich mich vor Schichtbeginn bei der Stationsleiterin, die das Pflegepersonal einteilt. Sie weist mir zwei Patientinnen zu, eine von ihnen ist Caitlin Beckett, die Frau, die, wie es heißt, von einer Fußgängerbrücke gesprungen ist. Mein Magen zieht sich zusammen, ich hatte gehofft, dieselben Patienten wie am Vortag zu bekommen, doch ich stimme zu. Bridget hat heute frei, sonst könnte ich anmerken, dass es besser wäre, wenn Caitlin bei der gleichen Pflegerin bleibt, aber nun geht das leider nicht.
Im Pausenraum packe ich meine Sachen in einen Spind und gehe zu Caitlins Krankenzimmer. Noch immer liegt sie bewusstlos im Bett, und ich muss an mich halten, um nicht die Fassung zu verlieren.
Die Glastüren öffnen sich, ich trete hindurch. An Caitlins Bett bleibe ich stehen, lasse meinen Blick über sie wandern, starre sie an. Bridget hat recht, trotz des Kopfverbands und der Schläuche sieht man, dass sie hübsch ist. Sie regt sich nicht, und ihre Haut ist bleich; wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, dass sie tot ist. Ohne die Geräte und Infusionen, die sie am Leben halten, wäre sie das ja auch.
Im Pausenraum haben die Pflegekräfte wieder über sie getratscht, überlegt, warum sie gesprungen ist. Dabei sollen wir nicht über die Patienten reden. Doch es entlastet uns, baut nach einem langen Arbeitstag Stress ab oder wappnet uns für eine neue Runde.
Misty hat gehört, dass Caitlin die Bahngleise beim Aufprall knapp verfehlt habe. Sie sei zwischen zwei Bahnlinien auf dem Schotterbett aufgeschlagen. »Wisst ihr, wie oft dort Züge fahren?«, fragte sie. Wahrscheinlich wollte sie damit sagen, dass Caitlin, wäre sie auf die Gleise gestürzt, von einem Zug erfasst worden und nicht mehr bei uns, sondern im Leichenschauhaus wäre.
»Züge können nicht so schnell bremsen«, fuhr sie fort. »Nicht einmal im Notfall. Ich hab gehört, dass der Bremsweg länger als eine Meile sein kann. Hängt vom Gewicht des Zugs und der Geschwindigkeit ab.«
»Dann hat sie Glück gehabt, neben den Gleisen gelandet zu sein«, entgegnete Natalia.
»Glück?«, fragte Misty ungläubig. Sicherlich dachte sie an die Langzeitfolgen eines Schädel-Hirn-Traumas, die tiefgreifenden Beeinträchtigungen, zu denen unter anderem Sehstörungen, Denk- und Gedächtnisstörungen und Schwierigkeiten bei der Grob- und Feinmotorik gehören. »Wie kannst du so etwas sagen? Hast du die Patientin nicht gesehen?« Natürlich hatte Natalia Caitlin gesehen, wir alle hatten durch die Glastüren einen Blick auf sie geworfen.
»Wenn sie wirklich hätte sterben wollen, hätte sie sich eine andere Brücke ausgesucht. Eine über einer verkehrsreichen Straße. Stell dir vor, du wärst der Bus- oder Autofahrer gewesen, der sie dann überfahren hätte«, sagte Misty.
Ich saß mit dem Rücken zu der Gruppe auf einer Bank, wollte zu dem Gespräch nichts beitragen, was aber nicht bedeutete, dass es mich nicht interessierte. Ich wollte hören, was andere über Caitlin zu sagen hatten.
Das Ganze spielte sich vor sieben Uhr morgens kurz vor dem Schichtwechsel ab, der Pausenraum war also voller als während der Schichten.
»Du weißt, dass du gleich jemanden überfährst, kannst dabei regelrecht zusehen, aber nichts mehr dagegen unternehmen.«
Erin erzählte von ihrem Onkel, der Güterzüge fuhr. »Vor ein paar Jahren hat eine Frau auf seiner Strecke Selbstmord begangen.« Sie schilderte, wie sich die Blicke der beiden vor dem Zusammenstoß noch getroffen hatten, der Onkel die Notbremse zog und dann schreckliche, endlos lange Sekunden bis zum Stillstand des Zugs warten musste, in den Ohren das Kreischen des dreieinhalbtausend Tonnen schweren Kolosses, der versuchte, anzuhalten. Und so geschah das Unausweichliche. Die Frau verschwand irgendwo unter ihm, und als der Zug endlich stand, musste der Onkel nach ihr suchen.
Ich war mir nicht sicher, ob ich den Rest der Geschichte hören wollte. Doch Erin sprach bereits weiter. »Wenn ein Zug einen Menschen überfährt, gibt es zwei Möglichkeiten: Er wird entweder zur Seite geschleudert und erleidet schwere innere Verletzungen, denen er aller Voraussicht nach erliegt. Oder er gerät unter die Räder und wird zerstückelt.« Sie ließ eine Kunstpause entstehen. »Das war bei der Frau unter dem Güterzug meines Onkels der Fall.« Dass ihr Onkel so etwas hatte erleben müssen, schien sie fassungslos zu machen. »Das war vor sechs Jahren, und er hat noch immer Albträume.«
»Grundgütiger«, sagte Misty. »Wie furchtbar. Obwohl es nicht seine Schuld war, wird er sich sein Leben lang Vorwürfe machen.«
Ich konnte mir das nicht länger anhören, stand auf und verließ den Pausenraum.
Mein Freund Luke folgte mir. »Wie schön, dass sie wieder was zu tratschen haben«, sagte er. Ich lächelte. Von dem ganzen Pflegepersonal tickt Luke am ehesten so wie ich, was wahrscheinlich an unserem Alter liegt. Wir sind zehn beziehungsweise fünfzehn Jahre älter als der Großteil der Pfleger und Krankenschwestern, von denen etliche ihre Ausbildung erst vor Kurzem abgeschlossen haben. Wir liefen den Flur hinunter. »Geht’s dir gut?«
Ich runzelte die Stirn. »Ja. Warum fragst du?«
»Du bist so still«, erwiderte er, und ich spürte seinen Blick.
»Bin ich das?« Dabei hatte ich mich so sehr bemüht, ganz normal zu wirken.
»Ja«, sagte Luke. Dann etwas leiser: »Und gestern bist du zu spät gekommen.«
»Aber nur, weil ich einen Arzttermin hatte«, erwiderte ich, obwohl Luke weiß, dass ich solche Termine normalerweise nicht in die Arbeitszeit lege. Doch zum Glück ließ er es dabei bewenden.
Nein, doch nicht ganz, er hatte noch mehr auf dem Herzen: »Gestern hast du deinen Ehering getragen.« Damit hatte ich nicht gerechnet. Erwischt. Schuldbewusst errötete ich. Der Gedanke, dass es jemandem auffallen könnte, war mir dummerweise nicht gekommen. »Natürlich geht es mich nichts an«, fuhr Luke fort, »aber …« Er zögerte, wollte mir nicht zu nahetreten. »Bist du wieder mit Ben zusammen?«
»Um Himmels willen, nein. Es ist nur …« Ich suchte nach den richtigen Worten. »Die Macht der Gewohnheit«, war das, was mir einfiel. Ich hätte den Ring nicht anstecken dürfen, was hatte ich mir bloß dabei gedacht? Zumal er sich nach den vielen Monaten ganz fremd an meinem Finger angefühlt hatte. Da Sienna nichts davon mitbekommen sollte, hatte ich ihn zu Hause sofort abgenommen und in meiner Schmuckschatulle verstaut.
»Okay«, sagte Luke. »Das verstehe ich. Wie geht es Sienna?« Ich war froh, dass er das Thema wechselte. Überhaupt finde ich es nett, dass er sich so oft nach meiner Tochter erkundigt, fragt, wie es ihr geht, wie es in der Schule läuft, ob ich ihre Freunde mag.
»Alles bestens.«
»Oh, was ich noch fragen wollte. Wie war dein Date?«
Es dauerte einen Moment, bis mein Gehirn umschaltete. Mein Date. Das hatte ich fast schon vergessen. Mir war, als wäre seitdem eine Ewigkeit vergangen, doch das belanglose Thema und die ganz normale Frage waren mir mehr als recht.
Tatsächlich war ich erst vor ein paar Tagen auf dem Date gewesen, dem ersten Date nach meiner Scheidung. Sein Name war Alec.
Ich lernte ihn auf einer Dating-App kennen, auf der ich mich vor einigen Monaten – wenn auch widerstrebend – angemeldet hatte. Luke und andere aus meinem Kollegenkreis hatten mich dazu überredet, doch ich traute der Sache nicht. Aber dann sagte ich mir, dass Sienna älter und jeden Tag ein wenig selbstständiger wurde. Dass sie bald aufs College gehen würde und ich für den Rest meines Lebens allein sein könnte. Ein weiterer Gedanke, der mich nachts wachhielt.
Auch Ben trifft sich wieder mit jemandem. Sienna hat mir von dieser Frau erzählt, und seitdem geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht gab das sogar den Ausschlag für mein eigenes Date. Ich wählte ein Kleid, das ich seit Jahren nicht mehr getragen hatte – ein sexy Teil mit geraffter Taille und tiefem V-Ausschnitt –, und stellte mir vor, wie gut es sich anfühlen würde, wenn ein Mann mich berühren und seine Hand unter den kurzen Rock des Kleides schieben würde, sein Blick voller Verlangen.
Aber es fühlte sich nicht gut an, sondern seltsam und unangenehm, und nun, einige Tage später, war das Ganze so unbedeutend, dass ich Alec bereits vergessen hatte.
»Nichts Besonderes.« Ich zuckte mit den Schultern.
»Mehr nicht?«
»Nein. Hat nicht gefunkt. War peinlich.«
»Ach, das tut mir leid. Sein Pech. Dann klappt es eben beim Nächsten.«
Ich war mir nicht sicher, ob es einen Nächsten geben würde.
Die Nachtschwester betritt Caitlins Krankenzimmer und macht mit mir die Übergabe. Wir stehen an Caitlins Bett, sie nennt Caitlins Vitalwerte, beschreibt ihren Zustand und die Vorgeschichte, zählt die Medikamente auf, die Caitlin bekommt. Das Koma ist unverändert, weder leichter noch schwerer als am Vortag. Auf Außenreize reagiert Caitlin nicht, was für jemanden in ihrer Verfassung nichts Ungewöhnliches ist. Patienten wie sie können sich auf unterschiedlichen Bewusstseinsebenen befinden. Die einen sind bei minimalem Bewusstsein, andere im komatösen Zustand. Vielleicht zucken sie, wenn wir ihnen Blut abnehmen, oder sie knirschen mit den Zähnen, wälzen sich im Bett hin und her, machen andere unwillkürliche Bewegungen. Caitlin tut nichts dergleichen. Sie kann nichts selbstständig, nicht einmal atmen.
Irgendwann nach meiner Schicht gestern hat man Caitlins Eltern benachrichtigt. Ich entdecke die beiden etwas später im Wartebereich. Offenbar haben sie die Nacht dort auf den Ruhesesseln verbracht. Ich beobachte sie aus der Distanz. Ihre Augen sind geschlossen. Vielleicht schlafen sie, vielleicht nicht.
Im Wartebereich der Intensivstation herrscht eine angespannte Atmosphäre, die man in den anderen Räumen des Krankenhauses so nicht findet. In der Regel dürfen Besucher einen Patienten nur allein oder zu zweit sehen und auch nur für kurze Zeit. Und so kampieren sie im Wartebereich, bangen, beten, weinen. Dass sie schlafen oder essen, kommt selten vor. Wenn sie das Krankenhaus schließlich verlassen, ähneln sie Zombies, und nur wenige haben das Glück, ihren Angehörigen mit nach Hause nehmen zu können.
Ich lasse Caitlins Eltern ruhen und kehre zu ihrer Tochter zurück. Es fällt mir schwer, mit ihr allein zu sein. Doch ich gehe meiner Arbeit nach, erledige sie mechanisch und versuche, nicht daran zu denken, was passiert ist – was Caitlin hierhergebracht hat. Ich überprüfe den Monitor, die Infusionen und die Vitalwerte und verabreiche Caitlin Medikamente. Doch immer wieder zuckt mein Blick zu ihrem Gesicht, und ich vergewissere mich, dass sie weiterhin bewusstlos ist. Dabei kommt mir der Gedanke, dass es eigentlich kaum möglich ist, sie mit Sicherheit zu identifizieren, man sieht ja nur ein Drittel ihres Gesichts. Sie könnte Gott weiß wer sein. Was für einen friedlichen Eindruck sie macht. Es wirkt irreal, wenn ich daran denke, was ihr geschehen ist.
Später am Morgen beginnt die Besuchszeit. Caitlins Eltern kommen herein. Den Rücken der Tür zugewandt, höre ich nur, dass sie aufgeht und eine Frau schüchtern fragt: »Dürfen wir eintreten?«
Ich drehe mich um. Die beiden dürften um die sechzig sein. Sie sind beide grauhaarig, oder genauer gesagt: Er ist grau meliert und ihr Haar ist silbrig. Sie sind gut gekleidet – sie in Jeans, lose fallendem Top und Strickjacke, er in Anzughose und Hemd, als wäre er aus dem Büro hierhergekommen. Doch in der endlosen Nacht, die sie hier gewartet haben, sind ihre Sachen zerknittert, die Hosenbeine ausgebeult. Die beiden sind etwa gleich groß, halten einander an der Hand, als suchten sie verzweifelt nach Trost. Das Augen-Make-up der Mutter vom Vortag ist verschmiert. »Wir sind Caitlins Eltern«, sagt sie. »Tom und Amelia Beckett.«
»Bitte, treten Sie ein«, sage ich. »Ich bin Meghan und heute für Ihre Tochter zuständig.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagt Mrs. Beckett, ohne mich anzusehen. Sie hat den Blick auf ihre Tochter gerichtet und nimmt alles in sich auf: den Verband, die Schläuche, den Tubus, die Sonde, den Tropf, all das, was sie nun zum ersten Mal sieht. Sie ringt nach Luft, presst eine Hand auf den Mund und kämpft mit den Tränen. Ich schaue woandershin, um zu vermeiden, dass mich ihre Reaktion zu sehr mitnimmt. Aber ich fühle mich dafür verantwortlich.
Jemanden in Caitlins Zustand zu sehen, das ist für Angehörige nur schwer zu verkraften. Bereits der Aufenthalt auf der Intensivstation kann anfangs überwältigend sein, man muss sich erst daran gewöhnen. Da wäre das grelle Licht, das dem Aussehen eines Schwerverletzten alles andere als zuträglich ist. Hinzu kommt das Fachpersonal, das im Krankenzimmer ein- und ausgeht: Oberärztinnen, Assistenzärzte, Atemtherapeutinnen, Ernährungstherapeuten, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeuten, um nur einige zu nennen. Mitunter können Angehörige diese Personen nicht auseinanderhalten, vermuten in jedem den Überbringer einer schlechten Nachricht. Auch das Summen, Zischen und Piepen der Geräte ist den meisten unheimlich. Sie wissen nicht, was diese Geräusche bedeuten, und das macht ihnen Angst. Vielleicht sind es Warnzeichen, denken sie, womöglich signalisieren sie Lebensgefahr.
Die Eltern treten an Caitlins Bett. »Darf ich sie anfassen?«, fragt Mrs. Beckett.
»Selbstverständlich.«
Ganz vorsichtig legt sie die Hand auf Caitlins Arm, achtet darauf, den intravenösen Zugang nicht zu verschieben.
Ich erkläre den Eltern, dass Caitlins Zustand stabil ist, sich über Nacht nichts verändert hat und der behandelnde Arzt im Laufe des Morgens hier sein wird, später am Tag auch die Atemtherapeutin und die Physiotherapeutin. Ich betone, wie wichtig es ist, dass wir Komapatienten bewegen, um Muskelschwund und Wundliegen vorzubeugen. »Konnten Sie in der Nacht ein wenig schlafen?«, frage ich.
»Nicht viel.«
»Haben Sie denn schon etwas gegessen?«
»Noch nicht.«
»Das sollten Sie aber. Sie dürfen sich nicht vernachlässigen, Sie müssen dafür sorgen, dass Sie ausreichend Schlaf bekommen und genug essen. Um Ihre Tochter kümmern wir uns, und zwar rund um die Uhr, sie ist in guten Händen.«
»Wir sind Ihnen sehr dankbar«, sagt Caitlins Vater. »Für alles, was Sie für unsere Tochter tun.«
»Am besten, Sie ignorieren mich einfach.« Ich gehe weiter meinen Pflichten nach oder versuche es zumindest, doch die Anwesenheit der Eltern und ihr Leid beeinträchtigen meine Konzentration. Ich schaue auf den Monitor. »Wenn Sie etwas wissen möchten, fragen Sie ruhig.«
»Wie lange wird Caitlin in diesem Zustand sein?«, erkundigt sich Mrs. Beckett.
»Schwer zu sagen. Das ist von Patientin zu Patientin unterschiedlich.« Ich schaffe es kaum, Caitlins Mutter anzusehen, ihre Pein ist so offenkundig. Die meisten Menschen liegen nur wenige Tage oder Wochen im tiefen Koma, bevor sie ihr Bewusstsein langsam wiedererlangen und in eine Art Wachkoma übergehen, selbstständig atmen können oder bei minimalem Bewusstsein sind. Bei anderen kann ein Koma Monate oder gar Jahre dauern, und manche wachen nie wieder auf.
Unsere Blicke begegnen sich. »Wie ist es, wenn man im Koma liegt?«, fragt sie.
»Auch das unterscheidet sich je nach Patientin.«
Ich wende mich ab, schaue auf Caitlin, auf ihr Gesicht mit den friedlich geschlossenen Augen, und sehe im Geist etwas anderes aufblitzen: Angst, Entsetzen und Schmerz. Wieder denke ich an den Sturz und frage mich, wie es ist, wenn es von einer sieben Meter hohen Brücke in die Tiefe geht. Ich stelle mir Caitlins Verzweiflung vor, den Versuch, im letzten Moment alles rückgängig zu machen, sich nicht zu bewegen, und dann das Fallen, die rudernden Arme, das Aufschlagen auf der Erde. Ich will emotionslos sein, klinisch, und Caitlin ebenso wie jede andere Patientin betrachten, doch es gelingt mir nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. Wieder frage ich mich, ob sie auf dem Weg nach unten bewusstlos geworden ist oder bei Bewusstsein war, ihre Schmerzsensoren sich jedoch ausgeschaltet hatten und sie beim Aufprall nichts gespürt hat.
Ich löse meinen Blick von Caitlin und drehe mich ihrer Mutter zu. »Für manche ist das Aufwachen so, als käme man nach einer Narkose zu sich. Man ist noch ein wenig benommen, aber die Zeit der Bewusstlosigkeit erscheint einem so kurz wie ein Wimpernschlag. Andere träumen während des Komas.«