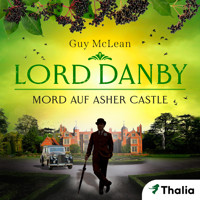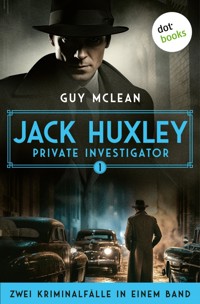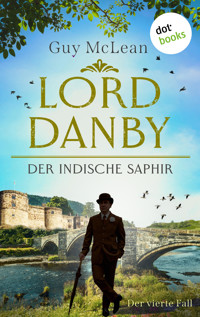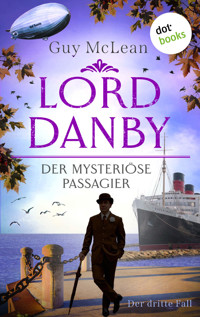
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lord Danby
- Sprache: Deutsch
Eine Mission zum Wohle des britischen Königreichs: Der humorvolle Krimi »Lord Danby – Der mysteriöse Passagier« von Guy McLean als eBook bei dotbooks. England geht vor die Hunde, da ist sich Lord Percival Danby sicher: Nicht nur will man den König 1936 zum Abdanken nötigen, nein, im selben Jahr brennt auch noch der allseits bewunderte Kristallpalast mitten in London nieder. Höchste Zeit, diesem Elend bei einer Zeppelinfahrt ins glanzvolle New York zu entfliehen. Doch Frieden ist Lord Danby nicht vergönnt: Mit an Bord ist ein höchst verdächtiger Anarchist … der eindeutig eine dunkle Verbindung zum Feuer im Kristallpalast hat! Und nun sind zahlreiche illustre Gäste hier oben, tausend Meter über dem Ozean, mit ihm eingesperrt. Wird Danby die Verschwörung noch rechtzeitig aufdecken können? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Kriminalroman »Lord Danby – Der mysteriöse Passagier« von Guy McLean ist der dritte Fall für Lord Danby, den unfreiwilligen Detektiv des englischen Königshauses. Ein Krimi-Vergnügen wie von Agatha Christie nach mehreren Gläsern Portwein. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
England geht vor die Hunde, da ist sich Lord Percival Danby sicher: Nicht nur will man den König 1936 zum Abdanken nötigen, nein, im selben Jahr brennt auch noch der allseits bewunderte Kristallpalast mitten in London nieder. Höchste Zeit, diesem Elend bei einer Zeppelinfahrt ins glanzvolle New York zu entfliehen. Doch Frieden ist Lord Danby nicht vergönnt: Mit an Bord ist ein höchst verdächtiger Anarchist … der eindeutig eine dunkle Verbindung zum Feuer im Kristallpalast hat! Und nun sind zahlreiche illustre Gäste hier oben, tausend Meter über dem Ozean, mit ihm eingesperrt. Wird Danby die Verschwörung noch rechtzeitig aufdecken können?
Über den Autor:
Guy McLean ist ein Pseudonym des Autors Stefan Lehnberg. Er ist ein wahres Multitalent. Schauspiel, Regie, Schriftstellerei – in all diesen (und zahllosen weiteren) Bereichen ist der Wahlberliner unglaublich erfolgreich. Er ist nicht nur der Verfasser der Lord-Danby-Reihe und mehrerer Theaterstücke, sondern war unter anderem als Autor für Harald Schmidt und Anke Engelke tätig. Seine tägliche Radiocomedy »Küss mich, Kanzler«, bei der Lehnberg als alleiniger Autor, Regisseur und männlicher Hauptdarsteller fungierte, brachte es auf über 3000 Folgen, und sein Roman »Mein Meisterwerk« wurde mit dem Ephraim-Kishon-Satirepreis ausgezeichnet. Weitere Höhepunkte seiner Karriere markieren die Veröffentlichung von »Das persönliche Tagebuch von Wladimir Putin«, »Comedy für Profis – Das Praxisbuch für Autoren und Comedians« sowie die drei Goethekrimis »Durch Nacht und Wind«, »Die Affäre Carambol« und »Die Briefe des Ikarus«. Außerdem sieht er gut aus, ist hochintelligent und verfügt über einen edlen Charakter. Doch ist ihm nichts davon zu Kopf gestiegen. Im Gegenteil: Er ist immer der sympathische Kumpel von nebenan geblieben, der sich auch keineswegs zu schade ist, mal ein paar biographische Zeilen über sich selbst zu schreiben.
Die Website des Autors: www.Lehnberg.com/
In der Reihe um »Lord Danby« erscheinen bei dotbooks als eBooks und Printausgaben die Bände:
»Lord Danby – Mord auf Asher Castle« – auch als Hörbuch bei Thalia erhältlich
»Lord Danby – Die Deauville-Affäre« – auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich
»Lord Danby – Der mysteriöse Passagier«
Weitere Kriminalromane sind in Vorbereitung.
Unter dem Pseudonym T. H. Lawrence erschien außerdem »Der Teufel von Dublin«, eine Anthologie neuer Father-Brown-Krimis.
***
Originalausgabe Dezember 2023
Copyright © der Originalausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
Syndikat-Logoverwendung: SYNDIKAT e.V.
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-882-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Lord Danby 3«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Guy McLean
Lord Danby – Der mysteriöse Passagier
Der dritte Fall
dotbooks.
Dramatis Personae
Lord Percival Danby
Basil Grover – Chief Inspector bei Scotland Yard
Spencer
Joseph Schenck
Sherwood van Cleave
Ellen Peterson
Dr. Alan Pryce Jones
Penelope Jessop
Vernon Dryden
Rose Dryden
Mr. Biggs
Mrs. Biggs
Beider Sohn Ronald
Mr. Laskin
Chester Strudwick
Constance Strudwick
Kapitän Buckley
Myrtle Sloane
Winslow H. Kirkeby
»In der Auswahl seiner Feinde
kann man nicht sorgfältig genug sein.«
Oscar Wilde
Prolog
Es war der elfte Dezember 1936, als ein Ereignis eintrat, das nicht nur die gesamte Welt zutiefst erschütterte, ja sie für einige Minuten sogar zum vollständigen Stillstand brachte, sondern das auch die Geschichte Großbritanniens auf immer verändern sollte.
Ich selbst befand mich zu diesem Zeitpunkt in den Kolonien, genauer gesagt in New York, und wie ich später erfuhr, blieben in jenen verhängnisvollen siebzig Sekunden nicht nur zahllose Autofahrer stehen, weil sie vor Tränen die Straße nicht mehr sehen konnten, und überall in Lichtspieltheatern wurde die Vorstellung unterbrochen sowie der dortige internationale Börsenhandel ausgesetzt, sondern es wurde in der gesamten Stadt nicht ein einziges Telefonat geführt. Laut des bedeutenden Schriftstellers H. L. Mencken handelte es sich hierbei um nichts weniger als das gewaltigste Ereignis seit der Auferstehung Jesu Christi und daher ... Doch ich greife wieder einmal vor. Eine bedauerliche Angewohnheit von uns Danbys, die einer gewissen Ungeduld geschuldet ist, die schon mancher zum Anlass nahm, sich zu beklagen. Ich selbst versuche sie, wo immer es geboten erscheint, im Zaume zu halten, respektiere aber durchaus auch die ehrwürdigen Resultate, die nämliche Charaktereigenschaft dazu befähigte, das gewaltige Vermögen der Danby-Familie im Laufe der letzten fünfhundert Jahre aufzubauen. Schlösser, weitläufige Ländereien und Adelstitel fallen einem leider nun mal nicht tatenlos in den Schoß (es sei denn, man hat das Glück, einer späteren Generation anzugehören), sondern es bedarf schon eines gerüttelten Maßes an Ungeduld in Geldangelegenheiten, um seine Umwelt dazu zu bringen, dieses entweder für einen zu erarbeiten oder – sollte es dort bereits vorhanden sein – herauszurücken.
Doch die Ungeduld muss vorerst zurückstehen, während ich einstweilen zunächst auf ein anderes, nicht ganz so bedeutendes, aber nicht minder historisches Ereignis in diesem an außergewöhnlichen Ereignissen wahrlich nicht eben armen Jahr 1936 zu sprechen komme: Im Januar war unser allseits geliebter Monarch, König Georg V., nach einer ein Vierteljahrhundert umspannenden Regierungszeit verstorben und sein ältester Sohn David hatte als Edward VIII. den Thron bestiegen. Leider war seine Regentschaft von Anfang an von Misshelligkeiten überschattet gewesen, denn seine Liebe zu der zweifach geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson, und mehr noch seine feste Absicht, diese zu ehelichen, war nicht nur seiner eigenen Familie, insbesondere seiner Mutter, als auch der Regierung unter Führung von Premierminister Stanley Baldwin sowie dem Erzbischof von Canterbury, Cosmo Gordon Lang, ein Dorn im Auge, sondern auch großen Teilen der Presse, wobei nicht eindeutig klar war, was schwerer wog: dass Mrs. Simpson geschieden war und somit den König, der ja auch das Oberhaupt der Anglikanischen Kirche und als solcher den Verteidiger des Glaubens darstellte, im Falle einer Heirat in einen unauflöslichen Widerspruch mit diesen Ämtern bringen würde, oder die schlichte Tatsache, dass eine Königin aus Amerika als einfach völlig unvorstellbar galt.
Was auch immer der letztlich entscheidende Grund war, er hatte eine veritable Staatskrise zur Folge, in der nicht wenige vaterlandslose Miesepeter, welche dem König sein Liebesglück missgönnten (ich selbst zählte, wie ich betonen möchte, nicht zu ihnen), diesen allen Ernstes vor die geschmacklose Alternative stellten, entweder seine Heiratspläne aufzugeben oder – abzudanken.
Doch das war noch nicht alles, was sich in diesem Jahr ereignete: Kurz nach des Königs Thronbesteigung im Januar war ich in jene grauenvollen Geschehnisse auf Asher Castle verwickelt, über die seinerzeit ausführlich in allen Blättern des Landes berichtet wurde, und in der ersten Junihälfte wurde ich während einer unschuldigen Reise in das französische Seebad Deauville mit einer weiteren mysteriösen Affäre konfrontiert, über die an dieser Stelle besser der Mantel des Schweigens gebreitet werden möge. Während ich mich anschließend von diesen Strapazen auf einer Reise durch Frankreich erholte, war mit G.K. Chesterton einer der klügsten Köpfe und größten Schriftsteller Englands verstorben und am dreißigsten November schließlich war das nämliche Geschehnis eingetreten, von dem jetzt die Rede sein soll. Doch, man möge mir vergeben, wenn ich auch hier dafür zunächst etwas ausholen muss:
Es war im Jahre 1849, als man beschloss, im Londoner Hydepark ein Gebäude für die Weltausstellung von 1851 zu errichten. Die Bedingungen der Ausschreibung waren so gewaltig, dass sie kaum erfüllbar zu sein schienen: Das Gebäude sollte eine viermal so große Fläche wie der Petersdom besitzen, dennoch nicht mehr als einhunderttausend Pfund kosten, alle Bäume im Park mussten erhalten werden, es sollte schnell erbaubar (und auch schnell wieder demontierbar sein) und last but not least sollte es selbstverständlich so repräsentativ sein, wie es sich für die Hauptstadt des Empires geziemte. Ausgewählt unter den Einreichungen von über zweihundert Architekten wurde schließlich ein Vorschlag des Gärtners ihrer Majestät, Königin Victoria, eines Mannes namens Joseph Paxton, der in nur zweiundzwanzig Wochen Bauzeit und unter Verwendung von nicht weniger als vierhunderttausend Glasplatten eine gigantische Version dessen errichten ließ, womit er sich auskannte: ein monumentales Gewächshaus, das in der Presse aber von Anfang an nur mit einem Namen bezeichnet wurde: Der Kristallpalast.
Das Bauwerk war von Anfang an eine Sensation. Das Volk liebte es. Verständlicherweise. War es doch der einzige Palast, den es jederzeit betreten durfte. Viele nannten ihn gar das Achte Weltwunder. (Wenn man bedenkt, dass von den ursprünglichen sieben bis auf die Pyramiden von Gizeh alle anderen schon lange nicht mehr existieren, könnte man den Kristallpalast sogar als das Zweite Weltwunder bezeichnen.)
1853 wurde der Kristallpalast, wie geplant, im Hydepark abgetragen und – wie ursprünglich nicht geplant, aber aufgrund seiner riesigen Beliebtheit unumgänglich – im Sydenhampark in sogar erweiterter Form wieder aufgebaut, wo er als Museum, Ausstellungsgebäude und Konzerthaus diente.
Dreiundachtzig Jahre später dann, in der Nacht vom dreißigsten November zum ersten Dezember dieses Jahres kam es im Inneren des Palastes zu einer Explosion, woraufhin dieses ehrwürdige und allseits geliebte Bauwerk vollständig niederbrannte. Man mag sich fragen, wie Glas brennen kann, nun, so unwahrscheinlich es klingt, es kann offenbar.
Natürlich waren am nächsten Tag sämtliche Zeitungen voll davon und London kannte kein anderes Gesprächsthema. Sehr schnell stand der Verdacht im Raume, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugegangen sein konnte oder, um noch deutlicher zu werden, dass hier ein Verbrechen vorlag. Scotland Yard nahm unverzüglich die Ermittlungen auf und die gesamte Bevölkerung wurde gebeten, die Augen offen zu halten und verdächtige Personen umgehend zu melden.
Nun kann es, weiß Gott, nicht meine Aufgabe sein, bei Kriminalproblemen tätig zu werden (noch bei irgendetwas anderem), wenn allerdings in England erst einmal angefangen wird, Paläste in die Luft zu sprengen und in Brand zu stecken – und seien es auch nur Kristallpaläste – muss das jeden aufrechten Gentleman auf den Plan rufen, sein Äußerstes zu tun, um bereits die ersten Schritte zum Umsturz im Keim zu ersticken. »Friede den Hütten, Krieg den Palästen!« war eine Parole der Französischen Revolution und wir alle wissen nur zu gut, wie das geendet hat, nämlich in höchst unzivilisierter Weise: Fast der ganze Adel wurde umgebracht. Nicht wie bei uns in England, wo der Monarch im neunzehnten Jahrhundert die anstrengende Regierungsarbeit einem Bürgerlichen aufhalste und trotzdem seinen Titel, seine Schlösser, seine Privilegien und seinen Reichtum behielt. Doch ob es ein zweites Mal eben so glimpflich ablaufen würde, ist keineswegs ausgemacht. Daher steht unumstößlich fest: Revolutionen in jeder Form sind mit einem Danby nicht zu machen. Rein moralisch gesehen war ich somit an vorderster Front dabei, den Übeltäter ausfindig und unschädlich zu machen; praktisch gesehen jedoch bin ich nun mal kein Kriminalist. Ich habe Besseres zu tun, als schlecht gekleidet an fremden Türen zu klopfen und zu fragen: »Wo waren Sie in der Nacht zum Siebzehnten?« Abgesehen davon wüsste ich auch gar nicht, wo ich bei der Suche anfangen sollte. Wenn ich nicht zufällig auf einen Mann stoße, der in der einen Hand einen Stadtplan von London hält, auf dem der Kristallpalast mit roter Tinte markiert wurde, und in der anderen Hand ein abgebranntes Streichholz, scheint mir die Sache ziemlich aussichtslos zu sein.
Indes wurden alsbald mehrere aufmerksame Bürger bei Scotland Yard vorstellig, die kurz vor der Explosion einen kleinen weißhaarigen Mann in der Nähe des Tatortes gesehen haben wollten, der jedoch jünger wirkte, als sein schlohweißes Haar es vermuten ließ, was in der Presse unmittelbar Spekulationen auslöste, dass der Attentäter seine Haare zu Tarnungszwecken gebleicht haben könnte. Von da war es nur noch ein kleiner Schritt zu der Vermutung, dass es sich bei dem Mann um einen Ausländer handelte, was diese Tat in Bezug auf ihre Ruchlosigkeit umgehend auf einen der ersten Plätze aller je begangenen Verbrechen in Großbritannien beförderte. Sicher, der berühmt-berüchtigte Guy Fawkes hatte im Jahre 1605 versucht, König Jakob I. sowie seine gesamte Familie, sämtliche Parlamentarier und alle Bischöfe zusammen mit dem Parlament in Westminster in die Luft zu sprengen (manche vertreten die durchaus bedenkenswerte Ansicht, dass er der einzige Mann war, der je mit ehrlichen Absichten ins Parlament ging), was natürlich ebenfalls streng zu missbilligen ist, aber immerhin war er Engländer.
Nun, da die Ausländer-Theorie im Raume stand, reagierte Scotland Yard sofort und stellte sämtliche Bahnhöfe im Großraum London, alle Ausfallstraßen, den Flughafen und alle Häfen unter strengste Bewachung. Sollte sich der kleine Mann mit den weißen Haaren hier irgendwo zeigen, würde man ihn unweigerlich festnehmen.
Aber wie dem auch sei, nachdem ich meine Empörung über die Freveltat an unserem Kristallpalast in angemessener Weise kundgetan hatte, gab es in dieser Angelegenheit nichts weiter für mich zu tun – so glaubte ich damals, wie sollte ich mich doch irren – und ich wandte mich wieder meinen eigenen Beschäftigungen zu.
Ich weiß nicht, ob ich es schon einmal erwähnt habe, aber ich bin einem guten Tropfen nicht gänzlich abhold und ich darf wohl behaupten, dass mein Keller, was die darin sorgsam gelagerten Weine betrifft, keinen wie auch immer gearteten Vergleich scheuen muss. Ja, ich getraue mich zu behaupten, dass ich, was die Welt der geistigen Genüsse angeht, mich durchaus als Kenner, ja als Experten bezeichnen darf. (Das Einzige, was mir ein ewiges Mysterium bleiben wird, ist, weshalb zusätzlich zu dem exquisiten Wein auch billiger Wein hergestellt wird. Wer will den haben? Was verspricht man sich davon, einen Wein zu trinken, der nur ein paar Pence kostet, wenn man sich doch auch eine Flasche Mouton Rothschild bringen lassen kann? Ich könnte es mir allenfalls so erklären, dass gewisse exzentrische Gentlemen einfach um jeden Preis auffallen wollen und dann auf den Flügeln eines Doppeldeckerflugzeuges in hunderten Yards Höhe Charleston tanzen oder – noch verrückter – eben diesen billigen Wein trinken, um aller Welt zu demonstrieren, was für verwegene Teufelskerle sie doch sind.)
Einen lange gehegten und über die Jahre immer mächtiger gewordenen heimlichen Wunsch hatte ich mir allerdings nie erfüllt: den Traum vom eigenen Wein. Bis vor zwei Jahren. Da hatte ich, nachdem ich mich mit einigen Experten beraten hatte, kurz entschlossen eine meiner Besitzungen in Lincolnshire unter beträchtlichem Aufwand in ein veritables Weingut umgestalten lassen, auf dem ich einen Seyval Blanc keltern ließ. Es fehlte an nichts. Weinberge, Rebstöcke, gewölbte Keller, Zehntausende von Flaschen, zwei Verkorkungsmaschinen, erfahrene Winzer und vieles weitere mehr. Auch ein wunderschönes Etikett mit dem Familienwappen der Danbys hatte ich von einem renommierten Künstler entwerfen lassen. Es lässt sich kaum in Worte fassen, in welch feierlicher Stimmung ich mich befand, als ich schließlich den ersten Schluck Danby-Wein verkostete, und ich muss wahrlich sagen, der Geschmack war schon etwas ganz Besonderes, aber dass ich mehr davon trank, hat sich danach irgendwie nicht mehr ergeben.
Auch war weder Harrods noch sonst irgendjemand bereit, den Verkauf dieses Weines zu übernehmen.
Nachdem ich nun aber bereits ein erkleckliches Sümmchen in die Anlage dieses Weingutes investiert hatte, widerstrebte es mir verständlicherweise, das Land wieder in einen Rübenacker zurückzuverwandeln, und ich tat das einzig Richtige: Ich verkaufte es an einen Amerikaner.
Nun sind Transaktionen mit Amerikanern grundsätzlich kein Vergnügen. Sind sie doch äußerst gerissene Geschäftsleute, die hart, bis an die Grenze der Unhöflichkeit, und oft weit darüber hinaus, verhandeln. Allerdings besitzen sie eine Achillesferse und das ist der Wein. Sie wollen den besten, aber sie verstehen nichts davon und erkennen ihn nicht, wenn sie ihn trinken. Aus diesem Grund ist es zum Beispiel in den edelsten Restaurants Frankreichs gang und gäbe, dass die jeweils teuersten Weine auf der Karte nicht zugleich die besten sind. Reiche Amerikaner jedoch achten nur auf den Preis und den pompösen Namen und bestellen sie dennoch, während die tatsächlich exquisitesten, aber nur zweitteuersten Weine wahren Kennern wie Franzosen und mir vorbehalten bleiben.
Wie heißt es so schön: »Im Wein liegt die Wahrheit, der Schwindel steckt im Etikett.«
All diesem eingedenk – und auch dem Umstand, dass es mir mein Gewissen (und die Sorge um meinen guten Ruf) verbot, den von Bacchus so schnöde verschmähten Weinberg an einen englischen Landsmann zu veräußern – hatte mein Gutsverwalter seine Fühler nach Amerika ausgestreckt und war dort tatsächlich fündig geworden. Ein reicher Stahlmagnat, den es danach dürstete, sich mit britischer Lebensart zu schmücken, hatte sich unklugerweise bereit erklärt, das Anwesen zu einem astronomischen Preis zu erwerben. Der einzige Pferdefuß bei der Angelegenheit lag darin, dass er stahlhart auf einer Vertragsunterzeichnung in New York bestand. Eine dreiste Zumutung, die ich unter normalen Umständen selbstverständlich voller Verachtung von mir gewiesen hätte, aber die Summe, die mir der Mann zahlen wollte, war wirklich geradezu lächerlich hoch und der monströse Irrsinn namens Prohibition, der Amerika dreizehn endlose Jahre zu einem Ort des Schreckens hatte werden lassen, war seit drei Jahren beendet, so dass man nun wieder dorthin reisen konnte, und so stimmte ich zu.
Dass die beiden kommenden Wochen gänzlich anders verlaufen würden als von mir vorgesehen, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht.
Erster Teil
Kapitel 1
Es war ein Tag nach dem Brand des Kristallpalastes, als ich meine Reise nach New York antrat. Da der Stahlmagnat, der mein Weingut kaufen wollte, klar gemacht hatte, das Geschäft nur unter der Bedingung abzuschließen, dass der Kaufvertrag innerhalb von vier Tagen unter Dach und Fach sei – zweifellos eine reine Schikane, um mich unter Druck zu setzen (leider mit Erfolg) – war es mir nicht möglich, mich der komfortabelsten Form des Reisens zu bedienen – dem Passagierschiff. Dies war umso misslicher, als die Cunard-Reederei gerade erst wenige Monate zuvor ihr neuestes und luxuriösestes Schiff vom Stapel hatte laufen lassen. Sie war darauf so stolz, dass sie bereits während des Baues bei seiner Majestät Georg V. untertänigst hatte anfragen lassen, ob es ihr wohl gestattet sei, dieses Wunderwerk der modernen Technik nach Englands größter Königin zu benennen. Der König zeigte sich huldvoll und antwortete, dass er diese Ehrung seiner Gemahlin Mary gerne genehmige. Und so heißt das Schiff nun R.M.SQueen Mary und nicht, wie von Cunard ursprünglich geplant, R.M.S.Queen Victoria. Doch trotz der falschen Benennung wäre ich nur zu gerne mit diesem hochmodernen Oceanliner, der über zweitausend Passagiere befördern konnte und mit jedem nur erdenklichen Luxus ausgestattet war, gefahren, doch leider dauerte die Reise über den Atlantik von Southampton nach New York (mit einem Zwischenstopp im französischen Cherbourg) sieben bis neun Tage und somit zu lange, um den mir gesetzten Termin einhalten zu können.
Eine Luftreise war daher das Mittel der Wahl. Natürlich nicht in einem Flugzeug. Drei Jahre zuvor hatte ich mich zum ersten und einzigen Mal mit einem solchen Höllengerät befördern lassen. Bei gutem Wetter und Windstille mag es halbwegs erträglich sein, aber bei Wind und Regen fühlt man sich als Passagier wie eine Olive im Cocktailmixer von Cyril, dem temperamentvollsten Barkeeper des Savoy Hotels in London. Furchtbar! Aus diesem Grund hatte ich für mich eine ebenso schnelle, aber wesentlich komfortablere Form des Reisens gewählt, allerdings auch eine recht teure: ein Flug mit einem anderen Wunderwerk der Technik – dem Zeppelin.
Der Reisepreis betrug stattliche achtzig Pfund Sterling. Leuten, die mit der englischen Währung nicht gut vertraut sind, sei gesagt, dass dies zwanzig Monatsgehältern eines Dienstmädchens entspricht.
Kapitel 2
Es war bereits kurz vor sechs am Abend, als mich ein Taxi am Aerodrome in Croydon absetzte. Ich war bereits über eine Stunde vor dem offiziellen Beginn der Reise erschienen, da man mir bei der Buchung derselben versichert hatte, dass bereits die Vorbereitungen zum Abflug ein einmaliges Schauspiel bieten würden. Und in der Tat, ich kam eben zurecht, um Zeuge eines faszinierenden – und auch ein wenig erschreckenden – Vorganges zu werden. Ich befand mich in einigem Abstand vor einer riesigen Halle von etwa sechzig Yards Höhe, sechzig Yards Breite und dreihundert Yards Länge. Zahllose Männer waren unter Anleitung eines Mannes mit einem Megaphon mit dem sogenannten »Aushallen« beschäftigt, also damit, den nur wenige Yards über dem Boden schwebenden Zeppelin mittels langer Seile aus der Halle zu bugsieren. Es war, wie man mir später erzählte – zusammen mit der Landung – der gefährlichste Teil der gesamten Operation, da jede Böe außerhalb der Halle, den Zeppelin erfassen und die dünne Außenhülle gegen die Wände der Halle werfen konnte, was in der Vergangenheit schon zu katastrophalen Folgen geführt hatte, die von schweren Verletzungen bis zur Zerstörung des Luftschiffes reichten. Höchste Umsicht und Präzision war hier geboten.
Erfreulicherweise kam es an diesem Abend zu keinerlei Zwischenfällen und schließlich war es soweit, dass ich, gemeinsam mit den etwa zwanzig übrigen Passagieren, das Luftschiff über zwei Gangways besteigen durfte. Dabei war nicht zu übersehen, dass eine solche Reise ihre speziellen Anforderungen hatte. Das hatte bereits mit der Abflugzeit am Abend begonnen, da in der kühlen Abendluft offenbar günstigere Startbedingungen vorlagen. Auch beobachtete ich, dass mit jedem Passagier, der über die Gangway ins Innere ging, mehrere außen befestigte Sandsäcke abgenommen wurden, um das genau austarierte Gewicht des Fluggerätes konstant zu halten. Des Weiteren – und das war nun wirklich ein Schock – wurden wir beim Betreten der Gondel von einem Offizier höflichst, aber keinerlei Widerspruch duldend, aufgefordert, sämtliche sich in unserem Besitz befindlichen Feuerzeuge und Streichhölzer auszuhändigen, da schon ein einzelner Funke genügen könnte, das Wasserstoffgas in der zigarrenförmigen Hülle zu entflammen und innerhalb von Sekunden das gesamte Luftschiff in ein loderndes Inferno zu verwandeln. Aus demselben Grund trug die Mannschaft spezielle Schuhe mit Filzsohlen, ich war froh, dass uns zumindest das nicht auch zugemutet wurde.
Eine Viertelstunde später war es soweit. Die Türen wurden geschlossen, alle Passagiere wurden aufgefordert, im Salon Platz zu nehmen und sich während des Startes nicht wegzubewegen. Dann – während aus den Tanks riesige Mengen Ballastwasser abgelassen wurden – erhob sich das Luftschiff majestätisch in die Lüfte – noch immer gehalten von den dicken Tauen der Bodenmannschaft. Die gigantische Hülle über uns ächzte und knarrte beunruhigend und einige der Passagiere warfen bängliche Blicke um sich. Irgendwann, ich vermochte nicht einzuschätzen in welcher Höhe, waren wohl die Taue gelöst worden und dann, in etwa achtzig Yards Höhe, kam auf einmal das schwere Brummen der vier gewaltigen Motoren dazu. Plötzlich schwebten wir nicht mehr nach oben, sondern nach vorne.
Nun durften wir uns auch wieder erheben und mit einer Mischung aus Sorge und Stolz standen ich und die übrigen Passagiere an den schräg nach unten gerichteten Fenstern der Panoramagalerie und blickten auf die hellen Lichter Londons hinunter, das Herzstück unseres geliebten Britischen Empires.
Als Nächstes erhielten wir vom Zweiten Offizier eine Schiffsführung. Wir sahen den Gang mit den zehn Passagierkabinen, auf jeder Seite fünf, nebst den vier WCs und den drei Waschräumen, die Kombüse, wo man unsere Mahlzeiten zubereiten würde, den Funkraum, den Navigationsraum, der mit zwei Männern besetzt war, von denen der eine für die Höhe und der andere für den Kurs verantwortlich war, und schließlich die Brücke, wo uns der Kapitän begrüßte und uns erklärte, dass wir zurzeit mit einer Geschwindigkeit von achtzig Knoten in einer Höhe von zweihundertzwanzig Yards flogen, eine Nutzlast von fünfhundertvierzigtausend Pfund sowie Ballast von sechzigtausend Pfund mit uns führten, dass der Zeppelin zweihundertsechzig Yards lang sei und die Hülle einen Durchmesser von vierzig Yards habe und dass wir nach der Überquerung von Cape Race auf Neufundland in rund sechzig Stunden Lakehurst bei New York erreichen würden.
»Wo schläft die Mannschaft?«, erkundigte sich ein sommersprossiger Junge, den ich auf etwa vierzehn schätzte.
»Die Mannschaft schläft in der Hülle«, lautete die überraschende Antwort. Einige Passagiere stießen Laute des Unglaubens aus. Andere lachten.
»Es ist keineswegs so«, erläuterte der Kapitän bereitwillig, »dass die ganze Hülle mit Gas gefüllt ist, wie es bei einem Fesselballon der Fall ist. Vielmehr enthält sie siebzehn einzelne Gaszellen, die insgesamt hunderttausend Kubikmeter Wasserstoffgas enthalten. Wenn also eine Gaszelle tatsächlich mal ein Loch hätte, würde das die Flugsicherheit dennoch in keiner Weise beeinträchtigen, zumal wir es sehr schnell bemerken würden, da dem Gas ein Bittermandelduftstoff beigemischt ist. Darüber hinaus ist dort oben Platz für die Mannschaftsquartiere, das Gepäck, Postsäcke, Tanks mit Ballastwasser, Tanks mit Treibstoffgas für die vier Motoren und noch einiges andere.«
»Und was passiert, wenn die Motoren versagen?«, fragte eine ältliche Dame mit Brille, die mir schon zuvor durch ihre Nervosität unangenehm aufgefallen war.
Der Kapitän lächelte charmant. »Das wird nicht passieren, Madam. Da können Sie ganz beruhigt sein.«
Diese Antwort schien die Dame ganz und gar nicht zu beruhigen. »Aber was, wenn doch?«, insistierte sie.
»Selbst dann können wir, im Gegensatz zu einem Flugzeug, weiterhin navigieren und problemlos landen«, versicherte ihr der Käptn in beruhigendem Tonfall. »Nicht umsonst ist der Zeppelin das einzige Luftfahrzeug, das ohne Zwischenlandung die ganze Erde umrundet hat. Es ist noch nie etwas passiert.«
»Irgendwann ist immer das erste Mal«, beharrte die Dame rechthaberisch. »Was passiert, wenn wir in ein Gewitter geraten?«
»Nichts. Der Zeppelin ist ein Faradayscher Käfig und somit vollkommen sicher vor Blitzeinschlägen.«
»Ihr Wort in Gottes Ohr!« Die Dame schien keineswegs überzeugt zu sein, doch der Kapitän schaffte es in bewundernswerter Weise, dennoch zuvorkommend zu bleiben:
»Meinen Sie nicht auch, Madam, dass wir besser voller Optimismus an die Sache herangehen sollten? Pessimismus hat noch nie zu etwas Gutem geführt.«
»Von wegen!«, beharrte die unangenehme Schreckschraube. »Man braucht beide. Die Optimisten erfinden das Flugzeug und die Pessimisten den Fallschirm. George Bernhard Shaw.« Sie posaunte den Namen des berühmten Dichters triumphierend heraus, als habe sie damit die Diskussion in letzter Distanz für sich entschieden.
Dann war Gelegenheit, unsere Kabinen aufzusuchen, unser inzwischen an Bord gebrachtes Handgepäck auszupacken – der Rest des Gepäcks (es durfte pro Passagier nicht mehr als vierzig Pfund wiegen, was für alle Ladies und Gentlemen, die es gewohnt waren, sich zu jedem Anlass korrekt zu kleiden, wahrlich eine nicht geringe Zumutung darstellte) befand sich im Frachtraum – und uns frisch zu machen. Alle Kabinen waren links und rechts eines schmalen Ganges aufgereiht, insgesamt zehn an der Zahl. Sie waren klein, etwa so wie die Kabinen im Orient-Express, aber abgesehen von den Seidentapeten leider weit weniger elegant. Zweckmäßigkeit, Platzersparnis, die Verhinderung von Bränden und ähnlich schnöde Gedanken schienen hier federführend gewesen zu sein. Eine gepolsterte Bank, ein Klappbett, ein Klapptisch und ein kleiner Schrank, das war schon die ganze Inneneinrichtung. Auch war die Deckenhöhe, wie überall im Schiff, recht niedrig. Über meinem Kopf befand sich gerade noch ein halber Fuß Platz. Freudensprünge waren hier definitiv nicht möglich, andererseits aber auch ohnehin nicht angebracht. Ich langte nach meinem silbernen Zigarettenetui, um mir eine meiner speziell für mich angefertigten türkischen Zigaretten von Morlands in der Grosvenor Street anzuzünden, dann fiel mir ein, dass ich ja kein Feuer hatte.
Es erübrigt sich zu sagen, dass es um meine Stimmung nicht zum Besten bestellt war, als ich mich um kurz vor acht im Speisesaal zum Dinner einfand.