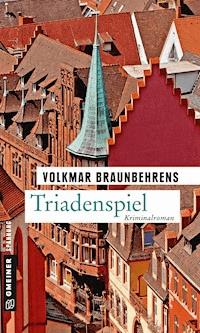Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Grabowski
- Sprache: Deutsch
Der Hamburger Modezar Karl Legrand hat seine Firma verkauft und eine der prächtigen Villen am Freiburger Lorettoberg als Ruhesitz erstanden. Doch am Morgen nach der pompösen Einweihung wird er tot im Garten gefunden. Als es kurz darauf ein weiteres Opfer gibt, welches mit derselben Waffe erschossen wurde, übernimmt Kommissar Grabowski die Ermittlungen. Diese führen ihn von Freiburg schließlich bis nach Hamburg, Berlin und Mailand …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Volkmar Braunbehrens
Lorettoberg
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Neuausgabe 2021
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © luciferfotolia / Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4146-2
Erster Teil
Anfang April 2008
I.
Eilig hatte er es nicht, das konnte man sehen. Er bewegte sich mit ruhiger Bestimmtheit, als er zu seinem Auto ging, das vor der von Fußweg und Straße etwas eingerückten Garage stand, einem älteren Mercedes-Modell, das bereits ein History-Nummernschild verdient hätte. Er hatte einen federnden Schritt, nicht sportlich, aber gelenkig und sichtlich ohne die Einschränkungen des Alters, denn er mochte schon um die 70 sein. Die aus der Stirn nach hinten frisierten Haare waren noch immer in kräftigem Schwarz grundiert, aber mit etlichen weißen Strähnen durchmischt. Der gleiche Farbkontrast schimmerte aus einem schmalen Oberlippenbart, der das schon faltige, markant längliche Gesicht mit einem starken Querstrich versah und die große, aber schmale Nase damit etwas entwertete, jedoch den lebhaften kleinen Äuglein, die tief und dunkel in ihren Höhlungen lagen, optisch einen festeren Halt in einer wirkungsvollen Gesichtskomposition gab. Groß gewachsen und sehr dünn, ohne im Mindesten kränklich auszusehen, wirkte er wie ein soignierter Herr, der durch seine ganze Erscheinung Distanz und Respekt ausstrahlte, dabei mit freundlicher Aufmerksamkeit und ohne jede Arroganz.
Seine Kleidung war leger, aber überaus gepflegt. Ein helles, leicht knittriges Leinenjackett mit Hornknöpfen, grünen Paspelierungen und aufgesetzten Taschen, wie man es in teuren Salzburger Geschäften finden konnte, abgeleitet von der alpenländischen Tracht und zugleich modisch so verwandelt, dass es mit bäurischem Stil nichts mehr gemein hatte. Dazu eine dunkelgraue, weich fließende, wohlgebügelte Hose und rötlichbraune, elegante Lederschuhe italienischer Provenienz. Zum blau-weiß gestreiften Hemd ohne Versteifungen an Kragen und Manschetten trug er eine einfarbige grüne Wollkrawatte, deren Knoten etwas zu voluminös geraten war und den überaus dünnen Hals dadurch noch mehr zur Geltung brachte.
Er legte eine kleine Aktentasche auf die Rückbank des Wagens, eigentlich eher eine schon etwas abgewetzte Kollegmappe ohne Griff aus schwarzem Leder, die man im Arm tragen musste und die nur wenige Blätter aufnehmen konnte, außerdem einen hellen Staubmantel, den man an diesem warmen und hellen Tag vermutlich gar nicht brauchte, und zwängte seine hohe Erscheinung mit geübter Geschmeidigkeit auf den Vordersitz. Über dem Armaturenbrett lagen griffbereit ein paar alte Lederhandschuhe, deren Handinnenfläche aus geflochtenem Baumwollfaden gewirkt war. Erst nachdem er sie sorgfältig übergestreift hatte, ließ er den Motor an, warf einen flüchtigen Blick in den Rückspiegel und fuhr sehr bedächtig los.
Der Kapellenweg war eine nur von Anwohnern frequentierte schmale Gasse, die sich in scharfen Kurven den Berg hinaufschlängelte. Teilweise war sie von hohen Stützmauern aus Sandsteinquadern gesäumt, die sich öfters zu Garageneinbuchtungen zurückzogen, oder von gemauerten Garteneinfriedungen und kunstvoll geschmiedeten Gittern begleitet. Hohes Buschwerk und Pflanzenzäune verwehrten die Sicht auf die Villen oder ließen nur üppige Dachformen mit verspielten Treppentürmen oder Erkerbewehrungen erkennen. Doch zwischen den Dächern bot der ganze Hang einen berauschenden Blick auf die Stadt, die sich in nordöstlicher Richtung wie in eine Kuhle zwischen die umgebenden Berge nistete. Schon vor über hundert Jahren waren hier Landhäuser und Villen in großzügig bemessenen parkartigen Gärten entstanden. Sonst hatte überall der Bedarf an Bauplätzen zur Verkleinerung der Grundstücke und einer Durchmischung mit modernen Wohnbauten geführt, doch hier oben war alles beim Alten geblieben, eine Art Dornröschenberg aus einer vergangenen Zeit. So waren allzu grobe Eingriffe in diese weiträumige Parklandschaft vermieden worden, obschon andere, ebenso recht ansehnliche Stadtteile mancherlei hässliche Verdichtungen hinnehmen mussten. Hier oben wohnten Leute, die nicht leichtfertig ihre Grundstücke an Bauunternehmer und Investoren verkauften. Sei es, weil sie es nicht nötig hatten und ihren Familienbesitz zusammenhielten, oder aber auch, weil sich immer wieder Käufer fanden, die geradezu horrende Preise für ein schlossähnliches Anwesen – oder was man dafür hielt – und das dazugehörende Gelände mit altem Baumbestand zu zahlen bereit waren, um es zu sanieren und zu pflegen. Mochten früher einmal vor allem Fabrikanten und Geschäftsleute ihren verschwenderischen Lebensabend hier genossen haben, so waren es seit einigen Jahrzehnten vor allem Anwälte und Zahnärzte, die an diesem Ort lebten. Und da zumindest die Zahnärzte, wie man weiß, nicht mehr zu den Bestverdienern gehören, wird bald ein neuer Zweig von Einkommensaufsteigern sich hier niederlassen und weiterhin dafür sorgen, dass alles ungeteilt erhalten bleibt, am besten unter Denkmalschutz, schon aus Gründen steuerlicher Absetzbarkeit.
Wenn er in der Stadt zu tun hatte, ging er fast immer zu Fuß. Er war ein begeisterter Spaziergänger, man konnte es seinem elastischen Schritt ansehen. Die Augen weit umherschweifen lassend, entging ihm nichts an den täglichen Veränderungen und Neuigkeiten. Er kannte alle, die hier wohnten oder vorbeigingen, grüßte jovial, blieb auch zu einem kleinen, freundlichen Wort stehen, wenn es sich so ergab. Er mochte das nicht missen. So holte er den Wagen nur aus der Garage, wenn es eine Besprechung an einem Ort gab, der nicht gut zu erreichen war, außerhalb des öffentlichen Nahverkehrs lag. Fernreisen unternahm er ohnehin nur mit der Bundesbahn.
Die Straße war steil und eng. Er fuhr im Schritttempo, bedächtig und vorsichtig. Die Haarnadelkurve war sehr unübersichtlich und oft genug kam es vor, dass gerade dort ein mit den Örtlichkeiten nicht Vertrauter entgegenkam, viel zu schnell die Kurve nahm und man gezwungen war, heftig zu bremsen. Aber jetzt gegen die Mittagszeit war niemand unterwegs, auch der Weg für die Fußgänger, rechts neben der Straße, war menschenleer. Kein Auto parkte unvorschriftsmäßig. Ein heiterer Spätvormittag in träger Ruhe. Weiter unten, wo es geradeaus ging und nicht mehr ganz so steil war, stand ein schwarzes Auto in einer Garagenbucht, gegenüber ein Magnolienbaum, der seine rostbraunen Spitzen über den Zaun bis auf den Gehweg reckte. Vor zwei Wochen war er über Nacht voll aufgeblüht, abends waren die Knospen noch zu und ließen die weißen Blütenblätter erst erahnen, am nächsten Morgen war alles fleischig aufgeplatzt und mischte in das Weiß ein zartes Altrosé, prächtig aufgeplustert und in verschwenderischer Üppigkeit. Und dann hatte es über Ostern einen neuen Wintereinbruch gegeben und der Schnee hatte sich wie ein Leichentuch über die ganze Region gebreitet. Die frühen Blüten hatten diesen jähen Kälteüberfall nicht ausgehalten und waren innerhalb weniger Stunden abgefallen. Als wüster, schmierig-brauner Moder bedeckten ihre Reste den Boden. Jedes Mal, wenn er seitdem vorbeikam, dachte er an dieses vorzeitige Ende allzu früher Pracht.
Plötzlich sah er, schon nahe vor sich, wie der große schwarze Wagen sich aus der Einbuchtung herausbewegte, quer über die Straße zu setzen begann, sehr langsam, aber stetig, ohne auch nur das geringste Ausweichmanöver anzudeuten. Reaktionsschnell erwog er eine Vollbremsung und sah im gleichen Augenblick ein, dass er bei dem abschüssigen Gelände nur in den anderen Wagen hineingeschlittert wäre. In Gefahr und Not bewährt sich der Pilot. Er gab deshalb seinem Gaspedal einen Kick, um durch Beschleunigung und einen ausweichenden Schlenker noch rechtzeitig vorbeizukommen. Fast auf gleicher Augenhöhe sah er in dem fremden Auto zwei Gestalten so unaufgeregt und teilnahmslos, als schliefen sie. Die Gesichter konnte er natürlich nicht erkennen, es waren nur dunkle Schatten. Sein Wagen spurtete nun tatsächlich nach vorn und schon glaubte er, dem geradezu wahnwitzig unachtsamen schwarzen Ungetüm entkommen zu sein, als er einen leichten Schlag hinten links spürte, nicht besonders heftig, aber er genügte, dass seine Hinterachse etwas aus der Spur gedrückt wurde und sein Wagen sich ein wenig neigte, als mache er eine leichte Verbeugung, dann war es schon vorbei.
Er hielt einige Meter weiter unten auf dem Gehweg an und sah in den Rückspiegel. Der schwarze Wagen hinter ihm stand nun schräg mitten auf der Straße, ein drohender Koloss. Niemand rührte sich. Er zog sich seine Handschuhe aus, legte sie auf das Armaturenbrett und stieg aus, ärgerlich, aber beherrscht. Er gehörte nicht zu den Autonarren, die ihr »heiligs Blechle« als das Wichtigste in ihrem Leben ansahen und über der Katastrophe einer geringen Beschädigung schier verzweifelten. Ein Auto war für ihn ein Fortbewegungsmittel, mehr nicht. Sein schon historisches Mercedes-Modell war zwar gut gepflegt, aber nicht als prunkende Antiquität, sondern um ihn möglichst lange benutzen zu können. Er hatte keinerlei Sehnsucht nach einem neuen Wagen, solange es dieser noch anstandslos tat. An einem Sammlerwert hatte er kein Interesse und wenn er darauf angesprochen wurde, ob er dieses Schmuckstück nicht zu einem erheblichen Preis zu veräußern bereit wäre, lachte er nur.
In dem anderen Auto rührte sich niemand. Die beiden Gestalten saßen unbewegt auf ihren Vordersitzen, aus den Augenwinkeln beobachteten sie ihn teilnahmslos. Er warf einen kurzen Blick auf den Schaden, der ihm entstanden war: Das Blech des Radkastens war erheblich eingedrückt, sah aus wie eine zerknüllte Zeitung und berührte fast den Reifen. Dann ging er auf den schwarzen Geländewagen zu, einen mit glitzerndem Frontgitter verzierten kantigen Kasten von martialischem Zuschnitt, fast wie ein Panzerwagen, der offenbar unbeschädigt geblieben war, jedenfalls war nichts anderes zu erkennen. Die beiden Insassen schien dies auch nicht zu interessieren. Sie ließen nicht einmal die Seitenfenster herunter, schauten ihn nur ungerührt an.
»Würden die Herren bitte kurz aussteigen!«
Er war sich nicht einmal sicher, dass sie ihn in ihrem festungsartig verschlossenen Gehäuse gehört hatten, jedenfalls reagierten sie nicht. Er begann nun umständlich und etwas hilflos zu gestikulieren, deutete immer wieder auf sein Fahrzeug, schließlich auch auf das eingedrückte Hinterteil. Sie sahen es wohl und blieben doch steif in ihrer hochbeinigen Panzerkiste sitzen. Er sah sich etwas verlegen um, da aber niemand sonst zu sehen war, beschloss er mit sarkastischer Gelassenheit zu warten. Irgendwann würden die beiden Finsterlinge, denn um solche musste es sich handeln, davon war er inzwischen überzeugt, sich rühren müssen, er hatte Zeit.
Einige Zeit geschah tatsächlich nichts, eine Pattsituation, bei der er sich dennoch sicher war, am Ende der Überlegene zu bleiben. Es dauerte auch gar nicht lange, dass von unten ein kleiner älterer Lieferwagen heraufschnaufte und die Straße von dem noch immer quer stehenden Geländewagen versperrt fand. Er musste anhalten und da sich nichts tat, hupte der Fahrer kurz. Nun schienen es die beiden sich doch anders zu überlegen, jedenfalls stieß der Fahrer des schwarzen Ungetüms energisch zurück, fuhr dann einen heftigen Bogen auf den Gehweg und kam immer noch in einigem Abstand mit scharfem Bremsen hinter dem beschädigten Mercedes zu stehen. Während der Lieferwagen befriedigt weiter den Berg hinauffuhr, stieg der Fahrer des Geländewagens energiegeladen aus, ein schwarz gekleideter Brocken von einem Mann, kraftstrotzend und gefährlich aussehend. Er hatte ein bulliges Gesicht mit Schweinsäuglein, sehr kurz geschorene Haare und trug am Handgelenk eine grobgliedrige schwere Silberkette.
»Dein Auto hat wohl ein kleines Wehwehchen, da musst du Pflaster nehmen.« Das war eine gänzlich unerwartete Bemerkung und dazu in einem Ton, den er nicht einfach hinzunehmen bereit war.
»Oho! Ich habe nicht die Ehre, mit Ihnen bekannt zu sein. Im Übrigen ist dies kein Wehwehchen, sondern etwas mehr als nur eine schmerzhafte Beule. Sie werden mir für den Schaden aufkommen. Ich werde den Wagen abschleppen lassen müssen.«
»Ach, wirklich?«
Während der Schwarze nun tatsächlich unwillig mit ihm mitkam, sah er, wie dessen Beifahrer ausstieg und sich hinten am Heck zu schaffen machte, aber er achtete nicht weiter auf ihn. Stattdessen nestelte er aus dem Brillenfach seines Jacketts eine Visitenkarte, um sie mit seinem Kontrahenten auszutauschen, wobei er auch die Versicherungsdaten notieren wollte. Er streckte ihm die Karte hin, doch der andere ignorierte sie absichtsvoll. Die schwarze Bulldogge stand nun vor dem Hinterrad und lachte breit und zynisch. »Mach dir doch nicht ins Hemd.«
Solche Unverschämtheit konnte er nicht gänzlich überhören, aber allzu sehr mochte er sich mit einem solchen Muskelpaket auch nicht anlegen. So begnügte er sich mit einem zwar marklosen, aber warnend gemeinten überlauten »Na! Na!«, um dann etwas leiser, aber entschieden hinzuzufügen:
»Ihren hilfreichen Ratschlag werde ich natürlich beherzigen. Sie scheinen die hohe Schule der verbalen Entgleisungen mit großem Erfolg absolviert zu haben.«
So viel konternde Eloquenz überstieg nun offenbar doch das Verständnis des Kraftprotzes. Er stieß ein schneidend drohendes »Hei!« aus, um dann eine Probe seiner gänzlich anderen Fähigkeiten abzugeben. Einen Fuß stemmte er gegen den Reifen, mit der rechten, silberbewehrten Hand griff er das eingedrückte Teil, zog heftig daran, um schließlich mit einem scharfen Ruck das Schutzblech nach außen zu biegen, bis es wie ein scharfkantiger Flügel vom Wagen abstand und weit in die Straße ragte. Zunächst hatte es so ausgesehen, als wolle er das Metall nur hilfreich zurechtbiegen, damit der Wagen weiterfahren könne, jetzt allerdings hatte er in gröbster Weise alles verschlimmert und blickte geradezu befriedigt auf sein böses Werk. Das war ein Akt roher Gewalt. Und zudem war in der engen Straße jeder Vorbeifahrende durch das herauskragende Metallteil aufs Äußerste gefährdet, am meisten die Radfahrer. »Das ist wirklich nicht sehr dienlich, was Sie da machen.« Doch der Brutalo lachte nur, rieb sich den Staub von den Händen und zuckte mit den Schultern.
Jetzt war es wirklich an der Zeit, nach der Versicherung zu fragen und die Daten auszutauschen. Wieder streckte er ihm seine Karte entgegen und zog zugleich unmissverständlich einen Schreibstift aus der Tasche. Der Schwarze ging nun ohne besondere Eile und ohne sich weiter umzusehen zu seinem Ungetüm von einem Auto, scheinbar, um die Unterlagen zu holen, der Beifahrer saß bereits wieder an seinem Platz. Doch dann stieg der Muskelprotz ein, ließ sich in den Sitz fallen, rief dabei laut: »Carte blanche!« und knallte die Tür zu. Sofort wurde gestartet und mit einem kurzen Schlenker bog der Roadster auf die Straße und fuhr eilig davon.
Instinktiv hatte er nach dem rabiaten Gebaren bereits damit gerechnet, dass die beiden sich aus dem Staub machen könnten, und war gewappnet, sich das Fabrikat und die Nummer des Autos zu merken, um gleich eine Anzeige zu erstatten. Am besten noch telefonisch, denn er war überzeugt, dass ein so auffälliges Gefährt ziemlich schnell im Stadtgebiet ausfindig zu machen wäre. Doch jetzt, als die beiden scharf an ihm vorbeifuhren, – er glaubte, ein hämisches Grinsen auf dem Gesicht des Beifahrers erkennen zu können –, sah er plötzlich, dass das hintere Nummernschild mit einem geknickten, lose darübergestülpten Pappkarton abgedeckt war, nicht einmal das Stadtkennzeichen war zu erkennen. Auch die Automarke war ihm unbekannt, immerhin erinnerte ihn das Signet an irgendetwas: ein Kreis mit einem horizontalen Querbalken durch die Mitte. Außerdem glaubte er, den Beginn eines Typenschildes gelesen zu haben:»Pat…«
Sofort hatte er die Situation erfasst. Die beiden Ganoven hatten es offenbar direkt auf ihn abgesehen. Das Ganze war kein Versehen oder ein Unfall, sondern eine planmäßige Provokation. Das Verstecken des Nummernschildes war so einfach wie wirkungsvoll. Erst hatte der Wagen quer gestanden, da war es nicht zu erkennen gewesen, und er hatte auch noch nicht darauf geachtet. Dann waren sie mit seinem Auto beschäftigt. Und schließlich der Abgang, so überraschend schnell, dass er nur noch hinterherblicken konnte – auf einen Pappdeckel, der bei der nächsten Kurve von allein davonfliegen würde. Oder unten, vor der Einmündung zur Hauptstraße, würden sie ihn einfach wegnehmen und fortwerfen. Das fiele nicht einmal Passanten auf, falls überhaupt gerade welche vorbeikämen. Sauber ausgedacht.
Noch während er betroffen neben seinem demolierten Fahrzeug stand, ratterten diese ersten Überlegungen durch seinen Kopf, nicht sonderlich systematisch, doch auch nicht verwirrt, dafür war er ein zu nüchtern denkender und kaum zu erschütternder Zeitgenosse. Schließlich fiel ihm etwas sehr viel Naheliegenderes ein und er suchte sein Handy aus der inneren Jackentasche. Aus dem anderen Brustfach nahm er ein kleines Adressbuch und schlug es auf.
»Meister Stalf«, er war sich sicher, an der Stimme gleich erkannt zu werden, »ich habe ein kleines Problem an meinem Fahrzeug, oder besser gesagt, es ist ein größeres. Können Sie mich Huckepack nehmen? Sie werden mich nämlich abschleppen müssen. Ein böser Mensch ist mir reingefahren. – Doch, es fährt noch, aber hinten ist ihm ein gefährlicher Flügel gewachsen, der weit heraussteht. – Natürlich, wenn Sie eine große Zange mitbringen. Aber da fällt mir ein: Haben Sie einen Fotoapparat? Man müsste das Auto vielleicht wegen der Versicherung erst fotografieren, im jetzigen Zustand. – Wirklich? Sie sind ein reizender Mensch, ich bin Ihnen sehr verbunden. Der Wagen steht gleich hundert Meter unterhalb meiner Wohnung. – Ja, im Kapellenweg. Wenn Sie gleich kommen, würde ich dort auf Sie warten. Aber es dürfte nicht zu lange dauern. – Ja, ich muss zu einer Sitzung. – Ach, Sie sind wirklich sehr hilfsbereit. Wenn ich Sie nicht hätte … – Großartig. Vielen Dank, sehr liebenswürdig.«
Otto von Hübner, sein Name lässt sich nicht länger verschweigen, lebte als Anwalt schon seit unvordenklichen Zeiten hier oben, allein im Haus mit Frau Ritter, einer weitläufigen Verwandten seiner verstorbenen Frau, die ihm auf diskrete Weise den Haushalt betreute, ohne allzu sehr in seine rüstige Selbstversorgung einzugreifen. Das Frühstück pflegte er sich selbst zu bereiten, mehrmals in der Woche aßen sie gemeinsam zu Mittag, aber stets nach vorheriger Verabredung, denn oftmals ging er auswärts essen. Im Grunde sorgte sie vor allem für seine Wäsche und sah auf Ordnung und Sauberkeit, im Übrigen war es mehr eine Wohngemeinschaft, in der jeder eigenen Interessen nachging, aber gelegentlich sah man beide zusammen im Konzert oder im Theater.
Eine eigene Kanzlei unterhielt er nicht, sein Büro war im Haus. Früher war er einmal Syndikus in einem Betrieb gewesen, hatte dann lange Jahre einen Wirtschaftsverband geleitet und war jetzt, als Pensionär, vor allem beratend tätig für manche großen Stiftungen, Familienbetriebe in ihren Erbauseinandersetzungen, vor allem aber für einige potente Investoren, bei denen sein Rat und seine Erfahrung in Handels- und Gesellschaftsrecht gefragt waren. Es waren dies sehr persönlich zu führende Mandate, bei denen der Schriftverkehr wenig umfänglich, die mündliche Beratung und Anwesenheit bei wichtigen Besprechungen jedoch unerlässlich war. Im Übrigen fand er die Unterstützung einer älteren, erfahrenen Schreibkraft, die ganz in der Nähe wohnte und sich am Ende ihres Arbeitslebens mit solchen freien, aber durchaus gut bezahlten Auftragsarbeiten begnügte.
Eine geregelte Arbeitszeit war mit seiner Beschäftigung nicht verbunden. Er stand zur Verfügung. Und das bedeutete oft mehrtägige Konferenzen auswärts, gelegentlich Besprechungen bis tief in die Nacht, auch lange Telefonate außerhalb jeder Geschäftszeit, sogar sonntags, von den Vorbereitungen in seiner einschlägig bestückten Bibliothek ganz zu schweigen. Mit dem juristischen Alltagsgeschäft hatte er nichts zu tun, eher mit langfristigen Strategien eines Konzernaufbaus, mit Nachfolgeregelungen, häufig auch mit den zugehörigen Fragen des Steuerrechts. Er war bekannt für seine pfiffigen und ungewöhnlichen Ideen, von deren Tragfähigkeit und realistischer Chance er oftmals erst zu überzeugen hatte.
Aber er genoss auch die Vorteile einer sehr freien Gestaltung seiner Lebensweise. Im Grunde war er ein Schöngeist, und Literatur und Kunst, auch Musik interessierten ihn mindestens ebenso wie seine Juristerei. Die persönliche Bekanntschaft mit Künstlern war ihm wichtig, gesellschaftliche Anlässe, bei denen Kunst und Geld zusammengeführt wurden, ließ er kaum aus, seien es Preisverleihungen, Ehrungen, Vernissagen oder Festivals wie Salzburg oder Baden-Baden. Um sich nützlich zu machen, versuchte er immer wieder, Künstler, Geldadel und Investoren dabei miteinander bekannt zu machen. Junge Talente zu fördern, war ihm ein besonderes Anliegen. Aber alles musste in einem festlichen Rahmen stattfinden, darauf legte er Wert. Diskretion und Öffentlichkeit schlossen sich nicht aus, ließen sich sogar nützlich verbinden. Er galt als ein Mäzen, aber sein eigener finanzieller Beitrag war dabei nicht einmal sehr groß. Nur war er in entscheidenden Momenten, wenn ein neues Projekt auszustatten war, immer dabei, gewissermaßen als Gründungsvater und als jemand, der die potentesten Geldgeber ansprechen, mitziehen und motivieren konnte. Den passenden Ton zu finden, Vertrauen zu gewinnen und die richtigen Leute zusammenzuführen – darauf beruhte sein Erfolg. Kein Wunder, dass er umworben war und in diesen Kreisen den besten Ruf genoss. Es wurde ihm gedankt, indem er als Erster zu allen spektakulären Gelegenheiten eingeladen wurde. Überall hielt man seine Anwesenheit für hilfreich und vorteilhaft. Bei längst ausgebuchten Hochglanzereignissen fand man für ihn immer noch einen Platz und natürlich in den vordersten Reihen.
Ein solcher Mensch ging auch mit den unangenehmen Zufällen des Lebens gelassen um. Dass ein geordnetes Leben von viel Unordnung umgeben und begleitet wird, war ihm eine selbstverständliche Einsicht in die menschlichen Unzulänglichkeiten. Nicht, dass ihm das gefiel, aber darum zu wissen, erleichterte ihm, es zu ertragen. Er gehörte zu jenen Schöngeistern, die auch mit der Exzentrik allen Künstlertums vertraut waren, den Abgründen, der Maßlosigkeit. Und insgeheim hatte er seine Bewunderung dafür. Zwar war er für sich selbst zu nüchtern, zu sehr Verstandesmensch und neigte zu keinerlei Exzessen. Schon einen richtigen Wutanfall mit törichten Ausfällen und überschäumenden Verwünschungen hätte er sich selbst nie verziehen. Sein Leben verlief überlegt, durchreflektiert, vorausschauend. Diese Selbstbeherrschung empfand er geradezu als Genuss und wenn er zur Selbstliebe je fähig war, dann gerade darin. Aber dass die meisten Menschen dieses Maß an Selbstkontrolle nicht aufbrachten, von allerlei Leidenschaften durchgeschüttelt wurden ebenso zu ihrem Verderben wie zu ihrem Vergnügen, hätte ihn nie dazu gebracht, sie deswegen zu verachten und sich selbst für etwas Besseres zu halten. Schlimmstenfalls versuchte er, ihnen aus dem Weg zu gehen.
Als er gegen Spätnachmittag mit einem Taxi nach Hause kam und die Stelle passierte, an der einige Stunden vorher der Überfall geschehen war, gingen ihm alle Einzelheiten noch einmal wie ein Film durch den Kopf. Die beiden Schurken hatte er noch nie zuvor in seinem Leben gesehen. Und doch hatten sie es gerade auf ihn abgesehen, daran hatte er keinen Zweifel. Wer auch immer dahinterstand, man wollte ihm wohl eine kleine Demütigung zukommen lassen. Und dies bedeutete, dass sie wohl nur die Handlanger dafür waren. Die Frage war nur, wer solche Auftragsganoven auf ihn hetzte. Darüber würde er nachdenken müssen. Hatte es mit der kleinen Konferenz zu tun, zu der er auf dem Weg gewesen war? Wohl kaum, wer konnte davon wissen? Nicht einmal Frau Ritter hatte er davon verständigt. Er pflegte seine Unabhängigkeit, indem er sie mit beiläufigen Einzelheiten seines Tuns und Lassens verschonte. Es sollte eine Beratung unter vier Augen sein, telefonisch verabredet, mehr nicht. Niemand sonst wusste davon. Oder ging es um etwas gänzlich anderes? Eine indirekte Warnung? Aber wem sollte sie gelten? Er war sich eigentlich ziemlich sicher, keine Feinde zu haben. Aber was waren Feinde? Ein etwas hochtrabendes Wort, so ungestüm ging es bei ihm nicht zu. Sicher, es gab immer Interessenskollisionen, gegensätzliche Auffassungen, Parteinahme.
Dem einen steht Nachbars Baum zu nah an der Grenze und lässt von den überhängenden Ästen auch noch das Laub herabfallen. Der andere will den Baum dennoch nicht beschneiden, weil er auf den Sichtschutz Wert legt. Ein Dritter ergreift Partei: Doch, der Baum muss weg, weil er mir die ganze schöne Aussicht nimmt. Und dann wird auch noch die Baumschutzordnung herangezogen, die das Fällen von Bäumen von einem bestimmten Stammumfang an verbietet. Schließlich mischt sich einer ein, der erst kürzlich hierhergezogen ist und plädiert dafür, die Zäune einzureißen und so eine weiträumige Parklandschaft mit alten Bäumen, aber ohne Eigentumsgrenzen entstehen zu lassen. Schließlich biete diese Gegend eine einmalige Chance für solche Verschönerungen, an denen doch alle teilhaben könnten, die schließlich allen zugute kämen. Na ja, da konnte man nun wirklich verschiedener Meinung sein. Aber es war doch lächerlich zu glauben, dass solche Auseinandersetzungen inzwischen zu handfesten Drohungen oder gar drastischen Attacken führen sollten.
Wem sollte er von diesem – »Überfall« berichten? Es war doch ein Überfall, wie sollte man es anders nennen? Gezielt, brutal, einschüchternd. Sollte er gleich die Polizei einschalten? Aber die würden das für ein Märchen halten. Sicher, ein Unfall mit Fahrerflucht, das ließ sich noch nachvollziehen. Aber Absicht? Bei einem ehrenwerten, hochgeachteten Bürger dieser Stadt? Ohne weitere Indizien oder Zeugen? Das klang doch etwas senil. Aber selbst wenn man ihm diese Geschichte abnehmen würde, in welchem Lichte würde er selbst plötzlich dastehen? Jemand, der offenbar mit Leuten aus der Unterwelt verkehrte und dabei in Scharmützel mit ihnen geriet? Was hatte der denn mit diesem Milieu zu tun? Das ging doch wohl nicht mit rechten Dingen zu? Nein, das war einfach peinlich. Man würde ihn schief ansehen und überdies in Erklärungsnöte bringen. Wie sollte er sich jungen, unerfahrenen Beamten gegenüber verständlich machen? Peinsam, auch nur darüber nachzudenken. Und doch nagte es an ihm. Nicht, dass er selbst sich etwas vorzuwerfen hatte. Er hatte sich keine Blöße gegeben und sich durchaus so verhalten, wie er es von sich selbst erwartete, selbst in der Niederlage überlegen. Und doch ohnmächtig und ratlos. Aber gerade das durfte nicht sein. Er musste die Sache völlig nüchtern betrachten, wie ein Unbeteiligter, die einzelnen Bestandteile aufdröseln und trennen. Eigentlich waren es doch zwei verschiedene Geschehnisse. Das eine: Da hat jemand einen ziemlichen Hass auf mich. Er will ein aggressives Zeichen setzen, mir eine Lektion erteilen, wenngleich ich nicht weiß, wofür. Keine Vorstellung, wer das sein könnte. Vor allem, er will mir nicht selbst an den Karren fahren, um sich nicht zu erkennen zu geben, das war so geplant. Das andere betrifft die Ausführung: Zwei Hallodris bekommen diesen Auftrag zu einer kleinen Demütigung, wahrscheinlich wissen sie nicht einmal, warum und weshalb. Es interessiert sie auch nicht. Wie sie das so erledigen, dass sie heil davonkommen, ist ihre Sache. Vermutlich haben sie ausgekundschaftet, wann mein Wagen vor der Garage steht und ich irgendwann wegfahren werde. Dann brauchten sie nur noch zu warten. Einfache Beobachtung genügte. Schöne Typen, einschüchternd, durchaus clever. Und das alles für ein schnell verdientes Handgeld. Ohne weiter nachzufragen.
Beiden Vorgängen liegt äußerste Präzision zugrunde. Der Auftraggeber ist dabei von ungebremster Leidenschaft motiviert, die beiden Ausführenden jedoch allein vom schnell verdienten Geld. Das ist der einzige, aber entscheidende Unterschied.
Wie aber darauf reagieren? Die beiden Ganoven ausfindig zu machen, könnte Aufgabe der Polizei sein. Es ginge um Unfall mit Fahrerflucht. Nur einen Unfall, denn ein Vorsatz oder gar versuchte Körperverletzung lassen sich nicht nachweisen, obschon sie offensichtlich mitgeplant waren. Aber ohne Zeugen? Und bei der Fahrerflucht würden die beiden wahrscheinlich frech behaupten, sie hätten mir sogar noch geholfen, die Delle wieder geradezubiegen. Selbst dabei käme nicht viel heraus. So gesehen haben die nicht einmal schlechte Arbeit gemacht, abgesehen von ihrem rüpelhaften Auftreten. Geringes Risiko, begrenzter Schaden, ganz nach Anweisung.
Den Drahtzieher ausfindig zu machen, dürfte schwieriger sein. Die beiden Halunken (wenn man sie denn hätte) würden ihren Hintermann auf keinen Fall preisgeben, das gehörte zum Ehrencodex. Und da der sich ja die Hände nicht selbst schmutzig gemacht und insofern keine Spuren hinterlassen hat, bliebe nur die Suche nach einem Motiv.
Allein die Befragung durch die Beamten: Haben Sie Feinde? Was sollte er darauf antworten? –
Nicht, dass ich wüsste.
Könnte es sein, dass aus Ihrer Anwaltstätigkeit irgendeine Gegnerschaft oder Feindseligkeit herrühren könnte? So, wie Sie es schildern, war es doch ein brutaler Angriff, bei dem auch eine Körperverletzung nicht ausgeschlossen werden musste.
Man würde also nach seinen Mandanten fragen, ob es zu ihnen irgendwelche Vermutungen gäbe. Aber hier sollte man besser keine Polizei herumschnüffeln lassen. Das fiel nun wirklich unter das Anwaltsgeheimnis. Und an öffentlichem Aufsehen war ihm keineswegs gelegen. Nein, keine Polizei. Es müsste andere Wege geben.
II.
Graber überlegte schon eine ganze Weile, wie er mit dieser Klientin fertig werden sollte. Sie war nicht nur äußerst aufgebracht und redete dauernd dazwischen, sondern sie ließ ihren Sohn, um den es doch eigentlich ging, kaum zu Wort kommen, schon gar nicht, wenn er den eigentlichen Sachverhalt schildern sollte. Ein im Grunde ziemlich harmloser Ladendiebstahl, der von einem Kaufhausdetektiv beobachtet worden war, hatte in einem wüsten Gerangel bei der Aufnahme der Personalien im Büro geendet. Sowohl der Detektiv wie auch der Delinquent hatten erhebliche Blessuren davongetragen und beschuldigten sich nun gegenseitig der Körperverletzung.
Der Sohn, gerade noch minderjährig, von schlaksiger, aber sportlicher Gestalt, grinste vor sich hin, schien die Sache nicht sehr ernst zu nehmen und zeigte eine leicht verächtliche Distanz zu seiner Mutter. Frau Müller, eine kleine, etwas korpulente Beamtenwitwe, drückte schon durch die Art, wie sie sich breit auf ihrem Stuhl vor dem Schreibtisch platzierte und ihren Sohn, der schräg hinter ihr saß, fast verdeckte, deutlich genug aus, wer hier das Sagen haben sollte. Als sie aber schon am Beginn der Schilderung der Vorfälle, auf die es doch ankam, wenn eine Verteidigungsstrategie sinnvoll entwickelt werden sollte, resolut dazwischenfuhr »Sei still, Bub!« und dann mit einem so plastischen Bericht anhob, als sei sie selbst dabei gewesen, reichte es Graber und er bat sie, draußen zu warten.
Er selbst schloss hinter ihr die Tür, nicht ohne vorher seiner Bürovorsteherin einen sprechenden Blick zuzuwerfen, den sie nur mit einem kaum merklichen Kopfnicken beantwortete. Die Verständigung zwischen Graber und ihr konnte sich in solchen Situationen mit knappsten Zeichen begnügen. Sie waren ein langjährig eingespieltes Team von zwar sehr unterschiedlicher Wesensart, aber beide in dem Ziel vereint, eine recht und schlecht laufende Anwaltspraxis einigermaßen über die Runden zu bringen. Er nannte sie seit jeher Elfi, obschon sie eigentlich Elfriede hieß, aber das klang doch allzu altmodisch. So hatte sich diese Verkürzung längst unter allen ihren Freunden und Bekannten durchgesetzt, obschon sie nichts Elfenhaftes an sich hatte.
Frau Müller maulte wieder los:
»Ihr Chef hat mich nicht einmal ausreden lassen.«
Aber Elfi traf offenbar den richtigen Punkt, als sie antwortete:
»Vor Gericht steht Ihr Sohn allein, da werden Sie ihm kaum helfen können. Und wenn Sie vor dem Richter dazwischenquatschen, werden Sie ohnehin auf den Flur verbannt. Da kann nur noch einer helfen und das ist der Anwalt. Und ich sagen Ihnen, Herr Graber setzt sich für ihn ein, das werden Sie sehen.« Jedenfalls beruhigte sich Frau Müller allmählich und nahm neben dem missmutigen älteren Herrn Platz, der bereits im Wartebereich der kleinen Kanzlei saß. So konnte Elfi sich wieder dem Computer zuwenden, neben sich eine aufgeschlagene Akte, an der anderen Seite das Telefon, hinter sich die Tür zum Büro, links vor sich der Garderobenständer neben dem Eingang und rechts dahinter die Flurerweiterung mit der Sitzecke. Sie hatte alles im Blick.
Der Vormittag war ruhig angelaufen. Graber, der ohnehin meist erst spät in die Praxis kam, hatte um zehn Uhr einen Gerichtstermin gehabt, eine Strafsache, aber da eine Schöffin krank geworden und der Ersatzschöffe so schnell nicht aufzufinden war, wurde die Verhandlung zum Ärger des Richters kurzfristig verschoben. Angemeldet war nur noch Herr Keilholz, der bereits wartete, – eine unangenehme Mietsache, bei der ein Räumungsbefehl beantragt war. Dabei hatte der Hausbesitzer allerdings völlig überzogen. Zwar war der arbeitslose Keilholz bereits sieben Monate im Mietrückstand und hatte weder auf die Mahnungen noch auf die Kündigung reagiert, zugleich hatte er aber Hauswartsaufgaben übernommen, zwar ohne Vertrag, doch stets bezahlt und insofern wohl zufriedenstellend ausgeführt. Mit solchen Dingen sich herumzuschlagen, machte viel Arbeit und meist lief es darauf hinaus, die Räumung noch einmal abzuwenden, also auf irgendeine Art von Vergleich, jedenfalls nichts, an dem etwas zu verdienen war. Eher so etwas wie Sozialarbeit. Aber hätte man Keilholz abwimmeln sollen? Oder auch nur können?
Und mit Herrn Öcalan, dessen Akte Elfi aufgeschlagen hatte, war es nicht viel anders, ein Kurde, bei dessen Namen allein vermutlich schon sämtliche Alarmglocken in der Ausländerbehörde losbimmelten. Er war ständig von der Abschiebung bedroht, nicht einmal eine formelle Duldung hatte er bisher erreicht. Seine einzige Chance bestand darin, dass man der Ausländerbehörde irgendeinen Verfahrensfehler nachweisen konnte, der einen neuen kleinen Aufschub bedeuten konnte. Aber trotz der ökonomischen Katastrophe, die solche Fälle für die Kanzlei bedeuteten, verschafften sie doch eine tiefe moralische Befriedigung, wenn es gelang, sie von Quartal zu Quartal am Köcheln zu halten. Was nicht endgültig entschieden wurde, war schon ein halber Sieg, bedeutete es doch für die Mandanten, dass wenigstens eine endgültige Niederlage abgewendet wurde, die nur ausweglose Schicksalsschläge zur Folge haben konnte.
Aber darin waren Graber und Elfi sich völlig einig, dass sie dieses Anwaltsbüro nicht allein zum Geldverdienen betrieben, sondern mit dem Anspruch, Leuten zum Recht zu verhelfen, die auf ihre Hilfe angewiesen waren. Nicht weil sie unschuldig wären, sondern weil das Recht immer bedroht ist, sei es von der Bürokratie, einer eigensinnigen Staatsverwaltung, sogar von der Justiz selbst, sei es von der Macht des Geldes. Das Recht aber ist das Zentrum aller demokratischen und sozialen Errungenschaften, ist ihr Garant. Dies war die unausgesprochene politische Philosophie, die sie teilten, ein nicht zu verachtender Rest, der von den Träumen von einer besseren, freieren und gerechteren Welt übrig geblieben war. Sie beide hatten sich schon im Studium kennengelernt, einem Studium, das noch von der Aufbruchsstimmung der 68er-Zeit geprägt war, auch wenn sie der Generation danach angehörten. Damals waren sie einige Zeit eng zusammen gewesen, hatten zwar ihr Lager geteilt, es aber nie bis zu einer gemeinsamen Wohnung gebracht. Schließlich war die Sympathie wärmebeständiger geblieben als die Liebe. Beide hatten sie noch in der Volkszählungskampagne mitgewirkt, aber Elfi war dann andere Wege gegangen, hatte noch vor dem Juraexamen ihr Studium abgebrochen, war nach Frankfurt gezogen, hatte einige Jahre in Galerien gejobbt. Erst Jahre später hatten sie sich zufällig wiedergetroffen, beide nicht gerade vom Erfolg verwöhnt, von Karriere konnte man ohnehin nicht sprechen. Graber hatte es in einigen Kanzleien als Anwalt versucht, sich aber nie wohlgefühlt und manchmal hatte er auch den Eindruck, dass ihm die lukrativeren Fälle immer von den Kollegen weggeschnappt wurden. So hatte er den riskanten Entschluss gefasst, lieber allein im eigenen Büro zu arbeiten. Elfi, ein paar Jahre jünger als Graber, nun Mitte 40, suchte gerade eine Veränderung und hatte sich bereit erklärt, Graber das Büro zu führen. Er hätte keine Bessere dafür finden können.
Frau Müller rutschte unruhig auf ihrem Stühlchen herum, wahrscheinlich wäre sie am liebsten wieder in das Büro gestürmt und hätte das Wort an sich gerissen. Elfi beobachtete sie unauffällig und war zu jeder Schlichtung bereit, als plötzlich das Telefon klingelte. Sie meldete sich mit dem ausgeleierten Sprüchlein, das ihr gedankenlos aus dem Mund flutschte:
»Anwaltspraxis Graber. Sie sprechen mit Elfriede Schamberger. Was kann ich für Sie tun?«
Eine geschmeidige Stimme meldete sich mit überdeutlicher Aussprache:
»H-ü-b-n-e-r. Kann ich Herrn Kollegen Graber sprechen?«
Sie war bei unbekannten Anrufern von größter Aufmerksamkeit und das Wort »Kollege« hatte sie nicht überhört. Sie brauchte nur den Bruchteil einer Sekunde in ihrem Gedächtnis zu kramen, um dann nachzufragen:
»Darf ich fragen, sind Sie Herr von Hübner?«
»Ganz recht.«
Es war nicht so, dass ihm der zusätzliche Namensbestandteil unwichtig gewesen wäre, er legte sogar großen Wert darauf, dennoch meldete er sich am Telefon stets nur mit »Hübner«, nicht aus falscher Bescheidenheit, sondern sogar gänzlich unbescheiden. Denn im Grunde erwartete er, dass man ihn kannte und ihn sogleich »vollständig« anredete. Kam es einmal vor, aber das war selten genug, dass er in einer ihm fremden Umgebung gezwungen war, sich selbst vorzustellen, pflegte er überdeutlich zu sagen: »Hübner, Otto von Hübner.« Es sollten keine Missverständnisse aufkommen.
»Einen Moment bitte, ich verbinde.«
Doch zunächst drückte sie auf die Unterbrechertaste und meldete sich bei Graber:
»Da ist ein Herr von Hübner in der Leitung.«
»Kenn ich nicht.«
»Vorsicht! Erzähle ich dir später. Wirtschaftsanwalt, ein hohes Tier.« Sie hatte sehr verhalten ins Telefon gesprochen, merkte aber, dass Frau Müller aufmerksam herübergeschaut hatte.
Graber war nicht ganz schlau geworden, was dieser Kollege wirklich von ihm wollte, es schien um einen Verkehrsunfall zu gehen und darum, dass er um die Mittagszeit zufällig in der Stadt sei und in der Kanzlei vorbeischauen könne. Natürlich wollte er keinen Termin vereinbaren (so sind solche Herren, aber das Wartezimmer mögen sie auch nicht, sondern rauschen am liebsten gleich ins Büro durch, »nur auf ein Wort«). Andererseits konnte es ein neues Mandat bedeuten, immerhin einen ordentlichen Versicherungsfall, und da soll man sich nicht anstellen. Natürlich hatte er Zeit (und würde notfalls sogar auf ihn warten).
Das musste er aber keineswegs. Gerade nachdem Graber Herrn Öcalan mit aufmunternden Worten verabschiedet hatte, kurz nach halb eins, kam Herr von Hübner ins Büro. Ganz gegen ihre Gewohnheit fragte Elfi weder nach Namen noch nach Begehr, sondern nahm ihm nach der Begrüßung sogleich den Staubmantel ab und öffnete die Tür zum Büro. Verwechslungen waren nicht möglich, ein solcher Besucher hatte sich noch nie in ihre Kanzlei verirrt. Die ganze imposante Erscheinung, groß, würdevoll, dabei aber höchst umgänglich und mit heiterem Strahlen im Gesicht, spiegelte einfach eine andere Liga als das sonstige Publikum. Sie hatte Graber schon zuvor instruiert mit allem, was ihr aus ihrer Frankfurter Galerienzeit erinnerlich war, und das war eigentlich nur vom Hörensagen. Natürlich vorwiegend aus der Museums- und Kunstszene. Und dass er mit wirklich allen führenden Wirtschaftsleuten persönlich bekannt sei. Rechtsanwalt, ja, aber ohne eigene Kanzlei. Was er tatsächlich arbeite und für wen, das wisse niemand. Da müsse schon eine Menge Kohle sein, jedenfalls gelte er als ein großer Kunstmäzen.
Elfi ging vor, Hübner folgte nur zögerlich, weil er sich ungeniert umsehen und einen optischen Eindruck von der Kanzlei gewinnen wollte, dann stellte sie Graber den Gast vor (statt umgekehrt). Sie dachte, dass es so richtig und geboten sei, schließlich kam er als Mandant, und selbst ein sehr bescheidenes Anwaltsbüro müsse auch eine gewisse Selbstsicherheit ausstrahlen. Die unverkennbare Verlegenheit Grabers, die sie sogleich bemerkte, überspielte sie, indem sie dem Besucher einen Kaffee anbot.
»Das ist reizend von Ihnen, vielen Dank, aber so kurz vor dem Mittagessen …«
Die Erzählung Herrn von Hübners von der eindeutig provozierten Beschädigung seines Autos am Vortag war sehr anschaulich durch blumige Ausschmückungen. Insbesondere das vulgäre Benehmen des bulligen Fahrers – »Silberkette und Gefängnishaarschnitt« – schilderte er mit köstlichem Humor. Er zeigte sich dabei keineswegs beunruhigt, nahm es eher als einen Ganovenstreich von Leuten, mit denen er sich eigentlich nicht abzugeben pflege oder gemeinmachen wolle, aber ganz durchgehen lassen könne man so etwas natürlich auch nicht. Graber versuchte, sich die Szene vorzustellen, war sich aber nicht sicher, ob er an seiner Stelle nicht in panische Angst geraten wäre. Aber dann interessierte ihn vor allem, wer dahinterstecken könnte. Wenn es keine persönlichen Feinde gab, wie Herr von Hübner versicherte, müsse man vielleicht an einen terroristischen Hintergrund denken. Indem er es aussprach, erschrak Graber sogleich, dass er selbst ein so abgedroschenes Vorurteil, wie es sich nur die Boulevardpresse ausdenken konnte, ins Gespräch brachte. Er bekam auch sogleich eine Abfuhr:
»Unsinn. Entschuldigen Sie, das halte ich für gänzlich abwegig. Das hieße nur, ein Schreckgespenst an die Wand zu malen.«
Graber lachte etwas gekünstelt auf, um seine Bemerkung selbst damit als Scherz zu entwerten.
»Sie haben völlig recht, diese Art Terrorismus gibt es bei uns zum Glück nicht. Wir leben doch in einer ziemlich friedlichen Ecke und nicht in Moskau.«
Noch so ein pauschales Vorurteil, das ihm da rausgerutscht war. Graber nahm sich vor, sich besser zu kontrollieren.
»Sehen Sie, ich will mich damit nicht weiter ins Gespräch bringen. Und deshalb will ich auch nicht die Polizei einschalten. Wenn die das nämlich richtig ernst nähme, und das müsste sie doch wohl, dann ginge das womöglich los mit verstärkter Bewachung und Personenschutz und ähnlichen Vorstellungen. Dann würde ständig eine Polizeistreife da oben, wo ich wohne, herumspazieren und das ganze Umfeld aufgeschreckt werden. Unter Umständen gäbe es sogar einen Artikel in der Zeitung. Nein, danke. Das möchte ich niemandem von meinen Nachbarn zumuten, mir selbst auch nicht.«
»Sie wohnen am Lorettoberg?«
»Ja, kennen Sie die Gegend?«
»Nein, nicht so genau.«
»Es ist sehr ruhig da oben. Ziemlich alte Villen in großen Grundstücken. Und es wohnen auch hauptsächlich ältere Herrschaften dort, Rentner und Pensionäre. Ein sehr seriöser Umkreis. Im Allgemeinen wenigstens. Mein neuer Nachbar wird sich da hoffentlich gut einfügen.«
»Darf ich fragen, wer das ist?«
»Ach, wie heißt er noch? Fällt mir im Moment nicht ein. Dieser bekannte Hamburger Modeunternehmer. Von dem haben Sie sicher schon gehört. Er hat gerade sein Unternehmen verkauft und will sich jetzt hierher zurückziehen. In der Presse wurde über ihn und seine legendären Feste und Partys immer sehr spektakulär berichtet. Ein richtiger Sonnyboy. Da kam immer die ganze High Society, die Stars und die Sternchen und aufregende Models natürlich und der ganze Regenbogenverein. Aber das wird ja nun vorbei sein. Eine solche Gesellschaft haben wir ja hier gar nicht. Zum Glück.«
»Und so jemand will sich nun hier ansiedeln?«
»Er ist schon da. Ich habe aber wenig von ihm bemerkt, an seinem Haus wurde lange renoviert, eine recht große, alte Villa. Er soll eine umfangreiche Kunstsammlung haben, moderne Kunst. Platz genug wird dort sein. Allein der Eingangsbereich mit einem riesigen Treppenhaus, – da lässt sich einiges unterbringen. Eine schöne Altersresidenz. Wissen Sie, dies ist eine beliebte Gegend. Das beste Wetter von ganz Deutschland, wenigstens das wärmste. Hervorragende Restaurants, gute Weine. Die Nähe zu Frankreich und der Schweiz. Hier haben sich schon immer vermögende Pensionäre gerne zur Ruhe gesetzt. Und um auf unsere Geschichte zurückzukommen: Mir liegt daran, dass es bei uns dort oben so ruhig bleibt. Deshalb möchte ich auch kein großes Aufheben machen.«
Die Frage blieb freilich im Raum und es dauerte recht lange, bis Graber sie beantwortet bekam, weil er sich nicht traute, sie direkt zu stellen: was er als Anwalt denn nun eigentlich dabei tun könne. Es lief darauf hinaus, die Sache mit der Versicherung zu regeln. Graber wagte nicht einzuwenden, dass dies vermutlich nur bedeute, den Schaden zu melden und bestenfalls einige Nachfragen zu beantworten. Gewiss, ein hochvermögender Wirtschaftsanwalt schlägt sich nicht gerne mit Versicherungen herum, das war Kleinkram, den man andere erledigen ließ. Und so fragte er zunächst nur, wie er denn auf ihn gekommen sei.
»Sie wurden mir von einem Kollegen aus der Anwaltskammer genannt. Ich fragte nach einem jungen, handsamen Anwalt, der auf dem Quivive ist, auch Strafsachen bearbeitet und noch nicht überlastet ist.«
Graber wunderte sich über die Ausdrucksweise. Vor allem das Wort »handsam« überraschte ihn, es konnte nur so etwas wie »zahm« bedeuten. Aber doch sicher nicht gegenüber der Versicherung? Da müsste er allerdings »auf dem Quivive« sein. Also »handsam« gegenüber Herrn von Hübner? Oder anders gesagt, er solle nach seiner Pfeife tanzen? Und dazu hatte man ausgerechnet ihn empfohlen? Einen Augenblick überlegte er, ob er diesen ohnehin lächerlichen Auftrag nicht ablehnen sollte. Andererseits konnte der Kontakt zu einem offenbar so bekannten und einflussreichen Herrn nur von Nutzen sein. Wofür auch immer, das ließ sich noch nicht absehen. Und so gab er sich »handsam« und wartete ab, was weiter gemeint war.
Mit einiger Umständlichkeit schälte sich heraus, dass er zunächst bei der Straßenverkehrsbehörde herausbekommen solle, – als Strafverteidiger habe man doch gewiss Kontakte dorthin (eine merkwürdige Unterstellung) –, wer hier oder in der näheren Umgebung ein solch ungewöhnliches Fahrzeug fahre. Er selbst kenne sich mit Autofabrikaten nicht aus. Er malte auf einem der leeren Notizzettel, die auf dem Schreibtisch lagen, ein Gebilde, das wie das Zeichen der Londoner U-Bahn aussah, und schrieb »Pat…« dazu. Ob dann ein Strafantrag gestellt werden solle, müsse man sehen, je nachdem. (Was solche Herren sich nur vorstellen, er ist doch kein Detektivbüro.) Graber blickte etwas verlegen auf die ungelenke Zeichnung vor ihm, ließ sich das schwarze Auto noch einmal genauer beschreiben und meinte dann lakonisch:
»Ein NissanPatrol.«
Der alte Herr sah ihn bewundernd an, lachte vergnügt auf und rief:
»Großartig! Sie kennen sich offenbar bestens in dieser Szene aus. Sie sind der richtige Mann für mich.«
Ob er Graber damit als einen Anwalt solch düsterer Gestalten wie der an seinem Überfall beteiligten identifiziert haben wollte, blieb unklar. Meinte er etwa, unter seinen Klienten könnten diese beiden zu finden sein? Wollte er ihn gar nur ausforschen? Graber wurde zunehmend etwas misstrauisch, worum es eigentlich ging, verscheuchte diese Gedanken aber wieder, als der Ehrfurcht gebietende Kollege unbekümmert fortfuhr, es könne sein, dass er mit der Zeit noch einige Aufträge mehr für ihn habe. Mit Alltagsdingen habe er keinerlei Erfahrung. (Was waren denn juristische Alltagsdinge?) Er brauche einen versierten Allrounder und wolle es gerne mit ihm, Graber, versuchen. (Ein etwas seltsames Mandat, aber, na schön.)
Unter diesen Umständen das Beste war freilich, dass Herr von Hübner erklärte, nun gerne eine Kleinigkeit essen zu wollen, und fragte, ob Graber ihn nicht begleiten wolle. Vielleicht habe er ja auch eine Idee, wo man hier in der Nähe hingehen könne. Graber vermutete, dass dies auf eine Einladung hinausliefe und überlegte kurz, bevor er den Vorschlag machte, die Osteria Oporto aufzusuchen. Er war sich sicher, dass dort um diese Zeit vor allem Anwaltskollegen verkehrten. Und mit Herrn von Hübner zusammen dort gesehen zu werden, machte sich sicher nicht schlecht fürs Renommee.
Elfi wollte dem ungewöhnlichen Besucher in den Mantel helfen, aber der nahm ihn ihr dankend aus der Hand und zog ihn sich allein über. Dabei sah er sie so überaus freundlich an, als wollte er sagen, dass er solche Hilfe von einer so reizenden Dame nicht annehmen könne. Graber stand wie ein hilfloser Stoffel daneben. Schließlich verabschiedete er sich sogar noch mit einem feinfühligen Handschlag. So etwas kam in dieser Kanzlei höchst selten vor. Aber Elfi benahm sich dabei, als wäre es eine gewohnte Selbstverständlichkeit. Graber öffnete wenigstens mit komplimentierender Geste die Türe.
*
Noch während man ihre Schritte auf der knarzenden Treppe nach unten hörte, klingelte das Telefon. Elfi erkannte, bevor sie den Hörer abnahm, auf dem Display sogleich die Nummer und flötete los:
»Das ist lieb, dass du anrufst. Gerade, als hättest du deine Augen überall. Eben sind alle gegangen und ich kann Pause machen.«
»Schön für dich. Bei mir ist es wie im Taubenschlag. Ich kann auch nur ganz kurz sprechen. Sehen wir uns heute Abend?«
»Wenn du magst.«
»Ich möchte dich unbedingt sehen. Und vielleicht eine Kleinigkeit kochen. Du weißt, wie mir der Kantinenfraß zum Hals raushängt. Kannst du nicht schnell noch auf dem Markt vorbeigehen und etwas Gemüse besorgen? Was dir gefällt. Alles andere habe ich.«
»Hast du spezielle Wünsche?«
»Nun, irgendetwas für eine kleine Gemüsepfanne, wir werden schon etwas daraus zaubern. Ich möchte spätestens um sechs hier Schluss machen.«
»Wenn nur nicht wieder etwas dazwischenkommt.«
»Heute nicht.«
»Bist du so sicher? Wenn wieder ein Mord passiert?«
»Heute auf keinen Fall. Ich hab das im Gefühl. Heut ist kein Wetter dafür.«
»Dein Wort in Gottes Ohr. Ich komme dann gegen halb sieben. Tschüs, mein Lieber.«
»Ciao, Bella.«
Elfi verstand dies weniger als schmeichelndes Kompliment, sondern als einen Ausdruck stiller Sehnsucht, der auch in ihr sogleich ein unbestimmtes Verlangen weckte. Ein stets präsentes Gefühl der Zugehörigkeit verband sie mit ihrem Freund Wolfgang Grabowski, etwas Selbstverständliches, das zu seiner Festigkeit keiner ständigen Beteuerungen und fortlaufenden Versicherungen durch schöne Worte bedurfte. Aus dem Alter waren sie beide heraus. Jedoch konnte sie – und er wahrscheinlich auch – aus allen gegenseitigen Worten, diesen vielstimmigen Akkorden des Alltags mit seinen Melodien aus Belanglosem und Bedeutungsvollem, stets die Grundstimme heraushören, die Nähe oder Weite ausdrückte, Wunsch oder Widerstreben, Begierde oder Erschöpfung. Dieser basso continuo begleitete sie beide und drückte eine Zugehörigkeit aus, die in ihrem realen Leben keineswegs für jeden sichtbar war. Denn sie lebten nicht zusammen, sondern jeder für sich und demonstrierten auch keine Auftritte als Paar. Das fiel ihnen leicht, denn gemeinsame Freunde hatten sie nicht, im Übrigen entgingen sie damit auch jeglichem Gerede. (Natürlich wusste Graber davon, der Uralt-Freund von Elfi, vor dem sie keinerlei Geheimnisse hatte.) Aber Grabowski schirmte sein Privatleben sorgfältig vor den Kollegen ab, er nannte das seine Berufshygiene. Sie beide genossen, ihren gereiften Jahren entsprechend, in ihrer Zuneigung auch ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, weil sie vielleicht ahnten, dass zu große Nähe dem gemeinsamen Band die Spannung genommen hätte. Sie mussten sich immer wieder zusammensuchen, aber darin lag nichts Beunruhigendes, weil sie sich insgeheim sicher waren, sich jederzeit erneut zu entdecken. Und es brauchte nie sehr viel, um aus Sehnsucht Begierde entstehen zu lassen und den Weg zu finden in ausgiebige Erfüllung und Sättigung.
Sie hatten einen gemeinsamen Abend vor sich, ungestört und ganz für sich selbst, angefangen mit einem leichten Essen, zu dem Elfi vom Markt noch einiges Frisches mitbringen sollte. Von der Herrenstraße bog sie ab, schlenderte auf der Nordseite des Münsters zwischen den Ständen herum. Es war immer noch sehr voll, obwohl einige Händler bereits die Körbe und Gemüsekisten zusammenstapelten, denn pünktlich um zwei Uhr mussten die Karren und Auslagen den Platz räumen, um den Fahrzeugen der Stadtreinigung Platz zu machen. Bei einem Marktstand aus Eichstetten, der immer besonders schönes Gemüse hatte, fand sie einen Bund junger Möhren, ungespritzt, wie bei allen Bauern dieser Kaiserstühler Gemeinde, und jungen Spinat.
Dann fiel ihr ein, vielleicht noch ihre Freundin Monique zu treffen, die um diese Mittagszeit meist im Café Wiener saß. Natürlich hieß sie eigentlich Monika, aber das war nun wirklich demodé,zumal wenn man eine Modeboutique besaß. Elfi schlängelte sich durch den lebhaften Fußgängerverkehr am Bertoldsbrunnen, wo offenbar um diese Zeit alle Schüler Freiburgs sich trafen oder zumindest auf ihrem Nachhauseweg umsteigen mussten, lief durchs Martinstor zum Café und sah schon vom Eingang aus ihre Freundin auf ihrem mittäglichen Stammplatz.
»Du siehst wieder toll aus. Der Shawl steht dir super.«
»Finde ich auch. Genau meine Farben.«
»Ist der von euch?«
»Na klar. Ist gerade erst hereingekommen. Du musst einfach mal wieder in den Laden kommen. Wir haben wunderschöne Sachen jetzt. Etwas abgetönt, nicht so laut, mehr dezent, aber ganz tolle Farben. Dinge, die man wirklich tragen kann. Und trotzdem sehr modisch. Würde ich dir gerne zeigen.«
»Ich bin schon lange nicht mehr richtig shoppen gewesen. Hier und da mal ein kleines Teil, aber eigentlich habe ich nichts Richtiges mehr anzuziehen, muss mich mal rundum erneuern, gerade jetzt, wo der Sommer kommt.«
»Das musst du aber bald machen, ist schon ziemlich ausgesucht. Obwohl, deine Größe«, sie schaute etwas abschätzend auf Elfis schmale Figur, »da lässt sich noch etwas finden.«
Beide schauten in die bereitliegenden Karten.
»Ich weiß schon, was ich nehme.«
Elfi zögerte noch, sah dann ihr Gegenüber fragend an.
»Einen Apfelstrudel mit Vanillesoße. Wir haben als Kinder immer Familiensoße dazu gesagt. Habe ich jetzt richtig Lust darauf.«
»Na gut. Nehme ich auch. Und einen Espresso danach.«
»Du, ich muss dir was erzählen. Ganz neu. Du kennst doch Legrand?«
»Nein, wer ist das?«
»Ich bitte dich, Legrand, der Modemacher, den kennt doch jeder.«
»Ach, der? Aber den kennst du doch nicht persönlich?«
»Nein, natürlich nicht. Bis jetzt wenigstens.«
Der Kellner kam vorbei und Elfi fragte, ob der Apfelstrudel warm sei.
Auf sein zerstreutes Nicken hin bestellten beide das Gleiche.
»Was ist nun mit diesem Legrand?«
»Der zieht nach Freiburg, stell dir das vor. Die Firma hat er ja verkauft, die geht jetzt zu …, na, fällt mir gerade nicht ein, das kommt gleich wieder. Also, der zieht nach Freiburg, für ganz, hat eine Villa am Lorettoberg gekauft. Und da gibt es demnächst eine riesige Einweihungsparty. Kommst du mit? Wir könnten zusammen dahin gehen.«
»Aber geht denn das? Ich kenne den doch gar nicht.«
»Das macht doch nichts. Ich nehme dich einfach mit. Da kommt die ganze Freiburger Modeszene hin, sind alle eingeladen. Und sonst werden auch noch eine Menge Leute da sein. Seine Feste in Hamburg sind legendär. Ich bin zwar noch nie dabei gewesen, kann ja meistens hier nicht weg«, sie redete sich jetzt richtig in Fahrt und malte sich aus, was der eigenen Anschauung fehlte, »aber du hast ja sicher schon Bilder davon gesehen, in der Bunte und der Gala und solchen Zeitschriften. Natürlich Schicki-Micki bis zum geht nicht mehr. Immer viel Prominenz, all die Leute, die seine Sachen tragen, Filmstars, Fernsehen, Krethi und Plethi.«
»Du glaubst doch nicht, dass die nun alle hierher kommen.«
»Warum denn nicht? In Hamburg kamen sie auch immer von weit her, aus Berlin, München, Düsseldorf, teilweise mit dem Privat-Jet. Bei solchen Festen schrecken die vor nichts zurück. Das sind nationale Ereignisse. Sonst wäre ja auch nicht so viel Presse dabei. Die wollen doch alle gesehen und fotografiert werden. Hast du noch nie gehört, was für schicke Kleider die da vorführen? Sündhaft teure Roben, ganz toll gestyltes Outfit, und immer den letzten Schrei. Die neuesten Modelle eben von den großen internationalen Marken, die wollen alle dabei sein, ist halt so ein Showlaufen. Und dann ist es auch Werbung. Das zahlt natürlich die Firma.«
»Könnte ganz interessant sein. Man kennt so etwas schließlich nur von Bildern. Die alle einmal live zu erleben …«
»Und stell dir vor, so etwas bekommen wir jetzt hier in Freiburg. Endlich mal was los hier. Das können wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Also abgemacht? Wir gehen zusammen hin.«
Elfi erkundigte sich etwas zögerlich: »Wann soll denn das sein?«
»Ende April. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, an Walpurgisnacht, also am Abend vor dem 1. Mai. Ist ein Feiertag danach, da können wir prima ausschlafen. Ich möchte mal wieder so richtig abtanzen bis zum Umfallen, die ganze Nacht durchmachen. Das ist schließlich was anderes als Disco. Auf so einem Fest«, sie lachte schrill auf, um gleich danach leise raunend fortzufahren, »da gibt es noch richtige Männer. Die können wirklich tanzen, die Modewelt eben. Hat viel mehr mit Theater und Film zu tun. Nicht diese schrecklichen Bubis von der unteren Etage mit gegeltem Haar, wie im Kagan, die sich schon super finden, wenn sie nur einmal mit dem Lift ganz nach oben fahren dürfen. Da geh ich auch nicht mehr hin. Aber das hier, das ist wirklich klasse, kannst du gar nicht vergleichen.« Sie holte tief Luft nach so viel Emphase und fügte zerstreut an: »Ich ruf dich noch an und sag dir Bescheid.«
Mittlerweile war der Apfelstrudel gekommen und dampfte vor sich hin.
Elfi, immer noch skeptisch, grübelte: »Und was ziehe ich da an?«
»Da werden wir schon etwas finden. Ich habe mir auch noch nichts überlegt. Wir werden irgendetwas Verrücktes kombinieren. Oder selbst erfinden. Das ist die Gelegenheit. Je verrückter, je toller. Auffallen muss man schon, das ist schließlich der Hauptspaß dabei. Und das hier in dem ständig so zurückhaltenden Freiburg. Wo die ganze Mischpoke immer so auf gediegen mimt. Das muss man mal richtig aufmischen. Komm doch in den nächsten Tagen einfach in den Laden, aber ruf mich sicherheitshalber vorher an. Damit wir nicht dauernd gestört werden. Das wird ein Heidenspaß.«
III.
Elfi stand im Türrahmen zur Küche der kleinen Dreizimmerwohnung und sah ihm beim Gemüseschneiden zu. Geübte Handbewegungen, aber ohne jeden Ehrgeiz, es mit den bekannten Kochstars aus den Fernsehsendungen und ihrer beeindruckenden Fingerfertigkeit aufzunehmen. Auf dem Herd stand bereits eine Pfanne auf mittlerer Flamme, – so nannte man es noch immer, obschon doch so gut wie alle inzwischen einen Elektroherd mit Glaskeramik-Kochzone hatten.
Das heißer werdende Öl breitete sich aus der Mitte aus. Daneben ein kleiner Topf mit Wasser, aus dem bereits die ersten Dampfwölkchen aufstiegen. Er gab anderthalb Tassen Basmati-Reis hinein, dann schob er das Gemüse mit dem Messer vom Holzbrett in die Pfanne, wobei ein gedämpftes Zischen zu hören war.
»Darf ich dir schon einmal etwas einschenken?«
»Was hast du denn Gutes?«
»Hier ist ein angenehmer Munzinger Weißburgunder von Clemens Lang. Trocken und dabei sehr ausgeglichen. Den hast du schon einmal bei mir getrunken.«
»Oh ja, ich erinnere mich. Gerne.«
Während er den Schraubverschluss der Flasche öffnete und zwei Gläser füllte, murmelte er noch:
»In zehn Minuten gibt’s was zu essen.«
Doch dann klingelte das Telefon und er drückte seinen Verdruss mit einem ärgerlichen Blick und hilflosem Schulterzucken aus, beschloss aber dennoch dranzugehen.
»Grabowski«, grummelte er mit bewusst unfreundlicher Stimme.
»Lutz, Heilbronn. Tut mir leid, dass ich dich so spät noch anrufe, aber im Dienst habe ich dich nicht mehr erreicht. Wir haben morgen eine Konferenz wegen der ermordeten Kollegin und da kommt ein erfahrener Profiler aus Stuttgart, der noch einmal alles durchsprechen will. Ich habe mir gedacht, dass es gut wäre, wenn du auch dazukommen könntest. Schließlich gibt es bei euch in Freiburg einen Fall mit derselben Täterin.«
»Mein Gott, so kurzfristig? Gibt es denn was Dringendes?«
»Nichts Sensationelles. Aber die neuen Spuren werfen eine Menge Fragen auf. Ich wollte dir wenigstens Bescheid sagen, falls es dir möglich ist. Übrigens kann ich dich beruhigen, wir fangen nicht so früh an, haben das erst auf elf Uhr angesetzt. Wir haben dann unsere laufenden Dinge schon hinter uns.«
»Das klingt schon besser.«
»Ich weiß doch, will es dir mit der Fahrerei auch so angenehm wie möglich machen. Aber wir müssen da endlich ein Stückchen weiterkommen, und euch betrifft es ja auch. Wir haben gerade eine SOKO Zelle eingerichtet, nur zu dieser Frau, die seit 15 Jahren schon in allen möglichen Fällen herumgeistert und immer rätselhafter wird. Besprich es mit deinem Chef. Du brauchst jetzt nicht zuzusagen, aber nützlich wäre es schon, dich dabeizuhaben. Wenn du um neun Uhr losfährst, kommst du immer noch rechtzeitig an. Und noch eins: Wir können anschließend zusammen Mittag essen, im Piccolo Mondo, wo wir schon einmal waren.«
»Das ist immerhin ein starkes Argument. Ich ruf dich morgen früh an und sag dir Bescheid. Ich denke, es wird gehen.«
»Wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Bis morgen dann, Adale.«
»Ciao, Lutz.«
Elfi sagte nichts und fragte auch nicht. Sie hatte sich Grabowski gegenüber jede Neugierde abgewöhnt, um ihn nicht in Konflikte mit seinen Dienstgeheimnissen zu bringen. Als einem der führenden Beamten der Mordkommission ging einiges über seinen Schreibtisch, das als streng vertraulich einzustufen war und keinesfalls an die Öffentlichkeit kommen durfte. Das war insoweit selbstverständlich. Aber auch ihre Stellung in einem Anwaltsbüro, das auch gelegentlich mit der Verteidigung in Strafsachen befasst war, erforderte eine sorgfältige Diskretion. Allerdings ging es meist nur um Kleinkriminelle, Diebereien, Drogensachen – eher Unspektakuläres. Aber sie war sich, ebenso wie Grabowski, sehr bewusst, dass ihrer beider Hintergrundwissen auch unversehens in eine bedrohliche Konkurrenz geraten konnte. Verteidiger und Ermittlungsbeamte vertreten letztlich meist diametral verschiedene Interessen.
Mit einem gewissen Schaudern erinnerte sie sich an einen Mordfall vor sieben Jahren im Zusammenhang mit dem Raub des Kreuzes von Sankt Trudpert aus dem Augustinermuseum, in den auch ihre Kanzlei verstrickt war. Es handelte sich zunächst um den spektakulären Diebstahl des zentralen Stückes einer Sonderausstellung, eine der wertvollsten gotischen Goldarbeiten, dazu mit einer Fülle von kostbaren Edelsteinen besetzt, eine Leihgabe aus der Eremitage in Sankt Petersburg. Eine reichlich zwielichtige Person, Frau Wunderlich, an den Namen erinnerte sie sich bestens, obschon es nicht ihr richtiger Name war, wurde mit einer ziemlich obskuren Geschichte Grabers Klientin. (»Unsere« Klientin, dachte sie, weil sie sich völlig mit dieser Anwaltspraxis identifizierte.) Und dann wurde klar, dass diese Frau Wunderlich nicht nur an diesem Diebstahl beteiligt war, sondern Graber auch noch in die Hehlerei hineinzuziehen versuchte. Aber das war noch nicht alles. Am Ende kam sogar heraus, dass sie ihren Kumpan umgebracht hatte, um die Beute allein zu verscherbeln. Eine ganz üble Geschichte, besonders weil Frau Wunderlich ihre Klientin war und sich jetzt auch noch als Mörderin herausstellte. Graber hatte das alles selbst herausgefunden. Aber was sollte er damit nun anfangen? Er konnte ja nicht einfach zur Polizei laufen und seine Kenntnisse auspacken, auch wenn er es am liebsten getan hätte. Das wäre Mandantenverrat gewesen, eines der schlimmsten Anwaltsvergehen, das sich denken lässt. Nur Graber und Elfi wussten davon und kannten die Einzelheiten. Und das alles passierte gerade in der Zeit, als Elfi Grabowski kennengelernt hatte, noch ohne zu wissen, dass er bei der Mordkommission war und gerade diese Frau Wunderlich wie die Nadel im Heuhaufen suchte.
Aber Grabowski war unkompliziert. Er hatte ein natürliches Vertrauen zu Elfi. Wie anders hätten sie miteinander umgehen sollen? Er plauderte zum Beispiel ziemlich ungeniert aus dem Präsidium, meist ging es nur um Kollegen und Vorgesetzte. Die eigentliche Arbeit jedoch war allzu sehr Puzzlekram und Detailstöberei, deren Voraussetzungen und Begründungen für einen Außenstehenden viel zu viele Erklärungen nötig gemacht hätten, um irgendetwas zu verstehen. Im Übrigen versuchte er, sein Privatleben vom Dienst so gut es ging zu trennen. Das bedeutete, dass er nur in groben Umrissen von dem erzählte, was ihn gerade beschäftigte. Und schon gar nicht fragte er Elfi nach ihren Klienten aus, das ging ihn weder etwas an, noch wollte er davon wissen. Was aber nicht hieß, dass hier strikte Tabuzonen errichtet waren. Die notwendige Zurückhaltung musste jeder selbst herausfinden, darin waren sie schließlich beide geübt und konnten sich arglos aufeinander verlassen.
Während Grabowski in einer weiteren Pfanne zwei Hähnchenschenkel gebraten hatte, sie schließlich in einer Mischung aus Tomatenmark und Honig mit Rosmarin noch kurz schmurgeln ließ und unterdessen den Reis durch ein Sieb goss, um ihn anschließend zu buttern, hatte Elfi den Tisch gedeckt und nach den Servietten gesucht.
»Zum Glück nicht so früh. Ich hätte keine Lust gehabt, schon morgens um sechs auf die Autobahn zu müssen.«
»Abwimmeln kannst du es nicht?«, fragte sie vorsichtig.
Er richtete bedächtig die Teller an, indem er den Reis aus einer Tasse stülpte, sodass er eine hübsche runde Form bekam, den geröteten Hähnchenschenkel danebenlegte und jeweils zwei volle Löffel aus der dampfenden Gemüsepfanne dazugab. Dann setzten sie sich im Wohnzimmer an den Tisch.