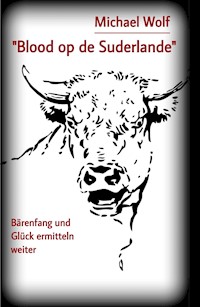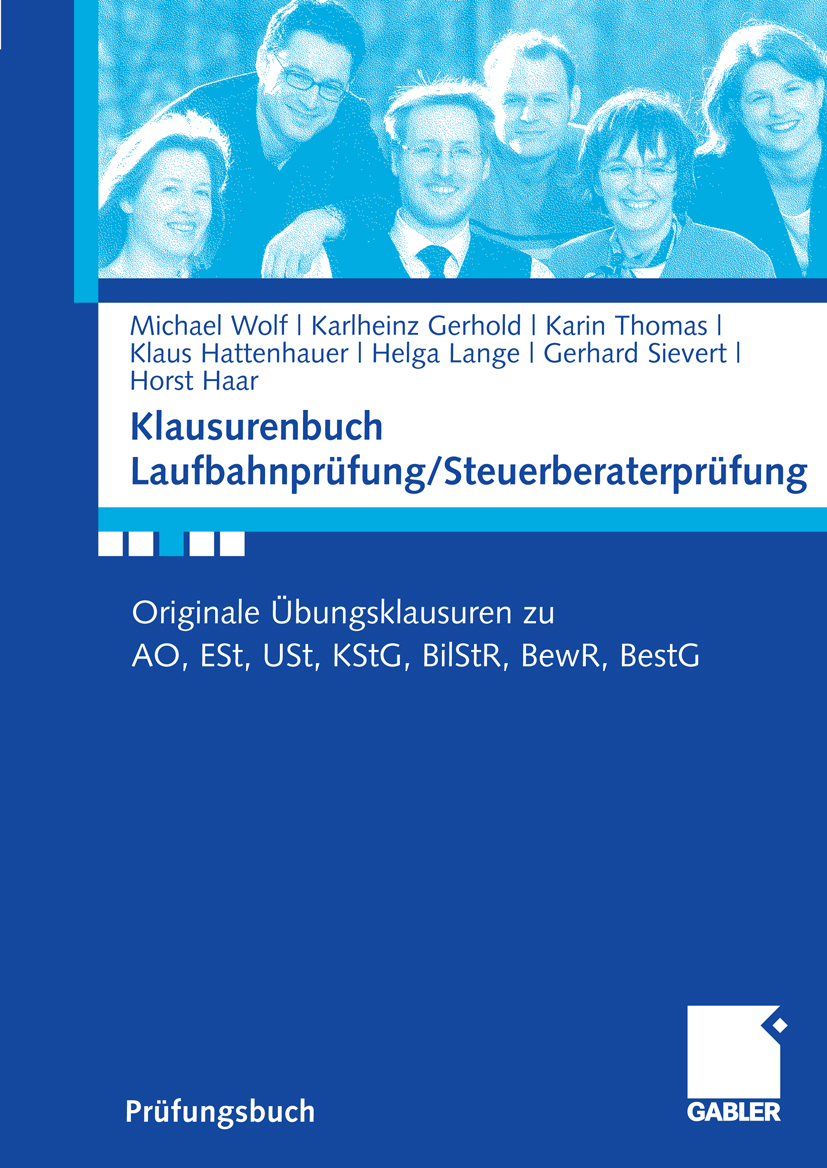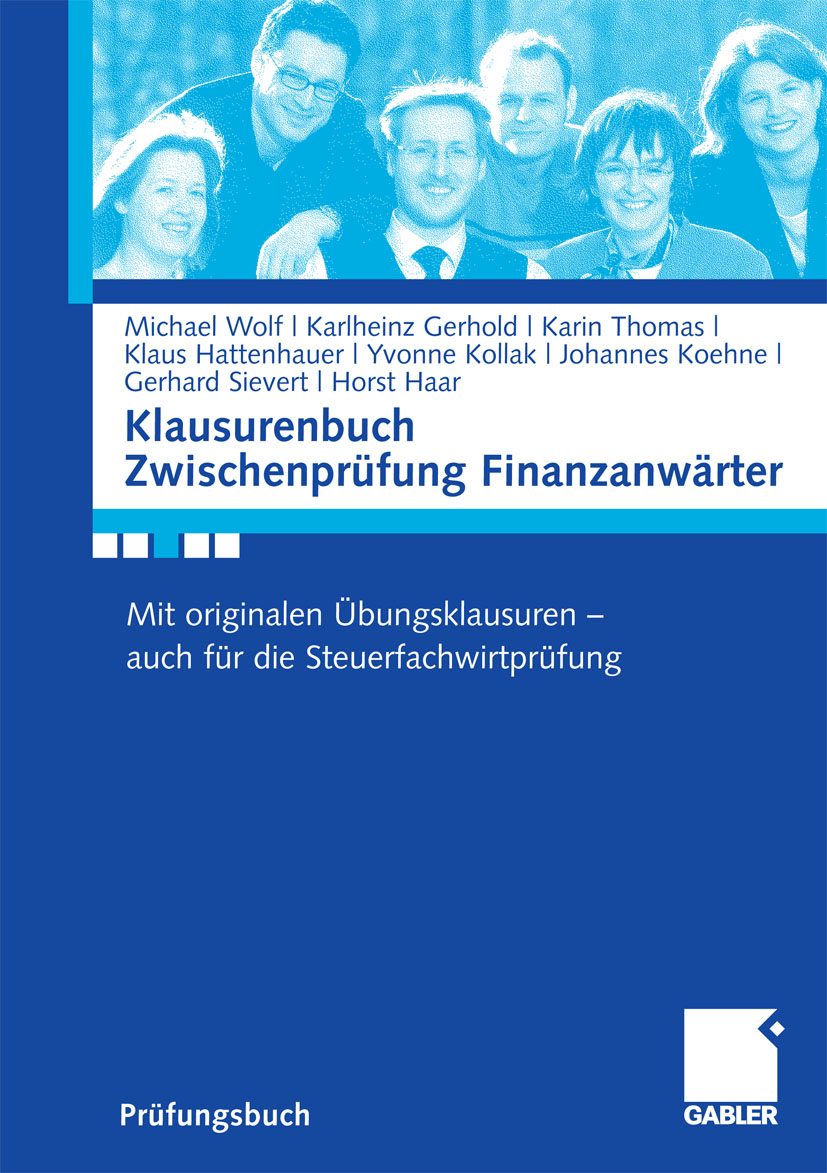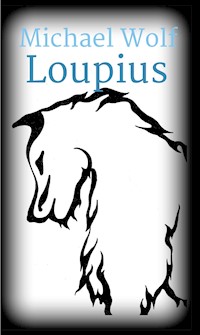
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Loupius" ist ein Kriminalroman, der in der heimischen Kulisse des Märkischen Kreises, des Hochsauerlandes, des bergischen Landes sowie in Hagen und Dortmund spielt. Es wird die Geschichte von Loupius, einem Mann mit vielen Facetten erzählt, der letztendlich zwei gefährliche Leidenschaften pflegt, zum einen die Tätigkeit als sogenannte graue Eminenz im Untergrund, zum anderen das weibliche Geschlecht. Was ihm letztendlich zum Verhängnis werden soll, bleibt bis zum Ende spannend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
LOUPIUS
© 2018 Michael Wolf
Umschlag: Julia Wolf
Illustration: Max Wolf
Lektorat, Korrektorat: Julia Wolf, Tanja Dornbach
ISBN: 978-3-7469-5902-3 (Paperback)
ISBN: 978-3-7469-5904-7 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Kleines Vorwort
Der Inhalt des Romans ist frei erfunden. Ähnlichkeiten zu lebenden oder bereits verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Die Orte des Geschehens existieren hingegen sehr wohl. Sie sind allesamt nicht so bekannt und daher hat sich der Autor entschlossen jeweils, soweit er es für notwendig erachtet unter Rückgriff auf die Datenbank „Wikipedia“ immer wieder eine kurze Beschreibung der gewählten Orte des Geschehens zu liefern. Dies ist gewiss nicht als Zeichen geringer Wertschätzung für diese Dörfer und Städte zu verstehen. Es hat rein praktische Erwägungen gehabt, ein Bild für den Leser zu schaffen.
´Personen
Fritz Wolf:
Loupius
Claudia Wolf:
Ehefrau von Loupius
Ellen Vega:
Geliebte von Loupius
Ellen Wegener:
Leibliche Mutter von Julius Wolf
Julius Wolf:
Adoptivsohn von Loupius, Polizist
Claudius Wolf:
Sohn von Loupius
Hugo Wegener:
Ehemann von Ellen Wegener
Jassir:
Treuer Diener von Ellen Wegener
Heinrich:
Großvater von Claudius und Julius Wolf; Adoptivvater von Claudia
Tante Ludowika:
Tante von Loupius
Ida Fleischfresser:
Lebensgefährtin von Heinrich
Lena Köster:
Aliasname von Ida
Luise:
Erste Frau von Heinrich
Eugen Harris:
Erster Polizeipräsident von Hagen in Westfalen
Moritz Metzger:
Polizeipräsident von Dortmund
Dietmar Matschulat:
Erster ermittelnder Kommissar im Fall Ellen Vega
Mark Piepenkötter:
Kollege von Matschulat
Dr. Anne Kathrin von Schönlau:
Leitende Oberstaatsanwältin
Franziska Bertuleidt:
Staatsanwältin
Mikaela Meier:
Neue Leiterin der Mordkommission
Halverscheid:
Polizist
Kriminalrat Mücke:
Vernehmungsbeamter im BKA im Verfahren gegen Loupius
Kriminaldirektor Jessen:
Vernehmungsbeamter im BKA im Verfahren gegen Loupius
Sahra Levi:
Polizistin - Assistentin von Julius Wolf
Luis Peterzani:
Präsident des Landgerichtes
Isaak Rosenthal:
Richter
Desiree Westfal:
Beisitzende Richterin
Ivonne Böllinghaus
Beisitzende Richterin
Antonia Vosskuhle:
Vorsitzende Richterin am Landgericht Hagen
Bernd Reitemeier:
Beisitzender Richter
Udo Jäger:
Beisitzender Richter
Oskar Salzmann:
Strafverteidiger
Carl Hüttebräuker:
Justizvollzugsangestellter
Peter Meier:
Vater von Mikaela Meier
Bastian Neuenhof:
Bauer
Gilda und Friedemann:
Geheimdienst
Öslem Bärenfang:
Ermittelnde Kommissarin
Konstantin Opfel:
Kriminalrat
Willy Wittgenstein:
Vorsitzender Richter am Landgericht Arnsberg
Maximilian Glück:
Kollege von Öslem Bärenfang
Dr. Steffen Steffenshagen:
Zweiter Polizeipräsident von Hagen in Westfalen
Anne-Marie/Anne-Sophie:
Nachbarin
Hubertus:
Augenzeuge
Doc. Immermann:
Notarzt
Prof. Tiefenrot:
Rechtsmediziner
Prolog
Ich hatte Angst. Ich war auf der Flucht. Ich war auf der Flucht, wahrscheinlich, so nahm ich es jedenfalls an, vor den Diensten unseres israelischen Staates. Bisher dachte ich, ich hätte es geschafft. Doch ich hatte mich fürchterlich geirrt. Den Fängen des besten Geheimdienstes der Welt entkommst du nicht. Die finden dich. Und dabei ist es vollkommen gleichgültig, wie gut du dich versteckst. Sie finden sie alle und dann sorgen sie für ihre Beute nach den Regeln der Kunst von Geheimdiensten. Ich hatte schon viel darüber gehört und jetzt fürchtete ich um mein Leben, um mein neues Leben.
In meinem ersten Leben war ich ein sehr glücklicher Mensch in meiner Heimat, dem Heiligen Land gewesen. Ich wuchs in Haifa auf und ging auch dort zur Schule. Mein Vater war mit seiner Familie aus Russland gekommen und hatte jetzt nach den grausamen Zeiten in Europa sein Ziel gefunden. Er war ein staatstragender Israelit geworden und seine ganze Treue galt dem jüdischen Volk. So war es natürlich auch die Pflicht meiner Geschwister und ebenso die Meinige gewesen, den Militärdienst abzuleisten und mit ganzer Loyalität zu meiner Nation an der Waffe ausbilden zu lassen.
Dass es nicht gut war, Männer und Frauen in derselben Armee dienen zu lassen, sollte ich bald erfahren. Mein Vorgesetzter war männlich und kein guter Mensch. Seine Belästigungen und noch schlimmeren Handlungen hatten ein unerträgliches Maß angenommen. Ich war ihm hoffnungslos auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Es widerte mich an, wenn er sich mir von hinten näherte. Ich wusste, was kam, so wie alle anderen auch, aber keiner half mir, wirklich keiner! Mein Vater wollte so etwas, wie er es nannte, nicht hören. Er verschloss Augen und Ohren und ich hasste ihn dafür. Und meine Mutter schwieg, wenn mein Vater es befahl. Meine Geschwister wollte ich nicht behelligen. Es war mir peinlich und hätte sie nur in Schwierigkeiten gebracht. Beide Brüder waren dabei, an ihrer steilen Laufbahn innerhalb der Armee zu arbeiten und diese hätten sie nicht, bzw. hätte ich das ebenfalls nicht gewollt, dass sie diese für mich aufs Spiel setzten. So blieb mir nur ein Ausweg. Ich musste desertieren und ins Ausland fliehen. Es gab da eine Organisation, die solche Fluchten für Frauen, wie mich organisierten und einen Weg über zunächst Jordanien dann Italien bis letztlich nach Deutschland für uns fanden. Ich hatte davon durch einer Mitsoldatin, der es ebenso, wie mir erging, erfahren und wandte mich, nachdem sich eine Freundin, ebenfalls eine Mitsoldatin, das Leben genommen hatte an diese Bewegung, die mich außer Landes schaffen sollte. Die genauso beschwerliche wie riskante Flucht gelang per LKW, per Schiff und dann wieder per LKW. Wir waren insgesamt zwanzig Frauen und mussten uns als Palästinenserinnen verkleiden. Wir sahen alle aus, wie Arrafat zu seiner Zeit. Grüne Kampfanzüge und diese schwarz-weißen Bommeltücher hatte man uns verordnet. Welchen Sinn das haben sollte, wusste ich nicht. Aber es war mir auch herzlich egal, wenn ich nur entkommen konnte. Das war in diesen Momenten meines Lebens das einzige Ziel.
Jetzt wohnte ich in einer zweihunderttausend Einwohner zählenden Stadt in Westfalen und hatte mittlerweile unter neuer Identität eine gute Position in einem Unternehmen, welches Zwieback und Schokoladennikoläuse herstellte. Dort gefiel es mir sehr gut. Die Kollegen waren sehr nett zu mir und so eigentlich auch alle meine Mitbürger dieser insbesondere Basketball begeisterten Stadt. Ich empfand erstmalig nach jahrelanger Odyssee so etwas wie Ruhe und sogar ein bisschen Heimat, trotz der Tatsache, dass ich immer noch Kontakt zu meiner Fluchtorganisation hatte, denn nichts war umsonst und ich musste stets mit allem rechnen.
Meine Kontaktperson war eine Frau und wohnte etwas außerhalb der Stadt. Bei ihr zu Hause war ich nie. Wenn wir uns trafen, und das war nicht häufig, dann an anonymen Orten, um keine Spuren zu verursachen.
Aber man hatte mich ohne Zweifel doch entdeckt, denn ich wurde seit einigen Tagen beobachtet. Ich war der Verzweiflung nahe. Morgens, wenn ich aus der Haustüre kam, stand da dieses Auto. Dieses auffällig unauffällige Auto, was man aus den Observationen in Kinofilmen kennt. Darin saßen ein Mann und eine Frau, die bemüht waren so zu tun, als ob sie sich für mich nicht interessierten. Aber ich wusste es sofort, dass diese Personen Agenten unseres Geheimdienstes waren. Ich hatte es im Gefühl. Nicht etwa, weil der Geheimdienst so dilettantisch arbeitete, das Gegenteil war der Fall, aber ich hatte so lange selbst in dem Land verbracht und wusste, wie man vorging. Man schürte die Angst des Verfolgten, eine solche Angst, die einem die Luft zum Atmen nahm. Der Wagen folgte mir, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fuhr und ebenfalls am Abend auf dem Heimweg. Einmal bin ich ausgestiegen und mit dem Bus weitergefahren. Da hat mich dann die Frau zu Fuß verfolgt. Ich hätte sie einfach ansprechen können. Aber ich hatte Angst. Und es wäre wahrscheinlich ohnehin nutzlos geblieben. Diese Menschen beantwortete keine Fragen. Nein, sie stellten sie.
Etwa über drei Wochen hinweg ging diese zermarternde Taktik bis ich eines abends, nachdem ich von der Arbeit zurückkehrte, vor meiner Wohnungstür ein Paket fand. Es war etwa so groß, wie ein Schuhkarton und ich nahm es mit in meine Wohnung. Warum genau, kann ich nicht sagen, war es Angst, war es Neugier oder war es Hoffnung, das Ende herbeizuführen? Ich deponierte das Paket zunächst auf dem Tisch in der Küche und sah nochmal aus dem Fenster. Und, richtig, da standen sie wieder und beobachteten das Haus. Wahrscheinlich war das Paket von ihnen und würde nichts Gutes bedeuten. Aber öffnen musste ich es. Es war nicht so schwer, sodass es eine Bombe hätte sein können. Nein, es war eigentlich federleicht und als ich es schüttelte, hörte ich lediglich etwas wie ein dickes Blatt aus Papier. So schnitt ich mit dem Messer entlang der Klebefolie und klappte die Seiten des Paketes hoch. Und ich hatte Recht. In dem Paket lag lediglich ein Bild. Ich erschrak zutiefst als ich den Inhalt erfasste. Es war ein altes Familienfoto aus meiner Heimat. Er zeigte meine Eltern, meine Geschwister und mich vor etwa 20 Jahren. Auf der Rückseite hatte man mit einem Kugelscheiber ein nicht ganz kunstvolles, aber dennoch gut erkennbares Bildnis eines Baumes mit ausgebreiteten Zweigen, von denen mehrere abgebrochen waren, gemalt. Ich erkannte, was das zu bedeuten hatte und es überkam mich eine Furcht, die ich in dieser Form noch nicht erlebt hatte, kalter Schweiß sammelte sich auf meiner Stirn und die Welt um mich herum drehte sich. Die Küche erschien mir auf einmal eiskalt. Dieses schwarze Symbol bedeutete den Tod. Es gab es auch auf einigen Gräbern, die ich kannte und drückte den Tod von jungen oder auch alten Menschen aus. Diese Botschaft war angekommen. Man drohte mir, meine Familie und mich umzubringen. Mein Leben war mir nachrangig, aber ich verspürte unendliche Angst um meine Familie, die mich innerlich zeriss. Ich musste also dringend weg und ich musste meine Familie schützen. Nur, wie sollte ich das anstellen? Ich konnte doch nicht zurück nach Israel. Dort wäre mein Leben wahrscheinlich keinen Pfifferling mehr wert gewesen. Zumindest würde ich für sehr lange Zeit ins Gefängnis kommen. Mein falscher Pass und meine neue Identität würden mir nichts nützen. Sie kannten mich bereits. Und sie wollten mich. Es blieb also kein Ausweg, als erneut zu versuchen, ihnen zu entkommen. Aber dann klopfte es plötzlich an der Tür. Einer war ins Haus gekommen. Ich hatte keine Klingel gehört. Und er war bereits an meiner Wohnungstür. Instinktiv schaute ich noch einmal aus dem Fenster. Der Wagen stand noch immer da. Nur saß jetzt die Frau allein darin. Ich geriet in Panik. Was würde geschehen. Sofort schaltete ich das Licht in meiner Wohnung im zehnten Stockwerk aus, als es erneut an der Tür klopfte. Ich nahm das Messer, mit dem ich gerade noch das Paket aufgeschnitten hatte und tastete mich langsam und leise in Richtung meiner Wohnungstür. Dort schaute ich vorsichtig durch den Spion und da sah ich ihn. Den Mann, der gerade noch im Auto gesessen und mich zuvor über Wochen verfolgt hatte, stand nun direkt vor mir und uns trennte lediglich das Holz der Tür. Er musste bemerkt haben, dass ich dort stand und ihn anschaute. Er drückte jetzt sein Gesicht ganz dicht an den Spion heran und ich sah seine nassen großen Lippen, wie sie sich bewegten. Es war so grausam und ich konnte mich vor Angst nicht mehr bewegen. Und da hob er seine Stimme an und flüsterte: „Komm Mädchen, komm nach Hause. Bitte komm, kleines Mädchen, komm!“ Dann neigte er sich und schob ein Kuvert ohne Absender unter der Tür hindurch und verschwand genauso lautlos, wie er gekommen war. Ich konnte nicht mehr und brach weinend zusammen. Als ich wieder zu mir kam, riss ich das Kuvert auf und las den darin befindlichen mit der Hand geschriebenen Brief. Erneut stellte sich bei mir ein ziemlich ungutes Gefühl der akuten Bedrohung ein. Mit einer wohl als militaristisch zu bezeichneten Wortwahl wurde mir befohlen, mich dort einfinden, wo ich zum ersten Mal meine Kontaktpersonen getroffen hatte. Ich sollte noch am heutigen Abend dort erscheinen und dies genau pünktlich um 21.30 Uhr. Ansonsten würde man mich holen kommen. Ich hatte Angst, jedoch auch keine Wahl. Was sollte ich tun? Gegebenenfalls würde es auch einen harmlosen Hintergrund haben. Mein Vater hatte mir beigebracht, nicht gleich immer an das Schlimmste zu denken. Das gelang aber nur sehr begrenzt. Ich musste wahrscheinlich schon mit dem Schlimmsten rechnen. Ich hätte fliehen können. Nein das hätte ich eben nicht gekonnt. Der Wagen mit den beiden Geheimdienstmitarbeitern stand noch vor meiner Haustür. Wie hätte ich denen entkommen sollen? Also blieb mir nur, den Befehl zu befolgen. Und so griff ich nach den Autoschlüsseln, rannte die Treppen herunter und schritt heraus auf die Straße. Dabei versuchte ich einen Blick meiner Beobachter zu erhaschen und diesmal gelang es mir eine tatsächlich eine Reaktion auszulösen. Beide lachten mich an und fuhren sich dabei mit den Zeigefingern über ihre Kehlen. Jeder weiß, was das zu bedeuten hatte. Doch jetzt störte mich das auch nicht mehr. Ich stieg in meinen Pickup und fuhr los, um mich zur angeordneten Zeit am angegebenen Ort einzufinden. Der Wagen vor meiner Haustür folgte mir, fuhr aber dann nicht hinter mir her aus dem Parkplatz, den ich laut Befehl ansteuern sollte, sondern vielmehr daran vorbei. Nachdem ich mein Auto gestoppt hatte, sah ich, wie sich aus dem Nichts zwei Personen näherten und mit einer Handlampe in mein Gesicht leuchteten. Ich hätte sterben können, allein schon wegen der Angst, die ich jetzt in einem schier unerträglichen Maß empfand. Da beschloss ich einfach los, und auf die beiden Personen zuzufahren. Doch dann sah ich, wie einer der beiden Personen ein Gewehr in meine Richtung anlegte und sich plötzlich Scheinwerfer eines großen Fahrzeuges, wie einem LKW, erhellten und auf mich mit hoher Geschwindigkeit zugefahren kamen. Mein Weg war versperrt. Nunmehr saß ich endgültig in der Falle. An Flucht war nicht mehr zu denken. Doch, ich musste weg. Also öffnete ich meine Tür und lief davon. Ich lief quer über die Autobahn und dann über ein Feld in die beginnende Nacht hinein. Damit hatten meine Verfolger offensichtlich nicht gerechnet. Keiner folgte mir, zumindest nahm ich es nicht unmittelbar war, aber sicher sein konnte ich natürlich nicht, und so lief ich weiter und weiter. Ich rannte in einen Wald, schlug mich durchs Geäst, ich musste ich steil bergab und ich stolperte, Zweige schlugen mir ins Gesicht und ich spürte wie mir das Blut die Wangen herunterlief. Ich stürzte. Ich versuchte mich wieder aufzurappeln, aber zwischenzeitlich tat mir alles weh. Ich hatte mich an der Hand verletzt und blutete. Ich musste weiter, ich wollte nicht kampflos aufgeben. So sollten sie mich nicht erwischen. Ich kam wieder auf die Beine. Ich rannte weiter. Endlich sah ich Licht. Meine Rettung, vor Erleichterung rannen mir Tränen über die Wangen. Endlich erreichte ich einen einsam gelegenen Bauernhof. Zunächst spielte ich kurz mit dem Gedanken, wie wild an die Tür zu hämmern, um mich bemerkbar zu machen, dann fürchtete ich dadurch Unschuldige in Gefahr zu bringen, denn meine Verfolger schreckten, dessen war ich mir sicher, vor nichts zurück.
Ich umrundete das Haus und entdeckte die Stalltür. Leise hob ich den Riegel hoch, die Tür knarrte aus meiner Sicht unerträglich laut. Jeder musste es gehört haben, aber es rührte sich nichts. Meine Wunde an der Hand blutete stark. Im spärlichen Mondlicht, welches durch die Stallfenster schien, erkannte ich einen tiefen Riss in meiner Innenhand, aber weitaus schlimmer noch eine Verletzung an der Arterie des Oberarms, die dringend hätte versorgt werden müssen. Ich konnte die Blutung einfach nicht stoppen, so sehr ich mich auch bemühte. Ganz feste drückte ich meine Jacke auf die Wunde. Doch das half alles nicht. Ich musste Hilfe haben. Ich drohte zu verbluten.
Plötzlich spürte ich in meinem Genick einen spitzen Gegenstand. So ging es also zu Ende. Sie hatten mich doch gefunden und so fühlt es sich also kurz vor dem Tod an. Ich schloss die Augen und wartete auf mein Ende. Es passierte aber nichts dergleichen, vielmehr stand hinter mir auf einmal der Bauer und schrie mich an: „So Mäuschen, keine Bewegung. Wer bist du und wo kommst du her? Was machst du hier?“
Ich drehte mich um und sah dem grimmig dreinschauenden, aber eigentlich freundlich wirkenden Bauern ins Gesicht. Eine Welle der Erleichterung durchkam mich.
Da ging das Licht im Stall an und die Bäuerin kam dazu. Die raunte ihren Mann an: “Nimm die Gabel runter. Bist du blind. Siehst du nicht, dass das arme Mädchen verletzt ist. Komm los, lass sie uns hineinbringen.“ Und so geschah es. Die liebenswerten Landleute halfen mir auf und brachten mich hinein in ihr Haus. Dort versorgte der Bauer meinen Arm und seine Frau verabreichte mir unter der Vorgabe, dass dies immer helfe, einen Weizenkorn, der auf mich, die ich noch nie Alkohol getrunken hatte eine entsprechende Wirkung hatte. Ich hatte Glück. Der Bauer war nicht nur Bauer, sondern auch Tierarzt und nähte meine Wunden mit der genialen Professionalität zusammen, mit denen er das auch bei verletzten Tieren tat. Und mein Glück sollte sich noch weiterentwickeln. In der direkten Nachbarschaft wohnte zudem noch ein Zahnarzt, den die Bäuerin zusätzlich herbeigerufen hatte und der dann auch noch heilende Hand anlegen konnte. Er gab mir eine Spritze, damit ich zunächst einmal zur Ruhe kommen sollte. Das verabreichte Medikament führte mich in der Wechselwirkung mit dem mir zuvor verordneten Weizenkorn jedoch nicht nur zur Ruhe, sondern in einen tiefen Schlaf, aus dem ich erst am nächsten Morgen wieder aufwachen sollte.
Mein Empfangskomitee, welches mir erschien, als ich aus dem Reich der Träume zurückkehrte, machte einen eher ungewöhnlichen Eindruck. Um meine Lagerstätte auf der Küchenbank herum saßen der Bauer und die Bäuerin sowie der Dentist, nebst Gattin. Die Viererrunde hatte die ganze Nacht Wache gehalten und sich dabei mit Eierlikör und Sekt versorgt. Gespannt waren sie auf die Geschichte, die ich ihnen jetzt präsentieren sollte. Und diese Geschichte bekamen sie. Mein ganzes Leben offenbarte ich ihnen und ich ließ nichts dabei aus. Eine Stunde lang hörten sie mir zu, und es kam zu einer völlig unerwarteten Reaktion. Ich hatte unerwartet Verbündete gefunden. Wie sie es geschafft haben, meine Eltern zu kontaktieren, sollte mir ein Rätsel sein. Jedoch standen acht Wochen später meine Eltern auf dem Bauernhof, auf dem ich so lieb aufgenommen wurde, und mich verstecken konnte. Wir fielen uns in die Arme und mein Vater flüsterte mir liebevoll in mein Ohr: „Bitte, verzeih mir, bitte verzeih mir. Es tut mir alles so leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, dass ich dich so allein gelassen habe.“ Dann begann er bitterlich zu weinen. Ich glaube, wir zwei waren einander noch nie so nahe, wie in diesem Moment und wir waren glücklich! Ich hatte ihm verziehen und empfand nur noch tiefe Liebe.
Aber dann fiel unerwartet der Schuss. Er durchbrach die idyllische Stille unerträglich laut. Es fiel der Schuss aus einem Jagdgewehr. Das Geschoss durchdrang unsere beiden Körper so, dass es in meinen Rücken ein- und aus dem Rücken meines Vaters, der mich fest in den Armen hielt, wieder hinausdrang. Mein Vater hat das nicht überlebt. Die Bäuerin sah nach dem Schuss eine Frau zu einem Auto laufen und dieses Auto dann wegfahren. Wegen der weiten Entfernung konnte sie jedoch nicht erkennen, um welchen Fahrzeugtyp es sich gehandelt hatte. Auch die Farbe des Wagens konnte sie nicht nennen. Sie war farbenblind. Die gute Bäuerin meinte lediglich, das Fahrzeug sei irgendwie auffällig unauffällig gewesen. Ich weiß bis heute nicht, wer geschossen hat und weshalb mein Vater eigentlich sterben musste. Die anschließenden Ermittlungen verliefen im Sande. Meine Mutter und ich leben seit jener Zeit gemeinsam an einem unbekannten Ort, dessen Namen ich mit Rücksicht auf das Leben meiner Mutter auch hier nicht bekannt geben möchte.
2003 - Ellen Vega ist tot
Es war schon sehr angenehm warm, in dieser Nacht des 1. auf den 2. April 2003. Es wehte ein laues Lüftchen und man konnte bereits ohne Jacke aus dem Haus gehen.
Kriminalhauptkommissar Dietmar Matschulat hatte es sich gerade mit einer Flasche Bier auf seinem Balkon gemütlich gemacht, um den Feierabend zu genießen. Derzeit war bei der Mordkommission nichts als zermürbender Papierkram zu erledigen, was nicht zu den Stärken von Matschulat gehörte.
Er wollte gerade zum ersten Schluck ansetzen, als er durch das unermüdliche Erklingen der Tatortmelodie, die er zum Klingelton seines Diensthandys auserkoren hatte, jäh auf den Boden der Realität zurückgeholt wurde. Er überlegte kurz, das Klingeln zu ignorieren, dann siegte aber doch sein Pflichtbewusstsein, was er durch jahrelange Tätigkeit erworben und trotz der ständigen Konfrontation mit dem Tod auch nicht verloren hatte.
Nachdem er das Telefonat beendet hatte, wusste er, dass er seinen gemütlichen Feierabend gegen eine Nachtschicht eintauschen konnte. Er machte sich noch einen starken Kaffee, den er in eine Thermoskanne füllte und nahm ein Paket Zigaretten mit. Das Rauchen hatte er immer wieder versucht aufzugeben, aber bei jeder Leiche war er dann doch wieder rückfällig geworden.
Keine 15 Minuten später fuhr Matschulat in Richtung Fundort der Leiche. Sein Kollege hatte ihm als Fundort eine Stelle an der A 45 – sogenannte „Sauerlandlinie“ genannt. Der Fundort war für Matschulat nicht schwer erkennbar. Das blaue Leuchten der Blinklichter war bereits von weitem erkennbar und er näherte sich mit mäßiger Geschwindigkeit der Absperrung, die mit dem PKW nun nicht mehr passiert werden konnte. Er parkte seinen Wagen, ging zu Fuß weiter und war immer noch überrascht, dass es trotz der späten Stunde angenehm warm war.
Sein Kollege Piepenkötter kam auf ihn zugelaufen. Seine schlaksige Gangart, ließ ihn immer wieder unbeholfen aussehen, aber dafür zeichnete ihn eine extrem schnelle Auffassungsgabe und analytische Art aus. Schnell fasste er für Matschulat das Wesentliche, so wie es sich derzeit darstellte, zusammen. Kinder waren beim Spiel am Rande einer Autobahnraststätte auf eine Erdhöhle gestoßen und hatten darin den Leichnam einer Frau, die sich erst viel später als Ellen Vega herausstellen sollte, gefunden. Sie alarmierten per Handy die Polizei in Hagen.
Diese versuchte zunächst zu ermitteln, weshalb die Kinder erst vier Stunden nach dem schrecklichen Fund den Anruf an die 110 tätigten, jedoch ohne Erfolg. Hierüber schweigen sich die vier Mädchen aus einem kleinen, bei Wikipedia unkommentierten, gerade einmal 50 Seelen zählenden Bauerndorf mit dem Namen Hunsdiek, trotz des von Matschulat unzweifelhaft ausgeübten Druck, bislang aus.
Sie gaben bisher nur an, nach der Schule am Nachmittag des 2. April um ca. 15.00 Uhr die tote Frau entdeckt zu haben. Die weiteren Umstände, die Hintergründe waren mehr als nebulös, zumal Kinder mit Sicherheit nicht an der Autobahn spielen sollten. Vielleicht fürchteten die Mädchen weitere Repressalien, jedenfalls hüllten sie sich in Schweigen.
Der Fall wäre eigentlich Routine für die Ermittler gewesen. Beginn der Ermittlungen, Spuren sichern, Identität ermitteln, die Angehörigen informieren, was für Matschulat trotz seiner langen Dienstzeit immer die traurigste und schwierigste Aufgabe war und dann irgendwann die Akte abschließen mit oder ohne Verdächtigen. In diesem Fall sollte aber alles anders sein. Die Leiche wurde geborgen und man sicherte ein Foto bei der Toten. Die darauf abgelichtete Person erkannten die Polizisten sofort und trauten ihren Augen nicht. Es war das Bild von Loupius, wie sie ihn alle nannten. Einer der wohl schillernsten Personen unter den deutschen Juristen und allgemein dem Milieu der organisierten Kriminalität zugeordnet. Ein Mann mit den besten Kontakten nach sogenannt ganz oben. Eine Figur, die in dieser Zeit alle Fäden in der Hand hielt und der man wahrscheinlich nie etwas nachweisen können würde. Ganze Heerscharen von Bundes- Landes und auch sonstigen Kriminalbeamten hatten sich bereits die Zähne an seiner Marmorfassade ausgebissen. Bisher war es keinem gelungen, Loupius, der mit bürgerlichem Namen Fritz Wolf hieß, auch nur in die Nähe eines erfolgsversprechenden Strafverfahrens zu bringen.
Matschulat erfasste ein heftiges Kribbeln, welches er immer dann verspürte, wenn er einer wichtigen Spur folgte. Sollte es ihm nach so langer Zeit gelingen, Loupius etwas nachzuweisen. Warum trug die Tote ein Foto von ihm mit sich? Das wäre ein Ermittlungserfolg, der ihm die Zeit bis zu seiner Pensionierung versüßen könnte.
Euphorisch wählte der sonst so coole Ermittler die Telefonnummer, die auf der Rückseite des Fotos notiert war. Es war mittlerweile 2.30 Uhr geworden, aber der Kommissar wollte sein Glück dennoch versuchen. Vielleicht hatte er ja Glück, so dachte er sich, und der Inhaber der Rufnummer hätte sein Handy auf dem Nachttischchen liegen und würde es hören.
Zunächst verfluchte Matschulat den Fundort der Leiche, da er keinen Empfang hatte. Dann ging jedoch der Ruf heraus und tatsächlich, es klingelte. Aber es klingelte nicht in weiter Ferne, sondern vielmehr fast unmittelbar hinter ihm aus einem kleinen Waldstück heraus, welches sich nahe des Tat- bzw. zur Zeit noch lediglich Fundortes anschloss. Matschulat hielt es für eine Erscheinung, die der späten beziehungsweise frühen Stunde geschuldet war. Er wollte seinen Augen nicht trauen, als er sich umdrehte und Loupius, der leibhaftig hinter ihm stand, erblickte. So viele Zufälle konnte es nicht geben, die Leiche, das Foto, die Rufnummer und Loupius. Schnell fasste sich Matschulat wieder und zog den derzeit einzig logischen Schluss, dass der Täter wieder an den Tatort zurückgekehrt war. Dass Loupius so ein Anfängerfehler passierte - Matschulat konnte es nicht recht glauben, doch dann konnte er trotz des geringen Lichteinfalls, den der abnehmende Mond gepaart mit dem blauen Schein der Blinklichter bot, Blut an der Kleidung seines Gegenübers sowie eine geschulterte Waffe, ein Gewehr, erkennen.
Sofort verfügte der Ermittler die Festnahme des seines Erachtens hochgradig Verdächtigen, der sich widerstandslos beugte.
Aber dieser Verdacht sollte sich später als wohl falsch herausstellen. Das Blut an der Jacke von Loupius stammte einwandfrei von einem Wildschwein, welches er nachweisbar kurz zuvor, als Jagdpächter des hiesigen Waldabschnittes, erlegt hatte. Zudem gab ihm seine Frau Claudia für den vom Gerichtsmediziner als wahrscheinlich festgelegten Todeszeitpunkt ein scheinbar absolut wasserdichtes Alibi. Ihr Mann, so sagte sie aus, habe zur fraglichen Zeit als Zuschauer in einer ihrer Gerichtsverhandlungen beim Familiengericht in Gummersbach gesessen. Das wisse sie genau, da sie die Verhandlung als vorsitzende Richterin geleitet habe und ihr Mann sie nach dem letzten Sitzungstermin überraschenderweise zu einem verspäteten Mittagessen abholen wollte.
Loupius war, wie gewohnt, schnell wieder auf freiem Fuß und Matschulat verlor zu seinem Verdruss den Fall an das Bundeskriminalamt.
Die Ermittlungen dort dauern bis heute an.
Die Tote stellte sich als alte Bekannte des Bundeskriminalamtes heraus. Es handelte sich, so war man sich schnell einig, um die lange schon gesuchte, abgetauchte Ellen Vega. Sie stand im Verdacht führendes Mitglied einer ständig wachsenden terroristischen Vereinigung zu sein. Es hatte bereits Ermittlungserfolge sowie auch zahlreiche Festnahmen von Mitgliedern einzelner Terrorzellen gegeben. Jedoch war bisher keiner der verhafteten und zum Teil auch wegen kapitaler Verbrechen verurteilten Personen bereit gewesen, gegen Ellen Vega auszusagen. Man vermutete, dass Ellen Vega insbesondere dafür verantwortlich gewesen sei, im gesamten europäischen Raum sogenannte „Sleeper“ zu installieren, die bei Bedarf losschlagen sollten. Als man sie obduzierte, fand man an ihrem Oberschenkel eine frische Wunde, die den unausweichlichen Eindruck vermitteln musste, dass dort etwas herausgeschnitten worden war. Die Todesursache lag darin jedenfalls nicht. Diese war vielmehr toxikologischer Herkunft. Ellen Vega war vergiftet worden. In der Erdhöhle, in der man sie entdeckt hatte, fand man ein kleines Döschen aus Gold, in dem die totbringende Giftpille mutmaßlich von ihrem Mörder transportiert worden war. Man hatte Ellen offenbar gezwungen, jedenfalls deuteten die Hämatome im Gesichtsbereich des Leichnams darauf hin, die tödliche Dosis einzunehmen. Weiterhin ging und geht man bis heute davon aus, dass Ellen Vega den Mörder gekannt haben musste, da es keine weiteren Kampfspuren oder sonstige Anzeichen von Gewalt zu finden gab. Sie musste sich höchstwahrscheinlich mit jemandem in dieser Erdhöhle verabredet gehabt haben. Diese Höhle, deren Standort aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt wird, lag bzw. liegt bis heute noch immer neben der Autobahnraststätte in etwa drei Metern Tiefe und bietet ca. 30 Personen Platz. Sie verfügt über eine, bisher unbemerkte Stromversorgung, da man sie mit der Autobahnelektrizität verbunden hatte und bezieht Wasser aus einem gut getarnten oberirdischen Regenwasserauffangbecken. Die Einrichtung ist eher spartanisch aber zweckmäßig und erinnerte an ein Feldlager der Bundeswehr. Jedenfalls stammen Feldbetten, Funkgeräte und sonstige Einrichtungsgegenstände sowie zahlreich vorhanden Waffen inklusive entsprechender Munition aus deren Beständen.
Der Polizeipräsident von Hagen in Westfalen, Eugen Harris und die leitende Oberstaatsanwältin von Hagen, Dr. Anne Kathrin von Schönlau im Jahre 2017 in dem Büro des Präsidenten
„Los, erzähl schon, Eugen. Warum möchtest du nicht, dass Julius den Fall noch einmal aufrollt? Er gehört zu den besten Polizisten und Mord verjährt nicht. Lass ihn doch. Oder hast Du vor irgendetwas Angst? Es wird doch nicht etwa gar Eitelkeit sein, weil Dir, dem Polizeipräsidenten von Hagen, damals noch als Leiter der Mordkommission, die Ermittlung des Täters nicht gelungen ist. Jeder weiß doch, dass Dir diese arroganten Armleuchter aus Düsseldorf und Wiesbaden dazwischengefunkt haben und Du gar nicht anders konntest, als den Fall abzugeben. Umso mehr müsste es doch jetzt für dich eine Genugtuung sein, wenn Julius die Hinrichtung seines Onkels oder besser gesagt Adoptivvaters „Loupius“ aufklärt und so diesen unterbelichteten Gestalten von den diversen Diensten mal eindrücklich vorführt, wozu die Hagener Polizei mit ihrem fantastischen Präsidenten im Stande ist.“
„Ja, du hast ja Recht! So, wie du ja immer Recht hast! Ich wollte nur kurz vor meinem Ruhestand keinen Ärger mehr haben. Aber das wäre feige und Entscheidungen aus Feigheit sind, so hat mein Vater jedenfalls stets betont, meistens schlecht. Nun gut, Biene -jeder, der sie liebte, nannte sie so-, dann soll es so sein. Gib ihm grünes Licht. Aber sage ihm auch, er solle größte Behutsamkeit walten lassen und etwas mehr Fingerspitzengefühl beweisen, als er es sonst zu tun pflegt, gerade weil Loupius ein Verwandter von ihm war. Das macht die Angelegenheit in Sachen Befangenheit ohnehin schon pikant genug. Nicht, dass er den falschen Leuten auf die Füße tritt. Du weißt, was damals los war und wer von den oberen zehntausend sich alles für den Fall interessiert hatte. Eigentlich war ich seiner Zeit, wenn ich ehrlich bin, sogar ganz froh gewesen, als diese bourgeoisen Elemente vom LKA mir den Fall wegnahmen. Die Nummer wäre sowieso für mich zu groß gewesen. Abgesehen davon, war ich da ohnehin gerade in den letzten Zügen zum Juraexamen an der Fernuniversität. Ich hatte die schriftlichen Prüfungen mit Bravour gelöst. Es fehlte nur noch die Mündliche zum Prädikatsexamen. Und daher zählte ohnehin jede Minute. Und als sich dann auch noch das BKA einschaltete, naja! Die hätten mich fertiggemacht. Und ich hatte damals bestimmt nicht das Format von Julius. So einen Typen, wie den, gibt’s eigentlich gar nicht. So jung und bereits Leiter einer ständigen Mordkommission, zwar nicht in Dortmund, aber Hagen ist auch nicht zu unterschätzten.“
Die leitende Oberstaatsanwältin von Schönlau wandte sich ab und verließ das Büro mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Sollte es ihr tatsächlich gelingen das Verfahren Loupius neu aufzurollen und abschließend aufzuklären?
Rückblende 2004/ Loupius ist tot
Ein Knall, furchtbar laut und die Stille von Traum und Schlaf zerreißend, hatte den Jungen aufschrecken lassen. Da war das gleißende Licht der Sonne, das verärgerte Zetern einer aufgescheucht davonfliegenden Amsel und das verwirrte, schlaftrunkene Kind setzte sich auf und rieb sich die Augen. Mit einem unwilligen Seufzen schaute sich der Junge um, bis sein Blick an etwas hängenblieb, was ihn irritierte. „Papa?“, murmelte er leise, ließ sich von der Hollywoodschaukel gleiten und stapfte los. Sein Vater lag ausgestreckt im Gras, als würde er die Wolken am Himmel beobachten. Aber er regte sich nicht, sah nicht zu ihm, rief ihn nicht zu sich, um ihm einen weit oben dahinziehenden Elefanten zu zeigen oder was auch immer er in einer Wolke erkannte. Der Junge stolperte die letzten Schritte zu ihm und stockte. Die Augen seines Vaters waren geöffnet, sahen nach oben, starrten ins Leere.
„Papa? Papa? Papa, jetzt steh doch auf! Papa, was ist mit dir? Papa! Papaaaaa!“, hallte die Kinderstimme durch die nachmittägliche Stille des weitläufigen Gartens. Die kleinen Hände des Jungen krallten sich in das Hemd seines Vaters, der regungslos im frisch gemähten Gras des Rasens lag. Der Vierjährige hob verwirrt den Kopf und rieb sich mit dem Handrücken die Tränen von den Wangen. Etwas fühlte sich seltsam an und er sah auf seine Finger, die rot verschmiert und klebrig waren. Blut! Wie es aus seinem Knie kam, wenn er beim Toben gestürzt war … 'Es blutet nur ein wenig, hört gleich auf …', beruhigten ihn seine Eltern dann immer. Das hier aber war viel Blut und es kam aus der Brust seines Vaters. Ein großer roter Fleck hatte sich auf dem Hemd ausgebreitet. „Papa!?“, wimmerte er leise, dann durchfuhr ihn ein Schluchzen und Zittern: „Papaaa!“ Doch so laut er auch rief, so verzweifelt er an seinem Vater auch zu ziehen und zu zerren versuchte – er reagierte nicht. Niemand kam und half ihm, seinen Vater zu wecken. Niemand nahm ihn in den Arm und versprach, dass alles gleich aufhören würde. Der Junge weinte bitterlich, zunächst laut schluchzend, dann mehr und mehr, leiser werdend in sich hinein. Er spürte die warme Sonne auf seinem Rücken, als wäre es die tröstende Hand seiner Mutter, wie ein stiller Windhauch ihm durchs Haar fuhr, und er schloss die Augen, als könnte ihn die Dunkelheit vor all dem beschützen, was er nicht begreifen konnte. Er hörte das Summen der Bienen, das Zwitschern der Vögel und das sanfte Rascheln der Blätter im Wind, schluchzte ein paar Mal leise „Papa“ murmelnd auf, dann wurde es still und er glitt langsam davon bis alles wieder so war, wie es sein sollte ...
„Claudius!“ Komm!“, hörte er die vertraute Stimme seines Vaters durch das Pluckern des fahrbaren Rasenmähers. Wie immer ließ er sofort alles stehen und liegen und rannte zur Rasenfläche, sprang auf den Schoß seines Vaters und schon fuhren sie los. Fritz Wolf hielt seinen Sohn mit einer Hand fest und lenkte mit der anderen den kleinen Traktor über die weitläufige Rasenfläche: „Auf geht’s, die Herrschaften, bitte gut festhalten!“ Es war so etwas wie ein kleines Ritual, dass Claudius ein paar Runden mitfuhr. Alsbald war zu spüren, dass der kleine Körper schwerer zu werden schien. Das monotone Geräusch des Motors und der angenehme Geruch des frisch gemähten Rasens ließen den Kleinen regelmäßig müde werden und beim nächsten Passieren der großen Hollywoodschaukel hielt Fritz Wolf an und legte seinen Sohn liebevoll vorsichtig auf der schattigen Sitzauflage ab. Es wunderte ihn immer, wie tief und friedlich Claudius dort schlief, bis er mit der Gartenarbeit fertig war. So sehr sein Sohn die riesige Schaukel mit ihrem groß geblümten Bezug und den knarrenden Federn liebte, so sehr war sie seiner Mutter ein Dorn im Auge. Claudia Wolf hatte sie von Anfang an als kleinkarierten amerikanischen Kitsch abgetan. Für Claudius aber war sie bei jedem Gartenaufenthalt ein unverzichtbarer Anlaufpunkt, verhieß Ruhe und Abenteuer gleichermaßen, als Himmelbett oder Piratenschiff. Und wie sehr genoss er der die Aussicht auf das wunderbare Ritual, wenn sein Vater verkündete, dass der Rasen mal wieder gemäht werden müsse. Jeder im Umfeld der Familie Wolf kannte diese Gewohnheit – und gerade die schien Fritz Wolf nun zum Verhängnis geworden zu sein ... Aus der Ferne hätte es ein Idyll sein können: Ein Vater mit seinem Sohn beim Entspannen im Garten. Aus der Ferne war nicht zu sehen, dass im Körper des Mannes kein Leben mehr war ...
Ruhig und friedvoll lag das Haus der Wolfs im nachmittäglichen Schein der Sonne. Ein elegantes weißes Cabriolet kam mit einem Rauschen die schmale Straße herunter und zog leichte Staubfahnen hinter sich her, die sich langsam wieder auf den Asphalt senkten. In Gedanken versunken bog Claudia Wolf in die Einfahrt zum Haus ab und steuerte den „weißen Blitz“, wie ihr Mann das Cabrio gerne nannte, über den breiten Kiesweg auf die Front der riesigen Garage zu. Fritz hatte ihr das Auto zum Hochzeitstag geschenkt und sie wusste sehr gut, dass es ihn mehr Überwindung als Geld gekostet hatte, ein solches Statussymbol zu erwerben. Claudia Wolf hörte nicht, wie die Steinchen der Kiesauffahrt in den Radhäusern prasselten, bis sie den Wagen mit einem leichten Rutschen vor den Garagen zum Stehen brachte. Sie hing mit ihren Gedanken noch immer beim Studium der letzten Akte und machte sich zugleich schon wieder Gedanken, wie sie den weiteren Ablauf des Tages organisieren sollte. Sie schnallte sich ab, ließ den Kopf nach hinten gegen das warme Leder der Kopfstütze sinken, schloss die Augen und fuhr sich mit einem Seufzen über die Stirn bis zur Nasenwurzel. Dumpf und unnachgiebig kündigte sich ihre Migräne an und sie spürte durch die geschlossenen Lider hindurch das Stechen der Helligkeit, sehnte sich nach dem Dunkel, das im Schlafzimmer auf sie wartete. Sie merkte, dass sie irgendetwas irritierte, aber sie kam nicht drauf, was es war. 'Komm! Auf!', hörte sie ihre innere Stimme, öffnete blinzelnd die Augen und tippte gewohnheitsmäßig auf die Hupe. Das tat sie nicht nur bei guter Laune oder dem Bedürfnis, schnell ihre Familie zu sehen. Nein, oft war der Grund ein einfacher. Kam sie aus der Stadt nach Hause, war der Kofferraum oft gut gefüllt und sie hoffte, mit dem Hupen Hilfe für den Transport der Einkäufe anzulocken. Das war in der Regel nicht schwer, weil nicht nur die Kinder, sondern auch die übrigen Hausbewohner, also Großvater Heinrich und seine zweite Frau Ida, wussten, wie spendabel sie sein konnte. Stets brachte sie für jeden eine Kleinigkeit mit. Mal gab es Süßigkeiten, mal Kleidung oder Spielzeug oder etwas für den gepflegten Garten, etwa Fische für den Gartenteich. Ida zum Beispiel las gern Gartenzeitschriften. In einem kleinen, umzäunten Abschnitt hatte sie ein wahres Kräuterreich angelegt. Ihr Mann unkte oft, dass sie sicherlich insgeheim in der Lage wäre, so manchen Gifttrunk zu brauen. So hatte Claudia heute mit einem Grinsen gezielt nach einer Zeitschrift über harmlose Küchenkräuter gesucht. Kurz, es lohnte sich, auf das Hupsignal zu reagieren, wenn sie nach Hause kam.
Heute aber wurde keine Tür aufgerissen, gab es keine Laufschritte auf dem Gartenweg zu hören. Claudia tippte noch einmal die Hupe an. Nichts … Das war es, was sie so irritiert hatte. Bei diesem Wetter sollten eigentlich fast alle draußen sein und es hätte noch nicht einmal des Hupens bedurft, um fleißige Helfer anzulocken. Sie runzelte die Stirn und spürte gleich, dass sich dahinter die Migräne anschlich. Die Verwunderung aber drängte das Unwohlsein in den Hintergrund. Trotz der Geräuschkulisse der sommerlichen Natur war es irgendwie still, unheimlich still. Sie schaute zur Garage hinüber und betätigte die Fernbedienung für die Tore: Der Wagen ihres Mannes leuchte matt im Schatten, doch die Fahrzeuge des Großvaters, ein VW-Kübelwagen für die Jagd, eine S-Klasse sowie Idas Mini waren fort. Allesamt! Und dann fiel ihr noch etwas weiteres auf, das sie noch mehr irritierte: Auch die diversen zwei- und vierrädrigen Fortbewegungsmitteln der großen Kinder waren fort …
Claudia Wolf spürte, wie etwas ihr den Mund trocken werden ließ. Alles wirkte wie ausgestorben, wie eine fremde Welt. So ruhig hatte sie das Anwesen noch nie erlebt, es war gespenstisch, wie ein Spuk am helllichten Tag. Keine Kinderrufe, keine Geschäftigkeit in Garten oder Haus, als habe etwas das alltägliche Leben abgezogen. Sie spürte, wie ein Schaudern ihr den Rücken hinauf kroch, sich um ihre Kehle schlang und sich als mulmiges Gefühl in der Magengegend ausbreitete. Etwas stimmte hier nicht und es gab da diese entsetzliche leise Stimme irgendwo in ihrem Unterbewusstsein, die ihr zuflüsterte, dass es dafür keine beruhigende Erklärung gab. Sie blickte sich um. Selbst aus der Nachbarschaft war kein Mucks zu hören. Der nächste Nachbar war ihr Bruder Hugo. Der Giebel seines Hauses reckte sich wie neugierig über die Wipfel des riesigen Rhododendrons. Zu dieser Jahreszeit spielte er mit seiner Frau Ellen oft draußen auf der Terrasse Tischtennis, doch auch das mitunter enervierende „Ping“ und „Pong“ war nicht zu hören. Sie stemmte sich innerlich gegen den Gedanken, dass etwas Schreckliches geschehen sein könnte. Warum nur war es so still!? Selbst die Vögel, die zu dieser Jahreszeit für gewöhnlich ein vielstimmiges Konzert veranstalteten, waren bis auf wenige zurückhaltende Zwitscherlaute nahezu verstummt. Claudia Wolf fühlte eine Panik in sich aufsteigen, gegen die sie sich nicht wehren konnte. Ihre Gedanken rasten mit ihrem Herzschlag um die Wette. 'Rudolf!', schoss es ihr durch den Kopf. Selbst die brave Bracke, treuer Begleiter ihres Vaters auf dessen Jagdtouren, hatte sich nicht blicken lassen. „Rudolf!“, versuchte sie das Tier zu rufen, doch kam ihr nur ein heiseres Krächzen über die Lippen. „Rudolf!“, gelang ihr mit bemüht festerer Stimme ein neuerlicher Versuch. Doch auch jeder Laut des Hundes blieb aus. Und ihr Vater hatte keinerlei Pläne gehabt, mit Rudolf ins Revier zu fahren. Alles formte in ihr die Ahnung zu einer immer bedrohlicher werdenden Gewissheit, dass etwas Schreckliches passiert sein musste.
Claudia, nunmehr auch ein wenig zitternd vor Angst, schlich sich geradezu in Richtung der Haustür und bereute schon, sich bei der Ankunft lautstark bemerkbar gemacht zu haben. Als sie eine der Steintreppen, welche rechts und links den Eingang säumten, hinaufgestiegen war, bemerkte sie, dass die Türe nicht verschlossen war. Vorsichtig drückte die gegen das Portal und als ein Eingang weit offenstand, betrat sie ihr Elternhaus. Eigentlich hätte nunmehr spätestens Rudolf oder zumindest die Haushälterin Teresa erscheinen müssen. Doch nichts geschah. Sie schritt leise weiter in die Halle. Niemand war zu sehen oder zu hören. Dann schlich sie zu dem alten Sekretär ihrer verstorbenen Mutter. Dort waren stets die schriftlichen Nachrichten zu finden, welche die Familie, falls direkte Ansprache unmöglich erschien, dort hinterließ. Und ja genau, hier lag ein Brief. Es war ein verschlossener Umschlag mit der Adressierung „An meine geliebte Frau“. Die Schrift erkannte sie sofort. Es war die ihres Mannes Fritz. Der Großvater schrieb anders. Also, sie musste gemeint sein. Sie erschrak beim Anblick dieser Post. Spontangedanken, wie, er hat sich getrennt, oder dergleichen, verdrängte sie direkt und riss das Kuvert auf. Auch jetzt erkannte sie für sich die unverwechselbare Handschrift ihres Geliebten, dem Einzigen, dem Vater ihrer Kinder und las:
„Liebste Pusch,
wenn du diese Zeilen liest, werde ich nicht mehr bei dir sein können. Ich bin soeben getötet worden. Man hat mich erschossen. Claudius ist bei mir. Er hat mich gefunden und geweint. Nun ist er eingeschlafen. Er liegt in meinen Armen und hat sein Köpfchen zwischen meine Schulter und meinen dicken Kopf eingekuschelt, weißt du, so wie er es gerne tut, wenn ihm unheimlich ist. Es ist warm hier draußen im Garten. Mach dir keine Sorge um ihn. Er schläft fest. Aber komm bitte heraus zu uns und erlöse unseren kleinen Mann aus dieser blöden Lage. Erschrick nicht. Er wird, wenn du ihn aufhebst, Blut an seinem Hemd haben. Es ist nicht das Seine. Man hat mir direkt in mein Herz geschossen und Claudius hat mich, als ich am Boden lag fest umarmt. Bitte sei nicht böse mit ihm. Es ist das neue Hemd, was er erst zu deinem Geburtstag tragen sollte. Aber ich hatte es ihm erlaubt.
Ich liebe dich und schaue aus dem Himmel auf dich. Bitte sei jetzt stark.
In ewiger Liebe
Dein Fritz.“
Claudia ließ starr vor Schreck, den Brief, der eigentlich gar nicht von ihrem Mann geschrieben sein konnte, zu Boden fallen und lief hinaus in den Garten. Ein Gedanken-Karussell raste durch ihren Kopf. Hatte er den Brief vorsorglich deponiert, weil er wegen seiner Vergangenheit und Gegenwart die ständig lauernde Gefahr spürte, oder hatte der Angreifer den Brief deponiert, war er etwa im Haus gewesen? Sie hoffte inständig, dass alles sich als furchtbar makabrer Scherz ihres Mannes herausstellen sollte, aber insgeheim verspürte sie nur noch Angst – um Fritz, um Claudius. Diesen hätte er keiner Gefahr ausgesetzt oder doch? War er über die Jahre zu unvorsichtig geworden? Fragen über Fragen, deren Antworten sie hoffte, von Fritz erfahren zu können. Er konnte nicht tot sein.
Oben an dem durch den Schatten der Bäume dunkel wirkenden Rand des kleinen Wäldchens sah sie ihren kleinen Claudius im Gras liegen und unter ihm, glaubte sie, Fritz zu erkennen. Sie eilte, ihre Geliebten zu erreichen. Claudius war ihr einziges leibliches Kind. Seine Geschwister hatten sie und Fritz adoptiert. Die zweihundert Meter bis zu ihrem kleinen Claudius erschienen ihr endlos und sie verspürte unerträgliche Angst. Doch jetzt war sie da. Sie schrie und weinte bitterlich, warf sich zu Boden und nahm Claudius in den Arm. Kurz kniete sie flehend neben dem leblosen Körper ihres Mannes. Dann sprang sie auf und lief mit dem Jüngsten im Arm zurück zum Haus, um Hilfe zu alarmieren. Als sie jedoch zurückkam, waren plötzlich alle Türen verschlossen. Die Terrassentür, durch welche sie eben noch hinaus in den Garten gelaufen war, ließ sich nicht mehr öffnen. Der Riegel war offenbar von Innen verschlossen worden. Der Türgriff zeigte nach unten. Sie rannte nach vorn zur Haustür. Doch auch die war zu. Sie wollte nur noch ihren geliebten Claudius in Sicherheit bringen, vermutete sie doch den Attentäter ihres geliebten Fritz noch in der Nähe. Um Hilfe rufend, lief sie zu den Nachbarn. Aber auch dort war niemand.
Außer Atem, mit rasendem Puls, rannte sie unter dem Schutz der Bäume zurück. Sie musste zumindest unbeschadet ihren Wagen erreichen, dann könnte sie Hilfe alarmieren.
Mit Erstaunen nahm sie dann Ellen im Augenwinkel war. Sie konnte diese durch das Fenster sehen. Konnte diese sie wirklich nicht gehört haben? Schnell rannte sie zur Tür und schrie flehend nach Hilfe. Aber Ellen öffnete nicht. Sie konnte ihre Schwägerin sehen und rief mit lauten panischen Schreien nach Hilfe. Diese jedoch bekam sie nicht. Ellen wendete sich ab, und ging die Treppe hinauf, ohne noch einmal auf Claudia und den kleinen wimmernden Claudius zurückzuschauen. Claudia verstand die Welt nicht mehr, es konnte nur so sein, dass Ellen selbst in Gefahr war.
Claudia rannte verlangsamt, das Gewicht von Claudius machte sie nun für Verfolger anfällig, vom Haus weg zu ihrem Auto.
Immer wieder hatte Fritz mit ihr geschimpft, wenn sie die Autoschlüssel stecken ließ. Aber diese kleine Unart gereichte ihr nunmehr zur einzigen Hilfe. Claudius schlief wundersamer Weise immer noch und sie legte ihn hinten auf die kleine Notsitzbank, bevor sie den Wagen startete. Ihr Fuß zitterte so, dass sie von der Kupplung abrutschte und den Wagen abwürgte, sie wähnte schon einen Verfolger im Rückspiegel, als es ihr gelang den Wagen mit rasender Geschwindigkeit vom Grundstück zu bewegen. Sie war gerade auf die Hauptstraße in Richtung der kleinen nahegelegenen Stadt mit dem Namen Halver, eingebogen, als ihr bereits Blaulichter entgegenschossen und von der Hauptstraße abbiegend mit höchst möglicher Geschwindigkeit, den ca. 2 km langen von Schlaglöchern gesäten Weg hoch zum Haus fuhren.
Blitzschnell riss sie das Lenkrad herum, Gott dankend, dass kein Gegenverkehr kam, und folgte den Rettern. Wer diese gerufen hatte, wusste sie nicht. Vielleicht war es Ellen gewesen. Aber das war ihr auch egal. Hauptsache war, dass Fritz Hilfe bekäme und überleben würde.
Doch dieser Wunsch war ihr nicht mehr zu erfüllen. Sie wusste es eigentlich, wollte es aber nicht wahrhaben.
Es war zu spät, viel zu spät. Der Gerichtsmediziner sollte später feststellen, dass Fritz bereits über zwei Stunden nach dem tödlichen Schuss leblos auf dem Rasen gelegen haben musste. Und fast eben die gesamte Zeit über hatte sein kleiner Sohn Claudius wahrscheinlich auch auf ihm liegend ausgehalten.
Als sie nach rasanter Fahrt am Hause angekommen war, und mit einer geradezu filmreifen Bremsung den Kies der Auffahrt emporschleuderte, traf sie dort auf vier Polizeibeamte, die ohne Orientierung schienen, und sich mit gezogenen Waffen in Richtung des Hauseingangs bewegen wollten. Sie empfand unendliche Erleichterung, zum einen sah sie die vermeintliche Gefahr durch den Eindringling gebannt, zum anderen kam endlich Hilfe für ihren geliebten Fritz. Es wird alles gut werden, dachte sie zu diesem Zeitpunkt.
Sie sprang aus dem Wagen, rannte in Richtung der Polizisten und kreischte hysterisch, dass ihr Mann am Waldesrand schwerstverletzt, leblos scheinend liege, Hilfe benötige. Auch schrie sie nunmehr regelrecht panisch, wo denn der Krankenwagen bliebe. Ob der denn nicht alarmiert worden sei?
Blitzschnell lief ein Beamter zurück zum Auto und veranlasste per Funk das baldige Eintreffen eines Rettungswagens. Sodann liefen alle, mit Ausnahme eines Beamten, der den Eingangsbereich und den immer noch schlafenden Claudius bewachen sollte, voran natürlich Claudia, hinauf zu Fritz. Dort angekommen stellte die Gruppe schnell fest, dass diesem kein Dienst mehr geleistet werden konnte. Claudia sackte aufgrund dieser Erkenntnis zitternd über Fritz zusammen. Ein Beamter blieb bei Claudia, während die anderen beiden die Kollegen von der Kripo informierten, versuchte Trost zu spenden, aber auch zu verhindern, dass weitere Spuren auf der Leiche und am vermeintlichen Tatort verwischt würden. Er nahm sie in den Arm, zog sie mit ihrer blutverschmierten Kleidung sanft von ihrem Mann. Es tat ihr nach anfänglich befremdlichen Gefühlen sehr gut. Sie brauchte jetzt einfach ein bisschen Wärme. Für sie war alles wie im Film, sie nahm alles nur benebelt war, bis Claudius, der mittlerweile aufgewacht war, sie jäh in die Realität zurückbrachte, und den Hügel hinaufgelaufen kam. Er ließ sich nicht von den Polizisten zurückhalten. Claudius war wütend. Er schien außer sich und prügelte auf seine Mutter ein. Das Bild, welches sich ihm bei seiner Ankunft am Unglücksort zeigte, überforderte ihn. Da lag sein über alles geliebter Vater, wahrscheinlich tot am Boden und davor stand seine Mutter und ließ sich von einem fremden Mann umarmen. Und noch dazu von einem Polizisten, denen sein Vater stets mit Argwohn entgegengetreten war. Claudia löste die gespannte Situation aber rasch auf. Höflich distanziert, so freundlich, wie es in der derzeitigen Situation möglich war, stieß sie den tröstenden Polizisten von sich und kniete sich hinunter zu ihrem eifersüchtig scheinenden verzweifelten Söhnchen, um diesen fest in ihre Arme zu schließen. Beide hielten sich eng umschlungen, weinten bitterlich, so dass sich auf dem Boden eine Mischung aus Blut, Tränen und Wimperntusche sammelte, doch es half ihnen zunächst ein wenig.
Die Szenerie erlangte nunmehr zügig die übliche Professionalität. Die Männer von der Kriminaltechnik betraten die Bühne und sperrten den Fundort der Leiche großräumig mit Flatterband ab. Die Mordkommission traf ein und Claudius wurde von einer Psychologin betreut. Diese hatte sich auch um Claudia kümmern wollen, doch die lehnte das vehement ab. Sie wollte wissen, was geschehen war und keine Zeit verschwenden. Ein übliches Verhaltensmuster von traumatisierten Angehörigen, entweder sie versanken in Trauer oder steigerten sich in Aktionismus.
Die Ermittlungen leitete zunächst der damalige Kriminalhauptkommissar Eugen Harris, der bereits viele Dienstjahre auf dem „Buckel“ bei der Mordkommission in Dortmund und dem geschuldet graue Haare hatte. Da sich der Fundort der Leiche im Märkischen Kreis befand, wäre eigentlich das Polizeipräsidium in Hagen zuständig gewesen. Dort gab es aber just zu der Zeit keine ständige Mordkommission. Daher übernahmen die Dortmunder den Fall.
Auf Anweisung des allein durch seine große stattliche Erscheinung raumeinnehmenden Harris, wurden die ersten Spuren durch die Beamten der Polizei Lüdenscheid gesichert.
Dort war auch der Notruf eingegangen, aufgrund dessen von dort aus direkt der Einsatz gefahren wurde. In der Ermittlungsakte wurde später eingetragen, dass der Anrufer, welche die Polizei informiert hatte, einen öffentlichen Fernsprecher in der Hansestadt Breckerfeld benutzt haben müsste.
Die Stimme des Anrufers war verstellt gewesen und konnte so bisher keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Fest stand aufgrund gutachterlicher Bewertung der Kriminaltechnik jedoch, dass es sich um eine Frauenstimme handelte, und diese Stimme zu einer Frau jenseits der dreißig bis vierzig Jahre gehören musste.
Im Polizeipräsidium Hagen 2017 / Büro von Julius Wolf
Hauptkriminalkommissar Julius Wolf bestieg mit einem mulmigen Gefühl die Treppe im Polizeipräsidium Hagen. Für ihn unerklärlich war er zu Oberstaatsanwältin Frau von Schönlau zitiert worden. Er ließ sich Zeit beim Treppensteigen, nicht etwa weil es seine Fitness nicht anders erlaubt hätte, er war überdurchschnittlich gut trainiert, ging regelmäßig joggen oder ins Fitnessstudio, nein vielmehr versuchte er sich einen Reim darauf zu machen, warum er hier erscheinen sollte. Verfehlungen hatte er sich nicht zu Schulden kommen lassen, hoffentlich hatte es nichts mit seinen familiären Verhältnissen zu tun, für die er selbst nicht das geringste konnte, ihm immer wieder Steine in den Weg legten.
Möglicherweise war aber auch endlich seinem Gesuch, die familiären Verstrickungen der „Wölfe“ aufzuklären, nachgekommen. Letzteres konnte er sich fast nicht vorstellen, da er schon mehrfach Anlauf genommen hatte und immer wieder zurückgewiesen wurde. Er wurde wegen seines Interesses und geheimer Ermittlungen bereits mehrfach bedroht, einmal sogar – zwar nicht schwer – aber verletzt durch einen Stein der auf sein fahrendes Auto geworfen worden war. Er konnte gerade noch den Wagen abfangen und so das Schlimmste vermeiden. Den Drohenden konnte er allerdings nicht ermitteln, vermutete aber eine Organisation oder eine ziemlich einflussreiche Stelle dahinter.
Er atmete noch einmal tief durch und betrat nach vorherigem Klopfen das Büro der Oberstaatsanwältin.
Sie war wie stets korrekt gekleidet. Der unzweifelhaft maßgeschneiderte graue Hosenanzug – sie trug stets einen solchen als „Arbeitskleidung“ - verlieh der 1,65 großen, leicht fülligen, aber nicht dicken, Oberstaatsanwältin ein adeliges Businessaussehen, welches ihre generell bekannte kühle und reservierte Art unterstrich.
Sie war entgegen ihrer sonst und von Julius erwarteten bestimmenden Art erstaunlich offen, geradezu leger.
Sie begann das Gespräch mit den Worten:
„So, Herr Hauptkriminalkommissar, Sie haben den Posten! Ich habe das mit dem Polizeipräsidenten geklärt. Der möchte natürlich, und ich übrigens auch, zügig Ergebnisse sehen, wenn wir Sie schon ab beordern. Sie wissen hoffentlich, worauf Sie sich dort einlassen? Ich muss Ihnen nicht sagen, dass Sie behutsam sein sollen, aber lassen Sie sich auch nicht einschüchtern. Wir stehen voll und ganz hinter Ihnen.“
„Danke, Frau Staatsanwältin. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Die Familie macht doch schon ziemlichen Druck auf mich und ich werde Sie nicht enttäuschen.“
„Wen, die Familie oder mich?“
Verwirrt antwortet Julius: „Beide, aber in erster Linie natürlich Sie, Frau Dr. von Schönlau.“ Nun verfiel die Oberstaatsanwältin wieder in ihren gewohnt barschen Ton.
„Gut, gut! Aber nun zur Sache. Haben Sie schon etwas? Ich weiß doch, dass Sie insgeheim bereits ermitteln, oder, täusche ich mich da?“
Unsicherheit erfasste Julius. Woher wusste sie von seinen geheimen Ermittlungen, steckte sie auch hinter den Drohungen? Dann machte es aber keinen Sinn, dass sie ihn jetzt mit den Ermittlungen betraute, oder war der Druck von oben zu stark geworden?
„Also, äh, nein. So ganz falsch ist Ihre Annahme nicht. Ein wenig habe ich schon einmal die Fühler ausgestreckt. Sie dürfen mir das jedoch bitte nicht übelnehmen.“
„Was ich Ihnen Übel nehmen werde, entscheide ich später, wenn Sie mir mitgeteilt haben, was Sie bereits vorzuweisen haben. Also was haben Sie?“
Julius rutschte ein wenig auf dem Stuhl hin und her und signalisierte Verlegenheit sowie Stolz gleichermaßen, als er seiner zuständigen Staatsanwältin die Akte des BKA überreichte. Er wusste, dass er diese bestimmt nicht in seinem Besitz haben durfte. Aber er besaß sie nun einmal mal und wollte damit auch nicht hinter dem Berg halten, zumal die Staatsanwältin eigentlich sein volles Vertrauen hatte. Die kurze Unsicherheit gerade schob er auf vermeintliche Gespenster, die er sehe. Gerade dieses Vertrauen, welches in der Sache Loupius gewiss nicht jeder verdiente, genoss aber auch er seitens seiner Vorgesetzten und das war in diesen Zeiten äußerst wichtig. Zu undurchsichtig waren doch die Verflechtungen in der Angelegenheit Loupius. Keiner wusste, wer alles in diesen Fall von organisierter Kriminalität verwickelt war.
Anne Kathrin von Schönlau erschrak, als sie die Akte sah. Damit hatte sie nicht gerechnet.
Sofort erkannte sie doch die Illegalität dieses Besitzes. Aber sie war auch neugierig.
Erstaunt fragte sie: „Woher haben Sie die denn, um Gottes Willen? Das kann uns allen den Kopf kosten. Sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Geheime Akten des BKA sind für uns sterbliche Beamten tabu. Das will ich eigentlich gar nicht gesehen haben. Ich müsste wahrscheinlich direkt ein Verfahren gegen Sie einleiten. Aber gut, sei es drum. Sie werden eine gute Erklärung dafür haben. Da bin ich mir sicher. Und trotz des gesamten Papierwustes habe ich meine Wurzeln nicht vergessen und ich bin nach wie vor eine wissbegierige Ermittlerin“. Die Oberstaatsanwältin hatte vor Beginn ihres Studiums eine Ausbildung bei der Polizei gemacht und war damals schon für ihre geradlinige Art geschätzt worden. Ihr damaliger Dienstherr war auch nicht glücklich, als sie ihm mitteilte studieren und Staatsanwältin werden zu wollen.
Sie forderte ihn mit den Worten „ich hoffe, dass außer uns beiden keiner hiervon etwas weiß“ auf, die Akte zu übergeben.
Julius bekam, wie stets wenn er verlegen war, rote Ohren und gestand leise ein: „Außer uns beiden und meiner Mutter.“
Die Staatsanwältin erhob ihre Stimme „Was zum Teufel hat Ihre Mutter damit zu tun und seit wann binden wir Privatpersonen in unsere Ermittlungen, die in diesem speziellen Fall noch nicht einmal aktuell sind, ein?“
Julius fasste sich langsam wieder und seine Ohren nahmen wieder die normale Farbe ein, er gewann sogar ein bisschen Oberhand.
„Ja meine Mutter, ist, wie Sie vielleicht wissen, die Schwägerin des Ermordeten. Und diese hat nach dem Tode meines Vaters Hugo eine alte Jugendliebe wieder ausgegraben und, wie der Zufall es wollte, war der ein Kollege vom BKA. Alles Weitere können Sie sich selbst zusammenreimen.“
„Wieso war, gibt es den Kollegen nicht mehr?“
Die nachfolgende Geschichte war ihrem Gegenüber sichtlich unangenehm, sollte sie doch seine Mutter in ein etwas dubios wirkendes und ermittlungstechnisch spannendes Licht rücken.
„Tja, wie soll ich sagen..“ druckste er „..meine Mutter scheint mit Männern nicht viel Glück zu haben oder diese nicht mit ihr. Nach dem tragischen Unfall meines Vaters, der aus dem Bett gefallen war und sich dabei bedauernswerterweise einen Genickbruch zuzog, hatte sie noch vier weitere Verehrer und was soll ich sagen? Sie sind alle tot. Und sie starben alle fast auf dieselbe Art und Weise, nämlich in unserem Wohnwagen an der Bevertalsperre an Herzversagen.“
Die Oberstaatsanwältin zog die Stirn kraus, so dass sich die Falte zwischen ihren Augen verstärkte, eine Eigenschaft, die sie immer dann an den Tag legte, wenn ihr etwas merkwürdig und ermittlungsrelevant erschien.
„Das ist mehr als seltsam. Gibt es denn ein oder gar mehrere Ermittlungsverfahren gegen Ihre Mutter? Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein.“
Julius stimmte der Oberstaatsanwältin trotz der Tatsache, dass es sich um seine Mutter handelte, zu.
„Ja, aber um die Kompetenz zur Aufklärung dieser Fälle streiten sich bereits mehre Dienststellen, also konkret die Kollegen aus Wuppertal, Remscheid, Gummersbach und Köln. Zudem mischt auch das BKA wieder mit. Die kommen jedoch bislang alle nicht so richtig voran und sind zur Zeit wohl noch der Meinung, es seien tatsächlich natürliche Todesursachen gewesen. Ein Zusammenhang konnte nicht ermittelt werden und die Obduktionen verliefen ebenfalls unauffällig. Daher habe ich beschlossen, die Angelegenheiten auf sich beruhen zu lassen. Mir ist es zwar nicht, aber soll es sicher besser egal sein. Nicht meine Zuständigkeit, heißt es da wahrscheinlich intelligenter Weise.“
Die Oberstaatsanwältin nickte nachdenklich.
„Na gut, Sie haben Recht und jetzt überlassen Sie mir bitte die Akte und schließen die Tür hinter sich, dass uns hier bloß keiner erwischt, bei der Lektüre dieses hoch geheimen Vorganges.“
Die Staatsanwältin ließ sich noch einen Kaffee von Julius bringen, begann zu lesen und war bereits so in die Akte vertieft, dass sie nicht einmal bemerkte, dass Julius noch einen Augenblick nachdenklich verharrte, bevor er sich hinsetzte und auf ihre Reaktion wartete.
Wie gewohnt, schlug sie dabei die Akte von hinten auf und vernahm zunächst den Vermerk „Ermittlungen eingestellt“. Als sie sodann weiter nach vorn blätterte, stieß sie auf das Vernehmungsprotokoll und begann dieses zu studieren. Der Inhalt fesselte Sie derart, dass der zuvor noch gut duftende Kaffee zwischenzeitlich erkaltet war. Ihre Gedanken versanken in das Jahr 2003 und sie befand sich gedanklich mit im Vernehmungszimmer.
Studium des Auszuges aus der Ermittlungsakte Loupius - 2003
Wortprotokoll über die Beschuldigtenvernehmung, Fritz Wolf, wegen des Vorwurfes: Mord
Ort: Wiesbaden
Datum: 5 September 2003
Uhrzeit: 7.30 Uhr
Anwesend: der Beschuldigte, Kriminaldirektor Jessen und Kriminalrat Mücke, sowie als Protokollantin Frau Mechthild Bäcker.
Vermerk: Auf Ton- und Videoaufzeichnung wurde auf Wunsch des Beschuldigten und in Abstimmung mit dem Behördenleiter unter Protest von Kriminalrat Mücke vorerst verzichtet. Der Beschuldigte wurde gem. §§ 136 I, 163 a III, IV StPO ordnungsgemäß belehrt.
Die Oberstaatsanwältin überblätterte die üblichen Belehrungsfloskeln und schlug den Beginn der eigentlichen Vernehmung zur Person und Sache auf.
Zur Person:
Mücke: “Sie heißen, wohnen, Beruf, Familienstand etc.?“
Wolf: „Ich heiße Fritz Wolf, geboren am 24.11.1962 in Hagen/Westfalen, verheiratet fünf Kinder, von Beruf Rechtsanwalt.“
Zur Sache:
Mücke: „Kennen Sie diese Person auf dem Foto und wie erklären Sie sich, dass diese Person Ihr Bild mit Ihrer Telefonnummer bei sich trug, Herr Wolf oder sollte ich besser sagen Loupius. So nennt man Sie doch gemeinhin, wenn man sich mit Ihnen einlässt, richtig? Sagen Sie schon, habe ich Recht?“
Wolf: „Um Ihre Fragen der Reihe nach zu beantworten, Sie offensichtlich überforderter Mensch. Ja, die Person auf dem Foto kenne ich. Und ja, es gibt ehrenwerte Personen, die mich Loupius nennen. Schließlich darf ich Ihnen auf Ihre letzte Frage hin mitteilen, dass selbst Sie Recht haben. Die Rechtsfähigkeit begann mit der Vollendung Ihrer Geburt, wenn man mal davon ausgeht, dass Sie wirklich geboren wurden und nicht vielleicht doch geschlüpft sind. Welches Recht Sie jedoch besitzen, entzieht sich meiner Kenntnis.“