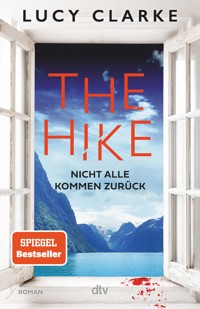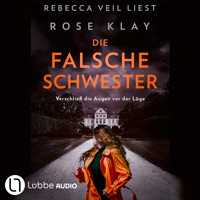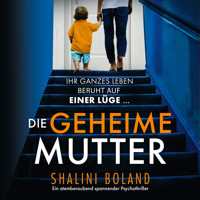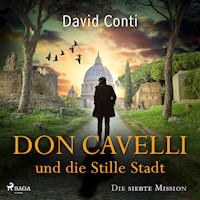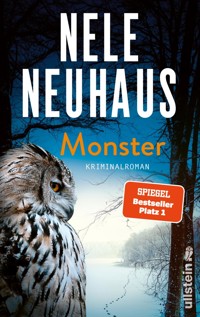4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Aus grausigen Tiefen steigt die vierte Taschenbuchausgabe von CTHULHU LIBRIA NEO auf und bringt Essays und Geschichten mit, die sich mit den Schrecken unter der Erde befassen. Neben Texten von Felix Woitkowski, Jörg Kleudgen und Rainer Zuch wird mit Michael Siefeners Schächte eine seit dreißig Jahren vergriffene Erzählung wieder zugänglich gemacht. Die Printausgabe des Buches umfasst 296 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Jörg Kleudgen (Hrsg.)CTHULHU LIBRIA NEO 4
In dieser Reihe bisher erschienen:
2101 William Meikle Das Amulett
2102 Roman Sander (Hrsg.) Götter des Grauens
2103 Andreas Ackermann Das Mysterium dunkler Träume
2104 Jörg Kleudgen & Uwe Vöhl Stolzenstein
2105 Andreas Zwengel Kinder des Yig
2106 W. H. Pugmire Der dunkle Fremde
2107 Tobias Reckermann Gotheim an der Ur
2108 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Xulhu
2109 Rainer Zuch Planet des dunklen Horizonts
2110 K. R. Sanders & Jörg Kleudgen Die Klinge von Umao Mo
2111 Arthur Gordon Wolf Mr. Munchkin
2112 Arthur Gordon Wolf Red Meadows
2113 Tobias Reckermann Rückkehr nach Gotheim
2114 Erik R. Andara Hinaus durch die zweite Tür
2115 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo
2116 Adam Hülseweh Das Vexyr von Vettseiffen
2117 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 2
2118 Alfred Wallon Salzburger Albträume
2119 Arno Thewlis Der Gott des Krieges
2120 Ian Delacroix Catacomb Kittens
2121 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 3
2122 Tobias Reckermann Gotheims Untergang
2123 Michael Buttler Schatten über Hamburg
2124 Andreas Zwengel Finsternacht
2125 Silke Brandt (Hrsg.) Feuersignale
2126 Markus K. Korb Treibgut
2127 Tobias Reckermann (Hrsg.) Drommetenrot
2128 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 4
2129 Peter Stohl Das Hexenhaus in Arkheim
Jörg Kleudgen (Hrsg.)
Cthulhu Libria Neo 4
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KleudgenTexte: Rainer Zuch, Jörg Kleudgen, Felix Woitkowski, Michael Siefener, Uwe Voehl, Christopher Müller, E. L. Brecht, Thomas Ulbricht, Christian Schrödel, Elmar HuberKorrektorat: AsKIllustrationen: Jörg Kleudgen, Christopher MüllerFotografien: Rainer Zuch (Genius Loci)Titelbild: Jörg KleudgenUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-938-6
Inhaltsverzeichnis
Editorial
„Hm, ein Schwerpunktthema? Etwas mit Höhlen oder Katakomben vielleicht?“, antwortete mir Dirk Bützer spontan auf die Frage, ob er einen Vorschlag für ein Schwerpunktthema des CTHULHU LIBRIA NEO-Magazins wisse. Damit hatte der in der Phantastikszene bekannte, umtriebige Sammler einen Nerv getroffen, und wenige Nachrichten später stand der Titel „Aus grausigen Tiefen …“ fest.
Was fasziniert uns am chthonischen Grauen? Ist es die Finsternis, die Feuchtigkeit, die unter der Erde herrscht, der modrige Geruch? Oder die Tatsache, dass wir die dünne Erdkruste, auf der wir uns für gewöhnlich bewegen, nur selten verlassen, aber am Ende unter ihr begraben werden: „Aus der Erde sind wir genommen, zur Erde sollen wir wieder werden, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub“, heißt es in der christlichen Begräbnisliturgie. Doch manchmal gelangen Dinge, die auf ewig ruhen sollten, wieder zurück ans Tageslicht.
Und dann ist da die Frage, was aus vorgeschichtlicher Zeit, in der unsere Vorfahren in Höhlen lebten, noch heute in unserer Psyche verankert ist. Dunkle vorzeitliche Kulte mögen die Griechen der Antike dazu bewegt haben, chthonische Götter wie Hades oder Hekate zu verehren.
Wir hoffen, dass unsere Beiträge im wahrsten Sinne des Wortes „Licht ins Dunkel“ bringen können!
Jörg Kleudgen
Der Abgrund der zweiten Wirklichkeit.
Die Kosmische Angst im Keller
von Rainer Zuch
0. Catacomb Resonator1
Stimmen.
Wir hören Musik von ihren rituellen Ursprüngen her: Stimmen, die sich zwischen rituellem Gesang und Raunen bewegen, fast tonlose Stimmen, die zunächst leise, dann mit zunehmender Intensität anschwellen, um anschließend zurückzusinken in tonloses Nichts. Doch wie in einer Wellenbewegung kehren sie wieder, vor und zurück. Es klingt, als kämen sie aus einer Gruft, abgründige Intonationen, ein atonaler Klagegesang ohne Melodie und Rhythmus. Gelegentlich wird er begleitet von an- und abschwellendem Rauschen und von elektronischen, schwirrenden Klängen, die dem unheimlichen Gesang eine verhalten aggressive Note geben.
Schließlich breitet sich eine Fast-Stille aus, in die nach einigen Minuten die Stimmen zurückkehren, nun begleitet von rhythmischen Lauten, die beinahe artikuliert wirken. Im letzten Drittel steigert sich die Intensität Musik, sie tritt dem Ohr fast unangenehm nahe, kreist es ein, bevor sie schließlich wieder in dem Nichts verschwindet, aus dem sie aufgestiegen war.
Obwohl der Tonträger eine CD ist, hat die Hülle das Format einer Vinyl-Single. Sie besteht aus schwarzem Karton und ist zweifarbig bedruckt: nach einem symmetrischen Schema verteilte braune Flecken, die sich um eine turmartige schwarze Form scharen. Bei näherem Hinsehen erkennt man in den braunen Flächen Andeutungen zyklopischen Mauerwerks, die sich zu einer gangartigen Architektur mit einer torartigen, schwarzen Öffnung formen. In dieser Öffnung ist ein Ausschnitt des Nachthimmels zu sehen, in dem einige Sterne als kleine silberne Tropfen verteilt sind.
Kein Boden ist sichtbar. Vielmehr sind die Mauern aus starker Untersicht gesehen. Wie der Titel andeutet, ist es der Blick aus einer Katakombe: Man sieht aus chthonischen Tiefen hinaus ins kalte Weltall.
Doch so nahe der Ausgang erscheint, so unerreichbar fern wirken die Sterne: ein Grab mit einem Ausblick, der keine Befreiung ist.
1. Kosmische Angst
„Die älteste und stärkste menschliche Gefühlsregung ist die Angst, und die älteste und stärkste Angst ist die Angst vor dem Unbekannten.“2
Wir kennen diesen Satz. Howard Phillips Lovecraft eröffnet mit ihm seine Untersuchung über den übernatürlichen Horror in der Literatur, in der er die Geschichte der weird fiction oder, wie die leider etwas irreführende Übersetzung lautet, der „unheimlich-übernatürlichen Horrorerzählung“3 nachvollzieht. In diesem Zusammenhang fällt der Begriff „kosmische Angst“. Diese habe nichts zu tun mit dem herkömmlichen gotischen Instrumentarium unheimlich-schauriger Erzählungen, in denen „blutige Gebeine oder eine in Laken gehüllte Gestalt, die vorschriftsmäßig mit den Ketten rasselt“4, in legionenhafter Anzahl auftreten. Vor allem das „vorschriftsmäßig“ verweist auf ein in Lovecrafts Augen grundlegendes Manko solcher Geschichten: Orte, Szenarien, Figuren und Situationen sind festgelegt und konventionalisiert, sie funktionieren nach bekannten Strickmustern, sie sind vorhersehbar. Man kann sie im Lehnsessel am Kamin genießen, während das Feuer prasselt und der Sturm ums Haus heult – wir sehen, dass es sogar Konventionen bezüglich des passenden Ambientes gibt. Lovecraft meint etwas gänzlich anderes:
„Eine bestimmte Atmosphäre atemloser und unerklärlicher Furcht vor äußeren unbekannten Mächten muß vorhanden sein, und die schrecklichste Vorstellung, die das menschliche Gehirn befallen kann – nämlich die Vorstellung von einer unheilvollen und punktuellen Aufhebung oder Ausschaltung jener unveränderlichen Naturgesetze, die unseren einzigen Schutz gegen die Attacken des Chaos und der Dämonen des unergründlichen Weltraums darstellen. … Der einzige Prüfstein für das wahrhaft Unheimlich-Übernatürliche ist ganz einfach die Frage, ob im Leser ein tiefes Gefühl der Furcht hervorgerufen wird, ein Gefühl, mit unbekannten Sphären und Mächten in Berührung zu kommen, eine aufmerksame Haltung furchtsamen Lauschens“5.
Das Unbekannte: der Gegenstand dieser Angst ist nicht das Böse, sondern das ganz Andere, Fremde, Unbegreifliche. Auch diese moralische Ungreifbarkeit unterscheidet die kosmische Angst von der Angst vor dem Gespenst oder Ungeheuer.
Für Lovecraft ist das Hervorrufen dieser allumfassenden Furcht von Anfang an gebunden an die Erzeugung einer bestimmten Atmosphäre und Stimmung:
„Atmosphäre, nicht die Handlung ist das große Desiderat in der unheimlichen Literatur. Eine Geschichte von einem Wunder kann … nie etwas anderes sein als ein lebendiges Bild einer bestimmten Art menschlicher Stimmung.“6
Die Bedeutung von Stimmung und Atmosphäre meint also wesentlich mehr als den wohligen Grusel im heimischen Wohnzimmer. Lovecraft ist es um ein „existenzielles Derangement“ gegangen: „Es tritt ein, wenn das bedroht ist, was man in Ermangelung eines besseren Wortes wohl als Seele bezeichnen muss.“7 Auch wer nicht an eine Seele im religiösen Sinn glaubt, sollte damit etwas anfangen können: Das Ziel ist die Verunsicherung jeder Vorstellung eines unverrückbaren Seinsgrundes.
Lovecraft zählt in Supernatural Horror in Literature eine ganze Reihe von Autoren auf, die sich seiner Auffassung nach effektiv mit dieser existentiellen Form von Angst beschäftigen. Neben einigen Andeutungen in der klassischen gotischen Schauerliteratur nennt er unter anderem Erzählungen von Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Ambrose Bierce, Robert W. Chambers, Clark Ashton Smith, Walter de la Mare, William Hope Hodgson, Arthur Machen und Algernon Blackwood.
Arthur Machen hat bereits 30 Jahre früher in seinen Erzählungen Formulierungen gefunden, die eine große Nähe zu Lovecrafts Haltung aufweisen. Auch Machen führt immer wieder Wissenschaftler ein, doch gerade sie sind anfällig für die Unerklärlichkeit der Welt: „… wir stehen inmitten von ehrfurchtgebietenden Mysterien und Sakramenten, und noch ist nicht klar, wer wir einmal sein werden.“8 Denn „die Materie [ist] ebenso wahrhaft entsetzlich und unbekannt … wie der Geist, daß die Wissenschaft erst auf der Schwelle zögert und spielt und kaum mehr als einen Blick von dem Wunder im Innern erhascht.“9 Wenn er im „Roman vom weißen Pulver“ von einem „Grauen, ein Schrecken ohne Form und Gestalt“ spricht und einer Angst, die so „gestaltlos“ sei wie das zerfallende Ding in der Ecke des Zimmers, das einmal ein Mensch war und das die Protagonistin erblicken muss10, hat er Formeln für die kosmische Angst gefunden, die in ihrer Eindringlichkeit denen Lovecraft in nichts nachstehen.
Auch viele Erzählungen Jean Rays, eines Autors, den Lovecraft sicher geschätzt hätte, wäre er lange genug am Leben geblieben, um ihn kennenzulernen, gehen auf ein fundamentales Entsetzen aus:
„… das ’Grauen’, eine entsetzliche und feige Angst, die sie grässlich zu den vom Mondlicht verzinnten Dächern aufschreien lässt. Es ist aber nichts da, nichts, nichts. Das heißt: für unsere menschlichen Sinne ist nichts da. Aber ein latenter sechster Sinn, ein verstümmelter, formloser Sinn, dem kein Organ zur Verfügung steht, spürt in uns dieses Etwas, dieses vielförmige Etwas, das sich dem Dunkel gesellt, den Mondnächten am Pol, dem grellen Rot des Blutes auf blanker Haut, dem Heulen des Windes übers Ödland.“11 Denn „die Angst ist kein Endzustand: sie steht über der Vernunft, der Urteilskraft und dem Verständnis. Sie ist die Verzweiflung vor einem Weg, den unübersteigbare Gegenstände uns versperren, sie ist die erste Reaktion der Seele vor dem Nichts, das hervorgetreten ist. … Man wird ihr auf ehrlichere Weise gerecht, wenn man sie wie eine Wächterin betrachtet, die zwar streng ist und ohne Zärtlichkeit, aber die sich zwischen uns und einer unbekannten Gefahr, die uns nackt und wehrlos lässt, aufrichtet.“12
„Jeder Horror, der den Namen verdient, ist letztlich metaphysisch.“13 Diesem Diktum Daniel Illgers kann man vor dem angeführten Hintergrund nur zustimmen. In seinem Buch über die kosmische Angst unterscheidet Illger kosmischen Horror und kosmische Angst. Er fasst sie als Phänomene auf, die im 19. und 20. Jahrhundert ständig an Bedeutung gewonnen haben, und prophezeit der kosmischen Angst eine größere Zukunft als der „Angst des 21. Jahrhunderts“.14 Wenn er sie kultur-und geistesgeschichtlich einordnet, bezieht er sich explizit auf Lovecraft. Den kosmischen Horror versteht er als „das Bestreben, all jene, die seinen Bannkreis betreten, mit der Ahnung einer zweiten, verborgenen Wirklichkeit zu erfüllen, welche hinter der alltäglichen Wirklichkeit wartet – einer Wirklichkeit, die voller Grauen und Geheimnis ist“.15 Diese zweite Wirklichkeit hat nichts mit unserer Erfahrungswirklichkeit zu tun, jener Welt, die wir als unwidersprochen gültig und sicher betrachten. Sie weitet im Gegenteil die Wirklichkeit in ungeahnte, unbekannte und deshalb furchterregende Räume aus, die nicht nur zeigen, dass das, was wir als Wirklichkeit verstehen, nicht alles ist. Viel schlimmer: Diese „zweite Wirklichkeit“ schlägt auf die erste zurück, relativiert sie, weist sie in enge Schranken und stellt sie dadurch auf den Kopf. Das, was wir als universell gültig betrachtet haben, wird auf einmal zu einer Insel in einem schwarzen Nichts, aus dem heraus die Fangarme des Unbekannten nach uns greifen. Das können sie, weil die Grenze zwischen diesen beiden Wirklichkeiten durchlässig ist, eine Membran, die Wechselwirkungen zulässt16, wodurch überhaupt erst ein den Verstand sprengendes Grauen wirksam werden kann. Der kosmische Horror entspricht einer Haltung absoluter Verlorenheit in einem wahlweise leeren und sinnlosen oder von schrecklichen, unbegreiflichen Kräften beherrschten Universum; in jedem Fall aber verdammt es das menschliche Leben zu etwas, das nicht einmal eine Marginalie im Kosmos genannt werden kann. Die einzigen angemessen erscheinenden Haltungen wären entweder totaler Fatalismus oder eine tödliche Depression – oder beides zusammen. „The only cosmic reality is mindless, undeviating fate – automatic unmoral, uncalculating inevitability“, schreibt Lovecraft 1921 in seinem Essay „Nietzscheism and Realism“.17
Der Umstand, dass Lovecrafts Werk existiert und er unzählige Nachfolger hat, die weird fiction und Horror schreiben, malen, verfilmen, kurz: dem kosmischen Horror eine ästhetische Form geben, zeigt, dass Fatalismus und Depression eben doch keine Option sind. Im Gegensatz zum kosmischen Horror ist die kosmische Angst nicht nihilistisch, sondern ein poetisch-ästhetisches Phänomen, das die sonderbaren Welten und unsere Ahnungen davon ausmalt und beschreibt bzw. beschreibungs- und erfahrungswürdig findet.18 Die Beschreibungen und Ausmalungen scheinen sogar notwendig zu sein. Dies hat für Illger zwei Gründe. Zum einen bedeutet die Erweiterung des Universums in namenlose, unbekannte Räume auch, „die ärgerlichen Beschränkungen von Zeit, Raum und Naturgesetz, die uns ständig einkerkern und unsere Wissbegier über die unendlichen kosmischen Räume jenseits unseres Blickfeldes und unserer analytischen Fähigkeiten zunichte machen“19, überwinden zu können. 1931 schreibt Lovecraft an seinen Freund Frank Belknap Long über „die ärgerliche Empfindung einer unerträglichen Beschränkung, die alle empfänglichen Menschen (mit Ausnahme solch selbstverblendeter Erdgucker wie der kleine Augie Derleth) verspüren, wenn sie ihre natürlichen Begrenzungen in Zeit und Raum mit all den Freiheiten, weiten Räumen, Verständnismöglichkeiten und abenteuerlichen Erwartungen vergleichen, die der Geist als abstrakte Begriffe zu formulieren imstande ist.“20
Wirklichkeit und Phantasie werden grenzenlos. Das macht sie zu einer Quelle von Stimmung und Atmosphäre:
„Wenn … zu diesem Gefühl der Angst und diesem Bewußtsein des Bösen noch die unvermeidliche Faszination des Staunens und der Neugier hinzukommt, entsteht ein Komplex von intensiven Emotionen und Phantasiereizungen, der zwangsläufig so lange Bestand haben wird wie die menschliche Rasse selbst.“21
Wieder ist es Machen, der vor Lovecraft schon ganz ähnliche Gedanken hat, wenn er einen Forscher als „seltsam verwirrt zwischen Entsetzen und Genugtuung“ beschreibt:
„Es war, als hätte einer meiner Kollegen von den Naturwissenschaften bei einem Gang durch einen ruhigen englischen Wald plötzlich der schleimigen, widerlichen Gegenwart des Ichthyosaurus gegenübergestanden, jenem Urbild der Geschichten von schrecklichen Lindwürmern, die von tapferen Rittern erlegt wurden … Doch als ein entschlossener Forscher fand ich mich durch diesen Gedanken in ein geradezu leidenschaftliches Entzücken versetzt“22.
Der zweite Grund ist, dass wir der anderen Wirklichkeit gar nicht ausweichen können, selbst im Tod nicht, weil der Tod selbst eine solche Realität ist, die uns mit der unausweichlichen Existenz von etwas ganz anderem konfrontiert:
„… diese andere Wirklichkeit [entspricht] den Phantasmen der Ich-Auflösung …, die mächtiger werden mit jedem Schritt hin zu der Schwelle des unerreichbaren Innenraums des Todes. Die kosmische Angst geht aus genau dieser Annäherung hervor. Sie gestaltet das Grauen der unbegreiflichen und unumkehrbaren Ich-Auflösung, die mit dem – in unmöglicher Ahnung erahnten, nie vollzogenen – Eintritt in den Tod einhergeht, als genussvolle Kunsterfahrung. Das begründet die enge Verbindung von Kosmischer Angst und Kosmischem Horror.“23
Der Tod ist eine unausweichliche Grenze, die jedes lebende Wesen überschreiten wird, aber eben nicht als es selbst, als lebendes Wesen.
Anders gesagt, verdankt die kosmische Angst ihre Existenz mehreren Umständen. Zum einen erweist sich jede Form von Identität als Konstrukt und steht auf tönernen Füßen – was übrigens auch interessante soziale und politische Implikationen hat.24 Das, was ängstigt, befreit gleichzeitig für die Annahme des immer Neuen. Außerdem steht sie grundsätzlichen Formen der Ignoranz entgegen, weil sie den existierenden Grenzen unseres Daseins nicht ausweicht, sondern bewusst hinsieht. Die kosmische Angst versucht diese existenziellen Dimensionen erfassbar zu machen, formuliert sie, gibt ihnen eine Gestalt.
Aufgrund der kosmischen Ausmaße ihres Vorhabens muss sie notwendigerweise scheitern. Indem sie versucht, das Unbegreifliche begreiflich zu machen und das Unbeschreibliche zu benennen, schreibt sie sich die Notwendigkeit von Leerstellen ein, die ihre Entsprechung in den „Löchern“ in der Realität haben. Mehr noch: der Versuch der Erfassbarmachung wendet sich gegen sich selbst. Lovecrafts Beschreibungen evozieren das Unbeschreibliche, er häuft Beobachtungen, Eigenschaften und Assoziationen an, die sich kaum zu einem kohärenten Ganzen verbinden lassen: „die sinnliche Konkretion zerstört sich selbst“.25
Gerade hier liegt die Bedeutung von Stimmung und Atmosphäre begründet, die im Gegensatz zu Handlung und Figurenzeichnung nicht faktengebunden sind und nicht in der Erfahrungswirklichkeit geerdet (!) werden müssen. Sie sind es, die die Bruchstücke zu einem Ganzen zusammenfügen.
[RZ]
[Einschub 1]
Eine Welt im Innern
Riesige Höhlen sind es, in denen sich in „Godzilla – King of the monsters“ die uralten, einst von den Menschen als Gottheiten verehrten Titanen fortbewegen, und sie führen hinab in die hohle Erde.
Das Motiv der Hohlwelt greift auch der französische Phantastikpionier Jules Verne in seinem 1864 erschienenen Roman Die Reise zum Mittelpunkt der Erde auf. Diese Reise, die eine Abenteurergruppe um den schrulligen deutschen Professor Lidenbrock von Hamburg über den Krater des erloschenen Vulkans Snæfellsjökull und durch verschiedene Erdschichten tief ins Innere der Welt führt, ist gleichermaßen ein geologisches wie auch prähistorisches Lehrstück, in dem Science und Fiction perfekt verschmelzen. Dabei belebt Verne die linear erzählte Handlung durch gegensätzliche Figuren: Lidenbroks Tollkühnheit und Wagemut reiben sich fortwährend am zaudernden Axel, seinem Neffen und Assistenten, der eine vom Professor entdeckte isländischen Runenschrift zuerst vernichten will, nachdem er ihre Botschaft entziffert hat:
„Steig in den Krater des Snæfellsjökull , den der Schatten des Scartaris vor den Kalenden des Juli bestreicht, kühner Wandrer, und du gelangst zum Mittelpunkt der Erde. Das hab ich getan. Arne Saknussemm.“ (Jules Verne: Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1991, S. 22).
Auf der anderen Seite ist es immer wieder Axel, der durch Zufall die Entdeckungen macht, die dem Professor in seinem Eifer wohl sonst verborgen blieben. Im wortkargen Eiderentenjäger Hans Bjelke finden beide ihren Gegenpol, dessen stoische Natur die waghalsige Mission wiederholt vor dem Scheitern bewahrt. Er stößt auf Empfehlung Professor Fridrikssons in Reykjavík zur Expedition. Dieser hat ein wissenschaftliches Interesse an Lidenbroks Unternehmung und enthüllt beinahe das Geheimnis um die Runenschrift:
„Ausgezeichnet!“ rief mein Onkel. (…) „Es paßt alles, alles klärt sich, alles gehört zusammen. Natürlich mußte er sein Geheimnis in Geheimschrift, damit die Inquisition …“
„Was für ein Geheimnis?“ „Ach was“, sagte mein Onkel laut und unwillig. „Bloße Spekulationen. Das soll einen ernsthaften Wissenschaftler wie Sie nicht anfechten, Professor Fridriksson!“ (S. 39)
An diesem Punkt überrascht die Erzählung, indem sie darauf verzichtet, Fridriksson als Gegner ins Spiel zu bringen, der mit Hans über einen geeigneten Spion verfügte, was das Spektrum der dramaturgischen Möglichkeiten der nachfolgenden Handlung erweitert hätte.
Verne verzichtet darauf und bricht mit den Erwartungen (heutiger?) Leser. Der erste Abschnitt der unterirdischen Reise gestaltet sich etwas langatmig, so wie es die reizarme Umgebung eines endlosen, ins Erdinnere führenden Ganges eben bedingt. Hier werden die Grenzen des Schauplatzes schnell offenbar. Ungeachtet der geologischen Schichten und der bemerkenswerten Phänomene, denen die Abenteurer begegnen, bleibt ein unterirdischer Gang doch ein finsterer Schlauch, ohne Vegetation, ohne Leben, und man bewegt sich in der Regel in zwei Richtungen, wenn es keine Abzweigungen oder geräumigere Höhlen gibt.
Umso gewaltiger fällt der Paukenschlag aus, mit dem der Autor den von zahlreichen Widrigkeiten behinderten Abstieg beschreibt:
„Es war ein Meer, dessen Ufer, so weit man sie sah, dem eingerissenen Landsaum Norwegens glichen, mit Steilküsten und schroffen Felsvorsprüngen, ein Meer, das den Meeren der Oberwelt glich, das aber doch zugleich unverwechselbar anders und fremd war.“ (S. 95)
Seit der Entdeckung dieses unterirdischen Ozeans erlebt der Leser eine klassische Lost World-Geschichte mit allem, was das Genre zu bieten hat: Dinosaurier, Mammuts und Urmenschen.
Die drei Forscher stoßen auf die Spuren Arne Saknussemms und anderer, die den Weg zum Mittelpunkt der Erde vor ihnen beschritten haben. Und sie gelangen auf abenteuerliche Weise an die Oberfläche zurück, ohne dass man ihren langwierigen Abstieg durch die Erdschichten erneut mitverfolgen müsste.
Die Wirkung der Erzählung auf das zeitgenössische Publikum kann man erahnen, aber auch nach hundertfünfzig Jahren weiß Jules Verne mit Die Reise zum Mittelpunkt der Erde zu faszinieren.
[JK]
Und wenn die Tiefe doch die Höhe ist?
von Felix Woitkowski
I
Die Dämmerung war weit vorangeschritten, als ich den einen Ort erreichte. Die Kunde davon hatte sich den Tag über sturmartig verbreitet und offenbar viele Menschen bereits erreicht, als ich noch bei den Ziegen im Gras liegend tatenlos den grauen Himmel betrachtete. Wie viele bereits vor mir angekommen waren, konnte ich nur schwer schätzen. Fünfzig. Hundert, vielleicht mehr, vermutlich sogar. Doch die bloße Zahl war nicht von Bedeutung, wichtig war nur, was sie taten und was sie bereits geschaffen hatten.
Ich kannte diesen einen Ort. Bis zum Vortag hatte hier ein Acker neben dem nächsten gelegen. Doch jetzt im Licht des erlischenden Tages war kaum noch etwas davon übrig. Alles Grün war fort. Eine jede Pflanze niedergetrampelt, herausgerissen, vergessen. An ihrer statt bedeckte nun schwarzer Mutterboden das Land, als würden die Schatten von unten wachsen, und mit jedem Augenblick wurde es mehr davon.
Die Menschen gruben. Unzählige Schaufeln trieben sie in die Tiefe und holten hervor, was seit Menschengedenken jeden unserer Schritte trug.
Jemand hatte Eimer besorgt, Handkarren. Doch lagen sie achtlos umgestürzt auf einem Haufen. Niemand kümmerte sich darum. Niemand organisierte, dass die Erde fortgebracht wurde, und dennoch funktioniert es. Sie wurde gelöst, hochgeschleudert, regnete ein Stück weiter herab, wurde erneut aufgehoben und geworfen. So gelangte sie Meter um Meter von dem Zentrum nach außen.
Ich musste den Kopf einziehen, hob schützend meine Arme, um von dem Geprassel nicht getroffen oder gar verletzt zu werden. Zugleich bemerkte ich, dass niemand sonst darauf Rücksicht nahm. Zu emsig arbeiteten sie sich vorwärts in die Tiefe, so als gäbe es nichts anderes in unserer Welt.
Nur langsam kam ich durch die Menge voran, spürte, wie es abwärts ging.
Noch gab es keine Fackeln, keine Lampen, und die Schatten wuchsen mit jedem Schritt. Dunkle Leiber mit Werkzeug in der Hand. Düstere Gesichter, schwarz vor Erde. Nichts anderes umgab mich mehr. Allein ihre Augen glänzten, als könnten die Seelen aus ihnen herausleuchten. Die Muskeln waren gespannt, die Glieder arbeiteten in einem kollektiven Rhythmus, still, stumm und ohne Gesang, ohne Protest. Denn was hier geschah, das war kein Sklavendienst. Es wurde gegraben, ja, und sie alle taten es, weil sie sich dafür entschlossen haben. Es war ihr Wille. Ihre Entscheidung. Das spürte ich – und mit jedem Augenblick, den ich länger unter ihnen verbrachte, überschlug sich auch meine Sehnsucht danach, ein Teil davon zu sein, bis mein Herz voller Blut rasend schmerzte. Ich wollte, ich musste es einfach, an diesem großen Akt teilhaben, worum auch immer es ging, was auch immer es bezweckte.
Nur wo beginnen? Nur wo beginnen?
Ohne Schaufel?
Ohne eigenen Sinn?
Reihe um Reihe von Schattenleibern durchmaß ich, stieg hinab, an der fliegenden Erde vorbei, da entdeckte ich ein kleines Licht. Eine Kerze befand sich auf einem Tisch, der ganz schief stehend bereits halb vom Aufwurf bedeckt war. Daran saßen drei, tranken, lachten, voller Erde. Bevor ich nach dem Was und Wohin fragen konnte, sprachen sie mich an, als hätte zwar jeder eine eigene Zunge, als ob sie sich die eine Stimme aber teilen müssten.
„Willkommen …“
„… im Zirkel …“
„… des Niedergangs!“
Der eine biss in eine Ratte, dass sie vor Schmerz quiekte. Er selbst erschrak darüber so sehr, dass er das Tier in die Menge schleuderte. Ich zog den Kopf ein, um nicht getroffen zu werden.
„Ab hier führt …“
„… alles in die …“
„… Tiefe.“
Sie lachten.
„Aber du …“
„… suchst sie …“
„… nicht wahr?“
„Die mit den bleichen …“
„… Augen, die …“
„… mit dem Wissen …“
„… der Würmer, …“
„… die hier …“
„… anfing zu …“
„… graben.“
Ich verstand. Sie hatten recht. Jetzt wusste ich es. „Wo kann ich sie finden?“
„Abwärts.“
„Unten.“
„Stets hinab.“
Sie lachten im Takt wie ein Tross Raben, der bei Vollmond auf glucksende Hühner getroffen war. Dann stießen sie lautstark an. Doch es schwappte kein gutes Wasser in ihren Gläsern und ihr Prost galt nicht meinem Wohlergehen, sondern einer Schaufel, die nicht weit von ihnen im Dreck lag. Ohne zu überlegen, griff ich danach und floh vor dem Tisch mit seinen drei Gesellen in die arbeitende Menge hinein. Es ging hinunter, wie ich wusste, wie sie es gesagt hatten, und mit jedem Schritt wuchs die Umklammerung der Nacht.
II
Licht! Wie ein mythischer Drachenodem verbreitete sich das Feuer durch die Grube, und mit einem Male hielt zwar nicht jeder, aber doch jeder Dritte eine Fackel in der Hand. Die Schwärze färbte sich glutrot, die Schatten zitterten. Endlich konnte es weitergehen, endlich sah ich mehr als gerade noch den Holzstiel in meinen Händen.
Eine Unruhe, ein Gemurmel folgte den Flammen, Brabbeln, ein Rufen, ein Jubel. Gemeinsam trieben wir die Schaufeln in den Boden. Lehm erkannte ich, dazwischen bisweilen Kies. Ein mittelgroßer Stein war mir im Weg und knirschte, als ich ihn aus seinem Bett hebelte. Diesen wollte ich nicht werfen, hob ihn stattdessen hoch, reichte ihn meinen Nachbarn, und erhielt, wer hätte es gedacht!, Brot zum Tausch. Als ich hineinbiss, schmeckte es wie Naschwerk. Ein Hauch Wärme lag noch darin verborgen, ob vom Ofen selbst oder den zahlreichen Händen, durch die der Laib gegangen war, ich wusste es nicht, aber sie war stark genug, meinen Bauch zu erreichen. Mein Herz schlug. Ich kaute, schluckte. Da kam ein Krug vorbei, glitt von Hand zu Hand, begleitet von erneuten Jubelschreien. Ich stürzte das Nass hinunter. Zu viel für einen Mann, reichte ich ihn weiter. Kaum war er wieder fort, begannen wir mit neuer Kraft zu graben. In die Tiefe mussten wir. In die Tiefe sollten wir. Was auch immer uns dort erwartete, wir waren bereit. Denn sie hatte heute begonnen und wir waren ihr gefolgt. Schaut nur, was wir jetzt schon erreicht hatten!
„Schaut nur, was wir jetzt schon erreicht haben!“ Die Worte, die ich gedacht hatte, dir mir in den Sinn gekommen waren, flüsterte jetzt jeder. Die Schmächtige neben mir fast zischend, der Bär auf der anderen Seite so, als lernte er in diesem Augenblick erst jedes einzelne Wort in unserer Sprache. Ich stimmte ein, schrie und zog alle Kraft aus dem Schrei, um die Schaufel noch tiefer zu treiben. „Schaut nur! Schaut her! Was haben wir nicht schon alles erreicht!“
III
Der Morgen graute so zögerlich, als wären zwei Nächte direkt aufeinandergefolgt und als müsste er sich darüber erst wieder daran gewöhnen, in die Welt zu kommen. Meine Schultern schmerzten, die Arme, die Beine. Ich schüttelte sie, lockerte sie. Sobald das Tageslicht den Schein der Fackeln übertrumpfte, bemerkte ich die Schwielen an meinen Händen, Blasen, aufgerissen, blutig, Zeugnisse meiner Arbeit in den vergangenen Stunden. Aber sie schmerzten nicht.
An meinen Stiefeln und Hosenbeinen hatten sich mehrere Lehmklumpen gebildet, allesamt größer als meine Faust. Kaum hatte ich sie mir mit der Schaufel abgestoßen, fühlte ich mich wie von einer Last befreit. Ich gähnte, streckte mich erneut, und fand mich bereits wieder dabei, eine Stelle zu suchen, an der ich weiter graben konnte.
Mit dem neuen Licht kehrte die Emsigkeit unter die Menschen zurück. Einigen ging es offenbar wie mir, andere hatten indes geschlafen, richteten sich jetzt auf, griffen nach ihren Schaufeln und fanden in den Takt der Vielen zurück.
Es war wohl gegen Mittag, da wurde Essen gereicht. Äpfel, Möhren waren darunter. Sie gingen von Hand zu Hand, bis jeder etwas hatte. Krüge folgten, wie schon in der langen Nacht. So kam der erste Augenblick, in dem ich mir eine Pause gönnte.
Hatte ich stundenlang bloß in die Tiefe geblickt, schaute ich nun zum ersten Mal hoch. Mein Rücken, mein Nacken knackte. Erstaunt verharrte ich. Zweierlei war es, dass mich zugleich so tief berührte, dass ich Tränen wegzwinkern musste. Gemeinsam hatten wir eine Tiefe erreicht, wie ich sie mir nicht hatte vorstellen können. Oh, was hatten wir geleistet! Gemeinsam! In einer Nacht? Oder waren es viele gewesen? Das war die erste Sache, doch eine weitere hing fest damit verbunden. Dort, wo die neu entstandene Wand beinahe waagerecht in die Tiefe ragte, fanden sich zahlreiche stützende Pfeiler, Gerüste, Unterstände. Ich entdeckte Flaschenzüge, an denen Eimer hingen, darüber zwei Kräne, die in der Höhe über den Schacht ragten. Dort oben regte sich eine geschäftige Menge.
Hier unten brandete ein Gemurmel auf, ein ruhiger Jubel, der den Kraftlosen in ihrer Pause Kraft spendete. Wir waren viele, dort oben wie hier unten, vereint in einer Sache. Der Baumeister der Kirche sollte dazu gestoßen sein, machte es die Runde, ein fähiger Mann. Unterstützt wurde er von einem studierten Dichter, der sich mit Gruben auskannte. Und ein Händler hatte seine Gehilfen hergeschickt. Sie organisierten den Abtransport. So erzählte man sich, wispernd, begierig, glücklich, als seien sie unsere Helden. Ich aber dachte nur an sie, die eine, die alles begonnen hatte, auf deren Rücken und Vision wir schufteten. Ich musste sie finden!
Die drei, die mir die Schaufel überlassen hatten, hatten nach unten gewiesen. Tiefer noch, tiefer. Das war der Weg, den ich beschritt, um sie zu suchen. Ich nahm also meine Schaufel fest in beide Hände und trieb sie in schwarzen Mutterboden zu meinen Füßen, und wie ich hörte, war ich nicht der einzige. Dutzende Frauen und Männer taten es mir gleich. So arbeiteten, schwiegen wir, und über Stunden war der Klang unserer Arbeit das Einzige, was den Schacht ausfüllte.
Dann kam der Regen.
IV
Es war längst wieder dunkel geworden, aber Fackeln spendeten ausreichend Licht.