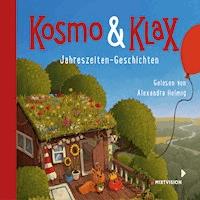Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mixtvision
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Lua ist vaterseelenallein, seit das Herz ihres Vaters aufgehört hat zu schlagen. Erst als sie mit Hilfe einer Zaubermurmel den Weg in den Zirkus findet und sich in die magische Welt der Zirkuskünstler begibt, kommt der Vater ihr wieder näher. Alexandra Helmig erzählt in ihrem Kinderbuchdebüt eine warmherzige Geschichte über Lua und die Suche nach dem richtigen Platz in der Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Töchter
INHALT
1. Mondfische angeln
2. Eine Murmel im Sand
3. Der lachende Baum
4. Rosarote Zuckerwatte
5. Federschlangen, die kitzeln
6. Nichts klappt
7. Das blinde Spiegelei
8. Marmelade auf der Nase
9. Hoch hinaus
10. Nudeln, die keine sind
11. Die Wundertüte
12. Das fehlende Puzzlestück
13. Tanzende Regentropfen
14. Sternenkleid
15. Zauberei mit Zahnbürsten
16. Ausgelacht
17. Verferkelt noch mal
18. Es regnet Gummibärchen
19. Goldstaub in der Manege
20. Ein besonderes Geschenk
Erstes Kapitel
Mondfische angeln
Lua sah Dinge, die andere nicht sahen. Weil die meisten Menschen Kartoffeln auf den Augen haben, wie Papa sagte. Da konnte man so viel reden und erzählen und schwärmen, wie man wollte – sie sahen die Dinge einfach nicht. Man konnte beispielsweise sagen:
»Pass auf, du musst die Schneeflocke fangen.«
»Hä? Warum?«, fragten dann die Menschen mit den Kartoffeln auf den Augen, und ihr Blick war leer.
»Na, weil sie bestimmt Angst davor hat, in einer Pfütze zu landen«, erklärte man ihnen, doch sie guckten nur ratlos, schüttelten den Kopf und gingen weiter.
Lua war neun Jahre alt. Sie hatte mittellanges braunes Haar, das glatt auf ihren Schultern lag und auch dann noch glatt blieb, wenn sie abends mit nassen Haaren und geflochtenem Zopf ins Bett ging. Sie bekamen höchstens einen Knick, aber niemals eine Locke wie die Haare ihrer Schwestern, der Zwillinge Celeste und Alva.
Am auffälligsten an Lua waren ihre grünbraunen Augen, die ihre Farbe änderten, je nachdem, wie Lua sich fühlte. Wie ein Tümpel, der grün vor sich hindümpelt, wenn niemand ihn stört, aber bräunlich wird, wenn man zum Beispiel mit einem Stock den Schlamm auf seinem Grund aufwühlt.
Wenn Lua glücklich war, strahlten ihre Augen wie ein heller Stern am Nachthimmel. Wenn sie jedoch ungeduldig oder wütend war, vor allem, wenn sie sich ungerecht behandelt oder nicht verstanden fühlte, dann fing ihr Blick an zu flirren, wie eine Glühbirne, bevor ihr Licht ausgeht. Es gab nur einen einzigen Menschen, der sie immer verstand.
Und das war ihr Papa.
Doch Luas Papa wohnte nicht mehr auf dieser Welt. Vor ziemlich genau einem Jahr, an einem Sonntagmorgen, hatte sein schwaches Herz aufgehört zu schlagen.
Seitdem war in Luas Welt nichts mehr so, wie es vorher war. Es verging kein Tag, an dem sie nicht an ihren Papa dachte. Sie sehnte sich nach seiner tiefen Stimme, seinem Lachen, sie sehnte sich danach, auf seinem Schoß zu sitzen und seine Hände auf ihrem Bauch zu spüren.
An den Nachmittagen war es besonders schlimm, denn das waren die Stunden, in denen sie ihn früher ganz für sich allein gehabt hatte. Wenn ihre beiden Schwestern noch im Kindergarten gewesen und erst am späten Nachmittag von Mama abgeholt worden waren, hatten sie zusammen gegessen und danach gemeinsam Luas Hausaufgaben gemacht. Papa hatte als Übersetzer für verschiedene Verlage gearbeitet und konnte sich seine Zeit frei einteilen. Das war der beste Beruf der Welt, fand Lua. Denn so konnte er immer da sein, wenn sie aus der Schule nach Hause kam.
Wenn sie die Wohnungstür öffnete, ihre Schultasche in die Ecke warf, stand er in der Küche und wartete bereits mit dem Mittagessen auf sie. Es gab Pasta mit viel Tomatensoße oder Pasta mit wenig Tomatensoße. Viel mehr Abwechslung gab es nicht, denn Papa konnte nicht besonders gut kochen. Wenn Lua sich beschwerte, grinste er nur und sagte verschwörerisch:
»Wusstest du, dass diese Nudeln eigentlich Süßkartoffeln sind? Sie haben heute extra für dich ihr Pasta-Ausgehkostüm angezogen. Ach ja, und die Tomatensoße ist übrigens mit dem Hackfleisch verheiratet und du würdest ihr einen großen Gefallen tun, wenn du ihre Liebe schmecktest.«
Papa wusste immer, was er tun musste, um Lua aufzuheitern. Er wusste auch immer, wie sie sich fühlte. Ob sie traurig war oder wütend oder eifersüchtig oder glücklich. Oft wusste er es sogar, bevor sie selbst es wusste.
Wenn Lua zum Beispiel neidisch war auf ihre Schwestern, die im Gegensatz zu ihr das dicke, lockige Haar von Mama geerbt hatten, was wildfremde Menschen auf der Straße regelmäßig dazu bewog, stehen zu bleiben und entzückt auszurufen: »Meine Güte, was für wundervolle Haare!«, dann flüsterte Papa ihr ins Ohr: »Du bist so voller Wunder, dass einem ganz schwindelig wird.«
Er schwankte über die Straße, raufte sich die Haare, schielte in zwei Richtungen, während er auf Lua zeigte und rief:
»Dieses Mädchen hat mich verzaubert!«
Er sah dabei so komisch aus, dass Lua jedes Mal laut lachen musste. Ein Lachen, bei dem jeder mitlachen musste, weil es so ansteckend war. Seit Papa nicht mehr da war, hatte Lua nicht mehr auf diese Weise gelacht.
So befreit, so ausgelassen, so atemlos.
Es war, als ob seither eine dicke Erdschicht ihr Lachen erstickte.
Die Geschichte, wie Lua ihr Lachen wiederfand, begann an einem Nachmittag mitten im Sommer:
Lua hatte sich mit ihrem besten Freund Jonah verabredet, bevor dieser mit seinem Vater übers Wochenende zum Angeln fuhr. Jonah wohnte mit seiner Mutter im Nachbarhaus. Seine Eltern hatten sich getrennt, als er vier Jahre alt war. Seitdem lebte sein Vater mit seiner neuen Frau und seinem neuen Sohn in einer anderen Stadt. Diesen Sommer würde Jonah zum ersten Mal ganz allein mit seinem Papa wegfahren. Seit Wochen redete er von nichts anderem. Lua war ein wenig eifersüchtig. Immerhin hatte er noch einen Papa, auch wenn er ihn nicht so oft sehen konnte.
Lua und Jonah wollten zu ihrem Geheimversteck, einer seichten Uferstelle an einem kleinen See, der im Naturschutzgebiet nicht weit entfernt von ihrer Wohnsiedlung lag. Dort saßen sie oft stundenlang auf dem steinigen Sandboden, eingerahmt vom Schilf der Uferböschung und dem Himmel über ihnen. Um dorthin zu kommen, musste man den stillgelegten Bahngleisen folgen, die hinter der Wohnsiedlung begannen und auf denen man so gut balancieren konnte.
Lua lief vorneweg, während Jonah versuchte, mit ihr Schritt zu halten. Das gelbe Hängekleid mit den roten Punkten flatterte um ihre Beine. Ein Geschenk von Papa aus dem letzten gemeinsamen Familienurlaub. Seitdem hatte Lua es so oft getragen, dass die roten Punkte vom vielen Waschen ausgeblichen und nun eher rosa waren. Lua mochte kein Rosa, aber in diesem Fall musste sie eben eine Ausnahme machen.
Es war ein herrlicher Sommertag. Der Himmel war so blau, als ob ihn jemand mit Leuchtfarbe angemalt hätte. Nur vereinzelt zogen Wolken vorbei, die aussahen wie Seepferdchen oder Elefanten oder andere Tiere.
»Lass uns den Zoo anschauen«, hatte Papa oft am Nachmittag gesagt, und dann hatten er und Lua sich auf den Balkon gesetzt und dem vorbeiziehenden Wolkenzoo bei seiner Reise am Himmel zugeschaut.
Als Lua und Jonah am See ankamen, ließen sie sich rücklings ins Gras fallen. Jonah strich mit den Händen durch die Wiesenblumen und summte leise vor sich hin, während Lua einen Maikäfer beobachtete, der über ihren Unterarm krabbelte. Seine dünnen Beine kitzelten auf der Haut.
Leise sagte sie: »Flieg, flieg, flieg, kleiner Käfer! Wenn ich blinzele, flieg!«
Lua blinzelte und der Maikäfer flog davon. Sehnsüchtig schaute sie ihm hinterher und dachte an die bevorstehenden Sommerferien. Wie gerne würde sie auch wegfliegen. Weit weg. In den Himmel und darüber hinaus.
»Die da sieht aus wie ein Dinosaurier«, sagte Jonah und zeigte auf eine Wolke am Himmel. Er hatte recht. Die Wolke sah tatsächlich aus wie ein kleiner Dinosaurier mit wulstigen Beinen. Doch Lua hatte heute keine Lust auf das Wolkenratespiel.
Sie setzte sich auf und schaute über den See. Die Oberfläche des Wassers schimmerte grün von den hohen Bäumen, die auf der anderen Seite des Sees standen. Ob es den Bäumen gefällt, dass sie sich jeden Tag im Spiegel anschauen müssen?, fragte sie sich und sah zu einer kleinen Tanne vorn am Ufer, die nur ein karges Blätterkleid trug. Sie nahm einen großen Stein vom Boden, holte weit aus und ließ ihn gleichmäßig übers Wasser hüpfen. Die Ringe, die sich ausbreiteten, wurden immer größer, als ob ein Wassergeist tief unten im See Seifenblasen blies. Jonah pfiff anerkennend durch die Zähne und nahm ebenfalls einen Stein. Eine Weile lang ließen sie schweigend Steine über den See hüpfen, kleine, große, sichelförmige oder solche, die flach wie ein abgenutztes Stück Seife waren. Sie verfolgten ihre unterschiedlichen Sprünge über das Wasser und die Ringe, die sich an der Wasseroberfläche bildeten. Normalerweise waren Lua und Jonah unzertrennlich, kein Blatt passte zwischen sie, sagten alle, doch jetzt lag ein ganzer Blätterhaufen zwischen ihnen.
Plötzlich sprang Jonah auf und lief zum Ufer. Ein langer Ast, den der letzte Sturm abgerissen hatte, lag dort am Boden. Er hob ihn auf und hielt ihn wie eine Angel ins Wasser.
»Die Fische in Österreich sind viel größer als hier«, sagte er und drehte sich grinsend zu Lua um.
Lua ärgerte sich, dass er so angeben musste. Sie warf ihre gesammelten Steine in hohem Bogen ins Wasser und sagte trotzig:
»Ich gehe auch mit meinem Papa angeln. Auf dem Mond. Da gibt es nämlich Mondfische, die sind noch viel größer als die Fische in Österreich!«
Jonah stocherte verlegen mit seiner »Angel« im Wasser herum, bis es sich braun färbte.
»Ich hab gedacht, dein Papa wohnt auf einem Stern.«
»Er ist umgezogen«, sagte Lua und streckte den Zeigefinger gen Himmel. »Sein Ausblick gefiel ihm nicht mehr. Deshalb wohnt er jetzt auf dem Mond.«
Jonah grinste. »Cool«, sagte er. »Kann ich mal mitkommen?«
Lua schaute durch ihn hindurch und sagte nichts, weil sie nichts sagen konnte. Weil der Satz sich in ihr Herz bohrte wie der Haken einer Angel.
»Vielleicht magst du ja auch mal mit mir und meinem Vater ...«
Jonah verstummte, als er merkte, dass Lua sich abwendete. Sie ergriff eine Handvoll Kieselsteine und rieb sie gegeneinander.
»Tut ... tut mir leid«, stammelte er verlegen.
Lua spürte einen dicken Kloß im Hals. Sie starrte auf die Steine in ihrer Hand und schwieg. Jonah wartete, doch Luas Schweigen wurde immer größer, bäumte sich auf wie ein Pferd, das vor einem Hindernis zurückschreckt.
«Ich muss jetzt nach Hause. Kommst du mit?«, fragte Jonah schließlich und stand auf. Er klopfte sich den Sand von der Hose und wartete geduldig auf eine Antwort. Lua schüttelte den Kopf.
»Sehen wir uns denn noch mal?«, fragte er vorsichtig. »Wir fahren so gegen sieben.«
»Mmm«, murmelte Lua.
Jonah wusste nicht, ob das ein Ja oder ein Nein sein sollte. Lua saß wie versteinert da, mit dem Rücken zu ihm. Als sie nach einer Weile immer noch nichts sagte, gab Jonah auf.
»Gut, dann vielleicht bis später«, sagte er und rannte die Böschung hinauf.
Lua sah ihm nach, seine blonden Haare glänzten im Sonnenlicht und die Jeans schlackerte um seine Beine. Jonah war eher klein für sein Alter und seine Mutter kaufte ihm Kleidung immer eine Nummer zu groß, weil er ja noch reinwachsen werde, wie sie sagte. Aber Jonah war auch schlau und wusste viel mehr als andere Neunjährige, das mochte Lua so an ihm.
Als Jonah hinter den Bäumen verschwunden war, überkam Lua eine Traurigkeit, die sich schwer wie eine nasse Decke auf ihre Augen legte. Unschlüssig starrte sie auf die gesammelten Steine in ihrer Hand.
Endlos lange sechs Wochen Sommerferien lagen vor ihr und es gab nichts, worauf sie sich hätte freuen können.
Zweites Kapitel
Eine Murmel im Sand
In der Siedlung, in der Lua wohnte, gab es einen Spielplatz, der im letzten Jahr eine neue Schaukel bekommen hatte. Sie war höher als die anderen Schaukeln und auf ihr konnte man so weit schwingen, dass man glaubte zu fliegen.
Normalerweise war der Spielplatz am Nachmittag voller Kinder. Heute war außer Lua niemand da. Sie saß auf der Schaukel und malte mit den Füßen Bilder in den Sand. Aus den Fenstern der Häuser ringsum hörte sie die Stimmen von aufgeregten Kindern und gestressten Eltern: »Luis, vergiss nicht deine Badehose!« Oder: »Mama, ich finde mein blaues T-Shirt nicht.«
Lua vermisste das Meer, vor allem aber vermisste sie die langen Autofahrten, wenn sie im Sommer zu Papas Familie nach Portugal fuhren. Wenn sie mit dem Kopf am Fenster die Welt vorbeiziehen sah und von fernen Ländern und Königreichen träumen konnte.
An Urlaub sei nicht mehr zu denken, hatte Mama gesagt. Seit Papas Herz aufgehört hatte zu schlagen, arbeitete sie den ganzen Tag im Krankenhaus und kam abends oft müde und gereizt nach Hause.
»Du kannst doch auch hier tolle Sachen machen. Und es sind ja nicht alle im Urlaub«, hatte Mama gesagt, um Lua zu trösten. Aber das stimmte nicht. Lua fiel nur eine Person ein, die auch nicht in den Urlaub fuhr: Frau Asor.
Frau Asor hatte rote Haare, die sie zu einem Knoten zusammengebunden hatte. Jedes Kind in der Siedlung kannte Frau Asor. Sie saß Tag für Tag an ihrem Fenster und schaute und strickte. Im Winter hinter geschlossenem, im Sommer bei offenem Fenster. Unentwegt klapperten ihre Stricknadeln. Seltsam war nur, dass gar keine Wolle zu sehen war. Zwischen ihren Nadeln war bloß Luft. Die Leute in der Siedlung sagten, dass Frau Asor verrückt sei, aber da sie niemandem etwas zuleide tat, kümmerte sich keiner weiter um sie.
Auch heute saß Frau Asor wie immer auf ihrem Platz. Lua blickte verstohlen zu ihr hinüber und fragte sich, ob Frau Asor wohl wusste, dass sie gar nichts strickte. Oder hatte sie vielleicht unsichtbare Wolle, die niemand außer ihr sehen konnte?
Ein lautes Hupen riss Lua aus ihren Tagträumen. Im Schritttempo fuhr ein silberner Kombi am Spielplatz vorbei. Die Fensterscheibe surrte herunter und Jonah krähte von der Rückbank des Autos:
»Ich fang dir einen ganz großen Fisch. Einen Mondfisch!«
Lua hob die Hand und lächelte. Sie winkte Jonah so lange hinterher, bis das Auto hinter einer Häuserzeile verschwunden war, und sogar noch länger, als ob sie mit dem Winken ein Stück mitfahren könnte.
Der Parkplatz der Siedlung war jetzt fast leer. Nur der rote Lieferwagen von Herrn Kubric, dem Hausmeister, zwei Kinderfahrräder und unzählige Ölflecken auf dem Asphalt erinnerten daran, dass hier viele Menschen wohnten.
Lua schloss die Augen und stellte sich vor, auf einem Karussell zu sitzen. Sie drehte sich mit der Schaukel ein, bis beide Seile so eng ineinander verwoben waren, dass sie den Kopf einziehen musste. Dann ließ sie los. Erst langsam, dann schneller und immer schneller drehte sich die Schaukel. Lua liebte das Gefühl, wenn die Welt vor ihren Augen verschwamm und scheinbar Kopf stand. Auch wenn Mama ihr erklärt hatte, dass es im Weltall kein Oben und kein Unten gab, mochte Lua die Vorstellung, dass die Menschen auf der anderen Seite der Erde auf dem Kopf standen.
Ein Fenster öffnete sich und Mama rief zum Abendessen. Lua sprang von der Schaukel ab. Da fiel ihr Blick auf Frau Asor, die mit ihren Stricknadeln sonderbare Zeichen in die Luft malte.
Frau Asor sei stumm, hieß es. Das war so, seit ihre Tochter als junge Frau von einem Auto angefahren wurde und im Krankenhaus eingeschlafen und nie wieder aufgewacht war. Die meisten Kinder hatten Angst vor Frau Asor, weil sie nicht redete, sondern nur dasaß und schaute und strickte.
Auch Lua fand sie ein bisschen unheimlich, doch heute war ihre Neugier stärker als ihre Scheu. Sie ging näher. Frau Asor deutete mit ihrer Nadel auf etwas, das auf dem Spielplatz sein musste. Lua drehte sich um und schaute zurück.
Da war das bunte Klettergerüst mit der Rutsche, die so stumpf war, dass man problemlos auf ihr hinauflaufen konnte, die beiden Motorräder auf den schwankenden Spiralen, die ihre Schwestern so liebten, die große Holzwippe, auf der sie und Jonah balancieren übten und die beiden Schaukeln. Zunächst konnte sie nichts Ungewöhnliches entdecken, doch dann sah sie im Sand unter der Schaukel etwas liegen, das aussah wie ein Ball. Neugierig ging Lua darauf zu. Eingegraben im Sand lag eine große Murmel, deren Oberfläche matt war. Lua bückte sich und hob sie auf.
In diesem Augenblick fingen sich die letzten Sonnenstrahlen des Tages in ihr und die Murmel leuchtete hell wie ein kleiner Mond.
Lua hielt den Atem an, ihr Herz klopfte schneller und ein Gedanke schoss ihr durch den Kopf: Die Murmel war von Papa. Er hatte sie für sie vom Himmel geworfen. Sie drückte sie an sich und schaute nach oben und wartete darauf, dass etwas passieren würde. Was genau das sein sollte, wusste sie selbst nicht.
Die Abendsonne tauchte den Spielplatz in ein gelbes Licht, sonst passierte nichts. Sosehr sich Lua auch anstrengte, sie konnte nichts Ungewöhnliches entdecken. Da fiel ihr Frau Asor wieder ein. Sie weiß bestimmt, was es mit der Murmel auf sich hat, dachte Lua und drehte sich um.
Doch die alte Dame war nicht mehr an ihrem Platz. Hatte Lua etwa geträumt? Hatte Frau Asor nicht eben noch da gesessen? Warum wollte sie, dass Lua diese Murmel fand? Seit wann lag sie auf dem Spielplatz und wie war sie überhaupt dahin gekommen?
Fragen über Fragen schossen ihr durch den Kopf, während sie auf den leeren Platz am Fenster starrte.
Zu Hause öffnete Lua leise die angelehnte Wohnungstür und hoffte, dass Mama und ihre kleinen Schwestern sie nicht bemerkten. Die Tür zur Küche stand halb offen. Alva und Celeste rannten im Panther-Kostüm um den Küchentisch herum und versuchten kreischend, sich gegenseitig am Schwanz zu ziehen, während Mama am Herd stand und lachend mit einem Holzlöffel im Suppentopf rührte. Auf Zehenspitzen schlich Lua in Richtung Kinderzimmer.
»Lua?«, rief Mama, als sie fast im Zimmer war.
Mist!, dachte Lua und schloss energisch die Tür hinter sich. Jetzt würde es nicht mehr lange dauern, bis ihre Schwestern das Zimmer stürmten. Sie horchte einen Moment, doch nichts geschah. Sie seufzte erleichtert. Eigentlich wollten sie im letzten Jahr in eine größere Wohnung umziehen und Lua hätte ihr eigenes Zimmer bekommen, doch seit Papas Tod war davon keine Rede mehr, als ob der Gedanke nie existiert hätte. Lua musste sich weiterhin das Zimmer mit ihren Schwestern teilen.
Es war schlimm genug, dass Lua nie wirklich ihre Ruhe haben konnte. Noch schlimmer aber war, dass Celeste und Alva alles liebten, was rosa war. Die Wand auf ihrer Seite war hellrosa gestrichen und mit unzähligen Kinderzeichnungen beklebt. Vor ihrem rosa Hochbett türmte sich ein Berg aus Puppen mit langen Haaren und dünnen Beinen und den passenden rosa Puppenkleidern.
In die Mitte des Raumes hatte Lua mit Kreide einen Strich auf den Boden gemalt. Eine Grenze, die ihre Schwestern nicht überschreiten sollten. Natürlich hielten sie sich nie daran.
Luas Bett war blau gestrichen und an die Wand hatte sie kleine und große Sterne geklebt, die in der Nacht leuchteten. Und einen Mond. So hatte sie jede Nacht das Gefühl, Papa nah zu sein. Wenn sie mit ihm redete, leise, wenn ihre Schwestern schon schliefen, stellte sie sich vor, dass er auf einem der Sterne wohnte wie ein Prinz.
Vor ein paar Wochen hatte Lua sich ein Zelt gebaut, in das sie sich zurückziehen konnte. Am Fußende ihres Bettes hatte sie verschiedene Tücher mit Wäscheklammern, Schnürsenkeln und Klebeband über beide Bettpfosten und einen Stuhl gespannt. Hier konnte sie in Ruhe nachdenken und lesen und träumen.
Lua nahm ein dickes Buch von ihrem Nachttisch und kroch damit vorsichtig in ihr Zelt. Sie schlug die erste Seite auf. Die Abbildung zeigte einen älteren Mann mit grauem Stoppelbart, der lachend vor einem Zirkuszelt stand. Im Arm hielt er eine hübsche junge Frau in einem bläulich glitzernden Kostüm. Beide strahlten in die Kamera. Darunter stand in großen Buchstaben:
MO – DER GRÖSSTE MAGIER DER WELT – UND SEINE ASSISTENTIN