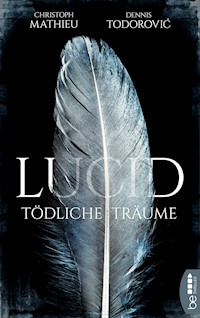
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn dir deine Träume zum Verhängnis werden ...
Die junge Künstlerin Signe Mortensen beherrscht das luzide Träumen: Im Traum kann sie machen, was sie will. Für den Neurologen Fabian Hardenberg ist sie die große Liebe - und sein Ticket zu wissenschaftlichem Ruhm.
Denn Signe ist der Schlüssel zu einem Forschungsprojekt, das nicht weniger verspricht als die Manipulation menschlicher Erinnerungen. Doch wo große Macht lockt, bringt die Gier das Schlimmste im Menschen zum Vorschein ...
Dieses eBook hätte als Taschenbuch über 600 Seiten - du wirst dir wünschen, es seien mehr! Ein eindrucksvoller Thriller über die Grenze zwischen Traumwelt und Realität, zwischen Loyalität und Verrat!
"Lucid ist außergewöhnlich ... ich habe das Buch ungelogen in 2 Tagen durchgesuchtet." (Leseratte2007, Lesejury)
"Die Idee, dass man mit luziden Träumen nicht nur die eigenen Träume bestimmen, sondern sogar in Erinnerungen von anderen Menschen eintauchen kann, ist erschreckend und faszinierend zugleich. ... Besonders die Schilderungen von Signes Träumen fand ich immer sehr aufregend." (BuecherwurmNZ, Lesejury)
"Ein rasantes Traumabenteuer, das man auch nach dem Lesen oft noch mit ins Bett nimmt." (Elli-Sofie, Lesejury)
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autoren
Titel
Impressum
TEIL 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
TEIL 2
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
TEIL 3
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
TEIL 4
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
TEIL 5
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
TEIL 6
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
EPILOG
Über dieses Buch
Wenn dir deine Träume zum Verhängnis werden …
Die junge Künstlerin Signe Mortensen beherrscht das luzide Träumen: Im Traum kann sie machen, was sie will. Für den Neurologen Fabian Hardenberg ist sie die große Liebe – und sein Ticket zu wissenschaftlichem Ruhm.
Denn Signe ist der Schlüssel zu einem Forschungsprojekt, das nicht weniger verspricht als die Manipulation menschlicher Erinnerungen. Doch wo große Macht lockt, bringt die Gier das Schlimmste im Menschen zum Vorschein …
Über die Autoren
Dennis Todorović und Christoph Mathieu lernten sich an der internationalen filmschule in Köln kennen, wo beide heute leben und arbeiten. Dennis Todorović hat bereits bei einer Vielzahl von Filmen Regie geführt und arbeitet als Autor und Dozent für Filmschauspiel. Christoph Mathieu ist Drehbuchautor, Journalist und Marketing-Berater. »Lucid – Tödliche Träume« ist ihr erster Roman.
CHRISTOPH MATHIEUDENNIS TODOROVIĆ
LUCID
TÖDLICHE TRÄUME
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Lukas Weidenbach
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © shutterstock: gordan | schankz
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6280-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
TEIL 1
Kapitel 1
»Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich durch mein Fehlverhalten …« Die Stimme brach ab. Der Mann im Radio musste sich räuspern und neu ansetzen: »… dass ich das öffentliche Vertrauen in meine Person und meine Politik unwiederbringlich verloren habe.«
Sie hatte die Lautstärke voll aufgedreht. Nur so konnten die Stimmen das Geräusch des Fahrtwindes übertönen, während Marine Kollmann ihr weißes BMW-Cabrio bei offenem Dach durch die Nacht gleiten ließ. Eigentlich war es schon zu kalt dafür geworden, Marine fröstelte leicht. Doch das rauschvolle Gefühl von Freiheit, das ihr der Fahrtwind in dieser Nacht gab, war jede Kälte wert.
Sie konnte sich kein schöneres Radioprogramm auf ihrer Fahrt nach Hause vorstellen als Webers Kapitulationsrede. Vor zwei Tagen erst hatte der unerhörte Skandal den bis dahin weitgehend unbekannten EU-Kommissar für Forschung und Innovation ins Blitzlichtgewitter und vor die Mikrofone der Journalisten gezwungen.
Eine 19-jährige Hotelangestellte hatte publik gemacht, dass er der Vater ihres Kindes war. Stein des öffentlichen Anstoßes und Grund für weitere polizeiliche Untersuchungen war dabei das Alter: Das Kind war zwei Jahre alt. Den dazugehörigen DNA-Test hatte die überraschend gut vorbereitete Anklägerin direkt mitgeliefert, sodass Weber seinen Posten schneller räumen musste, als er imstande war, die Kisten zu packen.
Marine Kollmann wusste mehr über die Affäre, als die Radiosprecherin in ihrer eher dürftigen Zusammenfassung berichten konnte – weit mehr. Ihr Ehemann Jacques Kollmann, zu dem sie so gut gelaunt nach Hause fuhr, war über vier Jahre lang die unsichtbare rechte Hand des Schwerenöters und Blenders Weber gewesen und hatte sich mit ihm zuletzt über Sparmaßnahmen in der Forschung zerstritten. Für Marine Kollmanns Arbeit als Leiterin eines der fortschrittlichsten und – zugegeben – teuersten neurologischen Institute Europas hätten Webers Sparmaßnahmen das Ende bedeutet. Doch dank ihrer raffinierten Idee, die bis dahin vertraulich gewahrte Geschichte mit dem Hotelflittchen zu nutzen, und mithilfe von Jacques Kollmanns guten Kontakten zu Parteileitung und Presse hatte ihr Mann nun die größten Chancen, Webers Nachfolger zu werden.
Marine war wieder einmal kurz vor dem Aus als Gewinnerin hervorgetreten. Seit sie vor etwas über sechzig Jahren in der Auvergne das Licht der Welt erblickt hatte, war es immer schon so gewesen: Nichts machte sie glücklicher als der Sieg. Dass man im Leben nichts geschenkt bekommt, war ihr früh klargeworden. Dass sie aber auch die Stärke besaß, für die Dinge, die sie erreichen wollte, zu kämpfen, war das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit an sich selbst. Von der mittellosen grauen Maus in Jugendjahren zur erfolgreichen Geschäftsfrau, die sie heute war, war es ein weiter Weg gewesen. Das Lied, mit dem der Radiosender seine regelmäßige Oldie-Night nach den Nachrichten einläutete, war mehr als passend. Marine trällerte mit ihrem französischen Akzent fröhlich mit: »You can get it if you really want. You can get it if you really want …!«
Die Reifen des Cabrios quietschten, als sie in die Einfahrt ihrer Villa fuhr. Mit dem Schwung einer Zwanzigjährigen stieg die kleine Frau aus dem Wagen. Trotz ihres zierlichen Körpers wirkte Marine immer sehr präsent und einnehmend, auch nach einem langen Arbeitstag wie diesem. Die Falten, die sich über die Jahre gebildet hatten, waren mit geschickt platziertem Make-up perfekt in Szene gesetzt, sodass sie ihr Gesicht nicht alt aussehen ließen, sondern ihre strahlend blauen Augen und ihr ansteckendes Lächeln betonten. Ihr raffiniert geschnittener Hosenanzug kam direkt aus der Schneiderei eines angesagten Pariser Designers mit Faible für exotische Schnitte.
»But you must try, try and try …«, summte Marine auf dem Weg zur Villa und blieb nur kurz stehen, als ihr auffiel, dass das Licht im Vorgarten nicht anging. War der Bewegungsmelder etwa schon wieder defekt?
Über solche Kleinigkeiten konnte sie sich heute nicht ärgern. Auch im Haus war kein Licht zu sehen. Vielleicht hatte sich Jacques schon schlafen gelegt? Sie wollte doch noch mit ihm darauf anstoßen, dass Weber endlich an die Presse getreten war. Und sie wollte ihm klarmachen, dass Jacques sich jetzt erst recht für ihr Institut einsetzen müsste.
Doch ihr Mann lag nicht im Bett.
Als Marine ins Wohnzimmer trat, saß er in seinem Sessel, reglos und mit dem Rücken zur Tür. Er hatte das Licht ausgelassen und bewegte sich nicht, als sie ihn ansprach. Marine vermutete, er sei mit seinem Schlummertrunk eingeschlafen – das passierte ihm manchmal, vor allem, wenn er schon auf der Arbeit angestoßen hatte und fröhlich beschwipst nach Hause gekommen war. Marine musste lächeln. Alkohol wirkte auf Jacques wie ein Anästhetikum.
Sie knipste das weiche Licht der Stehlampe an, um ihn nicht unnötig zu blenden, wenn sie ihn wecken würde. Doch als sich plötzlich zwei Lichtpunkte in seinem Gesicht spiegelten, erschrak sie. Jacques schlief nicht, sondern sah sie mit feuchten Augen an.
»Er ist tot.«
Marine dachte, sich verhört zu haben.
»Was sagst du?«
»Er ist tot, Marine.«
Die Fröhlichkeit, mit der sie eben noch im Schatten des Wohnzimmers gestanden war, war wie weggeblasen, als wäre sie vom Licht der Lampe vertrieben worden oder hätte bei Jacques’ Anblick das Weite gesucht.
»Wer ist tot?«
»Der Junge …«
»Welcher Junge, Jacques? Von wem redest du?«
»… und der andere, der …«, murmelte er kaum hörbar weiter, »… ich weiß nicht, der andere Junge vielleicht auch.«
Marine näherte sich ihm langsam. Leise klapperten ihre hochhackigen Schuhe auf dem Parkettboden. Als sie bei ihm stand, nahm sie das leere Glas aus seinem nassen Schoß. Er hatte den Whisky offensichtlich nicht getrunken, sondern über seine Anzughose gegossen. Marine atmete ein, stellte das Glas auf den Couchtisch und sprach in ruhigem, aber bestimmtem Ton: »Jacques, mein Lieber. Du holst jetzt tief Luft und erzählst mir, was passiert ist. Und zwar so, dass ich dir folgen kann.«
Er sah zu ihr hoch, und seine Zähne fingen an zu klappern: »Ich glaube, ich habe jemanden umgebracht.«
Das kleine Aquarell zeigte einen blass lasierten Strand, auf dem ein schwarzer Kater mit milchweißen Augen stand. Rechts neben dem alten Tier zerlegte sich das Motiv in grobe, eckige Strukturen und wurde zu einem abstrakten Bild.
Jedes Mal, wenn Prof. Wendt sich nachdenklich durch seinen angegrauten Bart strich, wurde Signe nervöser und zwirbelte mit der Hand in ihren schulterlangen strohblonden Haaren. Die 27-Jährige war eine der älteren Studentinnen der Kunstakademie, doch mit ihrem zierlichen Gesicht, ihrer blassen Haut und ihrem sanften Auftreten wirkte sie nahezu kindlich.
Prof. Wendt wandte sich von dem Bild ab und setzte sich breitbeinig auf einen Holzschemel. Signes Magen verknotete sich, als er ihr ein schiefes Lächeln zuwarf, das vielleicht beruhigend wirken sollte, in Wirklichkeit aber nur eine strenge Kritik vorbereitete: »Technisch ist wie immer nichts auszusetzen. Aber darum ging es bei dieser Arbeit nicht. Die Aufgabe war, etwas Lebendiges, Impulsives zu schaffen. Etwas weniger Durchdachtes. Ein Fenster zu Ihrer Seele.«
Aber das ist ein Fenster zu meiner Seele, dachte Signe. Es ist viel näher dran, als Sie ahnen!
»Dann habe ich das nicht richtig vermittelt«, sagte sie stattdessen und wollte sich ohrfeigen.
»Ich sehe, was Sie vermitteln wollten, Frau Mortensen. Aber diese Sorgfalt, mit der Sie arbeiten, diese pedantische Genauigkeit spricht vor allem von Ihrer Sorge, etwas falsch zu machen. Von Ihrer Angst vor den eigenen Impulsen.« Eine nachdenklich anmutende Pause verlieh dem Satz, mit dem er seine Kritik abschloss, erst die volle Härte: »Ich spüre nichts, wenn ich dieses Bild betrachte.«
Vielleicht weil Sie nichts spüren können!
Signe nahm das Bild von der Staffelei und schob es wortlos in eine Mappe, in der sie ihre Arbeitsproben aufbewahrte. Als sie vor knapp einem Jahr auf Empfehlung ihrer Kunstprofessorin in Kopenhagen an die renommierte Düsseldorfer Akademie gekommen war, hatte sie noch gedacht, dieser Schritt würde ihr Selbstbewusstsein stärken. Doch hier in Deutschland war ihre Dünnhäutigkeit nur schlimmer geworden.
»Sie sind sehr talentiert«, versuchte Wendt zu beschwichtigen. »Ich habe auch lange davor zurückgeschreckt, mich meinen innersten Ängsten und Gefühlen zu stellen. Doch irgendwann habe ich den Sprung ins Ungewisse, den Sprung in meine Seele, gewagt. Wenn Sie sich nicht trauen zu springen, müssen Sie jemanden finden, der Ihnen einen Schubs gibt.«
Und Sie sind dann wohl der Auserwählte? Dabei malen Sie doch selbst seit Jahren nichts mehr. Eingebildeter, alter Mann.
»Danke«, sagte Signe knapp. Sie schob sich an Wendt vorbei und verließ eilig das Atelier.
»Frau Mortensen«, rief ihr der Professor in versöhnlichem Ton hinterher, aber sie hatte weder die Kraft noch die Zeit, sich mehr von ihm über die »Angst vor ihrem Inneren« anzuhören. Es war höchste Zeit zu verschwinden, sie war ohnehin schon spät dran.
»Signe, da bist du ja endlich!« Fabian kam ihr gleich am Eingang zum Labor entgegen.
»Es tut mir leid, Professor Wendt hat mich aufgehalten.«
Fabian nahm Signes Hand wie ein Vater, der seine trödelnde Tochter von der Schule abholt und eigentlich ganz schnell weitermuss.
»Komm, Doktor Dryden ist seit zehn Minuten hier und wartet.«
»Doktor wer?«, fragte Signe, während Fabian sie durch das Foyer der Uniklinik zog.
»Dryden, die britische Neurologin, von der ich dir erzählt habe.«
Jetzt fiel es Signe wieder ein: »Die mit dem Nobelpreis?«
»Die, die für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde, ja. Aber sie hat ihn nicht, Signe. Du hörst nicht richtig zu, weißt du?«
Noch bevor sie sich bei Fabian entschuldigen konnte, waren sie am Labor angekommen, er drückte Signe einen Kuss auf die Lippen und riss die Tür auf.
»Doktor Dryden, hier ist sie!«, rief er aufgeregt in den Raum und schob Signe hinein.
Vor dem Fenster standen die Silhouetten zweier Personen im Gegenlicht, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten: ein pummeliger, kleiner Mann, der mit einem Strohhalm aus einem großen Kaffeebecher schlürfte, neben einer großen, schlanken Frau im Jackett, die mit verschränkten Armen den Raum dominierte. Die Frau bewegte sich auf Signe zu, wobei sie aus dem Licht trat und Signe ihr Gesicht sehen konnte. Dr. Dryden musste etwa Mitte fünfzig sein und hatte ein kantiges, nahezu maskulines Gesicht, das so gar nicht zu ihrer zierlichen, kleinen Nase passen wollte. Dass sie sich die schneeweißen Haare nicht färbte, ließ die Wissenschaftlerin nicht älter, sondern schillernder aussehen. Sie reichte Signe die Hand, ihr englischer Akzent war kaum zu hören: »Mein Name ist Dryden. Sie sind Frau Mortensen?«
Signe nickte. »Ja. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Wenn ich Herrn Wang glauben darf, dann habe ich einen noch größeren Grund zur Freude«, antwortete Dr. Dryden, ohne zu lächeln, und zeigte auf den pummeligen Mann am Fenster.
Signe erkannte ihn jetzt wieder: Es war Ye Wang, ein alter Studienkollege von Fabian, der vor einigen Tagen hier gewesen war, um irgendetwas mit ihrem Freund zu besprechen. Signe war selten in diesem Teil des Labors, wo die Monitore und Computer standen. Ihr Platz war drüben in der Röhre – im MRT-Scanner.
Dryden kam schnell zur Sache: »Sie sind luzide Träumerin, Frau Mortensen?«
Signe nickte.
Dr. Dryden nahm einen dünnen Schnellhefter vom Schreibtisch und fuhr fort: »Und wie weit, würden Sie sagen, reichen Ihre … Fähigkeiten im Traum? Oder anders gefragt: Was können Sie nicht?«
Signe zuckte mit den Schultern, sie wusste keine Antwort, doch Fabian kam ihr zu Hilfe: »Frau Mortensen ist in ihren Träumen eigentlich zu allem fähig, Doktor Dryden. Wenn sie sich bewusst gemacht hat, dass es sich um einen Traum handelt, dann ist sie absolut luzide. Sie gestaltet ihren Traum freier als jeder andere Proband, den ich untersucht habe. Ihre Fähigkeiten gehen weit über Fliegen und dergleichen hinaus.«
Während Fabian weiterredete, zeigte Dr. Dryden Signe das vorderste Blatt im Schnellhefter, auf dem ein verpixeltes Schwarz-Weiß-Bild zu sehen war, das ein wenig an eine Ultraschall-Aufnahme erinnerte. Darauf war in nebelig weißer Schrift ein Satz zu erkennen: Lieber Dr. Fabian. Ich bin einverstanden.
»Grenzen gibt es vielleicht nur da, wo Signes Vorstellungskraft endet, aber glauben Sie mir …«
Dr. Dryden hatte genug gehört und unterbrach Fabians Redefluss: »Frau Mortensen, mir ist zu Ohren gekommen, dass der Satz auf diesem Bild von Ihnen stammt?«
Signe nickte.
»Und dass Sie ihn aus einem Traum heraus versendet haben?«
»Ja, das war der erste Versuch von ganz vielen …«, wollte Signe erklären, doch Dryden wusste wohl Bescheid und ließ sie gar nicht erst ausreden. »Das würde ich mir sehr gerne mal live ansehen, wenn Sie nichts dagegen haben.«
Ihr Lächeln war höflich und doch seltsam, als hätte sie es vor dem Spiegel üben müssen – wie ein zu menschlichen Emotionen unfähiger Roboter. Signe schaute verunsichert zu Fabian. Die Augen des jungen Wissenschaftlers strahlten, er war unglaublich stolz auf Dr. Drydens Interesse an seiner Arbeit.
Fabian nickte Signe auffordernd zu.
»Klar, warum nicht?«, antwortete Signe.
Dr. Dryden wandte sich an Fabian: »Doktor Hardenberg, dann legen Sie mal los. Zeigen Sie uns Ihr kleines Wunder.«
Das junge Paar auf dem Bild sah so glücklich aus, als ob ihm auch der rote Nebel nichts anhaben könnte, der alles umgab. Rosarot glänzte der Schnee auf den Alpen am Gardasee, lila leuchtete das schäumende Wasser unter ihnen. Das kastanienbraune Haar der jungen Frau flatterte im Wind, sie stand im holzverkleideten Sportboot und winkte fröhlich, und auch der junge Mann neben ihr am Steuer ließ seine langen Haare im Wind wehen.
MARINE stand in geschwungener Schrift vorne auf dem Bug des Bootes. Es war ein Verlobungsgeschenk an die glückliche Frau, die, nur drei Tage nachdem die Fotografie entstanden war, Kollmanns Namen annehmen sollte.
In rot verblichenen Agfafarben strahlte das junge Paar vom Bücherregal aus ins Wohnzimmer, als würde es die Zukunft da draußen betrachten und sich darüber amüsieren, wie absurd deprimierend ihre Ehe werden würde.
Jacques Kollmann war seit den 70er-Jahren dicklich, zerknautscht und grauhaarig geworden, wie er da im Seiden-Bademantel saß und wieder sein Whisky-Glas umklammerte. Marine saß ihm mit verschränkten Armen gegenüber und hatte ihm nichts zu sagen. Leise tickte die Pendeluhr an der Wand. Kollmann fuhr erschrocken hoch, als es klingelte. Marine stand auf und ging zur Tür: »Das wird er sein. Du hättest ihn nicht rufen sollen.«
»Er wird wissen, was zu tun ist, Marine.«
An der Tür begrüßte sie Holger Brauer wortlos. Er nickte ihr lächelnd zu, doch in seinen kalten Augen war dieses Glänzen zu sehen, das Marine nie einzuordnen wusste, wenn sie auf ihn traf. Sie entzog sich Brauers Blick und ließ ihn eintreten.
Brauer war ein Bär von einem Mann, dem man ansah, dass er trotz seiner 65 Jahre täglich trainierte. Eine dicke Ader auf seiner Stirn zeugte von einer anstrengenden Vergangenheit. Jacques kam aus dem Wohnzimmer und ging auf ihn zu. Brauer warf einen Blick auf ein Paar Lederschuhe, die im Flur standen, schlammverkrustet und voller Dreck. Jacques fehlten die Worte, seinen Gast zu begrüßen. Mit verlegenem Blick stand er vor ihm.
»Na, dann leg mal los«, unterbrach Marine die Stille. »Jetzt, wo er schon mal da ist.«
Jacques Kollmann nickte, sah aber weiterhin ratlos den großen Mann mit der Ader an, der schweigend darauf wartete, zu erfahren, warum er herbestellt worden war.
»Also, es ist so … Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll …«
»Er hat einen Unfall gebaut und glaubt, dass jemand dabei umgekommen ist«, entfuhr es Marine. Brauer sah die kleine Französin an und hob eine Augenbraue. Sie wollte die Sache hinter sich bringen, hatte keine Geduld mehr mit Jacques und seinem Selbstmitleid, das sie sich die ganze Nacht hatte anhören müssen.
»Glaubt er oder weiß er das?«, fragte Brauer, als sie gemeinsam ins Wohnzimmer gingen, wo Jacques sich wieder in seinem Sessel niederließ.
»Ich denke, er ist sich recht sicher«, antwortete Marine und musterte Jacques. »Zwei junge Männer in einem weißen Golf, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Einer ist tot, der andere … vielleicht nicht.«
Brauer nickte. Er sah wieder zu Jacques.
»Was sollen wir tun, Holger?«, fragte der Mann im Sessel und klang wie ein hilfloses Kind.
»Fürs Erste? Herausfinden, ob der Junge lebt und ob er dich gesehen hat. Was sonst?«
»Kannst du das für uns tun?«
»Natürlich, Jacques.«
Marine konnte den flehenden Ton ihres Mannes nicht ausstehen. Mit jemandem wie Holger Brauer musste man Klartext sprechen. Sie vertraute dem ehemaligen BND-Mann nicht, der heute als privater Ermittler und Problemlöser tätig war und im Dienste ihres Mannes und anderer Auftraggeber immer da einsprang, wo sonst der gesamte Mitarbeiterstab versagte.
Mit verschränkten Armen baute sie sich vor Holger auf, sah streng zu ihm hoch und sagte: »Holger, du sagst uns Bescheid, bevor du etwas unternimmst.«
Brauer lächelte sie an. Sie war sich nicht sicher, ob es ein freundliches Lächeln war oder ob er sie lediglich belächelte. Bei Holger Brauer wusste man nie.
»Klar, Marine«, sagte er einschmeichelnd. »Der Kalte Krieg ist vorbei.« Ohne darauf einzugehen, was er damit genau meinte, wandte er sich wieder an Jacques: »Wo ist der Wagen?«
»Was meinst du? Ist da …? Ist da …? Ich meine, ist da etwas zu machen?«, fragte Jacques Kollmann und deutete auf den Mercedes.
Brauer stand in der Garage und musterte den Wagen. Er war einigermaßen heil geblieben. Die Seite war zerkratzt, die Beifahrertür eingedrückt. Der rechte Kotflügel hatte am meisten abbekommen. Er war quasi nicht mehr vorhanden. Beide Vorderlampen funktionierten nicht mehr. Auf Nachfrage beteuerte Jacques, gar nicht bemerkt zu haben, dass das Licht nicht mehr angewesen war.
»Ist gut weggekommen«, erklärte Brauer. »Aber nicht gut genug. Wird Fragen geben. Ist ’n Unfallwagen, sieht man.«
»Und was tun wir jetzt damit?«, fragte Marine.
Brauer ging sehr bedächtig um den Mercedes herum, wobei er seinen Blick durch die Garage schweifen ließ. Fahrräder hingen über dem Rasenmäher, in den Regalen hatten sich im Laufe der Jahre zahlreiche Blumentöpfe gesammelt. Ein Grill stand neben einer an der Wand gelehnten Ski-Box.
Marine machte einen Schritt in die Garage, um zu sehen, wonach Brauer suchte, doch der streckte seinen Arm aus und hielt sie davon ab weiterzugehen.
So wie Zauberkünstler plötzlich Blumensträuße in der Hand halten, sprang ein Teppichmesser von irgendwoher in Brauers Faust. Ehe sich Jacques und Marine fragen konnten, woher seine flinken Finger das Messer hervorgezogen hatten, schnitt Brauer ein dünnes Tau durch, das von einer Winde an der Wand straff gehalten wurde.
Die Kollmanns schrien erschrocken auf, als die Garage bebte und der Mercedes vor ihren Augen platt gedrückt wurde. Splitter flogen durch den Raum, Blech bog sich. Dann Stille. Mitten im zerstörten schwarzen Benz parkte ein schnittiges Motorboot, das seit einigen Jahren ausgemustert im Flaschenzug an der Garagendecke gehangen hatte.
»MARINE« stand in verblasster Schrift auf dem Bug des Bootes.
Holger Brauer klappte sein Messer ein und steckte es in eine hintere Hosentasche. »Hättet ihr wohl besser sichern müssen«, sagte er trocken.
Kapitel 2
Dr. Dryden beobachtete durch die schalldichte Scheibe, wie Fabian die Biosensoren an Signes Kopf anbrachte und sie langsam in den MRT-Scanner fuhr.
»Und Sie vertrauen ihm?«, fragte sie Ye Wang, ohne sich umzudrehen.
Der pummelige asiatische Wissenschaftler rührte mit dem Trinkhalm in den Milchschaumresten seines Grande-Kaffeebechers. »Na ja, ich kenne ihn von der Uni. Er ist gut in dem, was er macht. Hatte ihn lange nicht mehr gesehen, bis er sich wegen der Bildtechnik bei mir gemeldet hatte, die er für seine Versuchsreihe …«
»War meine Frage nicht verständlich?«, unterbrach ihn Dr. Dryden. »Ich wollte wissen, ob Sie ihm vertrauen?«
Ye zuckte mit den Schultern. Dryden sah ihn an und schwieg. In diesem Moment kam Fabian zurück in das Labor und ging geradewegs zu einem der Monitore, wo er eine Grafik aufrief. Fabian war voller Elan und Vorfreude, der berühmten Wissenschaftlerin seine bahnbrechende Arbeit vorzustellen. »Wir sind gleich so weit. Sie werden sehen, wir haben nicht zu viel versprochen.«
»Was genau ist der Inhalt Ihrer Studien?«
Fabian räusperte sich fachmännisch, bevor er erklärte: »Begonnen habe ich mit der Frage, ob luzide Träumer grundsätzlich emotionaler träumen und sich dadurch deutlicher an ihre Träume erinnern.«
Dr. Drydens prüfender Blick ließ Fabian leicht nervös werden. Er schielte kurz auf einen Monitor, um zu checken, ob Signe schon dabei war einzuschlafen. Tatsächlich verrieten die Kurven und Zahlen, dass sich ihr Körper langsam entspannte. Fabian fuhr fort: »Welche Eindrücke werden als emotionale Erlebnisse ins Langzeitgedächtnis übertragen, welche kommen nicht aus dem Kurzzeitgedächtnis und werden vergessen? Dazu habe ich über zweihundert Menschen, die Hälfte von ihnen luzide Träumer, im Schlaf untersucht. Es ging vor allem um den empirischen Vergleich der Aktivitätswerte von Amygdala, Insula und orbitofrontalem Kortex und deren jeweilige Korrelation mit der Tätigkeit des Hippo…«
An Dr. Drydens immer heftiger werdendem Nicken erkannte Fabian, dass sie sich wenig für seine Ausgangsstudien interessierte. »Aber seit ich Frau Mortensen kennengelernt habe, hat sich mein Fokus verschoben.«
»Inwiefern?« Dr. Drydens Stimme klang fast erleichtert, Fabian kam endlich zum Punkt.
»Ihre Werte wichen einfach gewaltig von denen anderer Träumer ab, und ich wollte unbedingt sehen, wie weit sie gehen kann. Ob etwa eine Kommunikation nach draußen für sie möglich ist. Sie ist die talentierteste Träumerin, die ich je kennengelernt habe.«
»Sie halten Träumen für ein Talent?«
»Seit ich Signe Mortensen kenne, ja.«
Dryden nickte nachdenklich. Dann sah sie wieder auf den Schnellhefter. Auf der Titelseite stand in der verpixelten Schrift: Lieber Dr. Fabian. Ich bin einverstanden.
»Einverstanden womit?«
Fabian blickte auf, er verstand die Frage nicht. Dryden verwies auf den Schnellhefter: »Die Nachricht. Ich frage mich, was sie zu bedeuten hat. Ist das relevant?«
»Für den Versuch? Nein. Es ist eine private Nachricht.« Dryden horchte auf, aber Fabian winkte ab: »Sie ist auf dem Titel, weil es die erste Nachricht war, die Signe aus einem Traum heraus geschickt hat. Der Protosatz sozusagen.«
Dryden brummelte ein leises »Aha« und blätterte weiter im Schnellhefter. Er war voller kryptischer Bilder, auf denen Worte und ganze Sätze auszumachen waren. Auf manchen waren kleine Zeichnungen zu erkennen.
»Aber womit ist sie denn einverstanden?«, wollte jetzt plötzlich Ye Wang wissen.
Fabian war eben noch froh gewesen, dass Dryden nicht weiterbohrte, da sprudelte aus Ye auch schon die Antwort auf seine eigene Frage heraus: »Ach, ich weiß. Sie war einverstanden, bei dir einzuziehen. Richtig? Ihr seid doch neulich erst zusammengezogen?«
Ye schien Fabians vorwurfsvollen Blick überhaupt nicht zu verstehen, als Dr. Dryden vom Schnellhefter aufblickte und nachhakte: »Pflegen Sie zu all Ihren Probanden auch privaten Umgang, Doktor Hardenberg?«
»Nein, nein, das dürfen Sie nicht falsch verstehen …«
»Wäre dann auch irgendwann ein bisschen eng in der Wohnung, nicht?«, kicherte Ye.
Fabian hatte alle Mühe, Yes pubertäre Laune zu ignorieren. Er hätte ihn am liebsten angeschnauzt, doch er fürchtete, dass er so sein Gesicht vor Dr. Dryden komplett verlieren würde.
»Frau Mortensen und ich, wir … Wir haben hier im Labor ein professionelles Arbeitsverhältnis.«
Dryden hob die Augenbraue, und Ye warf Fabian ein verschwörerisches Zwinkern zu, das ihn nur noch mehr irritierte. Schnell wandte er sich dem Monitor zu.
»Schauen Sie, sie müsste jetzt träumen.«
Dr. Dryden legte den Schnellhefter beiseite, stellte sich neben Fabian und betrachtete die grafische Darstellung von Signe Mortensens Gehirnaktivitäten. Ein kleines Browserfenster rechts oben zeigte ein Video von Signes Augenpartie. Schnell und ruckartig bewegten sich ihre Augäpfel unter den blassen Lidern hin und her.
»ZUGANG NUR FÜR PROFESSOREN!«, steht groß vor den Treppen auf dem Schild an der glänzenden Eisenkette zum Sprungturm. Die Kette wackelt noch, als wäre sie eben erst angebracht worden, und lenkt mir wie absichtlich das Sonnenlicht funkelnd in die Augen.
Eine Bremse fliegt mir um den Kopf. Das lästige Insekt hat sich mit der Kette abgesprochen, mir den Badetag zu vermiesen. Es brummt in meine Ohren, schlägt eine Kurve und setzt sich auf meinen nassen Schenkel. Die Bremse klatsche ich tot, das größere Problem steht oben auf dem Fünfmeterturm.
»Nein, du darfst hier nicht hoch, Signe, kannst du denn immer noch nicht lesen?«, ruft das Problem.
Ich kann sein Gesicht nicht erkennen, weil die Sonne direkt hinter ihm steht, aber mit seinen dünnen Beinchen sieht der dicke Mann in seinem hautengen schwarz-weiß gestreiften Herren-Badeanzug und dem blöden Rauschebart aus wie der Schurke ausPopeye– wie hieß der noch? Brutus! Er macht dämliche Turnübungen wie aus dem 19. Jahrhundert: »Und eins und zwei«, ruft er sich selber zu. »Und eins und zwei.«
»Wieso denn nur für Professoren?!«, schreie ich zu ihm hoch. »Wir wollen alle mal springen!« Ich zeige auf die Kinder hinter mir.
»Und wer ist ›alle‹?«, fragt er.
Ich drehe mich um, und da steht keiner. Wo sind sie denn alle hin, hier war doch eben noch eine lange Schlange Menschen? Der dicke Brutus lacht mich aus, sein Bauch wackelt auf und ab, dann macht er weiter seine Übungen zu »Eins und zwei und eins und zwei!«.
Ich haue wütend nach einer zweiten Bremse, die mich ganz schockiert ansieht, weil sie wohl nur an mir vorbeifliegen wollte und überhaupt eine von diesen Friedensbremsen ist. Mir ist das egal. Alles Biester, diese Bremsen!
Und die dicke Spaßbremse da oben ärgert mich am meisten. Aber ich will darüberstehen und mir nichts anmerken lassen. Ich versuche den Mann zu ignorieren, aber ich spüre, dass er mich immer noch anstarrt – also sehe ich doch wieder zu ihm hoch.
Eine Wolke schiebt sich zwischen ihn und die Sonne, und erst jetzt erkenne ich ihn: Es ist Professor Wendt mit seinem schiefen Lächeln und seiner gönnerhaften Arroganz.
»Was denn?«, rufe ich ihm zu. »Was wollen Sie noch?«
Wendt nimmt seinen linken Fuß in die Hand und versucht seinen kleinen Oberschenkel zu dehnen. »Signe, Signe, Signe«, sagt er und verliert fast das Gleichgewicht. Ich lache ihn laut aus, er lacht noch lauter zurück. »Signe, du darfst hier nicht hoch, weil du dich nicht traust zu springen! Weil du nicht den Mut hast! Weil du gar nicht weißt, wie das geht, mutig zu sein!«
Warum duzt mich Professor Wendt? Meint er denn, nur weil er jetzt wie eine blöde Comicfigur aussieht, mich wie ein Kind behandeln zu dürfen? Am liebsten würde ich ihn anschreien, aber ich habe ein besseres Argument und bleibe höflich: »Sie springen doch selber nicht! Seit Stunden hampeln Sie da oben rum und machen ›eins und zwei‹.«
Wendt lacht nur und boxt in die Luft.
Plötzlich höre ich ein leises Klingeln und spüre ein vertrautes Gefühl von warmem Fell an meinem Bein. Ich sehe nach unten: Der Schwarze Max mit seinem klingelnden Glöckchen am Halsband.
Schön, dich zu sehen, Max!
Der Kater blickt mich mit milchweißen Augen an, mit denen er mich doch sehen kann. Er scheint mich an etwas erinnern zu wollen. Ich muss nicht lange überlegen, was er meint.
Ein Traum, Max?
»Wenn du erst mal den Mut hast zu springen«, meckert Professor Brutus von hoch oben weiter, »wenn du dich deinen kindischen Ängsten endlich stellen magst, dann darfst du auch hier hoch, aber du willst ja nicht, dass man dir hilft«, sagt er und verzieht dabei das Gesicht wie ein Kind, das jemanden nachäfft.
Es reicht! »Ist Ihnen klar, dass das ein Traum ist?«, frage ich ihn drohend und zeige auf den Schwarzen Max. Der Professor ignoriert den Kater: »Eins und zwei …«
»Sie wissen, dass ich hier das Sagen habe, ja?«
»… und eins und zwei.«
Ich schnippe, und die Bremse von eben, die nur an mir vorbeifliegen wollte und die mich in der Zwischenzeit mit ihrem dummen Bremsenkopf schon fast wieder vergessen hat, muss wie ferngesteuert den Kurs wechseln und wieder auf mich zufliegen. Voller Angst flattert sie vor mir auf der Stelle.
Ich nehme ein golden schimmerndes Pulver aus meiner Hosentasche und blase es der Bremse ins Gesicht. Sie kneift ihre riesigen Facettenaugen zu und reibt sich den Rüssel. Als sie die Augen wieder öffnet, ist sie über einen Meter groß und erschrickt darüber fast zu Tode.
Ich verziehe keine Miene und zeige mit dem Finger auf Popeyes Gegenspieler auf dem Sprungturm. Die Bremse versteht, hält ihr linkes vorderstes Bremsenbein zum Soldatengruß an den Kopf und fliegt schnurstracks los und bis in den Himmel davon.
Ein lauer Wind weht mir um die Nase, und dann ist es plötzlich ganz still. »Jetzt ist sie weg!«, lacht Professor Wendt vom Sprungturm.
Aber er lacht nicht lange. Meine Riesenbremse ist nur einen Bogen geflogen und donnert jetzt geradewegs und mit der Geschwindigkeit eines Düsenjets auf ihn zu!
Wendt kriegt es mit der Angst zu tun. »Mach sie weg, Signe!«
»Sie müssen nur springen, Professor! Trauen Sie sich!«
Erbarmungslos rast die Bremse auf ihn zu, nur noch vierzig Meter …
»Mach sie weg, du kannst auch hoch, schau!« Er zeigt auf die Turmtreppen. Auf dem Schild steht jetzt: »ZUGANG NUR FÜR PROFESSOREN UND SIGNE!«
Aber ich muss jetzt streng sein.
Nur noch zwanzig Meter …
Wendt steht schon am Rand des Sprungturms, weint aber wie ein Kind, das von seinen Eltern abgeholt werden möchte.
Zehn Meter …
Wendt will springen, hält sich aber krampfhaft fest …
Vier Meter …
Drei …
Wendt springt. Ich lache auf, die Bremse wird mit einem PUFF! wieder klein und fliegt davon.
Professor Wendt klatscht mit voller Wucht ins Wasser, riesige Fontänen spritzen aus dem Becken.
Die Bremse muss sich mehrmals ducken und ausweichen, um nicht vom Wasser zu Boden gerissen zu werden. Erleichtert fliegt sie davon, diesen Moment wird wohl auch ihr dummer kleiner Kopf nicht mehr vergessen.
Wendt schlägt im Wasser umher und ruft: »Ich kann nicht schwimm…«
Ich muss jetzt streng sein.
Ich wende mich ab und lasse ihn im Becken paddeln.
»Signe, ich ertri…«
»Das hätten sie sich vorher überlegen sollen, Professor«, rufe ich ihm zu, ohne mich umzudrehen.
Wendts Antwort ist nur noch ein schwaches Gluckern.
Ich habe genug gehört und hebe die Arme hoch. Zeit für den Strand. Der Kater klettert an mir hoch und legt sich um meinen Nacken.
Mit Schwung reiße ich beide Arme nach unten und hebe ab wie eine Rakete. Unter mir zerbrechen die Fliesen in Stücke, und ich rase bis zu den Wolken.
Da oben breite ich gemütlich meine Arme aus und gleite, vom warmen Wind getragen, über das weite Land.
Ich spüre, wie sich der Schwarze Max auf meinen Rücken legt und schnurrt. Er liebt es, zu fliegen. Leise klingelt sein Glöckchen im Wind. Die grüne Landschaft unter mir endet da vorne, dahinter liegt der weite Ozean.
Ich spüre, wie die Barthaare des Katers meine Wange kitzeln, schaue über meine Schulter und sehe direkt in seine milchweißen Augen. Der Schwarze Max neigt wieder den Kopf. Ach ja, das Zeichen für Fabian und Doktor Dryden.
Ich balle meine linke Hand zur Faust, zähle bis fünf, dann balle ich die rechte.
Dr. Dryden bewegte ihr Gesicht näher an den Monitor. Auf einer bunten Grafik, die einen Scan von Signes Gehirn zeigte, leuchtete eine blaue Fläche in der rechten Hirnhälfte auf. Kurz darauf geschah das Gleiche in der linken.
»Was macht sie da?«, fragte Dryden neugierig. »Bewegt sie ihre Hände?«
»Sie ballt ihre Fäuste«, korrigierte Fabian vorsichtig. »Erst die linke, dann die rechte. Das ist unser verabredetes Zeichen.«
»Sie signalisiert Ihnen damit, dass sie bewusst träumt?«
»Genau!« Fabian trat mit einem großen Schritt an einen anderen Monitor. »Wenn ich Sie dann bitten dürfte. Die Show ist hier zu sehen«. Er öffnete eine Grafik, die wie ein Ultraschallbild aussah und nur aus Schatten, grauen Wolken und flackerndem Weiß zu bestehen schien.
Ich lande sanft mit den nackten Füßen im warmen Sand. Mein Kater springt von mir ab und läuft voraus zum Ufer.
Ich atme die salzige Luft des Meeres ein und fühle mich, als wäre ich nach einer langen Reise endlich wieder zu Hause angekommen. Nirgendwo habe ich dieses Gefühl so stark wie an diesem Strand.
Zwei Palmen streben aus dem weißen Sand. Weit vorne, wo die braunen Spitzen der Korallen aus dem Meer ragen, verfärbt sich das Wasser in strahlendes Türkis. Es ist ein Ort, den ich mir ausgedacht habe – und doch ist es der sicherste Ort der Welt.
Manchmal, wenn ich mich bei Fabian ankuschele, denke ich, dass es sich in seinen Armen so ähnlich anfühlt, dass ich bei ihm in Sicherheit bin. So sicher, wie hier im Sand zu liegen und Max dabei zuzusehen, wie er hinter der Brandung nach kleinen, bunten Fischen Ausschau hält, die seinen milchweißen Augen ebenso wenig entgehen können wie alles andere auch. Ein scharfsichtiger blinder Kater ist er im Traum. Der echte Schwarze Max damals war tatsächlich blind, das arme Ding, aber hier ist nichts unmöglich, und blinde Kateraugen sehen so scharf wie die eines Adlers.
Wie ein apportierender Hund trägt er plötzlich einen Holzzweig im Maul und legt ihn vor mich hin. Ich nehme den Stock in die Hand, und Max stützt sich auf seine Vorderpfoten.
»Was soll ich Ihnen eigentlich schreiben?«, frage ich ihn, doch das scheint ihm ziemlich egal zu sein, denn er rennt wieder zur Brandung, um bei den Fischen nach dem Rechten zu sehen.
Ich beuge mich vor und zeichne mit dem Zweig einen Strich in den weichen Sand.
Dr. Dryden stellte sich zwischen Fabian und Ye Wang, als sich im Nebel ein Strich bildete. Ein Kreis schloss sich daran an, dann zwei spitze Dreiecke: Langsam war im Nebel die Skizze einer Katze zu erkennen.
Dryden beugte sich neugierig vor und ließ ein leises Lächeln über ihre strengen Gesichtszüge fahren. Diese Eigenschaft schien sie mit Fabian zu teilen: Wissenschaftliche Phänomene lösten euphorische Gefühle in ihr aus. Unter der Strichzeichnung erschien eine kurze Botschaft: »HALLO, DR. DRYDEN!«
Ye Wang trat hinter die Wissenschaftlerin. »Das ist die Person, die wir suchen, oder?«
Dryden nickte. Fabian huschte ein breites Grinsen über das Gesicht.
Die Sonne scheint mir warm in den Nacken, während ich im Schneidersitz im weißen Sand sitze und auf das hellblaue Meer hinausschaue.
Da vorne treibt ein Körper. Es ist Professor Wendts Wasserleiche aus dem Schwimmbad. Der Schwarze Max miaut ihm ein bisschen wehmütig nach und sieht sich nach mir um.
»Keine Sorge, Max, ist doch nur ein Traum.«
Kapitel 3
Mühsam las Signe das vierseitige Paragrafenpapier. An einer Stelle runzelte sie die Stirn und blickte auf: »Hier steht, dass ich Strafzahlungen zu erwarten habe, wenn ich über das Engram-Projekt spreche.«
Dryden nickte. »Ich verstehe Ihre Bedenken. Ich unterschreibe grundsätzlich nichts, was sich vermeiden lässt. Aber hier ist es leider nicht zu ändern. Als Wissenschaftler sind wir es der Öffentlichkeit schuldig, sorgsam mit unserer Forschung umzugehen. So eindrucksvoll ihre Traumnachrichten auch sind, im Vergleich zu unserer Arbeit in Jülich ist das wie ›Jugend forscht‹.«
Fabian traute seinen Ohren nicht. Ye Wang konnte sich ein leises Kichern nicht verkneifen, aber Dryden fuhr, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach fort: »Wir müssen unbedingt sicherstellen, dass alles unter Verschluss bleibt, bis wir solide Ergebnisse haben und potenzielle Risiken ausschließen können.« Sie blickte kurz zu Fabian: »Das meinte ich auch nur mit ›Jugend forscht‹, Doktor Hardenberg. Verzeihung. Ihre Versuche sind harmlos.«
Fabian versuchte, sich den Ärger nicht anmerken zu lassen. Er wollte endlich mehr über das Engram-Projekt erfahren, für das eine prominente Wissenschaftlerin wie Dr. Dryden eigens aus Austin in die Provinz nach Jülich gezogen war, einer kleinen Stadt an der niederländischen Grenze, in der eines der renommiertesten Forschungszentren der Welt seinen Sitz hatte.
»Komm, lass uns unterschreiben«, sagte er mit einem auffordernden Lächeln zu Signe.
Dr. Dryden hob wieder die Augenbraue. »Verzeihung, Doktor Hardenberg. Ich … Wir benötigen nur das Einverständnis von Frau Mortensen.«
Fabian verstand nicht: »Aber ich könnte doch genauso herumerzählen …«
Dryden unterbrach: »Ich hatte nicht vor, Sie einzuweihen. Ich hoffe, Sie verstehen das.«
Fabian konnte kaum fassen, wie schnell es sein langjähriges Idol schaffte, sich zu einem Widersacher zu mausern. »Nein, das verstehe ich nicht. Signe ist meine Probandin. Ich habe sie entdeckt.«
Dr. Drydens Mundwinkel zuckten ein wenig, es war ihre Version eines müden Lächelns. »Doktor Hardenberg, Frau Mortensen ist keine seltene Spezies. Und sie ist auch nicht Ihr Eigentum. Sie ist eine Person, die für sich selbst entscheiden kann, wenn ich nicht völlig irre.«
Fabian und Dr. Dryden sahen sich lange an, als spielten sie darum, wer zuerst zwinkert. Erst ein Räuspern von Signe unterbrach das Blickduell.
»Frau Doktor Dryden, ich … ich möchte schon, dass Fabian … also Doktor Hardenberg mit eingeweiht wird, wenn ich das unterschreiben soll.«
Fabians Hand griff demonstrativ nach Signes. Drydens Blick überflog die Einheitsgeste und blieb auf Signe stehen. »Ich irre also völlig. Ist das Ihr letztes Wort?«
Signe wollte sich der Hals zuschnüren, aber das war ihr jetzt wichtig: »Wir sind schließlich zusammen, ich habe keine Geheimnisse vor ihm.«
Dryden gab sich mit einem Seufzer geschlagen: »Nun gut. Machen sie eine Kopie davon, und dann unterschreiben Sie beide.«
Dr. Dryden wandte sich in ihrer Rede demonstrativ an Signe, während sie wie eine strenge Lehrerin, die einen Text diktiert, im Laborraum auf und ab ging. »Nun weiß ich natürlich nicht, inwieweit Sie vorgebildet sind, Frau Mortensen. Aber da Sie mit einem Wissenschaftler liiert sind, der in diesem Bereich tätig ist, nehme ich an, dass Ihnen der Begriff ›Engram‹ etwas sagt, nach dem wir unser Forschungsprojekt in Jülich benannt haben?«
Signe zuckte mit den Schultern. »Ja, ich habe es aber nie so richtig verstanden. Engramme sind so was wie Spuren, die die Infrastruktur im Gehirn bilden. Ich stelle sie mir wie Straßen vor. Kleine Gassen, große Alleen, Autobahnen.«
Dryden sah Signe interessiert an und nickte. »Ein fantasievoller Vergleich, aber ja, warum nicht?«
Ye Wang saß Signe und Fabian gegenüber und hielt ein Tablet auf dem Schoß, aus dem ein dreidimensionales Abbild des menschlichen Gehirns hervortrat. Er tippte auf zwei kleine Stellen etwa in der Mitte der jeweiligen Gehirnhälften, die daraufhin gelb aufleuchteten.
»Und den Hippocampus kennen Sie auch?«, fragte Dryden.
Ye vergrößerte eine der gelben Stellen, sodass ein kleines, bogenförmiges Organ nun unmittelbar vor dem Tablet schwebte. Signe erkannte das schrumpelige kleine Ding, das sie an diesen Monsterfötus aus dem Film Alien erinnerte. Da ihr der Vergleich aber immer zu gruselig gewesen war, wählte Signe die deutsche Übersetzung des lateinischen Namens Hippocampus.
»Das Seepferdchen.« Signe nickte.
Drydens Mundwinkel zuckten wieder leicht: »Und was macht … das Seepferdchen?«
Fabian wurde es langsam zu dumm: »Doktor Dryden, Signe weiß sehr wohl …«
Doch die Wissenschaftlerin war in ihrer Lehrerrolle nun voll aufgegangen, hob den Finger und deutete Fabian an, still zu sein. »Ich möchte es von ihr hören. Es geht ja schließlich auch um einen Versuch an ihr.«
Fabian schüttelte den Kopf und schwieg.
»Frau Mortensen?«
»Der Hippocampus ist so was wie die Schaltstelle zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Wo alle Reize und Sinneseindrücke sortiert werden.«
»Sehr gut. Und was passiert im Hippocampus, während wir träumen?«
»Ach so, ja. Also im Traum werden dort Informationen wegsortiert oder eben im Gedächtnis gespeichert. Je nachdem, ob es zum Beispiel emotionale Erlebnisse sind oder nicht …«
Dryden war mit Signes Vorkenntnissen zufrieden: »Richtig. Psychologen bezeichnen diesen komplexen Prozess als Traum-Verarbeitung, wir nennen ihn Neurogenese. Was aber genau passiert, ist noch nicht gründlich genug erforscht. Der Prozess müsste von außen eingesehen werden können. Doch wie funktioniert das?«
Als hätten sie sich abgesprochen, wischte Ye das Seepferdchen-Organ vom Tablet und rief ein anderes Bild auf. Es erschien ein seltsames Wesen, wie es Signe nie zuvor gesehen hatte. Es sah aus wie ein eisernes Seeungeheuer mit langen, feinen Tentakeln, die in einem dicken Kopf zusammenliefen. Doch der hatte weder Augen noch einen Mund. Er wirkte kalt und glatt, nicht wie ein Tier, eher wie eine Maschine.
»Was ist das?«, fragte Signe besorgt.
Dr. Dryden nickte Ye Wang aufmunternd zu, er räusperte sich und erklärte: »Das ist einer unserer Datentransmitter. Die haben wir in Jülich entwickelt.«
»Asiatische Bescheidenheit«, unterbrach Dryden ihren jungen Kollegen. »Herr Wang ist der Kopf hinter den kleinen Kraken. In der Theorie wussten wir, was wir wollten. Doch Herr Wang war derjenige, der die Technik überhaupt erst zum Leben erweckt hat.«
Der Chinese wollte etwas antworten, stotterte aber nur verlegen, also fuhr Dryden fort: »Die Transmitter verbinden sich mit der neuronalen Struktur des Gehirns und können die Informationen aus dem Hippocampus in digitale Signale wandeln, die wir über eine Datenleitung an baugleiche Transmitter in einem anderen Gehirn senden können.«
Ye strich wieder über sein Tablet, wo nun zwei Gehirne nebeneinander erschienen. Animierte kleine Kraken flogen auf die gelb markierten Seepferdchen in beiden Gehirnen, leuchtende Halbbögen stellten den Versand der Daten aus den Krakenschwärmen dar, und eine rot gepunktete Linie schließlich stand für den Datenfluss von einem Gehirn zum anderen.
Fabian konnte es nicht fassen, was die beiden Wissenschaftler aus Jülich hier behaupteten.
»Dort werden die Daten vom Fornix, einem mächtigen Strang von Nervenfasern, wie jeder andere Reiz behandelt und ins Limbische System übertragen. Im Prinzip funktioniert das so wie die Datenübertragung von einem Router zum anderen.«
»Und was bedeutet das jetzt für mich?«, fragte Signe. »Was haben Sie mit mir vor?«
Dr. Dryden machte eine Handbewegung, mit der sie Signe wohl um etwas Geduld bitten wollte, doch wie alles, was Dryden tat, wirkte das eher wie eine harsche Rüge. »Der Ablauf des Versuchs ist wie folgt: Zwei Probanden werden mit Transmittern ausgestattet. Beide begeben sich im Schlaf in den Traumzustand, und mittels der Datenübertragung erhält ein Proband die Eindrücke und Reize des anderen zugespielt. Er erlebt mit, was der andere träumt.«
»Und das funktioniert?«, fragte Fabian ungläubig.
»Aber natürlich. Das Verfahren ist bei uns schon Routine«, antwortete Dryden, wobei sich ihre Mundwinkel nun unerwartet steil nach oben hoben. Das wissenschaftliche Wunder, das sie beschrieb, erfüllte sie mit Stolz.
»Unfassbar«, entfuhr es Fabian. »Das ist wirklich sensationell.« Aufgeregt schaute er zu Signe, als würde er erwarten, dass sie auch in Begeisterung ausbrach. Doch sie wirkte eher verunsichert.
»Und warum ich?«, fragte sie.
Ye und Fabian sahen Dryden an, die sich nun endlich setzte, bevor sie Signe ihre Antwort gab. »Unsere Probanden haben fremde Träume bisher passiv miterlebt. Luzide Träumer sollten aber innerhalb eines Traumes Entscheidungen treffen und somit auch die Träume anderer assoziativ …«, sie suchte nach dem passenden Verb, »… bereisen können. Mit dieser Fähigkeit sollte es möglich sein, gezielt in Träumen nach Assoziationen und vielleicht sogar nach konkreten Erinnerungen zu suchen. So könnten wir mehr Wissen über den Vorgang der Neurogenese und damit über das Gehirn sammeln als je zuvor. Verstehen Sie? Die Hirnforschung könnte von außen nach innen verlagert werden. Unsere Erkenntnisse würden dort gewonnen werden, wo sie auch stattfinden. In den Träumen und Erinnerungen.«
Fabian hing förmlich an Drydens Lippen, jetzt wusste er wieder, warum sie sein Idol war. Ihre Arbeit überstieg bei Weitem alles, was er sich hätte vorstellen können, sie war die Visionärin ihres Fachs, und Fabian beneidete sie.
Signe hingegen machte sie Angst. »Ich soll für Sie in den Träumen anderer Menschen spazieren gehen?«
Dryden nickte. »Bislang sind unsere Versuche mit luziden Träumern leider nicht sehr erfolgreich gewesen. In der Praxis sind sie meist nicht besonders gut in der Lage, sich auf fremde Reize einzulassen. Im Fremdtraum sind sie enttäuschend ›unluzide‹. Aber nach dem, was ich heute von Ihnen gesehen habe, bin ich davon überzeugt, dass Sie sehr viel …«, Dryden sah Fabian an, »… talentierter sind.«
»Das kann ich nicht tun«, flüsterte Signe.
Die nächtliche Großstadt warf ihr Licht in die Wohnung, die Fabian von seinem Vater geerbt hatte und in der er seit wenigen Wochen mit Signe zusammenwohnte. Die Silhouetten eleganter Designermöbel waren zu erkennen, die Häuser von gegenüber reflektierten in der glatten Fläche des Flachbildfernsehers, der über einer Sitzgruppe hing.
Plötzlich sprang das Licht einer elegant geschwungenen Messinglampe an. Der Raum wurde in warmes Licht getaucht und ließ die Blumen auf den Fensterbänken erstrahlen, die Signe kurz nach ihrem Einzug gekauft hatte. Sie hatte auch ein großes Bild an die kahle weiße Wand gehängt. Es zeigte einen von hellem Sonnenlicht erleuchteten nordischen Tannenwald, über dessen Baumkronen aber dunkle Nacht herrschte. Ein fotorealistisch anmutendes und doch vollkommen surreales Werk, das Signe in Dänemark gemalt hatte, kurz bevor sie nach Deutschland gekommen war. Fabian war ganz begeistert davon gewesen.
An diesem Abend beachtete er es gar nicht, sondern ging schnurstracks in die Küche. Signe folgte ihm. Fabian öffnete den Kühlschrank und suchte nach etwas zu essen, nahm aber nichts.
Signe berührte ihn vorsichtig an der Schulter. »Sei nicht mehr böse.«
Fabian schlug die Kühlschranktür wieder zu, wobei er Signes Hand von seiner Schulter schob, und suchte stattdessen etwas in einem anderen Schrank.
»Sag doch mal was.«
Fabians Gesichtsausdruck konnte nicht verbergen, wie enttäuscht er war. »Würde ich gerne. Aber ich will nichts sagen, was dich verletzen könnte.«
»Hab ich dich verletzt?«
»Du hast Margret Dryden vor den Kopf gestoßen. Das ist eigentlich viel schlimmer.« Er fand eine Weinflasche und nahm den Flaschenöffner aus der Schublade.
»Das wollte ich nicht.«
»Was dann? Warum hast du Nein gesagt?«
»Es ist …«, setzte Signe an, »… ich hab einfach Angst davor.«
Fabian sah sie lange an, doch seine Enttäuschung war größer als sein Verständnis. Er schüttelte den Kopf und ging an Signe vorbei ins Wohnzimmer.
»Geh ins Bett, Signe. Lass mich mal allein.«
Sie biss sich auf die Lippen. Sie kannte Fabian gut genug, um zu wissen, dass er es ernst meinte und in den nächsten Stunden nicht ansprechbar sein würde. Leise ging sie ins Badezimmer, um sich bettfertig zu machen.
Fabian zog den Korken aus der alten Flasche und fluchte, als er ihm dabei in den Rotwein bröselte. Er schenkte sich ein volles Glas ein, griff nach der Fernbedienung und schaltete den Fernseher ein, wo irgendwelche Leute über irgendwelche Themen stritten.
Die Diskussionen waren nur das Grundrauschen zu den Gedanken, denen sich Fabian hingab. Nie war er seinen beruflichen Zielen so nah gewesen wie heute. Und ausgerechnet Signe hatte abgelehnt, die doch der Schlüssel zu Margret Dryden sein konnte. Fabians Gesicht wurde zu einer zynischen Grimasse.
»Und? Wie lange braucht es noch bis zum Chefarzt?« Die Worte seines Vaters Leo Hardenberg verfolgten ihn. Fabian hatte ihm immer wieder geduldig erklärt, dass er Wissenschaftler sei und nicht Arzt und dass Grundlagenforschung in der Wissenschaft mehr als nur ein Hobby für Millionärssöhnchen sei. Sein Vater – der große, alte Kaufmann – hatte das nie verstanden, bis zu seinem Tod vor vier Jahren nicht.
Eine große Boulevardzeitung hatte damals ein Foto von Leo Hardenbergs Beerdigung veröffentlicht, auf dem Fabian seine Mutter Clementine stützte, die im Gegensatz zu seinem Vater immer an ihn geglaubt und seine beruflichen Entscheidungen verteidigt hatte. Im Fokus der Aufnahme aber standen nicht Fabian und seine Mutter, sondern seine drei Jahre älteren Zwillingsschwestern. Sie waren von der Redaktion sogar rot eingekreist worden. Britta und Inga trugen das gleiche schwarze Kleid, waren ineinander untergehakt und blickten nicht ins Grab, sondern direkt in die Linse des Fotografen. »Der Vater lebt in ihnen weiter«, stand in großen Lettern über der Aufnahme. »Die schönen Hardenberg-Zwillinge übernehmen die Konzernleitung.«
Die beiden Karrierefrauen wussten sich zu inszenieren. Kaum waren sie in ihre Chefbüros gezogen, schafften sie es auf die Titel internationaler Wirtschaftszeitungen. Fabian erinnerte sich besonders an das Cover eines Business-Magazins, auf dem sich seine Schwestern in Bleistiftröcken und mit aufgeknöpften Blusen einen aufblasbaren Erdball zuwarfen. »Spielend leicht die Welt erobern«, hieß die Schlagzeile. »Wie die Hardenberg-Zwillinge mit Charme und Sex-Appeal HADI noch größer machen wollen.«
HADI stand für Hardenberg Discount. 5000 Filialen in Deutschland erinnerten Fabian immer wieder daran, wie viel größer sein Name war als er selbst.
Schon als Kind hatte Fabian seine dominanten Schwestern stets als eine untrennbare Einheit wahrgenommen. Sie schienen immer einer Meinung zu sein. Erst recht, wenn es darum ging, den kleinen Bruder mit perfekt untereinander abgestimmten Lügengeschichten zu ärgern oder ihm Streiche zu spielen. Ihretwegen hatte er bis zu seinem zehnten Lebensjahr geglaubt, Erdbeermarmelade bestehe in Wirklichkeit aus pürierten Mäusen.
Als er neun war, hatten die Zwillinge Fabian mitten im Winter in den leeren Swimmingpool im Garten gelockt. Sie hatten so lange behauptet, dass unter einer losen Fliese Geld versteckt sei, bis Fabian an einer Strickleiter hinuntergeklettert war, um nachzusehen. Fabian träumte noch heute davon, wie Inga und Britta hämisch lachend die Leiter wegzogen. Stundenlang hatte er im leeren Pool festgesessen und sich eine grausige Erkältung geholt.
Als nach dem Tod des Vaters alle Aufmerksamkeit auf den Zwillingen lag, hatte Fabian das Gefühl, in der Familie kaum noch wahrgenommen zu werden. Wie sehr wünschte er sich, irgendwann auf einer Familienfeier aufzutreten und auf eine Publikation verweisen zu können, die sein Konterfei zeigte – und nicht das seiner Schwestern.
Fabian trank das Glas Rotwein aus und schenkte nach.
Leise bewegt sich der weiße Berg unter mir auf und ab. Wie ein riesiges Faultier liege ich darauf, meine Arme und Beine baumeln an den Hängen in die Tiefe, ich presse mein Ohr in die weiße Wiese aus Baumwolle, und mit jedem Auf atme ich ein, mit jedem Ab atme ich aus.
Papa atmet heute zu langsam.
Wenn sie schlafen, atmen Erwachsene immer langsamer, man muss ganz lange ausatmen und dann die Luft anhalten, bevor man mit einem schlafenden Papa wieder zusammen einatmen kann. Aber jetzt atmet er eindeutig viel zu langsam, ich komme kaum hinterher, immer wieder muss ich zwischendurch Luft schnappen. Aber wir müssen unbedingt im Rhythmus bleiben. Wenn ich nicht mit Papa atme, dann lasse ich ihn los, dann wird er noch langsamer, dann hebt sich sein Bauch unter meinem Ohr kaum mehr. Papa braucht mich zum Mitatmen, alleine kann er das nicht mehr.
Die Maschine über seinem Bett piept leise ihre dumme Melodie aus einem Ton.
Piep … piep … piep.
Wenn ich mein rechtes Ohr ganz fest in Papas Baumwollhemd presse, höre ich den blöden Ton wenigstens nur auf dem anderen. Ich drücke mein Ohrläppchen ins linke Ohr, und wenn ich es nur richtig tief reindrücke, dann wird der Ton ganz leise – verschwindet fast.
Plötzlich merke ich, dass ich abgelenkt war, ich habe zu früh eingeatmet. Jetzt fiept die Maschine gehässig einen langen, schrillen Ton: Das Zeichen, dass ich verloren habe, weil ich nicht mit Papa im Rhythmus geblieben bin. Das wäre wichtig gewesen, denn jetzt kann er nicht mehr einatmen.
Schnell senkt sich der Berg, Papa atmet tief aus und aus und aus, und ich sinke mit ihm auf der Baumwollwiese, tiefer und tiefer ins Krankenhausbett hinein. Auf das flache Laken, unter dem Papa spurlos verschwindet. Ich bleibe alleine darauf zurück und weine in Papas Bett.
Es klopft laut an die Tür. »Signe!«, ruft eine Frau. »Signe, bist du da drin?« Ich weiß, wer die Frau ist, sie kommt vom Jugendamt, sie will mich mitnehmen, weil Mama nicht da ist, aber ich muss hierbleiben, bis sie kommt …
Ich sitze im Bett in meinem Zimmer, das ich immer noch nicht aufgeräumt habe, wo doch Mama sicher bald zurückkommt. Überall ist Unordnung …
»Mach auf, Signe!«, ruft die Frau, und ich ziehe das Laken vor mich, das Laken, in dem Papa verschwunden ist, als es noch weiß war, als ich eben noch bei ihm im Krankenhaus war. Jetzt ist es fast gelb, weil ich mich nicht zur Waschmaschine in den Keller traue, und mit Seife gehen die Flecken nicht weg.
Ich will im Bett bleiben, mich hinter dem Laken verstecken, bis die Frau wieder weg ist. Wenn ich lange genug aushalte, kommt Mama zurück und macht alles wieder sauber wie früher.
»Signe, mach auf! Versteh doch endlich, du bist allein!«, schreit die Frau hinter der Tür, und mein Herz schlägt wie verrückt.
»Dein Vater ist tot, deine Mutter ist weg, niemand will dich haben, Signe! Du bist ganz allein!«
Signe riss die Augen auf und atmete tief durch. Es war wieder dieser Traum gewesen, in dem Max nicht auftauchte.
Das Gefühl der Einsamkeit hing ihr nach. Die Frau vom Jugendamt im Traum hatte recht gehabt. Signe hatte niemanden – außer Fabian. Zitternd stand sie auf und ging zu ihm ins Wohnzimmer.
»Bist du noch wach?«
Er drehte sich zu ihr um.
»Ich glaube, du hast recht, Fabian. Ich mache es.«
Kapitel 4
So gut gelaunt wie auf der Fahrt nach Jülich hatte Signe Fabian selten gesehen. Pfeifend trommelte er auf dem Lenkrad herum, das Schiebedach und die Seitenfenster waren weit geöffnet, und Signe ließ sich den Gegenwind durch die Haare blasen. Die Sonne stand noch tief am Horizont und tauchte die Welt in herbstliches Gold.
Der Wegweiser, der zum Forschungszentrum führte, wirkte absurd groß. So als wollte er mitteilen, dass in wenigen Kilometern auch die Provinz ende: Signe und Fabian fuhren an Bauernhöfen und kleinen Einfamilienhäusern vorbei.
Kühe staunten über vorbeifahrende Autos, gut genährte Politiker lächelten unbeholfen von Wahlplakaten, und Windräder führten mit ihren rotierenden Armen rituelle Tänze auf. In der Ferne entdeckte Signe einen Braunkohlebagger, der wie ein mechanischer Drache wirkte, als er in stoischer Langsamkeit ein Grubenloch aushob.
»Achtung, ihr Riesen!«, rief Signe. »Der Drache ist bereits am Horizont! Mit wedelnden Armen allein könnt ihr ihn nicht vertreiben.«
Fabian sah Signe kurz an, als wäre sie verrückt geworden. »Was meinst du?«
»Ach, ich habe nur mit den Windrädern gesprochen«, antwortete sie grinsend. Fabian lachte. Signe hatte wirklich eine erstaunlich blühende Fantasie.
»Es ist schon verrückt, wie viele davon hier mittlerweile in den Boden gesteckt wurden«, sagte er dann nachdenklich. »Damals hätte man nicht gedacht, dass die mal nötig sein würden.«
»Wie meinst du das?«
»Das Forschungszentrum ist in den 50er-Jahren gebaut worden. Kernforschungszentrum hieß es damals noch. So wie heute nach Wegen gesucht wird, sauberen Strom zu gewinnen, hat man damals geglaubt, die Atomkraft würde alle Energieprobleme lösen. Na ja, Tschernobyl und Fukushima haben dann gezeigt, dass das nicht ganz so schlau gewesen war.«
»›Walle, walle, manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe.‹«
»Bitte was?«
»Ein Gedicht von Goethe. Kennst du das nicht? Du bist doch der Deutsche von uns beiden«, sagte Signe neckisch. Fabian warf ihr einen gespielt missmutigen Blick zu.
»Es heißt Der Zauberlehrling. Der verhext einen Besen, damit er für ihn Wasser holt. Aber am Ende ertrinkt der Lehrling fast in einer Flut, weil aus dem Besen ganz viele werden, die alle Wasser holen. Der Lehrling verliert die Kontrolle. Daran musste ich gerade denken.«
»Verstehe«, sagte Fabian mit einem Lächeln. Es gab nun wirklich kein Thema, zu dem Signe nicht irgendwelche fantasievollen Bilder parat gehabt hätte.
»Die Atomreaktoren in Jülich sind jedenfalls schon seit fast zehn Jahren nicht mehr aktiv«, fuhr er sachlich fort, während Signe das Handschuhfach öffnete und nach einer Dose Cola kramte. »Heute wird dort in den Bereichen Biochemie, Nanotechnik und Neuro-Wissenschaft geforscht. Und das ziemlich erfolgreich«
»Und da kann man nicht die Kontrolle verlieren?«
»Zumindest entsteht kein radioaktiver Müll. Keine Sorge, die wissen dort genau, was sie tun.«
»Dann sind sie also die Hexenmeister?«
»Bitte?«
»Na, im Gedicht kann nur der alte Hexenmeister den Zauber rückgängig machen. ›Ach, da kommt der Meister! Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los.‹«
»Wehe, du nennst irgendwen dort Hexenmeister.« Fabian lachte.
Signe hob die Arme an, den Finger der rechten Hand bereits an der Lasche der Coladose, und rezitierte mit donnernder Stimme den Spruch des Hexenmeisters aus Goethes Gedicht: »›In die Ecke, Besen, Besen! Seid’s gewesen …‹« Sie zog an der Lasche, und die Cola spritzte zischend auf das Armaturenbrett. Noch bevor Signe ihre Hand zum Fenster hinaushalten konnte, hatte sich das klebrige Getränk auf der Frontscheibe und dem Lenkrad verteilt.
»Scheiße!«, rief Fabian wütend. Er fuhr an den Straßenrand, wo er den Wagen zum Stehen brachte. »Mensch, Signe, was soll das denn?«
»Warte, ich mache es weg!« Eilig kramte sie wieder im Handschuhfach und suchte nach Papiertaschentüchern, doch bis sie welche finden konnte, hatte Fabian längst ein Tuch aus seiner Hosentasche gezogen und wischte das klebrige Zeug von der Frontscheibe.
»So ekelhaft …«
Signe sah ihn erstaunt an. Wie schnell Fabians ehrliche Freude seinem Ärger gewichen war. »Tut mir leid«, sagte sie kleinlaut. Fabian rang sich ein Lächeln ab: »Ist schon gut. Geht schon wieder weg.«
Doch Signe wurde das Gefühl nicht los, dass sie mit der Cola einen glücklichen Moment zerstört hatte.
»Klebriges Zeug«, murmelte Fabian vor sich hin, während er die Flüssigkeit vom Lenkrad wischte.
Über der Empfangstheke des hellen gläsernen Foyers war das dreidimensionale Hologramm eines Gehirns zu sehen, das sich langsam drehte. Das Hirn schwebte direkt über dem Kopf des Portiers, der sehr geistesabwesend in ein Jerry-Cotton-Heft schaute.
Das Hirn scheint seinem Kopf entwichen zu sein, dachte Signe amüsiert.
Der Mann schreckte aus seiner Lektüre auf, als Fabian ihn ansprach. Signe hätte beinahe laut gelacht, als genau in diesem Moment auch das Gehirn vor dem Monitor verschwand und auf einen schlichten Engram-Schriftzug überblendet wurde.
Jetzt hat er seinen Verstand wieder. Erstaunlich, was die hier können.
Der Portier rief eilig in Dr. Drydens Büro an, um sie anzukündigen. Nicht einmal eine Minute später erschien ein junger Mann auf der großen Treppe. Er war Ende zwanzig und wirkte sehr sportlich, hatte aber bereits den Ansatz einer Glatze.
»Frau Mortensen«, rief er. »Wir freuen uns so sehr, dass Sie da sind.«
Noch ehe er Signe erreicht hatte, stellte er sich mit lauter, fröhlicher Stimme und russischem Akzent vor: »Aleks Petrow. Ich bin der Assistent von Doktor Dryden.« Aleks schüttelte erfreut Signes Hand. »Und außerdem Postdoktorand beim Engram-Projekt.«
Aleks vergaß völlig, Fabian zu begrüßen, der sich vor Signe schieben musste, um dem jungen Assistenten seine Hand geben zu können. »Doktor Fabian Hardenberg. Ich habe deine Chefin auf Frau Mortensen aufmerksam gemacht.« Fabian schien Aleks absichtlich zu duzen, um ihm deutlich zu machen, dass er mit dem jüngeren Kollegen mindestens auf einer Stufe stand.
Aleks nickte und schenkte Fabian ein kurzes Lächeln, das auch ein freches Grinsen hätte sein können. Fabian war verunsichert, er überlegte, was Dr. Dryden ihrem Assistenten über ihn gesagt haben könnte.
Schnell hatte Aleks aber wieder ein professionelles Pokerface aufgesetzt. Er bedeutete den beiden, ihm zu den Treppen zu folgen. »Doktor Dryden hätte Sie … oder euch … persönlich in Empfang genommen, doch sie musste schnell zum Evaluations-Gespräch mit dem letzten Probanden.«
An den weißen Wänden des Treppenhauses hingen abstrakte Kunstwerke. Erst beim näheren Hinsehen erkannte Signe, dass die Bilder stilisierte Querschnitte von Gehirnen und Nervensystemen zeigten.
»Sie hat mich gebeten, euch das Gespräch gleich mithören zu lassen.« Aleks Petrow stemmte eine Schwingtür auf, durch die er so schnell hindurchschritt, dass sein offener Kittel wie ein weißer Schleier hinter ihm herwehte.
Eine junge Frau, die durch ein großes Fenster in einen anderen Raum schaute, drehte sich kurz um, um die Neuankömmlinge mit einem Nicken zu begrüßen. Sie protokollierte ein Gespräch im Nebenraum, das gleichzeitig von einem Computer aufgezeichnet wurde: »Ja, es war ein sehr klarer Traum. Ich kann mich ziemlich genau daran erinnern. Besser, als ich mich normalerweise an Träume erinnere.«





























