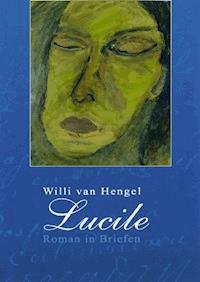
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Mittelpunkt dieses neu erschienenen Briefromans steht eine Philosophiestudentin, deren Briefe an ihre Freundin Lucile von zunehmenden Zweifeln an dem, was wir unter "Realität" verstehen, bestimmt werden. Nachdem ihr Freund zu einer Reise aufgebrochen ist, führt sie das Alleinsein in immer tiefere Fragen: über die Liebe und ihr Leiden verursachendes Wesen, über das Leben und sein prinzipielles Offensein und über die Sehnsucht nicht nur nach Menschen, sondern vor allem auch nach Antworten. Die zunehmenden Zweifel treiben die Protagonistin immer mehr in die Einsamkeit. Der Austausch mit Freuden findet für sie nur noch an der Oberfläche statt, denn alles könnte auch anders sein. "Über alles lässt sich streiten, über alles lässt sich lachen: also über nichts!" Das Erleben von Kontingenz ergreift auch ihr eigenes Ich. Sie fühlt sich von anderen nicht mehr gekannt, denn gekannt zu werden bedeutet, von der eigenen Existenz überzeugt zu sein, und diese Selbstgewissheit hat die Protagonistin verloren. Schließlich erscheint auch die scheinbar Halt gebende Brieffreundin Lucile als imaginär: "obwohl ich gar nicht weiß, ob es dich wirklich gibt, dort in Paris oder irgendwo anders, außer als ein Wort."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Willi van Hengel
Lucile
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Lucile
Lucile,
Lucile,
Liebe Lucile,
Ach, Lucile,
Liebe Lucile,
Liebe Lucile,
Ach, Lucile,
Ach, Lucile,
Liebe Lucile,
Lucile,
Lucile …
Dem Abschied
Ach, Lucile,
Impressum neobooks
Lucile
Impressum:
Willi van Hengel Graacher Straße 8 13088 Berlin
und begann ihnen zuzuhören begann ihnen die dinge von den lippen zu nehmen wie einen eimer wasser beim treppauftreppabwischen von einer stufe auf die nächste wie eine bücherbepackte tasche mit geschmierten broten für die nacht vom fahrrad
und begann ihnen blind ihre welt zuzugestehen lippauflippabgelesen um dabei meinen heimlichen namen zu vergessen wie den verklärten schleier der nebel, der sinne, auf deiner augen- und denkreise im niemandsland, lucile.
Lucile,
… beinahe eingenickt in dem klapprigen Gartenstuhl, eingetaucht in ein Schaumstoffkissen, versteckt mich der Schatten des Kirschbaums vor dem Licht der sengenden Sonne. Im Kopf die Bilder von einer Fischerhütte in Südfrankreich, an einer noch unentdeckten Küste; sie tragen mich in die Hände eines Tagtraums, so, als wäre ich wirklich da.
Ich erwache in diesem kleinen Haus und verspüre den Drang zu schreiben. Dir zu schreiben, als hätte ich neunundzwanzig Jahre darauf gewartet, kommt nun zum ersten Mal der Gedanke, dass meine Geburt einen Sinn gehabt hat. In der Küche nebenan ist André mit dem Obst fürs Abendessen beschäftigt. Er singt dabei und summt zu der Musik, die aus dem Kofferradio in den Raum steigt. Ich setze mich an den Holztisch am Fenster und schreibe deinen Namen auf ein Blatt Papier – das oberste eines kleinen Stapels –, schreibe Lucile und weiß, dass ich damit ein würdiges Versteck meiner Empfindungen gefunden habe, vielleicht das würdigste überhaupt.
Als ich vor einigen Tagen nach dem Abendessen mit André in der Küche saß, eine Ecke französisches Brot, etwas Schafskäse und einige Oliven und Tomaten auf dem Tisch, ein Glas Wein in der Hand, und nachdem er, der mit einer halb abgeschnittenen Tomate spielte – er schaukelte sie mit dem Zeigefinger hin und her –, mich gefragt hat, ob ich ein genialisches Dasein, mit allen nur erdenklichen geistigen und gefühlsmäßigen Abstürzen, begleitet von seltenen, jedoch dann gottähnlichen Aufschwüngen, einem zufriedenen, mit den Problemen des Alltags bekleideten Leben vorziehen würde, bis hin zu der Vorstellung eines hingebungsvollen und leidenschaftlichen Todes, da konnte ich nicht mehr länger umhin, nicht mehr länger verdrängen, dass ich im Grunde meines Herzens gar nicht weiß, was ich will – außer zu schreiben, dir zu schreiben. Das Schicksal und das Glück eines Lebens, sagte André, tun sich nur denjenigen auf, die ein Funkeln in ihren Augen entdecken, Sehende, die die Geschehnisse des Tages und der Nacht wie einen aufrüttelnden Traum empfinden, eine Geschichte also, die ihnen nicht gehören kann.
Ich antwortete ihm nicht, tippte lediglich von der anderen Seite des Tisches die halbe Tomate mit einer Fingerspitze an; ihr Wippen und mein verlegenes Lächeln genügten ihm.
Doch habe kein Mitleid mit mir, dass ich nicht in Südfrankreich in einem verschlafenen Fischerdorf sitze und den Wind genieße, sondern daheim bei meiner Mutter im Garten. Ich sitze hier mit Fieber und einer Sehnsucht – sie heißt André: die Kraft und Lust in jedem Wort, das ich denke und fühle – und an dich richten werde.
Ich wusste nicht so recht, wie ich beginnen sollte, vorhin, an diesem Tisch in Südfrankreich oder, vielmehr, im Garten meiner Mutter, im Schatten des Kirschbaums (sicherlich weißt du noch, dass er süße Früchte trägt, keine sauren; noch aber sind es grüne und harte Kugeln, die die Zukunft in sich bergen und bald Gegenwart geworden sein werden, reife rote und gelbblasse Gegenwart, die geschmeckt werden will und in ihrer Anmut danach verlangt, in sie hineinzubeißen, sie zu genießen, ihr Fruchtfleisch vom Kern abzuknabbern und diesen dann auszuspucken, ohne darauf zu achten, wo er landet). Wie beginnen, habe ich mich gefragt, mit welchen Worten, nach so langer Zeit. Oft habe ich in den letzten beiden Jahren (so lange schon ist es her, dass wir nichts voneinander gehört haben) vor einem leeren Blatt Papier gesessen, um dir zu schreiben … – über Liebe Lucile bin ich jedoch nie hinausgekommen. Stets habe ich den Laut meiner inneren Stimme vermisst, der notwendig ist, um einem Brief – und dann auch noch an dich – den Sinn zu geben, den er verdient. Ein Brief sollte die Öffnung des Herzens sein zu einem Gespräch, einem Gespräch mit dir, bei dem ich mir vorstelle, wie du in deiner Pariser Wohnung sitzt und dein Gesicht in meine Zeilen legst, wie du geduldig Wort für Wort mit einem Lächeln oder einem leichten Kopfschütteln begleitest, ohne ein Ende des Briefes herbeizusehnen.
Vielleicht wunderst du dich, warum ich dir schreibe, jetzt, nach zwei Jahren des Schweigens, zwei Jahre, in denen wir weder den Postboten mit der Zustellung eines Briefes, nicht einmal einer Postkarte (auf der unter deinem Namen Hallo Herr Postbote deine Frau wird gerade von einem anderen gevögelt steht), noch den Schaffner im Zug nach Paris oder nach Bonn geärgert haben. Irgendwie ist es immer noch wie früher, als ich die Gedanken und die Gefühle, die mich berührt haben, nur mit dir besprechen mochte. Nur in deiner Gegenwart empfand ich mich ernst genommen, fühlte ich mich verstanden und vor allem – aufgehoben.
Also, was zögerst du noch, habe ich mir gesagt, schreib ihr. Ich ahne, dass nichts zwischen uns verloren gegangen ist, kein Wort, oder ein Wurm, ein Stück Wurm, das Wort wäre, und das den Rest seines Körpers suchte, langsam daherkriechend und etwas aufgeregt in der Hoffnung, ihn wiederzufinden. Und in diesem Moment, allein, begann ich, meine Haare zu drehen und ihre splissigen Spitzen zwischen zwei Finger zu nehmen und auf meine Wange zu drücken, wie Nadelspitzen auf meiner Haut. Ich fühlte, von weitem und wohl verworren, dass ich etwas suchte, das passt, vielleicht einen Eigennamen; ja, einen Eigennamen als Standpunkt und Sichtweise auf etwas, als Haut um deine Meinung, und du bist mehr als nur das, was du zu sagen hast, mehr als die Laute deiner Gedanken, das meiste kann man eh nicht ausdrücken, zumindest nicht mit Worten – und genau das bist du. So habe ich dich gefunden, dich wiedergefunden, die Sanftheit deiner kleinen Nase, die leidenschaftliche Umarmung deiner Augen, deine Stimme, ganz unverdächtig, in meiner Erinnerung, erklärungslos und schön dein Name, Lucile.
Weißt du noch würde ich jetzt sagen, wenn du hier sitzen würdest, mir gegenüber, hier im Garten meiner Mutter, auf einem dieser alten Sommerklappstühle mit den geblümten Bezügen, die an sämtlichen Ecken aufgesprungen sind. Der vergilbte Schaumstoff wächst wie Unkraut aus den Löchern heraus; aber er wuchert nicht. Weißt du noch – wir würden sicherlich den ganzen Nachmittag in Erinnerungen schwelgen, über unsere Unerfahrenheit von damals lachen, von nichts eine Ahnung, und froh sein, dieses schreckliche Alter von siebzehn bis fünfundzwanzig überlebt zu haben.
Das allein würde genügen, um dir zu schreiben, Lucile. Aber das ist es nicht allein. Denn nicht nur, dass wir gemeinsame Erinnerungen, die gleichen Vokabeln der Vergangenheit in uns aufbewahren, sondern vor allem das Gefühl, dass sich ein anderer für mich und meine Worte interessiert und nicht nur zuhört und mit dem Kopf nickt und ach und echt und boah sagt, veranlasst mich, dir zu schreiben.
Verwunderlich, findest du nicht?
Du glaubst gar nicht, wie meine Freunde mich langweilen (die meisten zumindest), wie sie in ihrer mühsam zurechtgezimmerten Welt (sollte man nicht besser Hundehütte sagen) ihre Tage und Nächte verbringen. Es macht mich traurig, mitansehen zu müssen, wie schnell sie sich zufrieden geben mit den Freuden eines Hundelebens, und schneller noch bemüht sind, ihren Leichtsinn abzutragen, den man in jungen Jahren gar nicht genießen kann, weil man das Gegenteil, die Müdigkeit und den Blutmangel der Begriffe, noch nicht am eigenen Leib erfahren hat. Ich spüre, dass ich ihnen nicht mehr folgen will und auch immer weniger bereit bin, sie verstehen zu wollen. Das Spielerische ihres Daseins schwindet mit jedem Tag. Ich höre in dem, was sie sagen, kaum noch etwas Eigenes. Ich schmecke in ihren Worten nichts Erfrischendes, nichts Fleischliches mehr. Niemand von ihnen versucht zu fliegen; denn für eine gelungene Landung gibt es keine Garantie! Wäre doch wenigstens einer unter ihnen, der Lokomotivführer oder Schauspieler werden wollte; nicht einmal das. Was bleibt, ist der unscheinbare (abwaschbare) Fleck vor dem Nichts. Ich glaube, so haben wir es früher immer genannt: der abwaschbare Fleck Leben vor dem Nichts. Weißt du noch … Und plötzlich beginnt man seinen Schminkkoffer zu vermissen, denn irgendwann beginnt die Stunde, ab da man mit dem Kajalstift einen letzten müden Streifen Sonne aus sich hervorzuheben versucht, an eine Oberfläche, die nichts verbirgt – außer vielleicht sich selbst.
Sei mir nicht böse, ich weiß selbst nicht, warum ich so kompliziert denke, vielleicht ist das meine Art, vor der Realität zu fliehen, du kennst mich doch!?
derselbe Tag, eine Stunde später
Lucile,
spürst du, dass ich dich hierher erzähle, zu mir, wie ich mir einbilde, dass du hier vor mir sitzt, unter dem großen Kirschbaum (ich lege eine seiner Blüten ins Kuvert; vielleicht ist ihr Duft noch nicht ganz verflogen, wenn du den Brief und die Blüte in den Händen hältst), und dich die Sommerfliegen nerven, die auf deinen nackten Beinen herumkrabbeln, und wie du sie, ohne ein Wort darüber zu verlieren, mit dem Fuß und der Hand zu vertreiben suchst. Das erscheint mir wirklicher als das, was ich vermeintlich sehe, vermeintlich höre und rieche. Ich erzähle dich hierher, zu mir, und biete dir eine Tasse Kaffee an. Ich weiß noch, ohne Milch, nur mit Zucker, zwei Teelöffel. Wie eine alte Frau habe ich damals gesagt, weißt du noch, und du hast dich jedes Mal geärgert. Wie eine alte Frau würde ich wieder sagen und spüren, dass du dich – obwohl, oder gerade weil du nur ein müdes Lächeln dafür übrig hättest – immer noch über diesen Satz ärgern würdest. Ich erzähle dich hierher, Lucile, zu mir. Ganz langsam steigst du aus dem Blatt Papier, stehst auf und gehst in die Küche, um etwas zu essen zu holen, einige Scheiben Brot, etwas Käse, vielleicht findest du sogar den Kaviar im Kühlfach und träufelst ihn auf, vielleicht kommst du auch nur mit etwas Gebäck, Keksen und selbstgebackenem Kuchen meiner Mutter zurück, setzt dich hin und hörst mir zu, schüttelst ab und an mit dem Kopf und nickst, wenn es andere Worte, andere Bilder und Gesten sind, von denen ich dir erzähle, und sagst etwas, wenn es dir zu viel wird und du eine Erholung in deiner eigenen Stimme suchst.
Manchmal aber flattert dein Schweigen über mein Satzende hinaus, und deine Stimme reagiert nicht auf meine Zeichen, einen Punkt oder einen Absatz. Du sagst nichts, schaust mich nur an; und dennoch – das ist das Verwunderliche daran – gibst du mir nicht das Gefühl, mich mit deinem Schweigen allein zu lassen. Weder ringst du dir eine gequälte Antwort ab, noch scheinst du abwesend zu sein, abwesend mit deinen Gedanken, die in einem fernen Land auf den Schwingen der Phantasie landen. Du hast immer eine Ruhe und eine Gelassenheit ausgestrahlt, die ich bewunderte – und die ich nun vermisse, ebenso wie dein Lächeln in den Augen, die immer lächeln, auch wenn du sonst ganz anders drauf bist.
Früher habe ich dich dafür gehasst. Weißt du noch? Im Stillen habe ich dich eine Egomanin genannt, eine arrogante Misanthropin, die alles andere, alle anderen, mit einer verletzenden Gleichgültigkeit verachtete, einzigartig in ihrer Kälte; und ich habe gehofft, ja eigentlich nur darauf gewartet, dass du in dem Blut der Wunden, die du anderen zugefügt hast, bald ertrinken wirst. Ich konnte dich dann, manchmal tagelang – einmal sind es sogar mehr als zwei Wochen gewesen – weder sehen noch um mich haben, bis endlich ein liebes Wort oder eine einfühlsame Geste von dir kam und der Zorn verflogen war. Ich glaube, wir haben nie darüber geredet. Doch irgendwann habe ich bemerkt, dass du nicht mich verachtet hast, sondern das Gerede der Leute um dich herum. Von da an habe ich für dich keine Zukunft mehr gesehen – außer als Künstlerin. Die Kunst wird die einzige Chance für sie sein zu überleben, habe ich damals gedacht. Kannst du dir vorstellen, wie schwer du es uns, besonders mir, gemacht hast: Wie sollten wir dich verstehen und das alles nachempfinden können, wenn du es selbst nicht einmal wusstest?
Sobald man sich von seiner Vernunft abzulösen versucht, damit beginnt, alle Wahrheiten in sich anzuzweifeln, oder sich darüber zu wundern, dass es sie überhaupt gibt, wird die normale Einstellung gegenüber den Dingen mürbe. Man kann dann nicht so sein wie andere und nicht so tun, als wäre alles beim alten. Es geht tiefer, rührt, rumort, rüttelt in einem, sitzt wie ein Virus in den Knochen, im Fleisch, in der Seele, irgendwo, man weiß es nicht, weiß nicht wo, kann es nicht lokalisieren. So ist man (du) andauernd getrieben, angetrieben, umgetrieben, hin- und hergetrieben zwischen sich und der Welt, ohne diese Kluft überbrücken zu können. Es ist etwas, über das man nicht sprechen kann, worüber man also schweigen muss, weil es sich – eben ausgesprochen – auslöscht.
Die wahren Künstler sind die Philosophen; glaube mir, die Philosophen, die der Wahrheit eins auswischen und aus den Tiefen aufsteigen wie Phönix aus der vertrockneten und staubigen Asche, um mit einem fallschirmseidenen Lächeln über eine Welt aus Worten hinweg zu segeln, getragen von den Winden des Fremdseins, des einzigen Vertrauens einer enthaupteten Jungfräulichkeit, derer wir uns sicher sein können. Androgyne, Androgyne, höre ich dich aufschreien im fernen Paris – ist es eigentlich auch so heiß dort? –, Androgyne, immer wieder, und weiß, besser als je ein anderer zuvor, um deine melancholische Ausgelassenheit, um deinen tiefen, archaischen Wunsch, nackt, splitternackt, überall und immerzu nackt sein zu wollen. Aber du schämst dich. Warum eigentlich?
Du siehst, ich habe mir Gedanken gemacht über dich und mich, über die Welt und unser Schweigen. Ich hoffe, dass es dir nicht unangenehm ist, von mir in ein Gespräch verwickelt zu werden, das du vielleicht gar nicht führen willst (was ich aber nicht glaube!). Aber es steht dir ja frei, den Brief zur Seite zu legen, oder in den Ofen zu werfen. Hast du diesen zierlichen Ofen noch, mit dem du im Winter deine Zimmer beheizt? Steht er noch an seinem Platz, in der Ecke hinter dem Bett? Damals, als ich dich besucht habe, es war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, im Winter neunundneunzig, mussten wir die Verbindungstür der beiden Zimmer offen lassen, damit die Wärme sich gleichmäßig ausbreiten konnte. Ich habe immer auf dem Boden vor dem Ofen gesessen (ich glaube, mir war dauernd kalt) und mich von Zeit zu Zeit mit dem Rücken an seine Glastür gelehnt, es jedoch nie länger als eine halbe Minute ausgehalten; mir wäre sonst durch den Pullover hindurch die Haut verbrannt. Oft hast du mich gefragt, ob mir nicht warm genug sei und ob ich mich nicht lieber in den Sessel oder aufs Bett setzen wolle, was mich verwirrt hat. Erst später ist mir aufgegangen, dass ich deinem Blick im Wege gesessen habe. Du schautest so gerne ins lodernde Feuer, starrtest hinein, bis auch der letzte klare Gedanke verglüht war. Nie hast du gesagt, was du eigentlich wolltest; immer hast du nur stille Zeichen gegeben, die ich entdecken und entschlüsseln sollte.
Deine unerklärlich schlechte Laune war Zeichen der Unzufriedenheit mit meiner Unachtsamkeit. Was du von mir und von dir verlangtest, war eine Aufmerksamkeit, die man eine Dechiffrierung der Seele nennen könnte; sie sollte die unscheinbarsten leiblichen Wallungen lesen. Im gleichen Atemzug beklagtest du den Makel der Intellektuellen und meintest mich damit, nur weil ich mich für die Welt hinter der Welt interessiert habe, für das, was uns eigentlich interessiert, wofür wir jeden Tag aufstehen, oder was wir beim Aufwachen als erstes denken, die Lider noch verschlossen, oder was wir fühlen, wenn wir beleidigt werden, wie unser Ego schwimmt und taumelt – und meintest mit Makel, dass wir nicht normal reden würden. Uns als was Besonderes betrachten, meine Güte, wir sind doch nicht wie Kühe auf der Weide, die saublöd aus ihrer schwarz-weiß gescheckten Wäsche glotzen und sich wundern, warum man sie für so blöde hält; einmal eine Kuh sein, dann hätte ich erst recht einen Makel an Intellektualität, aber das will ich nicht einmal. Die Worte selbst weinten, wenn du sie ausgesprochen hast; von jedem Buchstaben tropften ihre Tränen, die in Wirklichkeit deine nichtgeweinten Tränen waren, herab. Du trautest dich nicht zu weinen. Von anderen aber hast du es verlangt.
Morgens, wenn du Holz in den Ofen gelegt hast – es glühte noch ein wenig (ich glaube, dass es meine Mutter gewesen ist, die dir diesen Hausfrauendreh verraten hat, vor dem Schlafengehen ein Brikett in Zeitungspapier eingewickelt ins abklingende Feuer zu legen) und es sich von neuem entzündete, begann es oft zu qualmen, weil du ein ums andere Mal vergessen hast, das Ofenrohr zum Kamin zu öffnen, den Hebel auf die andere Seite zu drehen. Kaum dass du wieder ins Bett unter die kuschelig weiche Decke geschlüpft bist (wir wollten erst dann aufstehen, wenn es wärmer im Zimmer geworden ist, denn unseren Atem konnten wir sehen, so kalt war es), stand die ganze Wohnung unter Qualm. Aber nicht du, sondern ich bin aufgesprungen und habe die Fenster geöffnet, damit wir nicht erstickten und uns die eiskalte Pariser Wintermorgenluft das Leben rettete. Dir ist alles egal gewesen. Du wärst liegen geblieben, bis die Feuerwehr angerückt wäre und die Tür aufgebrochen hätte, und du wärst sauer gewesen, dass du die ganze Zeit hättest husten müssen, fast ohnmächtig in deinem Bett liegend. Einmalig deine Trägheit (oder wie soll ich es nennen?). So sieht doch keine Wirklichkeitsflucht aus!
Ich bin nun ziemlich erschöpft, Lucile, morgen schreibe ich dir mehr.
einen Tag später
Gestern Abend fühlte ich mich leer, im Begriffe, mich aufzulösen, oder war ich schon aufgelöst? Ich fühlte mich, als sähe ich zu, dass mich irgendeiner ausradiert, und es blieben von mir nur Radiergummikrümel übrig. Das soll gar nicht traurig klingen, obwohl ich es ein wenig bin. Die Sehnsucht nagt an mir. Ich denke nur noch an den Tag, an dem ich André wiedersehen werde. Die Gedanken sind in die Enge getrieben, von Ohnmacht umzingelt; vielleicht wissen sie keinen anderen Ausweg, als sich auslöschen zu wollen. Man hätte fast Mitleid mit ihnen haben können, wären es nicht meine eigenen gewesen. Ich hielt es in meinem Zimmer nicht mehr aus; weder der Fernseher noch irgendein Buch noch ich selbst wussten mit mir was anzufangen. Die lange Zeit – zehn Tage, bis ich André wiedersehen werde – schoss mir wie ein Wasserfall, der plötzlich eine Staumauer durchbricht, ins Gesicht. Ich war wie vom Blitz getroffen, spürte das Zerbrechen und Zerreißen der Schleimwände im Magen, der Herzklappen in der Brust, als André mir sagte, dass wir uns fast zwei Wochen nicht sehen würden, er müsse zehn oder elf Tage nach Dubrovnik verreisen, der schönsten Stadt der Welt. Schon dreimal sei er dort gewesen, jedes Jahr im April finde dort ein Physikerkongress statt, nur in diesem Jahr sei der Termin verschoben worden, wegen der Auswirkungen des Krieges zwischen den Serben und Kroaten. Sein Professor habe ihn auch in diesem Jahr gebeten, sein Referent zu sein und für die von ihm herausgegebene Spezielle Zeitschrift für Physik Verlauf und Ergebnis der Tagung festzuhalten (bei dem Wort Ergebnis habe sein Professor verschmitzt zu lächeln begonnen). Außerdem hatte André gesagt, wobei er wohl ebenso verschmitzt wie sein physikalischer Meister gelächelt hatte, haben wir uns im April kennengelernt, genau in der Woche, in der normalerweise der Kongress stattgefunden hätte. Es war für mich nicht ganz einfach, seine Worte hinunterzuschlucken, gerade zu einer Zeit, als wir uns sehr aneinander gewöhnt hatten und ich ihn jeden Tag um mich haben wollte.
Auf der Flucht vor mir selbst bin ich in eine Kneipe gegangen, in eines dieser überfüllten und mit Rauch und grässlich lauter Musik aufgepumpten Löcher, die letzten Endes alle gleich auf mich wirken: wie schlecht beleuchtete kalte Klos. Aber gerade wenn du dich leer fühlst, wenn du genervt bist, jedes Wort zu viel ist und wie ein elektrischer Stromschlag in dich fährt, kurz: wenn du deine Haut abstreifen willst wie eine Schlange, um ein neues Leben zu beginnen, ganz einfach von einem Augenblick zum nächsten: ein neues Leben beginnen





























