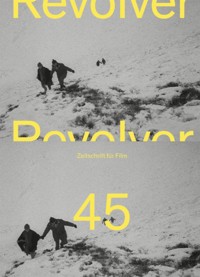18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag C.H. Beck oHG - LSW Publikumsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Benjamin Heisenbergs Roman „Lukusch“ ist eine wilde und witzige Fahrt durch die unfassbare Geschichte des jungen Schachtalents Anton Lukusch und seines grobschlächtigen Sidekicks Igor. Klug und lässig zugleich spielt dieser Roman mit den Möglichkeiten des Erzählens und sprengt dabei seine eigenen Grenzen. Anton Lukusch war ein ganz normaler Junge aus Prypjat – bis zur Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986. Gemeinsam mit anderen Kindern wird er von der Hilfsorganisation Shelta nach Westdeutschland gebracht, um der hohen Strahlenbelastung zu entkommen. Dort beginnt für ihn ein ganz neues Leben: Durch Zufall wird Lukuschs analytisches Talent beim Schachspielen entdeckt. Ein Überflieger, ein Wunderkind – die Bundesrepublik jubelt! Vor den Augen der Öffentlichkeit gewinnt er eine Partie gegen Bundeskanzler Helmut Kohl, knackt ein scheinbar unlösbares Rätsel bei "Wetten, dass…" und wird sogar von internationalen Konzernen als Berater verpflichtet. Ihn selbst scheint seine spektakuläre Erfolgsgeschichte kaum zu interessieren. Wie ferngesteuert löst Anton alle ihm gestellten Aufgaben, lächelt brav in die Kameras und lässt sich von seinem Umfeld herumreichen wie ein teures Spielzeug, mit dem man im Scheinwerferlicht glänzen kann. Ist dieser Junge wirklich „nur“ ein herausragendes Talent, und was hat es mit seinem ständigen Schatten Igor auf sich? Antons spurloses Verschwinden ist nur der Anfang höchst kurioser Entwicklungen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Benjamin Heisenberg
LUKUSCH
ROMAN C.H.BECK
Süddeutsche Zeitung vom 22.5.2020, «Vermisst in Tschernobyl», von Claus Bosung
ZUM BUCH
Benjamin Heisenbergs Roman «Lukusch» ist eine wilde und witzige Fahrt durch die unfassbare Geschichte des jungen Schachtalents Anton Lukusch und seines grobschlächtigen Sidekicks Igor. Klug und lässig zugleich spielt dieser Roman mit den Möglichkeiten des Erzählens und sprengt dabei seine eigenen Grenzen.
Anton Lukusch war ein ganz normaler Junge aus Prypjat – bis zur Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986. Gemeinsam mit anderen Kindern wird er von der Hilfsorganisation Shelta nach Westdeutschland gebracht, um der hohen Strahlenbelastung zu entkommen. Dort beginnt für ihn ein ganz neues Leben: Durch Zufall wird Lukuschs analytisches Talent beim Schachspielen entdeckt. Ein Überflieger, ein Wunderkind – die Bundesrepublik jubelt! Vor den Augen der Öffentlichkeit gewinnt er eine Partie gegen Bundeskanzler Helmut Kohl, knackt ein scheinbar unlösbares Rätsel bei Wetten, dass … und wird sogar von internationalen Konzernen als Berater verpflichtet. Ihn selbst scheint seine spektakuläre Erfolgsgeschichte kaum zu interessieren. Wie ferngesteuert löst Anton alle ihm gestellten Aufgaben, lächelt brav in die Kameras und lässt sich von seinem Umfeld herumreichen wie ein teures Spielzeug, mit dem man im Scheinwerferlicht glänzen kann. Ist dieser Junge wirklich «nur» ein herausragendes Talent, und was hat es mit seinem ständigen Schatten Igor auf sich? Antons spurloses Verschwinden ist nur der Anfang höchst kurioser Entwicklungen …
ÜBER DEN AUTOR
Benjamin Heisenberg, geboren 1974 in Tübingen, arbeitet als Regisseur, Autor und bildender Künstler. Seine Arbeiten erhielten namhafte Auszeichnungen.
INHALT
VORWORT DES HERAUSGEBERS
HAUPTTEIL
EPILOG
PERSONENVERZEICHNIS
NACHWEISE
DANKSAGUNGEN
VORWORT DES HERAUSGEBERS
Im Sommer 2021 traten Prof. Dr. Burkhard Ritter und seine Frau Agnes mit der Frage an mich heran, ob ich ihnen bei der Veröffentlichung von Dokumenten ihres Sohnes Simon Ritter behilflich sein könnte. Simon wurde zu diesem Zeitpunkt schon über ein Jahr vermisst, aber seine Eltern waren entschlossen, keine Möglichkeit auszulassen, um die öffentliche Aufmerksamkeit für die Suche nach dem Sohn aufrechtzuerhalten. Für mich verstand es sich von selbst, sie mit all meinen Möglichkeiten zu unterstützen.
Mit Simon Ritter verbindet mich eine Freundschaft aus Kindertagen. Er ist nur einen Steinwurf von mir entfernt, in Ückershausen bei Würzburg, aufgewachsen. Im Fußballklub, auf dem Schulweg, im Konfirmandenunterricht und bei langen Abenden im Würzburger Nachtleben verbrachten wir gerne Zeit zusammen. Obwohl es uns beide ins Filmgeschäft zog, verloren wir uns nach dem Abitur aus den Augen. Zum letzten Mal begegnete ich ihm 2013 beim zwanzigjährigen Abiturtreffen in einer Würzburger Jazz-Bar. Schon damals kamen wir auf das junge Schachtalent Anton Lukusch und seinen Begleiter Igor Shevchuk, später Nazarenko, zu sprechen, die als Tschernobyl-Flüchtlingskinder in den späten Achtzigern bei den Ritters gelebt hatten.
Das Auftauchen Igor Shevchuks alias Nazarenko 2019 in Deutschland war der Auslöser für die Nachforschungen, die Simon zuletzt nach Kiew und weiter nach Prypjat bei Tschernobyl führten. Dort verschwand er am 6. Februar 2020, im Gebiet des durch die Reaktorkatastrophe 1986 berühmt gewordenen Atommeilers. Am selben Tag hatte er Verwandte Lukuschs in der Gegend besucht. Um sich zu schützen, reiste er unter falscher Identität. Er wurde zuletzt gesehen, als er den Bus zurück nach Kiew bestieg. Nachforschungen in der Ukraine, Belarus und Deutschland wurden durch die hereinbrechende Corona-Krise und zuletzt durch den Krieg in der Ukraine erschwert. Bis heute blieben alle Ermittlungen ergebnislos.
In seinem Hotelzimmer in Kiew wurde in seinem Gepäck eine lose Sammlung verschiedener Bilddokumente, Texte und Bücher gefunden. Sie belegen, dass er für ein Film- oder Romanprojekt über die Geschichte Anton Lukuschs und seines Begleiters Igor Shevchuk recherchierte. Offensichtlich war er in diesem Zusammenhang auf ein kriminelles Geflecht international operierender Firmen gestoßen. Wie seine Eltern berichteten, wurde der größte Teil der Recherchen und Notizen kurz vor seinem Verschwinden von Unbekannten aus seinem Haus in Ückershausen abtransportiert und vermutlich vernichtet.
Unklar bleibt, ob das im Folgenden veröffentlichte Konvolut an Materialien von Ritter allein oder in Zusammenarbeit mit anderen gesammelt und verfasst wurde. Mehrheitlich werden die Dokumente in der Reihenfolge veröffentlicht, wie sie aufgefunden wurden. Textteile die durch Transport oder Lektüre sichtlich durcheinander geraten waren, habe ich nach bestem Wissen und Gewissen chronologisch und in Sinnzusammenhängen geordnet.
Simons Verschwinden und das damit verbundene Leid seiner Eltern berühren mich tief. Es ist mir ein Anliegen, als Herausgeber seiner Schriften einen kleinen Beitrag zur möglichen Klärung seines Verbleibs zu leisten.
Luzern, im März 2022
Benjamin Heisenberg
Helmut Kohl vs. Anton Lukusch, Kanzleramt, Bonn, 1987
HAUPTTEIL
«DAS WAREN DIE 80ER JAHRE», LTV
Dezember, 1990
LUKUSCH
von Guntram Heinrich
1987, zwei Jahre vor der Öffnung der DDR, bewegtedie Geschichte eines Jungen aus der damaligen Sowjetunion die Gemüter der Deutschen. Der kleine Anton Lukusch war als Teil einer großen Gruppe von Tschernobyl-Flüchtlingen mit der NGO Shelta nach Deutschland gekommen: Kinder, zu Hunderten von ihren Eltern in den Westen geschickt, um der hohen Strahlenbelastung zu entkommen. Lukusch, der, wie die meisten von ihnen, aus einfachen, ländlichen Verhältnissen kam, fiel in der Gruppe am Anfang kaum auf. Wenn man von ihm sprach, dann vor allem wegen seiner besonderen Verbindung mit einem starken Jungen namens Igor. Die beiden hatten das Reaktorunglück zusammen aus nächster Nähe erlebt und waren gemeinsam im Krankenhaus behandelt worden. Seitdem wich keiner der beiden von der Seite des anderen.
Auf Anton Lukusch wurde man erst aufmerksam, als er durch Zufall das Schachspiel für sich entdeckte. In nur wenigen Tagen gelang es ihm ohne Schwierigkeiten, alle seine Mitschüler sowie anschließend sämtliche Betreuer im Schach zu schlagen. Auch alle folgenden Gegner aus dem Umfeld der Gastfamilien blieben gegen ihn chancenlos.
Im Rückblick hätte man denken mögen, Lukusch sei nur deshalb in den Westen gekommen, um für kurze Zeit ein verblüffendes Gastspiel seines Genies zu geben und anschließend ebenso unvermittelt, wie er aufgetaucht war, wieder zu verschwinden.
Nach einer dreiwöchigen Zwischenphase, in der er von Schachklubs als Kuriosität herumgereicht wurde, verhalf ein weiterer glücklicher Umstand zum endgültigen Durchbruch des kleinen Großmeisters in spe. Die Strahlen-Flüchtlinge erhielten eine Einladung ins Bundeskanzleramt nach Bonn. Sie sollten vor versammelter Presse empfangen werden, um so für die Tschernobyl-Kampagne zu werben. Natürlich stellte man dem Bundeskanzler auch die junge Neuentdeckung vor. Im ersten Spiel verlor der Regierungschef haushoch, in der zweiten Partie gewährte ihm Lukusch durch ein scheinbar versehentliches Opfer ein Höflichkeitsremis. Das Ereignis wurde zum Publikumsrenner im Sommerloch 1987 und sicherte dem Tschernobyl-Programm auf Jahre sein Bestehen.
Anton Lukusch gewann mit dem Bundeskanzler einen aufrichtigen Fan und einflussreichen Förderer. Bald erhielt er Unterricht in den renommiertesten Schachschulen, spielte gegen die deutsche Elite und internationale Stars, doch nur selten fiel sein eigener König.
1988 erklärte sich Bernd Schulthess, ein Unternehmer aus dem Siegerland, bereit, die weitere Ausbildung des Jungen zu ermöglichen. Von nun an lebte Lukusch auf einer abgeschiedenen Burg, in arbeitsamer Einsamkeit, begleitet lediglich von Igor, seinem ungleichen Schatten. Nicht nur ein Betreuer, auch eine Köchin, ein Fahrer und zeitweise zwei Sicherheitsleute gehörten in dieser Zeit zur Entourage der beiden Strahlenflüchtlinge.
Die Ereignisse des Jahres 1989 überschlugen sich und Lukusch geriet in Vergessenheit. Als er im Frühjahr 1990 mit einer Partie gegen den Supercomputer NEC SX-3/44R zurück ins Interesse der Öffentlichkeit kam, lag er auf Platz 45 der Weltrangliste und hatte bereits gegen die gesamte Schachweltspitze gespielt. Wie bekannt wurde, hatte man ihn in der Zwischenzeit wegen seiner außerordentlichen analytischen Fähigkeiten als Unternehmensberater beschäftigt. Obwohl in Deutschland nur wenig beachtet, verhalf ihm erst das Spiel gegen den gefürchteten Rechner zu internationaler Beachtung. Erst jetzt berichtete das russische Fernsehen und man feierte ihn als Karpow jr.
Wenige Wochen nach dieser Ehrung, drei Jahre nachdem Anton nach Deutschland gekommen war, erhielt die Redaktion eines Nachrichtensenders in Kiew ein Schreiben, in dem seine Großmutter Valja Lukusch um die genaue Adresse ihres im Westen zur Berühmtheit avancierten Enkels Anton Lukusch nachsuchte. Ein Kamerateam fuhr in das kleine ukrainische Dorf, wo sich die Lukuschs niedergelassen hatten, und überredete Antons Großmutter zu einem Besuch im Westen. Das Team begleitete sie, denn man wollte ihr Wiedersehen mit dem prominenten Enkel genau für die Öffentlichkeit festhalten.
Was jedoch geschah, widersprach gründlich allen Erwartungen. Beim Rundgang durch das Schloss, in dem Lukusch wohnte, konnte man sehen, wie sich Valja Lukuschs Miene mehr und mehr verdunkelte, und als er zu Ende war, nahm sie Anton an der Hand. Sie machte deutlich, dass die Verhältnisse und Sitten, an die ihr Enkel hier herangeführt wurde, in keinster Weise mit ihren Vorstellungen von einer guten Erziehung übereinstimmten, sie würde deshalb Anton und auch Igor mit zurück in die Ukraine nehmen. Alles Bitten und Beschwören half nicht, sie reiste mit beiden Jungen aus.
Lukusch spielte nur noch wenige Partien. Er verschwand so schnell aus dem öffentlichen Interesse, wie er gekommen war, ohne wirkliche Spuren zu hinterlassen und ohne selbst davon berührt zu werden. In einem Gespräch mit ukrainischen Medien beschrieb er sein Schicksal mit Gelassenheit als einen von höherer Hand gelenkten Weg, auf den er keinen Einfluss habe, dem er jedoch immer neu und mit Spannung entgegensehe.
«Sie sind zu früh, Ritter!» Jochen Wehner, der Mann, der ’87 Anton Lukuschs Schachtalent entdeckt hat, grinst mich an. Ich murmle eine Entschuldigung, aber die scheint ihn nicht zu interessieren. Das Blitzen in seinen Augen verrät, dass er die Provokation liebt. Er zieht das enge T-Shirt zurecht, während ich mich an ihm vorbei durch die Tür drücke. Meine Schulter streift unbeabsichtigt seine austrainierte Brust. Ich kann ihn riechen und darüber das Deo. Er registriert das alles mit Freude. Wahrscheinlich hat er noch vor einer Minute diesen straffen neunundsechzigjährigen Körper gestählt und ist einfach stolz darauf. Seit ich ihn auf Facebook gefunden habe und wir dort befreundet sind, hat er regelmäßig Bilder seines Torsos unter einem gespannten T-Shirt gepostet. Ich weiß also, wie das aussieht. Oft fotografiert er sich nur vom Hals abwärts, dann wirkt er zwanzig Jahre jünger. Wer das Profilbild mit den Postings vergleicht, muss ins Zweifeln kommen, ob der Kopf des unsicher lächelnden älteren Herrn mit schütterem grauem Haar tatsächlich von diesem Muskelpaket getragen wird.
Jochen Wehners Leben ist von drei Leidenschaften und einer Liebe geprägt. Das gesteht er mir bei der kleinen Führung durchs Haus, die er mir unbedingt geben will. Das Haus ist nicht groß, die Führung kurz, aber der Mann hat viel zu erzählen. Eigentlich seien es zwei Lieben, aber sein Hund Ares sei vor sechs Jahren gestorben. Wehner sammelt passioniert Kunst und Fotos von seinen Leidenschaften und seiner Liebe. So habe ich die Antwort, lange bevor er endlich selbst damit herausrückt. Nur die Einordnung, welches der Themen Leidenschaft und welches Liebe ist, liefert er mir zuletzt nach.
Leidenschaften:
Henriette (seine Frau)
Schach
Training
Liebe:
Maria (seine Tochter)
Seine Frau Henriette ist ganz klar Leidenschaft. Sie hat ihn schon in der Schule erwählt. Da war er noch ein begabter Nachwuchsfußballer, dribbelstark und auch nicht auf den Kopf gefallen. Sie: immer kess und anspruchsvoll. Die Königin des Abi-Jahrgangs. Er hat sie erobert und nie wieder hergegeben. Aber das hat gekostet. Vor allem, weil Wehners berufliche Laufbahn alles andere als geradlinig war. Das Studium der Sportwissenschaften brach er ab, wegen eines Bandscheibenvorfalls beim Hanteltraining. Es folgten sechs Monate schmerzhafter Zwangspause. Henriette weigerte sich zu arbeiten. Sie war schon schwanger mit Maria. Danach hieß es erst mal Geld verdienen für alles, was eine junge Familie mit anspruchsvoller Mutter so braucht. Also heuerte Wehner bei seinem Schulfreund Häusermann-Reisen an. Jahrelang fuhr er Bus (den Zweier-Führerschein hatte er vom Wehrdienst mitgebracht). Henriette sprach nie über seinen Beruf, nicht mit ihm, nicht mit ihrer kleinen Tochter und auch sonst mit niemandem. Sie hatte einen angehenden Sportstar geheiratet, oder wenigstens einen angehenden Spitzensportwissenschaftler – keinen Busfahrer.
Wehner studierte weiter, im Fernstudium, abends, wenn Henriette fernsah und Maria schlief. Er musste aufpassen, tagsüber nicht am Steuer einzuschlafen, aber die Kinder und Senioren, die er herumkutschierte, machten ihm Freude. Wenn seine Reisegruppen durch Schlösser, Freizeitparks und Outletcenter pflügten, nutzte er die Pausen, um zu trainieren oder auf seinem kleinen batteriebetriebenen «Mephisto 2000» die berühmten Schachpartien Karpows und Kasparows nachzuspielen. Warum man den Schachcomputer «Mephisto» getauft hatte, wollte ihm erst nicht in den Kopf, aber irgendwann, bei einer verkorksten Partie, begriff er, dass dieses Gerät ihn, den Dr. Faustus, in eine Hölle aus vertrackten Varianten führte. Er musste sie aufsuchen, um die Grenze seines geistigen Fassungsvermögens zu spüren und sich mit den Schachgöttern zu messen, für die Mephisto ein elektronischer Wicht in den Niederungen des Schachzirkus war.
«Bisschen monothematisch, was?»
Er hat wohl meinen Blick auf das x-te Ölbild eines Schachbretts bemerkt. Ansonsten hängen hier nur Bilder von Henriette und Maria in allen Lebenslagen.
Er öffnet einen kleinen hölzernen Hängeschrank in der Kehre des Treppenaufgangs ins Obergeschoss. Die Überraschung ist gelungen. Ich kann es kaum glauben und verschlucke meinen Kommentar zu den Bildern an dem seltsamen Laut, der mir entweicht. Anton Lukusch sieht mich aus dem kleinen Schränkchen heraus an, oder jedenfalls seine Augen. Ich kenne das Foto, das der Maler als Vorlage gehabt hat. Der Blick ist ihm gelungen, die Physiognomie nicht wirklich. Anton schaut mich mit diesem Ausdruck eines stoischen Esels an, unlesbar, aber tief und ruhig und geduldig. Hier ruht eine Natur in der Natur. Keine Distanz nach innen und außen, keine Ironie, kein Drama – einfach Kurt, ohne Helm und ohne Gurt, einfach Kurt, schießt es mir dabei durch den Kopf.
«Nicht mal Henni weiß, dass ich ihn hier habe», grinst Wehner, «denkt, das ist mein Werkzeugschrank.» Er lacht laut. «Hammer, oder? Hat auch der Willi gemalt.» Willi ist ein Freund, zuerst auch in der Familien-Busfahrer-Falle gelandet, aber jetzt erfolgreichster Porträtmaler im Ochsenfurter Gau.
«Das war Oktober ’87, Kleinrinderfelder Schachmeisterschaft», sage ich. «Achtzehn Siege, kein Remis.»
«Ich heiße Jochen», sagt Wehner und drückt mir so fest die Hand, dass ich mich gar nicht freuen kann über seine Zuneigung.
Mein «Simon» kommt gequetscht.
«Mensch! Ich hab mich so gefreut, als ich deine Nachricht auf Facebook gesehen hab. Seit der Junge ’90 von der Omma abgeholt wurde, hab ich doch nix mehr vom Anton gehört.» Er spricht das Oma mit zwei M, wie man das in Franken macht. «Der Einzige, wo mit mir über den Bub noch redet, ist der Jörg vom Schachklub, aber der kommt nimmer, wegen Prostata.»
Wehner ist eine Goldgrube. Ich habe das geahnt. Er hat nicht nur alle TV-Sendungen mit Lukusch mitgeschnitten, sondern auch alle Artikel säuberlich abgeheftet. Während er mir seine digitalisierten Super-8-Aufnahmen von Lukusch zeigt, redet er ununterbrochen auf mich ein.
«Henni will nix mehr von dem Bub hören! Sie hat mich damals fast verlassen, wegen dem Lottoschein.»
Die Geschichte kenne ich noch nicht.
«Keiner weiß das», lächelt er, «deshalb hab ich dich ja heute da herbestellt, weil Henni in der Physio ist. Sie hasst diese Geschichte. Wenn ich es nicht in meinen Werkzeugschränken versteckt hätte, wär das alles schon vernichtet. Sie meint es nicht böse, aber sie sagt, man muss im Leben nach vorne schauen, vor allem, wenn man sich immer so saumäßig ärgert, wenn man wieder drüber nachdenkt. Des is hald ihre bosidive Mendalidäd.»
Wenn das keine Leidenschaft ist …
Wir beginnen ganz von vorne. Ich habe die Geschichte schon einmal im Schach Echo von 1988 gelesen, aber sie jetzt von Wehner selbst zu hören, wird mir hoffentlich helfen, den Weg des kleinen, vergessenen Genies Anton Lukusch besser zu verstehen.
«Mir haben diese Kinder leidgetan», seufzt Wehner. «Als die schon das erste Mal bei mir in den Bus eingestiegen sind, hab ich gesehen, dass die nicht aus dem Westen sind. Das hat man nicht nur an den Kleidern gesehen, sondern an den blassen Gesichtern, und wie die alles angeschaut haben. Wir sind erst mal zum Tierpark nach Sommerhausen und danach haben wir im Hotel Sonne am Biebelrieder Dreieck zu Mittag gegessen. Der Hotelier hatte draußen für die Kinder ein kleines Büfett aufgebaut mit Brotzeit und ein paar Leckereien, das haben die komplett leer gegessen. Zwei Mädchen haben sich danach bei mir im Bus übergeben, weil die zu viel reingeleiert haben. Da hab ich mich nicht gefreut, aber übel nehmen konnte ich’s ihnen auch nicht. Danach hab ich sie zur Homburg bei Gössenheim rausgefahren, das ist so eine Ruine im Wald, von Würzburg aus Richtung Veitshöchheim, Zellingen, Karlstadt. Da haben die Kinder im Wald herumgetobt und Versteck gespielt. Ich war derweil im Bus und habe Musik gehört und auf meinem Mephisto Schach gespielt. Den konnte ich am 12-Volt-Zigarettenanzünder laden. Na ja, dann ist der Anton vom Herrn Schombert in den Bus gebracht worden, weil er mit einem Jungen im Laub gerauft hat und dabei in eine Pfütze gefallen war. Der war komplett dreckig. Der Schombert hat ihn also bei mir gelassen, damit er sich umzieht und ein wenig aufwärmt. Ich hab mich nicht so für ihn interessiert, weil ich mitten in einer haarigen Partie steckte. Der Anton wollte erst mal hinten auf so einem kleinen Nintendo zocken – aber da war die Batterie alle. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn die Batterie von dem Ding nicht alle gewesen wäre, hätte das alles gombled anderschd ausgehen können!»
Wehner macht eine rhetorische Pause und schaut mich bedeutungsvoll an. «Gombled anderschd.» Ich halte seinen Blick.
«Für mich hätte das viel verändert und für einige andere auch. Für Anton, glaube ich, gar nichts.» Jochen Wehners Weg mit Lukusch erinnert mich an einen klassischen Zen-Aphorismus:
Als ich begann, Zen zu lernen, waren Berge Berge. Als ich glaubte, Zen zu begreifen, schienen die Berge keine Berge mehr zu sein, doch als ich Zen verstand, waren Berge wieder einfach Berge.
Lukusch hat diesen Weg nie gemacht und wohl nie gebraucht. Aber den Menschen, die den Aufstieg seines Sterns begleiteten und später sein schnelles Verschwinden, muss es wie ein seltsamer Traum erschienen sein, in dem Berge plötzlich keine mehr waren und für eine Weile alles möglich schien.
«Ich hatte den Mephisto auf der Fahrerkonsole aufgestellt. Ich weiß noch genau, im Radio lief ständig dieser Achtzigerjahre-Techno-Hit BIG FUN von Inner City. Den Takt hab ich genommen, um nicht zu lange zu grübeln. Der Anton ist nach vorne gekommen und hat sich neben mich gestellt. Einfach so – nix gesagt. Ich hab nur kurz aufgeschaut, ihm zugenickt und mich nicht weiter um ihn gekümmert. Der Bub hat das Spiel verfolgt, und das hat angefangen, mich zu stressen, weil ich gnadenlos gegen Karpow abschmierte. Ich meine – klar hab ich immer gegen Karpow verloren, aber nicht, wenn jemand zugeschaut hat. Der wusste ja nicht, wer Karpow war, der hat nur gesehen, dass ich verliere. Irgendwann habe ich mich entnervt zurückgelehnt und das Spiel aufgegeben.»
Wehner zögert lächelnd. «Der Bub hat sicher gar nicht gemerkt, dass ich genervt war. Der hatte inzwischen die Züge verstanden und schon weitergedacht, aber das hab ich erst begriffen, als wir anfingen zu spielen.»
Er schaltet den Fernseher aus und starrt vor sich hin. Unbewusst lässt er den Bizeps des rechten Arms kontrahieren und gleich darauf den linken. Das scheint seine Angewohnheit beim Denken zu sein: links, rechts, links, rechts, links, links … Ich kann mich plötzlich nicht mehr konzentrieren und verpasse ein paar Sätze.
«Nee, der hat nicht viel gesagt, aber er war unheimlich höflich. Obwohl der ja erst mal ein bisschen einfach rüberkam, so von außen gesehen.» Jochen Wehner lacht wieder laut auf. «‹Wenn er will sich Zeit nehmen›, hat der Anton geantwortet. Er! Also hab ich ihm das ganze Spiel erklärt und schnell gemerkt, dass er das längst selbst gecheckt hatte. Nur so was wie Rochade kannte er natürlich nicht. Aber da hat er mich schon langsam zu interessieren begonnen, weil er so schlau war.»
Sie spielten: Anton entspannt seitlich neben dem Brett sitzend, der Mann frontal auf das Brett konzentriert. Draußen tobten die Kinder durch den Wald, brieten Bratwürste und sangen ukrainische und deutsche Lieder. Im Bus versanken Wehner und der kleine Junge in eine Welt aus schwarzen und weißen Feldern. Antons Leben, das bisher unbewusst, organisch, schicksalsbestimmt gewesen war, sollte bald in allzu strukturierte Formen gegossen werden. Seine Fähigkeiten wurden erkannt. Er wurde eingeordnet und herausgefordert, eingeteilt und eingesetzt. Er hatte das Schachbrett betreten, und schnell wurde sichtbar, dass er es nicht als Bauer verlassen würde.
Ein Schlüssel geht im Türschloss, und Wehner wird plötzlich hektisch. Er rafft alle Lukusch-Devotionalien zusammen in den Alukoffer und stellt sich gerade noch rechtzeitig neben die Couch, auf der ich sitze. Die Frau in der Tür ist anders, als ich erwartet habe. Sie hat sich eine Strähne im Haar dunkel gefärbt und lächelt uns ganz freundlich an. Die Schönheit der Abi-Queen von damals hat Henriette immer noch, aber nicht mehr so sehr äußerlich, sie leuchtet aus ihr heraus.
«Herr Ritter ist wegen dem Sofa im Keller da», lügt Wehner. «Er kann es leider doch nicht gebrauchen.» Sie nickt und er schiebt mich an ihr vorbei nach draußen. Hat sie mich erkannt? Sie muss den Namen verstanden haben, aber in ihrem Blick erkenne ich nicht, was sie denkt.
Am Auto erzählt er die Geschichte leise zu Ende. Anton und Wehner saßen den ganzen Nachmittag in voller Konzentration zusammen. An einen seiner Züge erinnerte er sich besonders, denn Anton bewegte sich erst gar nicht, sah dann ganz grimmig auf und schüttelte spielerisch drohend mit der Faust. Er fluchte auf Ukrainisch und bat den Busfahrer um eine Tasse Tee. Wehner drehte sich weg, um einzuschenken. Als er wieder auf das Schachbrett sah, hatte Anton zwei Figuren vertauscht. Wehner begriff sofort und zog Anton lachend die Kappe vom Kopf. Der Junge musste das Spiel wieder herstellen, dann ging es weiter. Draußen kam Wind auf. Sturmböen wirbelten Blätter um den Bus. Anton machte seinen nächsten Zug. Die ersten Tropfen trommelten gegen die großen Fenster. Der Busfahrer schaute kurz auf und vertiefte sich dann wieder ins Spiel. Ein regelrechter Orkan brach draußen los.
Kurz darauf wurde an die Tür des Busses getrommelt. Der Sturm peitschte den Kindern durch Kleider und Haare. Einer hielt sich am anderen fest, bis sie im sicheren Bus waren. Durchnässt fielen sie übereinander und verteilten den Matsch und die Blätter im Gang und auf den Sitzen. Man fragte nach Anton, aber Wehners Bemerkung, der Junge hätte von ihm Schach gelernt und nach der ersten verlorenen Partie in fünf weiteren gewonnen, ging im Lärm der Kinder unter. Auf der Heimfahrt wanderte Wehners Blick immer wieder in den Rückspiegel zu Anton, der mit dem kleinen Schachcomputer ganz konzentriert auf seinem Platz saß. Um ihn herum wildes Treiben, Lukusch unberührt, nur in der Welt des Spiels. Wehner, der erst im Erwachsenenalter das Schach für sich entdeckt hatte, empfand eine fast telepathische Seelenverwandtschaft mit dem Bub: «Ich bin mit den singenden und kreischenden Kindern losgefahren, aber um mich herum ist es ganz leise geworden und ich hab im Kopf nur noch die Geräusche der Figuren auf dem kleinen Brett ganz hinten im Bus gehört. Das war so eine schöne Fahrt …»
Wehner weiß noch alles, als wäre es gestern gewesen. Ob er damals auch bemerkt hat, wie sehr ich in seine Tochter verknallt war? Ich selbst kann mich an diesen Ausflug nur vage erinnern. Anton interessierte mich damals nicht. Ich empfand ihn in den ersten Wochen als Last, die mir von meinen Eltern ans Bein gebunden worden war. Später stand er mir meist im Weg, als es um Maria ging, und wurde irgendwann ein Freund, als ich mich damit abgefunden hatte, dass Maria nichts mit mir anfangen würde.
Vitrine im Deutschen Schachmuseum Mitte hinten: Unterschrift Lukuschs auf der Hülle des Mephisto-Schachcomputers Mitte: Anton bei seinem ersten Schachturnier im SC Heuchelhof Rechts: Urkunde Deutscher Schachpreis 1989, Einreisedokumente Links: Ordner mit der Dokumentensammlung von Dr. Ritter
Igor Shevchuk ist wieder aufgetaucht. Bei Eurosport, in einer Schachsendung aus dem Hessischen Hof in Frankfurt, habe ich ihn genau erkannt. Der heutige Igor sieht dem von damals nicht mehr sehr ähnlich, aber seine Augen sind noch wie früher. Dunkelbraun, nicht offen oder wach, aber mit Instinkt und einer Konzentration, die nicht vom Durchschauen kommt, sondern vom absoluten Aufmerksamkeitstunnel, in dem er sein Gegenüber wie eine fette Schlange paralysiert. Er trägt mittlerweile Anzug und Rollkragenpullover. Die Haare sind mit Gel flach gedrückt, mit einem hellen Scheitel dazwischen, wie schwarze Gräten am hellen Rückgrat eines Fisches.
Ich konnte mir früher vorstellen, dass der massige Junge einen guten Geschäftsmann abgeben würde. Dass ich ihn hier in Deutschland als Schachgroßmeister wiederfände, darauf wäre ich nicht im Traum gekommen.
Aber wo ist Anton Lukusch? Auf keinem Foto, in keinem Fernsehbericht ist er zu sehen, dabei müsste er sich in unmittelbarer Nähe aufhalten. Nicht umsonst taucht Igor in so vielen alten Fotos von Anton auf. Sie waren buchstäblich unzertrennlich, weit über das Maß hinaus, von dem die Öffentlichkeit damals wusste. Wieder und wieder habe ich erfolglos die Aufnahmen aus dem Hessischen Hof nach einem Gesicht durchsucht, das dem gealterten Anton ähneln könnte. Vielleicht steht er immer hinter der Kamera oder hält sich im Nebenzimmer auf, aber zumindest in den bewegten Magazinbeiträgen im Fernsehen hätte Anton zu sehen sein können. Wenn sich seit ’87 nicht viel geändert hat, kann er nicht weit sein.
Igor hat seine Beziehung zu Anton Lukusch anscheinend nicht zum Thema gemacht und in der Presse hat ihn offenbar niemand erkannt. Auch einen anderen Namen hat er sich zugelegt: Nazarenko. Unter einem Clip aus dem luxuriösen Foyer des Hessischen Hofs in Frankfurt hat Eurosport einen Sprecher folgenden Text sagen lassen: «Igor Nazarenko, der Großmeister aus Minsk, spricht fließend Deutsch mit den zahlreichen Journalistinnen und Journalisten, die den Favoriten für die Frankfurt Open bestürmen.» Eurosport hat ein Interview mit ihm geführt, das eingeblendet wird. Igor spricht so makellos Deutsch, wie ich es als Kind nie von ihm gehört habe: «Ich spiele die Frankfurt Open zum ersten Mal – überhaupt ist es mein erstes Turnier auf deutschem Boden, aber ich spüre, dass die Stadt von Goethe und Otto Hahn mir Gluck bringen wird.» Er sagt «Gluck», aber das ist auch alles, was ihn von einem Muttersprachler unterscheidet.
«Woher sprechen Sie so gut Deutsch, Herr Nazarenko?»
Igors Augen verengen sich nur um ein My. «Ein guter Freund hat es mir beigebracht – ich war mal als Kind hier, in Ferien.»
«Viel Glück für das Turnier!»
Er sagt nichts, nickt nur.
Lukusch sprach Deutsch, als Sohn einer russlanddeutschen Familie, Igor aus einer belarussischen brachte bis zum Ende kaum ein Wort heraus. Er verständigte sich problemlos mit Händen und Füßen oder ließ übersetzen. Aber es ist Igor, zweifelsfrei. Ich habe Fotos verglichen aus dem Fotoalbum meines Vaters und ich habe sein Gesicht damals so gut studiert wie kaum ein anderer. 1987, eines Abends in der Klinik, habe ich, für ein paar Momente, meine ganze Aufmerksamkeit nur auf Igor gerichtet. Seine Züge haben sich in meine Erinnerung eingebrannt, als mein Vater und ich zu ergründen suchten, wie unzertrennlich die beiden wirklich waren.
Damals wurden die besonders schwer betroffenen Kinder aus Tschernobyl auch in Deutschland noch in regelmäßigen Abständen im Krankenhaus untersucht, und mein Vater machte den Versuch beim Schichtwechsels des Personals, als etwa zehn Minuten niemand auf der Station war. Er wolle mich in der Klinik auf Hausstauballergie testen lassen, hatte er zu Hause meiner Mutter erklärt, aber auf der Station gestand er mir, dass ich Teil eines ganz anderen Plans war.
Anton und Igor schliefen bereits vor dem laufenden Fernseher und wachten auch nicht auf, als wir die Bremsen ihrer Betten lösten und sie, so vorsichtig wir konnten, mit den angeschlossenen Geräten aus dem Zimmer rollten. Mehrfach murmelte Anton im Schlaf und kratzte sich an den festgeklebten Elektroden des EKG. Wir hielten inne, mit angehaltenem Atem, bis er sich wieder beruhigt hatte. Mein Vater schob Anton nach rechts, am unbesetzten Schwesternzimmer vorbei. Ich manövrierte Igor, seinem Handzeichen gehorchend, den langen Gang entlang Richtung Ostflügel, Meter um Meter, weg von Anton, gespannt darauf wartend, was passieren würde. Igor hatte den Kopf zur Seite gedreht und atmete rasselnd unter der Last des eigenen Gewichts. Ich war so auf ihn konzentriert, dass ich die Entfernung zu meinem Vater und Anton nicht beachtete, aber nur wenig später blieben wir gleichzeitig stehen und sahen uns um. Die Züge der Kinder waren schlaff geworden. Kein Kampf, kein Drama, kein Erwachen. Nur die Maschinen explodierten förmlich vor Warntönen. Sie wurden beide einfach still, als das Leben aus ihnen wich. Dann brach die Hölle los.
Es gelang uns gerade noch, die beiden zurück ins Zimmer zu fahren, bevor es von Schwestern und Ärzten wimmelte. Augenblicke später tauchten die ersten Pulsschläge wieder auf den Messgeräten auf. Sie mussten nicht reanimiert werden, aber wirklich gut ging es ihnen noch nicht.
Später im Auto startete mein Vater den Motor, schaltete ihn aber gleich wieder ab und schnaufte hörbar aus. «Simon, das war haarscharf!» Er machte eine lange Pause, bevor er weitersprach. «Das ist – gelinde gesagt – erstaunlich.»
Die zusammengewachsenen Augenbrauen, die ungleichen Nasenflügel, der Mund, der auch heute noch links immer leicht zu lächeln scheint, und das schwere Kinn, das schon damals fast in seinem fleischigen Hals verschwand. Es ist Igor, zweifelsfrei. Keine Ahnung, warum er sich heute Nazarenko nennt, keine Ahnung, warum nicht Anton statt seiner am Schachbrett sitzt.
Eigentlich hatte ich Lukusch vergessen. Das heißt, manchmal habe ich von ihm erzählt, als Anekdote beim Abendessen – eine Erzähltrophäe, mit der man sich die Aufmerksamkeit am Tisch sichern kann – vor allem Frauen liebten die Geschichte des kleinen, stoischen Ausnahmetalents. Igor kam darin kaum oder gar nicht vor. Dass gerade er jetzt in Frankfurt Schach spielt, gibt mir neue Rätsel auf. Schon vor einer Weile habe ich begonnen, mich wieder für die beiden zu interessieren. Ein Foto von Anton am Würzburger Hauptbahnhof war der erste Anlass.
Wir drehten einen Kurzfilm, dessen Herzstück eine lange Dialogszene im Bahnhofsrestaurant war. Das Restaurant ist mittlerweile der unvermeidlichen Hochglanz-Einkaufspassage des modernen deutschen Bahnhofs gewichen, aber damals empfing es uns noch mit dem ganzen Charme eines abgelebten Spannteppichs.
In einer Drehpause entdeckte ich das Bild von Anton Lukusch an einer der viereckigen Säulen im Raum, deren Kanten mit Metall verstärkt waren, damit die Koffertrolleys keine Schäden hinterließen. Mit dem gleichen Sicherheitsgedanken hatte man wohl auch das Foto in einem dicken Metallrahmen mit zwei massiven Schrauben in den Beton gedübelt. Es zeigte Lukusch bei einem Schachturnier, das anscheinend hier im Restaurant stattgefunden hatte. Wie auf einer Textzeile unter dem Bild zu lesen war, handelte es sich um die Fränkische Meisterschaft der Junioren, 1987. Lukusch musste gewonnen haben, denn jemand hatte mit einem dicken Filzstift «Sieger» auf das Foto gekritzelt. Darunter stand ein Schriftzug, den ich erst auf den zweiten Blick als die Unterschrift Antons entzifferte. So viel war sicher, Anton hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht oft Autogramme gegeben. Die Unterschrift, die auf dem kleinen Mephisto-Schachcomputer im Deutschen Schachmuseum zu sehen ist, stammt von 1989 und sieht weit geschliffener aus. Hinter Anton war Jochen Wehner auf dem Foto zu sehen, muskulös und immer leicht angespannt. Dabei war er sicher stolz, auch in der zweiten Reihe hinter seinem Schützling noch im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen.
Das Foto wurde während eines Spiels aufgenommen – vielleicht das Finale. Wehner, als Trainer, sah gebannt auf das Schachbrett. Er hatte einen kleinen Block mit Stift in der Hand, auf dem er wahrscheinlich die Spielzüge der Partie notierte. Anton verzog keine Miene. Er hatte seinen Zug schon gemacht und sich zurückgelehnt. Die rechte Hand war ausgestreckt und unscharf, weil sie gerade auf die Schachuhr niedersauste.