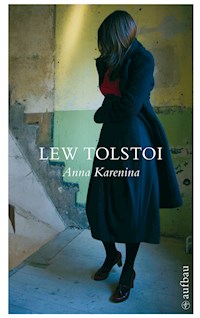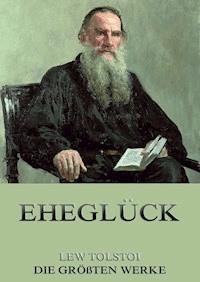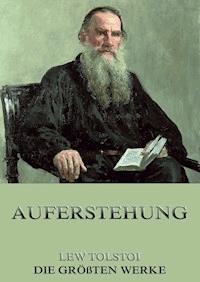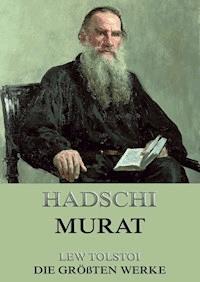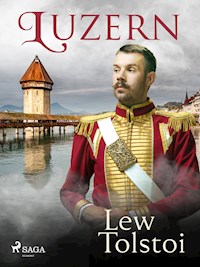Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Die Kurzgeschichte Luzern des russischen Autors Lew Nikolajewitsch Tolstoi erschien 1857 und beschreibt die Aufzeichnungen des fiktiven Fürsten D. Nechljudow. Darin stellt Tolstoi einerseits positiv die schöne Landschaft um Luzern, andererseits negativ den wachsenden Tourismus der arroganten Engländer und die Abneigung der Einheimischen gegenüber einem Bettler dar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luzern
Lew Tolstoi
Über den Autoren:
Luzern
Aus den Aufzeichnungen des Fürsten D. Nechljudow
den 8. Juli
Gestern abend bin ich in Luzern angekommen und im besten hiesigen Hotel, dem Schweizerhof, abgestiegen. »Luzern ist eine alte Kantonsstadt, am Ufer des Vierwaldstätter Sees gelegen,« sagt Murray, »einer der romantischsten Orte der Schweiz; in dieser Stadt kreuzen sich drei wichtige Straßen; in nur einer Stunde Dampferfahrt liegt der Berg Rigi, dessen Gipfel eine der herrlichsten Aussichten der Welt bietet.«
Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht, doch auch die andern Reiseführer behaupten dasselbe; aus diesem Grunde gibt es hier eine Menge von Touristen aller Nationen, besonders aber Engländer.
Das prunkvolle fünfstöckige Haus des »Schweizerhof« ist erst vor kurzem am Kai, unmittelbar am See, erbaut worden, und zwar an derselben Stelle, wo sich in alten Zeiten eine hölzerne, krumme, überdachte Brücke mit Kapellen an den Ecken und Heiligenbildern an den Pfeilern befand. Nun hat man dank dem ungeheuren Andrang der Engländer und aus Rücksicht auf ihre Bedürfnisse, ihren Geschmack und ihr Geld die alte Brücke abgebrochen und an ihrer Stelle einen schnurgeraden Sockeldamm angelegt, auf dem Damm mehrere geradlinige viereckige, fünfstöckige Häuser erbaut, vor den Häusern aber zwei Reihen Linden gepflanzt und diese mit Pfählen gestützt. Zwischen den Linden hat man, wie es überall üblich ist, grün angestrichene Bänke verteilt. Das ist die Promenade; hier ergehen sich die Engländerinnen mit schweizerischen Strohhüten und die Engländer in ihren praktischen und bequemen Anzügen, und sie freuen sich alle ihrer Schöpfung. Es ist ja möglich, daß diese Kais und Häuser, Linden und Engländer sich irgendwo anders ganz hübsch machen würden; jedenfalls aber nicht hier, inmitten dieser seltsam majestätischen und zugleich unbeschreiblich harmonischen und weichen Landschaft.
Als ich in mein Zimmer hinaufkam und das auf den See gehende Fenster öffnete, wurde ich im ersten Augenblick von der Schönheit dieses Wassers, dieser Berge und dieses Himmels buchstäblich geblendet und erschüttert. Mich überkam eine innere Unruhe und das Bedürfnis, dem Überfluß dessen, was meine Seele erfüllte, irgendwie Ausdruck zu verleihen. Ich hatte in diesem Augenblick das Verlangen, irgend jemand zu umarmen, fest zu umhalsen, zu kitzeln und sogar zu zwicken und überhaupt mit ihm oder mit mir selbst irgend etwas ganz Ungewöhnliches anzufangen.
Es war in der siebenten Abendstunde. Den ganzen Tag hindurch hatte es geregnet, doch jetzt heiterte sich das Wetter auf. Vor meinem Fenster breitete sich zwischen den abwechslungsreichen grünen Ufern der See, blau wie brennender Schwefel, von zahllosen, als kleine Punkte erscheinenden Booten und ihren sich verziehenden Spuren belebt, unbeweglich, glatt, gleichsam erhaben; er zog sich, zwischen zwei ungeheuren Bergvorsprüngen eingeengt, in die Ferne, schmiegte sich dunkelnd an die übereinandergetürmten Berge, Wolken und Gletscher und verlor sich zwischen ihnen. Im Vordergrunde lagen feuchte, hellgrüne, geschwungene Ufer mit Schilf, Wiesen, Gärten und Villen; weiter kamen dunkelgrüne, bewaldete Anhöhen mit Schloßruinen; den Hintergrund bildete die zusammengeballte, weiße und lilafarbene Gebirgskette mit seltsamen felsigen und mattweißen schneebedeckten Gipfeln; und alles war übergossen von einer zarten, durchsichtig blauen Luft und beleuchtet von den durch die zerfetzten Wolken hervorschießenden warmen Strahlen der untergehenden Sonne. Weder auf dem See, noch in den Bergen, noch am Himmel gab es eine einzige ununterbrochene Linie, eine einzige ungemischte Farbe, einen einzigen ruhigen Punkt: überall war Bewegung, Unsymmetrie, Phantastik, eine unaufhörliche Vermengung und Verschiedenheit der Schatten und Linien, und zugleich die Ruhe, Milde, Einheit und Notwendigkeit des Schönen. Und mitten in dieser unbestimmten, verworrenen und freien Schönheit lag unmittelbar vor meinem Fenster der dumme, künstliche weiße Kai mit den gestützten Lindenbäumchen und den grünen Bänken; alle diese armseligen und banalen Werke von Menschenhand waren nicht wie die fernen Villen und Ruinen in der allgemeinen Harmonie und Schönheit aufgegangen, sondern widersprachen ihr auf die gröblichste Weise. Mein Blick stieß sich immer unwillkürlich an diese gräßliche gerade Linie des Dammes, und ich wollte sie zurückstoßen und vernichten wie einen schwarzen Fleck, der einem auf der Nase unter dem Auge sitzt; doch der Kai mit den lustwandelnden Engländern blieb immer an seinem Platz, und ich begann mir unwillkürlich einen Gesichtspunkt zu suchen, von dem aus ich ihn nicht zu sehen brauchte. Es gelang mir auch, meine Augen derart einzustellen, und so genoß ich bis zur Mahlzeit ganz allein jenes unvollständige, doch um so süßere Gefühl, das der Mensch empfindet, wenn er sich ganz allein dem Naturgenuß ergibt.
Um halb acht rief man mich zum Essen. Im großen, prächtig ausgestatteten Parterresaal waren zwei lange Tische für mindestens hundert Personen gedeckt. Etwa drei Minuten dauerte das stumme Erscheinen der Gäste, das Rauschen der Damenkleider, die leichten Schritte und die leisen Unterredungen mit den ungemein höflichen und eleganten Kellnern; vor allen Gedecken saßen bald Herren und Damen, die alle sehr elegant, sogar kostbar und überhaupt ungemein sorgfältig gekleidet waren. Wie überall in der Schweiz, bestand der größte Teil der Tischgesellschaft aus Engländern; daher bestimmten den allgemeinen Ton der Table d'hote eine strenge Beachtung der gesetzlich anerkannten Anstandsregeln, eine Verschlossenheit, die nicht auf dem Stolz der Gäste, sondern auf dem Mangel eines Bedürfnisses, sich einander zu nähern, beruhte, und das Behagen, das jeder für sich in der bequemen und angenehmen Befriedigung seiner Bedürfnisse fand. Überall schimmerten schneeweiße Spitzen, schneeweiße Kragen, schneeweiße, echte und falsche Zähne und schneeweiße Gesichter und Hände. Doch die Gesichter, von denen viele auffallend schön sind, drücken nur das Bewußtsein des eigenen Wohlbehagens aus und einen vollständigen Mangel an Interesse für alles, was sie umgibt und sie nicht direkt berührt; die schneeweißen Hände mit den kostbaren Ringen und Mitaines bewegen sich nur, um den Kragen gerade zu richten, den Braten zu zerschneiden und Wein einzuschenken: alle diese Bewegungen drücken keine Spur von Seele aus. Die Angehörigen einzelner Familien tauschen nur ab und zu leise Bemerkungen aus über den angenehmen Geschmack einer Speise oder eines Weines und über die schöne Aussicht vom Rigi. Die alleinstehenden Herren und Damen sitzen schweigsam nebeneinander, ohne einander anzublicken. Wenn von diesen hundert Personen zwei zusammen reden, so kann man wetten, daß das Gespräch entweder vom Wetter oder von der Besteigung des Rigi handelt. Messer und Gabel bewegen sich kaum hörbar auf den Tellern, man nimmt sich höchst bescheidene Portionen und ißt Erbsen und andere Gemüse ausschließlich mit der Gabel; die Kellner, die sich unwillkürlich der allgemeinen Schweigsamkeit unterordnen, fragen im Flüsterton, welchen Wein man haben möchte. Bei solchen Mahlzeiten empfinde ich stets ein schweres und unangenehmes und gegen das Ende – trauriges Gefühl. Ich habe immer den Eindruck, als ob ich etwas verbrochen hätte und dafür gestraft werden müßte, wie in meiner Kindheit, wo man mich für irgendeinen Streich auf einen Stuhl setzte und ironisch sagte: »So, jetzt ruhe dich aus, mein Lieber!« – während in meinen Adern junges, wildes Blut pochte und aus dem Nebenzimmer die ausgelassenen Schreie meiner Brüder klangen. Früher versuchte ich immer, mich gegen das drückende Gefühl, das ich bei solchen Mahlzeiten empfand, aufzulehnen, doch vergeblich: alle diese leblosen Gesichter haben auf mich einen unwiderstehlichen Einfluß, und ich werde ebenso leblos wie sie. Ich will nichts, ich denke an nichts, ich beobachte sogar nicht. Anfangs machte ich noch Versuche, meine Tischnachbarn ins Gespräch zu ziehen; zur Antwort bekam ich aber nur die gleichen Phrasen, die wohl zum hunderttausendsten Mal auf der gleichen Stelle und zum hunderttausendsten Mal vom gleichen Menschen wiederholt wurden. Dabei sind sie alle doch sicher nicht dumm und nicht gefühllos; viele von diesen erfrorenen Menschen haben wohl das gleiche Innenleben wie ich, und manche ein viel interessanteres und komplizierteres. Warum verzichten sie dann auf einen der größten Genüsse im Leben, auf den Genuß aneinander, den Genuß am Menschen?
Wie anders war es doch in unserer Pariser Pension, wo wir etwa zwanzig Personen von den verschiedensten Nationen, Berufen und Eigenschaften uns unter dem Einflüsse der französischen Geselligkeit an der Table d'hote wie zu einem Vergnügen zusammenfanden! Dort wurde jedes, an irgendeinem Tischende begonnenes, mit Scherzen und Wortspielen gewürztes Gespräch, wenn auch in gebrochener Sprache geführt, sofort zu einem allgemeinen. Ein jeder redete, was ihm gerade in den Kopf kam, ohne sich um die Richtigkeit der Sprache zu kümmern; wir hatten dort unsern Philosophen, unsern Streithahn, unsern bel esprit und unsern Narren, eine ständige Zielscheibe für spöttische Bemerkungen; alles hatten wir gemeinsam. Gleich nach dem Essen rückten wir den Tisch beiseite und tanzten im Takt und auch nicht im Takt bis zum Abend Polka. Wir gaben uns dort zwar etwas kokett, nicht sehr klug und würdevoll, aber immerhin menschlich. Die spanische Gräfin mit ihren romantischen Abenteuern, der italienische Abbate, der nach dem Essen Stellen aus der Göttlichen Komödie zu deklamieren pflegte, der amerikanische Doktor, der Zutritt zu den Tuilerien hatte, der junge Dramatiker mit der langen Mähne, die Pianistin, die nach ihrer eigenen Behauptung die schönste Polka der Welt komponiert hatte, und die unglückliche schöne Witwe, die an jedem Finger drei Ringe trug – wir alle unterhielten zu einander durchaus menschliche, wenn auch etwas oberflächliche, doch freundschaftliche Beziehungen und haben teils flüchtige, teils aufrichtig herzliche Erinnerungen aneinander bewahrt. Wenn ich aber bei einer englischen Table d'hote auf alle diese Spitzen, Bänder, Ringe, pomadisierten Haare und seidenen Kleider sehe, denke ich immer daran, wie vielen lebenden Frauen dieser Schmuck und Tand Glück geben würde und die Fähigkeit, auch andere zu beglücken. So seltsam ist der Gedanke, daß hier so viele Freunde und Liebende, glückliche Freunde und glücklich Liebende, ohne es selbst zu wissen, vielleicht dicht beisammen sitzen. Und sie werden es, Gott weiß warum, nie erfahren und werden nie einander das Glück schenken, das sie so leicht schenken könnten und nach dem sie alle so sehr dürsten.
Am Ende der Mahlzeit überkam mich wie immer eine traurige Stimmung; ich ließ das Dessert stehen, verließ die Tafel und begab mich in ziemlich schlechter Laune in die Stadt. Die engen, schmutzigen, unbeleuchteten Gassen, die Läden, die eben geschlossen wurden, die Begegnungen mit betrunkenen Arbeitern und mit Frauen, die Wasser holten, und anderen Frauen, die bessere Hüte aufhatten und, sich fortwährend umblickend, an den Mauern entlang durch die Gassen huschten, vermochten meine düstere Stimmung nicht zu verscheuchen, ja, sie verstärkten sie nur. Es war schon ganz finster, als ich, ohne mich umzublicken und ohne an etwas zu denken, nach Hause ging, in der Hoffnung, mich durch den Schlaf von der düsteren Stimmung zu befreien. Ich empfand eine schreckliche innere Kälte, jenes drückende Gefühl von Einsamkeit, wie es uns oft ohne jeden ersichtlichen Grund überfällt, wenn wir auf einer Reise nach einem neuen Ort kommen.