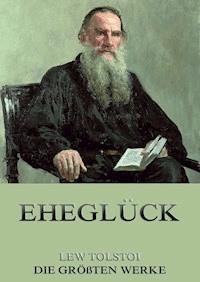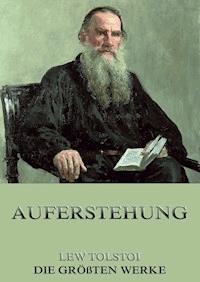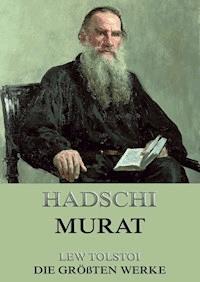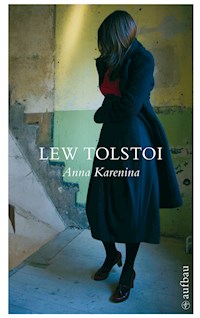
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einer der größten Liebesromane der Weltliteratur
Anna, die schöne Frau des hohen Petersburger Beamten Karenin, hat sich leidenschaftlich in den Grafen Wronski verliebt. Sie bekennt sich offen zu ihrer Liebe und verläßt ihren Mann. Aber die vornehme Gesellschaft verzeiht ihr diesen provozierenden Verstoß gegen die Konventionen nicht. Verzweifelt kämpft Anna um ihren Sohn und um ihre Liebe.
»Tolstoi ist einer der größten Psychologen; weil wir seine Figuren nicht wirklich verstehen, begreifen wir sie im Innersten.«Daniel Kehlmann, Der Spiegel
Im Hause von Stiwa Oblonski ist alles aus dem Gleise geraten, denn er hat mal wieder ein Verhältnis – diesmal mit einer früheren Gouvernante der Familie. Seine Schwester Anna, verheiratet mit dem hohen Petersburger Beamten Karenin, kommt als wahre Friedensstifterin in all die Aufregung. Wenig später jedoch ist sie selbst in viel tieferen Nöten: Sie hat sich in den schönen jungen Grafen Wronski verliebt und bekennt sich zu ihrer Liebe. Einer Frau verzeiht die Gesellschaft einen Verstoß gegen die Konventionen nicht so leicht wie dem flatterhaften Stiwa. Darüberhinaus verweigert der mächtige Karenin Anna die Scheidung und den Sohn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1843
Veröffentlichungsjahr: 2010
Sammlungen
Ähnliche
Lew Tolstoi
Anna Karenina
Roman
Aus dem Russischen von Hermann Asemissen
Impressum
Titel der Originalausgabe
Aннa Kapeнинa
ISBN 978-3-8412-0070-9
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, BerlinBei Rütten & Loening erstmals 1956 erschienen; Rütten & Loening ist eineMarke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung undVerwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesonderefür Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischenSystemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über dasInternet.
Einbandgestaltung morgen, unter Verwendung eines Fotosvon Kai Dieterich/bobsairport
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Impressum
Inhaltsübersicht
ERSTER TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ZWEITER TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
DRITTER TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
VIERTER TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
FÜNFTER TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
SECHSTER TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
SIEBENTER TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ACHTER TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lew Tolstoi, 1854
ERSTER TEIL
Die Rache ist mein;
ich will vergelten.
1
Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Art.
Im Hause der Oblonskis war alles aus dem Geleise geraten. Die Frau des Hauses hatte erfahren, daß ihr Mann mit der Französin, die früher bei ihnen als Gouvernante angestellt war, ein Verhältnis unterhielt, und hatte ihm erklärt, sie könne mit ihm nicht weiter unter demselben Dache leben. Dieser Zustand dauerte nun schon den dritten Tag an und bedrückte sowohl die Eheleute selbst als auch alle Familienmitglieder und das ganze Personal. Sämtliche Mitglieder der Familie und das Hausgesinde hatten das Empfinden, daß ihre Hausgemeinschaft sinnlos geworden sei und daß zwischen Leuten, die zufällig in einem Gasthof zusammentreffen, eine engere Verbindung bestehe als zwischen ihnen, den Mitgliedern der Familie Oblonski und ihrem Hausgesinde. Die Frau des Hauses verließ ihre Zimmer nicht, der Hausherr war seit zwei Tagen nicht zu Hause gewesen. Die Kinder irrten in der ganzen Wohnung wie verloren umher; die englische Erzieherin hatte sich mit der Wirtschafterin überworfen und an eine Freundin geschrieben, sie möchte sich nach einer anderen Stelle für sie umsehen; der Koch war bereits am Vortage während des Mittagessens seiner Wege gegangen, das Küchenmädchen und der Kutscher hatten ihren Dienst aufgesagt.
Am dritten Tage nach dem Zerwürfnis wachte Fürst Stepan Arkadjitsch Oblonski – Stiwa, wie er in der Gesellschaft genannt wurde – zur üblichen Stunde, das heißt um acht Uhr morgens, auf, allerdings nicht im ehelichen Schlafzimmer, sondern auf dem Lederdiwan in seinem Arbeitszimmer. Er drehte sich auf dem Diwan, der unter seinem korpulenten, gepflegten Körper federte, auf die andere Seite, schob die Hand unter das Kissen, vergrub das Gesicht darin und war dabei, nochmals fest einzuschlafen; plötzlich jedoch schnellte er in die Höhe, setzte sich aufrecht hin und öffnete die Augen.
Ja, ja, wie war das doch gleich? Er versuchte, sich das eben Geträumte ins Gedächtnis zu rufen. Wie war es denn? Ja! Alabin gab ein Diner in Darmstadt; nein, nicht in Darmstadt, irgendwo in Amerika. Ja, aber jenes Darmstadt, das lag in Amerika. Ja, Alabin gab ein Diner auf Tischen aus Glas, ja, und die Tische sangen: »Il mio tesoro«, oder nein, nicht »Il mio tesoro«, sondern etwas Schöneres … und dann diese kleinen Karaffen, die zugleich auch Frauen waren …
Die Augen Stepan Arkadjitschs leuchteten freudig auf, und er lächelte versonnen. Ja, das war sehr schön, sehr schön. Noch vielerlei vortreffliche Dinge gab es dort, doch beim Erwachen kann man das nicht in Worten ausdrücken, und sogar die Gedanken lassen sich nicht aussprechen. Als er nun den Lichtstreifen bemerkte, der am Rande des Tuchvorhangs durch eines der Fenster ins Zimmer drang, setzte er die Füße mit einem übermütigen Schwung auf den Fußboden, angelte mit ihnen nach den goldschimmernden Saffianpantoffeln, die seine Frau bestickt und ihm im vorigen Jahr zum Geburtstag geschenkt hatte, und streckte, ohne aufzustehen, den Arm aus alter, neunjähriger Gewohnheit in die Richtung, in der im Schlafzimmer sein Schlafrock hing. Und jetzt besann er sich plötzlich darauf, daß und warum er nicht im gemeinsamen Schlafzimmer, sondern in seinem Arbeitszimmer geschlafen hatte, das Lächeln verschwand von seinem Gesicht, und er zog die Stirn kraus.
»Ach, ach, ach! O weh!« jammerte er, als ihm alles einfiel, was geschehen war. In seinem Gedächtnis wurden jetzt wieder alle Einzelheiten des Zerwürfnisses mit seiner Frau lebendig, die ganze Hoffnungslosigkeit seiner Lage und – was am quälendsten war – sein eigenes Schuldbewußtsein.
Nein, sie wird nicht verzeihen und kann nicht verzeihen. Und das schrecklichste ist, daß ich an allem schuld bin – schuld bin, und doch eigentlich schuldlos. Darin liegt eben die ganze Tragik, sagte er sich in Gedanken.
»Ach, ach, ach!« murmelte er verzweifelt vor sich hin, als er sich der für ihn peinvollsten Momente der Auseinandersetzung mit seiner Frau erinnerte.
Am unangenehmsten war jener erste Augenblick gewesen, als er bei seiner Rückkehr aus dem Theater in angeregter, zufriedener Stimmung und mit einer riesigen, seiner Frau zugedachten Birne in der Hand in den Salon getreten war und Dolly dort nicht angetroffen hatte; zu seinem Erstaunen hatte er sie auch nicht in seinem Arbeitszimmer gefunden; schließlich hatte er sie im Schlafzimmer mit dem unglückseligen, alles verratenden Briefchen in der Hand entdeckt.
Dolly, diese rührige, ewig sorgende und, wie er meinte, ein wenig beschränkte Frau, hatte regungslos mit dem Briefchen in der Hand in einem Sessel gesessen und ihn mit einem Blick empfangen, in dem sich Entsetzen, Verzweiflung und Zorn ausdrückten.
»Was ist das? Was?« hatte sie gefragt und auf das Briefchen gedeutet.
Und als Stepan Arkadjitsch daran zurückdachte, ärgerte er sich, wie es häufig geschieht, nicht sosehr über das Vorkommnis selbst als vielmehr über die Art, wie er auf die Worte seiner Frau reagiert hatte.
Ihm war es in jenem Augenblick so ergangen, wie es den meisten Menschen ergeht, wenn sie unvorbereitet einer für sie sehr beschämenden Handlungsweise überführt werden. Er hatte es nicht verstanden, seine Haltung der Situation anzupassen, in der er seiner Frau nach Aufdeckung seiner Schuld gegenüberstand. Anstatt den Beleidigten zu spielen, zu leugnen, sich zu rechtfertigen, um Vergebung zu bitten oder auch einfach Gleichmut zu bewahren – alles wäre besser gewesen als sein Verhalten! –, hatte er sein Gesicht ganz mechanisch (auf Grund von Gehirnreflexen, meinte Stepan Arkadjitsch, der die Physiologie schätzte) zu seinem üblichen, gutmütigen und in dieser Lage albern wirkenden Lächeln verzogen.
Dieses alberne Lächeln konnte er sich nicht verzeihen. Angesichts seines Lächelns war Dolly wie unter einem physischen Schmerz zusammengezuckt, hatte ihrer Empörung mit der ihr eigenen Heftigkeit durch eine Flut harter Worte Luft gemacht und war aus dem Zimmer gelaufen. Seitdem weigerte sie sich, mit ihm zusammenzukommen.
»Schuld an allem ist dieses dumme Lächeln«, murmelte Stepan Arkadjitsch vor sich hin. »Aber was soll man machen? Was macht man bloß?« fragte er sich verzweifelt und fand keine Antwort.
2
Stepan Arkadjitsch war sich selbst gegenüber ein ehrlicher Mensch. Er konnte sich keiner Selbsttäuschung hingeben und sich nicht einreden, daß er seine Handlungsweise bereue. Es war ihm einfach nicht möglich, Reue darüber zu empfinden, daß er, ein jetzt vierunddreißigjähriger, gutaussehender und leicht entflammbarer Mann, nicht mehr in seine Frau, die Mutter von fünf Kindern (zwei weitere Kinder waren gestorben) und nur ein Jahr jünger war als er, verliebt war. Er bereute lediglich, daß er es nicht besser verstanden hatte, seine Frau zu täuschen. Aber er war sich der ganzen Schwere seiner Lage bewußt und bedauerte seine Frau, die Kinder und sich selbst. Vielleicht wäre es ihm auch gelungen, sein Vergehen vor seiner Frau besser zu verbergen, wenn er geahnt hätte, daß diese Nachricht eine solche Wirkung auf sie ausüben würde. Er hatte über diese Frage nie genauer nachgedacht, aber undeutlich hatte er sich vorgestellt, daß seine Frau längst erraten habe, daß er ihr untreu sei, und daß sie ein Auge zudrücke. Er meinte sogar, daß sie, eine abgezehrte, gealterte und nicht mehr hübsche Frau, die sich durch nichts Besonderes auszeichnete und nichts weiter als eine gute Hausmutter war, schon aus Gerechtigkeitssinn nachsichtig gegen ihn sein müsse. Und nun hatte sich genau das Gegenteil herausgestellt.
»Ach, wie furchtbar! Oh, oh, oh, wie furchtbar!« sagte Stepan Arkadjitsch immer wieder vor sich hin und wußte sich keinen Rat. Und wie schön war doch das Leben bis jetzt, wie gut ist alles gegangen! Sie war zufrieden, war glücklich durch die Kinder, ich habe ihr nichts in den Weg gelegt, überließ es ihr, sich nach Belieben mit den Kindern abzugeben und im Haushalt zu schalten und walten, wie sie wollte. Gewiß, es ist nicht schön, daß sie als Gouvernante bei uns angestellt gewesen ist. Das ist nicht schön! Es hat immer einen trivialen, ordinären Beigeschmack, wenn man mit einer Gouvernante des eigenen Hauses flirtet. Aber was für eine Gouvernante! (Er stellte sich lebhaft die schalkhaften schwarzen Augen und das Lächeln von Mademoiselle Rolland vor.) Doch solange sie bei uns im Hause war, habe ich mir ja nichts erlaubt. Das schlimmste ist, daß sie auch schon … Als ob alles verhext wäre! Oh, oh, oh! Was macht man bloß, was macht man bloß?
Er fand keine Antwort außer jener gewöhnlichen, die das Leben auf alle komplizierten und unlösbaren Fragen gibt. Diese Antwort lautet: Man muß in den Tag hinein leben, das heißt sich vergessen. In einem Traum Vergessen zu suchen, das war nicht mehr möglich, zum mindesten nicht vor der Nacht, und die Musik, die von jenen Karaffen ausgegangen war, die sich dann in Frauen verwandelt hatten, ließ sich nicht mehr zum Klingen bringen; es blieb also nichts anderes übrig, als ein Vergessen in dem zu suchen, was der Tag mit sich brachte.
Dann werden wir weitersehen, sagte sich Stepan Arkadjitsch, während er seinen grauen, mit blauer Seide gefütterten Schlafrock anzog und den an den Enden mit Troddeln versehenen Gürtel zu einer Schleife zusammenband; dann sog er die Luft mit Behagen in seinen breiten Brustkorb, ging mit seinen nach außen gekehrten Füßen, die seinen fülligen Körper so elastisch trugen, forschen Schrittes ans Fenster, zog den Vorhang zurück und setzte energisch die Klingel in Bewegung. Auf das Klingelzeichen trat sofort sein alter Freund, der Kammerdiener Matwej, ein und brachte die Kleider, die Schuhe und ein Telegramm. Hinter Matwej erschien auch der Friseur mit allem Zubehör zum Rasieren.
»Sind Akten aus dem Amt gebracht worden?« fragte Stepan Arkadjitsch, als er Matwej das Telegramm abnahm und sich vor den Spiegel setzte.
»Sie liegen auf dem Frühstückstisch«, antwortete Matwej, wobei er fragend und besorgt auf seinen Herrn blickte und dann nach einer kurzen Pause mit einem listigen Lächeln hinzufügte: »Vom Fuhrunternehmer ist jemand hiergewesen.«
Stepan Arkadjitsch antwortete nichts und sah Matwej nur im Spiegel an. An dem Blick, den sie im Spiegel miteinander tauschten, war zu erkennen, wie gut sie einander verstanden. In dem Blick Stepan Arkadjitschs drückte sich die Frage aus: Warum sagst du das? Weißt du denn nicht Bescheid?
Matwej steckte die Hände in die Taschen seines Jacketts, trat einen halben Schritt zurück und blickte schweigend mit einem gutmütigen, kaum merkbaren Lächeln auf seinen Herrn.
»Ich habe ihm gesagt, er soll nächsten Sonntag kommen und bis dahin weder Sie noch sich selbst unnötig bemühen«, beantwortete er die stumme Frage Stepan Arkadjitschs mit einem Satz, für den er sich die Worte offenbar vorher zurechtgelegt hatte.
Stepan Arkadjitsch merkte, daß Matwej zum Scherzen aufgelegt war und die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollte. Nachdem er das Telegramm aufgerissen und den wie immer verstümmelten Text entziffert hatte, verklärte sich sein Gesicht.
»Matwej, meine Schwester Anna Arkadjewna trifft morgen ein«, sagte er, wobei er für einen Augenblick die glänzende rundliche kleine Hand des Friseurs festhielt, die zwischen den beiden Hälften des langen gewellten Backenbarts eine blaßrosa Bahn zog.
»Gott sei Dank«, antwortete Matwej und gab damit zu verstehen, daß er sich ebenso wie sein Herr der Bedeutung dieses Besuches bewußt war und zu der Ansicht neigte, die Schwester Stepan Arkadjitschs, die dieser über alles liebte, könne eine Versöhnung zwischen Mann und Frau herbeiführen.
»Allein oder mit dem Herrn Gemahl?« fragte Matwej.
Stepan Arkadjitsch, der nicht antworten konnte, weil der Friseur gerade an seiner Oberlippe beschäftigt war, hob einen Finger in die Höhe. Matwej nickte dem Spiegelbild zu.
»Allein. Sollen oben die Zimmer hergerichtet werden?«
»Melde es Darja Alexandrowna. Je nachdem, was sie bestimmt.«
»Darja Alexandrowna?« wiederholte Matwej, gleichsam zweifelnd.
»Ja, melde es ihr. Hier, nimm auch das Telegramm mit und sage mir dann Bescheid, was sie gesagt hat.«
Er streckt die Fühler aus! dachte Matwej, aber laut sagte er nur:
»Zu Befehl!«
Stepan Arkadjitsch, fertig rasiert und frisiert, war schon im Begriff, sich anzuziehen, als Matwej, bedächtig mit seinen knarrenden Stiefeln einherschreitend, mit dem Telegramm in der Hand ins Zimmer zurückkehrte. Der Friseur hatte sich inzwischen entfernt.
»Von Darja Alexandrowna soll ich melden, daß sie verreist. Man soll, das heißt, Sie sollen alles machen, wie es Ihnen beliebt«, sagte er mit einem nur in den Augen erkennbaren Lächeln, steckte die Hände in die Taschen, legte den Kopf auf die Seite und sah seinen Herrn erwartungsvoll an.
Stepan Arkadjitsch schwieg eine Weile. Dann erschien auf seinem hübschen Gesicht ein gutmütiges, aber etwas klägliches Lächeln.
»Na, Matwej?« sagte er und wiegte den Kopf.
»Macht nichts, Herr, es wird schon werden«, antwortete Matwej. »Wird werden?«
»Jawohl.«
»Meinst du? – Wer ist denn dort?« fragte Stepan Arkadjitsch, als hinter der Tür das Rascheln eines Frauenkleides laut wurde.
»Ich bin’s«, antwortete eine feste, angenehme Frauenstimme, und im Türspalt erschien das strenge pockennarbige Gesicht der Kinderfrau Matrjona Filimonowna.
»Was gibt’s, Matrjoscha?« fragte Stepan Arkadjitsch und trat zu ihr an die Tür.
Obwohl Stepan Arkadjitsch seiner Frau gegenüber zutiefst im Unrecht war und dies selbst einsah, nahmen fast alle im Hause für ihn Partei, selbst die alte Kinderfrau, die ganz besonders an Darja Alexandrowna hing.
»Was gibt’s?« fragte er bedrückt.
»Gehen Sie zu ihr, Herr, bitten Sie noch einmal um Verzeihung. Vielleicht steht Ihnen Gott bei. Sie quält sich so, es ist nicht mit anzusehen, und im Hause geht auch alles drunter und drüber. Die Kinder, Herr, die Kinder sind zu bedauern. Leisten Sie Abbitte, Herr. Was hilft’s? Hast du dir die Suppe eingebrockt, dann …«
»Sie wird mich ja gar nicht zu sich lassen …«
»Versuchen Sie’s. Gott ist gnädig, beten Sie zu Gott, Herr, beten Sie zu Gott!«
»Nun gut, gehe jetzt«, sagte Stepan Arkadjitsch und wurde plötzlich rot. »So, nun reich mir die Kleider«, wandte er sich dann an Matwej und warf mit einer energischen Bewegung den Schlafrock ab.
Matwej pustete etwas Unsichtbares vom Hemd, das er schon wie ein Kummet bereithielt, und streifte es mit sichtlichem Vergnügen über den gepflegten Körper seines Herrn.
3
Nach beendeter Toilette besprühte sich Stepan Arkadjitsch mit Parfüm, zog an den Hemdsärmeln die Manschetten zurecht und verteilte mit gewohnten Handgriffen die Zigaretten, die Brieftasche, die Zündholzschachtel und die Uhr mit mehreren Anhängern, die an einer Doppelkette befestigt war, auf die verschiedenen Taschen; dann schwenkte er sein Taschentuch und begab sich mit dem Gefühl, sauber, duftend, gesund und ungeachtet allen Mißgeschicks im Vollbesitz seiner physischen Kraft zu sein, mit leicht wippenden Schritten ins Speisezimmer, wo bereits der Kaffee auf ihn wartete und neben dem Gedeck die eingegangenen Briefe und die aus dem Amt gebrachten Akten lagen.
Er las die Briefe. Einer darunter berührte ihn sehr unangenehm: er war von dem Kaufmann, mit dem er wegen des Verkaufs eines Waldstückes in Unterhandlung stand, das zum Gut seiner Frau gehörte. Dieser Wald mußte unbedingt verkauft werden; jetzt jedoch, bevor er sich nicht mit seiner Frau ausgesöhnt hatte, war gar nicht daran zu denken. Am unangenehmsten dabei war, daß sich auf diese Weise eine Geldfrage in die bevorstehende Versöhnung mit seiner Frau einschlich. Der Gedanke, daß er sich von einer Geldfrage leiten lassen und eine Versöhnung mit seiner Frau betreiben könnte, um den Wald zu verkaufen – allein dieser Gedanke schon beleidigte ihn.
Nachdem Stepan Arkadjitsch alle Briefe gelesen hatte, zog er die vom Amt gekommenen Schriftstücke zu sich heran; er blätterte schnell zwei Aktenstücke durch, machte mit einem dicken Bleistift einige Randnotizen, schob die Akten wieder beiseite und wandte sich dem Frühstück zu. Beim Kaffeetrinken entfaltete er die noch feuchte Morgenzeitung und begann zu lesen.
Stepan Arkadjitsch hielt eine liberale Zeitung – keine extreme, sondern ein Blatt jener Richtung, der die Mehrzahl seiner Bekannten huldigte. Und obwohl er sich im Grunde genommen weder für wissenschaftliche Belange noch für Kunst und Politik interessierte, vertrat er in allen diesen Fragen mit Entschiedenheit die gleichen Ansichten, die von dieser Mehrzahl und von seiner Zeitung vertreten wurden; er änderte sie nur, wenn die Mehrzahl sie änderte, oder, richtiger gesagt, nicht er änderte sie, sondern sie änderten sich von selbst in ihm, ohne daß er es merkte.
Stepan Arkadjitsch wählte nicht eine Richtung und Ansichten, sondern die Richtungen und Ansichten kamen zu ihm, genauso, wie er auch nicht die Fasson seiner Hüte und den Schnitt seiner Anzüge wählte, sondern sie so trug, wie sie gerade Mode waren. Ansichten zu haben aber war für ihn, der in einem bestimmten Kreise lebte und das Bedürfnis nach einer gewissen geistigen Beschäftigung empfand, wie es sich gewöhnlich in reiferen Jahren einstellt, ebenso eine Notwendigkeit wie der Besitz eines Hutes. Und wenn es auch einen Grund dafür gab, daß er die liberale Richtung der konservativen vorzog, der ebenfalls viele seiner Bekannten anhingen, so lag dieser Grund nicht darin, daß er die liberale Richtung für vernünftiger gehalten hätte, sondern in dem Umstand, daß sie besser zu seinem ganzen Lebensstil paßte. Die liberale Partei erklärte, daß in Rußland alles schlecht sei – und in der Tat, Stepan Arkadjitsch hatte viele Schulden und entschieden zuwenig Geld. Die liberale Partei erklärte, daß die Ehe eine überholte Einrichtung sei, die einer Umgestaltung bedürfe – und in der Tat, das Familienleben bereitete Stepan Arkadjitsch wenig Vergnügen und zwang ihn, zu lügen und sich zu verstellen, was seiner Natur höchst zuwider war. Die liberale Partei erklärte oder vielmehr sie war der Auffassung, daß die Religion lediglich ein Mittel zur Zügelung des unzivilisierten Teils der Bevölkerung sei – und in der Tat, Stepan Arkadjitsch vermochte selbst einem kurzen Gottesdienst nicht bis zum Ende beizuwohnen, ohne daß seine Füße geschmerzt hätten, und er konnte nicht begreifen, wozu in so schrecklichen und hochtönenden Worten vom Jenseits geredet wurde, da es sich doch auch in dieser Welt ganz gut leben ließ. Außerdem bereitete es Stepan Arkadjitsch, der einen guten Scherz liebte, Vergnügen, gelegentlich irgendein harmloses Gemüt durch die Bemerkung zu verblüffen, daß es, wenn man sich schon etwas auf seine Ahnen einbilde, nicht richtig sei, bei Rjurik haltzumachen und den Urvater – den Affen – zu verleugnen. Die liberale Richtung war Stepan Arkadjitsch somit zur Gewohnheit geworden, und er schätzte seine Zeitung ebenso, wie er nach dem Mittagessen eine Zigarre schätzte, die in seinem Kopf eine leichte Benebelung hervorrief. Er las den Leitartikel, in dem davon die Rede war, daß es gänzlich unberechtigt sei, darüber zu wehklagen, daß der Radikalismus angeblich alle konservativen Elemente zu vernichten drohe und daß die Regierung unbedingt Maßnahmen zur Unterdrückung der revolutionären Hydra ergreifen müsse, denn, so hieß es weiter, »die Gefahr liegt unseres Erachtens nicht in der vermeintlichen revolutionären Hydra, sondern in dem hartnäckigen Festhalten an Traditionen, die den Fortschritt hemmen«. Ferner las er einen Artikel finanzpolitischen Inhalts, in dem Bentham und Mill erwähnt wurden und der einige Nadelstiche gegen das Ministerium enthielt. Dank seiner schnellen Auffassungsgabe durchschaute er die Bedeutung jeder Stichelei: er wußte, von wem sie ausging, gegen wen sie gerichtet und worauf sie gemünzt war, und das bereitete ihm stets ein gewisses Vergnügen. Heute war dieses Vergnügen allerdings durch die Erinnerung an die Ermahnungen Matrjona Filimonownas und durch die unerquicklichen Verhältnisse im Hause getrübt. Er las auch noch, daß Graf Beust dem Vernehmen nach ins Ausland, nach Wiesbaden, gereist sei, daß es ein Mittel gegen graue Haare gebe, daß jemand einen leichten Kutschwagen verkaufen wolle und daß eine junge Frau eine Stelle suche; aber er empfand diesmal nicht das stille, mit Ironie gemischte Vergnügen, das ihm das Lesen solcher Notizen sonst bereitete.
Als er mit der Zeitungslektüre fertig war, eine große Semmel mit Butter verzehrt und eine zweite Tasse Kaffee zu sich genommen hatte, stand er auf, schüttelte die Brotkrümel von der Weste ab, wölbte seine breite Brust und lächelte zufrieden – nicht etwa, weil ihm etwas besonders Angenehmes eingefallen wäre, sondern dank seiner guten Verdauung.
Doch dieses freudige Lächeln rief ihm auch sofort das Vorgefallene ins Gedächtnis, und er machte ein nachdenkliches Gesicht.
Hinter der Tür wurden zwei Kinderstimmen laut, in denen Stepan Arkadjitsch die Stimmen seines Söhnchens Grischa und des etwas älteren Töchterchens Tanja erkannte.
»Ich habe dir doch gesagt, daß man die Passagiere nicht aufs Dach setzen kann!« rief das Mädchen auf englisch. »Sammle sie jetzt auf!«
Alles ist in Unordnung geraten, dachte Stepan Arkadjitsch, sogar die Kinder sind sich selbst überlassen. Er ging an die Tür und rief die beiden zu sich. Sie ließen die Schachtel, die einen Eisenbahnwagen darstellen sollte, liegen und kamen zum Vater.
Tanja, Vaters Liebling, kam stürmisch hereingelaufen, umarmte ihn und blieb lachend an seinem Halse hängen, um mit Behagen den ihr wohlbekannten Duft einzuatmen, der von seinem Bart ausging. Nachdem sie endlich sein von der gebückten Stellung gerötetes und vor Zärtlichkeit strahlendes Gesicht geküßt hatte, zog sie die Arme zurück und wollte weglaufen; doch der Vater hielt sie zurück.
»Was macht Mama?« fragte er und strich mit der Hand über den weichen, zarten Nacken des Töchterchens. »Guten Morgen«, fügte er lächelnd, zu dem Knaben gewandt, hinzu, der zur Begrüßung herangetreten war.
Er war sich bewußt, daß er den Knaben weniger liebte, und bemühte sich stets, die Kinder gleichmäßig zu behandeln; aber der Knabe spürte das und beantwortete das kalte Lächeln des Vaters nicht mit einem Lächeln.
»Mama? Sie ist aufgestanden«, antwortete das Mädchen.
Stepan Arkadjitsch seufzte. Dann hat sie wieder die ganze Nacht nicht geschlafen! sagte er sich.
»Nun, ist sie guter Laune?«
Tanja wußte, daß Vater und Mutter sich verzankt hatten und daß die Mutter nicht guter Laune sein konnte; sie meinte auch, daß der Vater das wissen müsse und sich verstellte, wenn er so leichthin danach fragte. Und sie errötete für den Vater. Er merkte das sofort und wurde auch rot.
»Ich weiß nicht«, antwortete Tanja. »Sie hat gesagt, wir brauchen heute nicht zu lernen und sollen mit Miss Hull zu Großmama gehen.«
»Nun, dann gehe, mein Liebling. Ach so, warte mal«, sagte er, hielt sie noch einmal zurück und streichelte ihr weiches Händchen.
Er nahm vom Kaminsims eine Schachtel mit Konfekt, die er am Abend zuvor dorthin gestellt hatte, und wählte für sie zwei Stück aus: ein Schokoladen- und ein Sahnepraline, die ihr, wie er wußte, am besten schmeckten.
»Für Grischa?« fragte Tanja und zeigte auf das Schokoladenkonfekt.
»Ja, ja.« Und nachdem er nochmals ihre schmale Schulter gestreichelt und sie auf Hals und Haarwurzeln geküßt hatte, gab er sie frei.
»Der Wagen ist vorgefahren«, meldete Matwej. »Und eine Bittstellerin wartet auch noch«, fügte er hinzu.
»Schon lange?« fragte Stepan Arkadjitsch.
»Ein halbes Stündchen vielleicht.«
»Wie oft schon hat man dir gesagt, daß du immer sofort zu melden hast!«
»Man muß Ihnen doch wenigstens Zeit lassen, Kaffee zu trinken«, antwortete Matwej in jenem freundschaftlich-groben Ton, den man ihm nie übelnehmen konnte.
»Nun, dann bitte sie jetzt aber ganz schnell herein«, sagte Oblonski mit unwillig gerunzelter Stirn.
Die Bittstellerin, Witwe eines Stabshauptmanns Kalinin, hatte ein ganz unmögliches und sinnloses Anliegen. Aber seiner Gewohnheit gemäß nötigte er sie, Platz zu nehmen, hörte sie aufmerksam und ohne sie zu unterbrechen an und erteilte ihr einen ausführlichen Rat, was sie unternehmen und an wen sie sich wenden solle; er gab ihr sogar für die Persönlichkeit, die ihr nützlich sein konnte, eine durchaus gewandt verfaßte Empfehlung mit, die er in seiner forschen, breiten, schönen und deutlichen Handschrift niederschrieb. Nachdem er die Frau entlassen hatte, nahm er seinen Hut und blieb einen Augenblick stehen, um nachzudenken, ob er vielleicht etwas vergessen hätte. Nein, er hatte nichts vergessen, bis auf das eine, was er vergessen wollte – den Gang zu seiner Frau.
»Ach ja!« Er ließ den Kopf sinken, und sein hübsches Gesicht nahm einen betrübten Ausdruck an. Soll ich, oder soll ich nicht? fragte er sich selbst. Eine Stimme in seinem Innern sagte ihm, daß es zwecklos sei, zu seiner Frau zu gehen, daß dies nur zu einer Heuchelei führen würde und daß es keine Möglichkeit gebe, ihre Beziehungen zu verbessern und wiederherzustellen, weil es eben unmöglich sei, ihr aufs neue ein anziehendes, verführerisches Aussehen zu geben oder ihn in einen hinfälligen, nicht mehr der Liebe bedürftigen Greis zu verwandeln. Jetzt konnte alles nur auf Heuchelei und Lüge hinauslaufen; Heuchelei und Lüge aber waren seiner Natur zuwider.
»Ja, aber irgendwann muß es ja doch sein; bei dem jetzigen Zustand kann es doch nicht bleiben«, sagte er und versuchte sich Mut zuzusprechen. Er wölbte die Brust, nahm eine Zigarette, zündete sie an, machte zwei tiefe Züge, warf sie in die als Aschenbecher dienende Perlmuttmuschel, durchquerte mit schnellen Schritten den finsteren Salon und öffnete die andere Tür – die Tür zum Zimmer seiner Frau.
4
Darja Alexandrowna, in einer Morgenjacke, ihr einstmals dichtes und schönes, mittlerweile stark gelichtetes Haar im Nacken zu einem Knoten aufgesteckt, stand mit großen, erschrockenen, in dem hageren, eingefallenen Gesicht scharf hervortretenden Augen inmitten aller möglichen im Zimmer herumliegenden Sachen vor einer geöffneten Chiffonniere, aus der sie irgend etwas heraussuchte. Als sie die Schritte ihres Mannes hörte, hielt sie inne, blickte nach der Tür und versuchte vergeblich, ihrem Gesicht einen strengen und verächtlichen Ausdruck zu geben. Sie empfand Angst vor ihm, Angst vor der bevorstehenden Auseinandersetzung. Sie hatte eben erst versucht, das zu tun, wozu sie sich innerhalb dieser drei Tage wohl schon zehnmal angeschickt hatte: die Kindersachen und ihre eigenen Kleider auszusuchen, die sie zu ihrer Mutter bringen wollte – und konnte sich wiederum nicht dazu entschließen. Nach wie vor jedoch hielt sie an der Überzeugung fest, daß es so nicht weitergehen könne, daß sie irgend etwas unternehmen müsse, um ihren Mann zu bestrafen, zu blamieren und ihm wenigstens zu einem geringen Teil das Leid heimzuzahlen, das er ihr zugefügt hatte. Sie redete sich immer noch ein, daß sie ihn verlassen werde, fühlte indessen, daß dies unausführbar sei; unausführbar deshalb, weil sie sich nicht an den Gedanken gewöhnen konnte, ihn fortan nicht mehr als ihren Mann anzusehen und nicht mehr zu lieben. Zudem dachte sie daran, daß es ihr schon hier, im eigenen Hause, schwergefallen war, mit ihren fünf Kindern allen Anforderungen gerecht zu werden, und daß es damit an jedem andern Ort, wenn sie mit der ganzen Kinderschar hinkäme, noch schlechter bestellt sein würde. Auch so schon war das jüngste in diesen drei Tagen erkrankt, weil man ihm sauer gewordene Bouillon zu trinken gegeben hatte, und die vier anderen waren gestern so gut wie ganz ohne Mittagessen geblieben. Sie fühlte, daß ein Verlassen des Hauses völlig unmöglich war; aber sie gab sich einer Selbsttäuschung hin, indem sie dennoch die Sachen aussortierte und so tat, als führe sie weg.
Als ihr Mann ins Zimmer trat, griff sie mit der Hand in die Schublade der Chiffonniere und gab sich den Anschein, dort etwas zu suchen. Zu ihm blickte sie sich erst um, als er dicht an sie herangetreten war, wobei jedoch ihr Gesicht, dem sie einen strengen und energischen Ausdruck geben wollte, nur Fassungslosigkeit und Kummer ausdrückte.
»Dolly!« sagte Stepan Arkadjitsch mit leiser, sanfter Stimme. Er zog den Kopf ein und bemühte sich, zerknirscht und demütig auszusehen, strahlte indessen dennoch Frische und Gesundheit aus.
Sie musterte mit einem schnellen Blick vom Kopf bis zu den Füßen seine von Frische und Gesundheit strotzende Erscheinung. Ja, er ist glücklich und zufrieden, dachte sie. Und ich? … Seine ganze Gutmütigkeit, um derentwillen ihn alle lieben und loben, ist widerlich; ich hasse diese Gutmütigkeit! Sie preßte den Mund zusammen, und auf der rechten Wange ihres blassen, nervösen Gesichts wurde ein Zucken der Muskeln bemerkbar.
»Was wünschen Sie?« fragte sie hastig mit hohler, gleichsam fremder Stimme.
»Dolly!« wiederholte er mit einem Zittern in der Stimme. »Anna kommt heute zu uns.«
»Was habe ich damit zu tun? Ich kann sie nicht empfangen!« rief sie aus.
»Aber das geht doch nicht, Dolly …«
»Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie!« schrie sie, ohne ihn anzusehen, und dieser Schrei klang so, als sei er von einem physischen Schmerz hervorgerufen.
Stepan Arkadjitsch hatte bei dem Gedanken an seine Frau bis jetzt die Ruhe bewahrt, hatte gehofft, daß »es schon werden wird«, wie Matwej sich ausgedrückt hatte, und es war ihm möglich gewesen, in Ruhe die Zeitung zu lesen und seinen Kaffee zu trinken; doch als er jetzt ihr gequältes, leidendes Gesicht vor sich hatte und den verzweifelten, herzzerreißenden Ton ihrer Stimme hörte, da verschlug es ihm den Atem, irgend etwas schnürte ihm die Kehle zusammen, und in seinen Augen schimmerten Tränen.
»Mein Gott, was habe ich angerichtet! Dolly! Um Gottes willen! Ich …« Er konnte nicht weitersprechen, Tränen erstickten seine Stimme.
Sie schlug die Schublade der Chiffonniere zu und sah ihm ins Gesicht.
»Dolly, was kann ich dir sagen? – Nur das eine: Vergib mir, vergib mir. .. Denke an die Vergangenheit: Wiegen denn neun Jahre unseres Lebens gar nichts gegen ein paar Augenblicke der … der …«
Sie schlug die Augen nieder, und während sie auf seine nächsten Worte wartete, schien sie ihn gleichsam anzuflehen, daß er sie irgendwie von seiner Schuldlosigkeit überzeugen möge.
»Augenblicke der Leidenschaft …«, fuhr er fort und wollte weitersprechen, doch bei diesem Wort preßten sich Darja Alexandrownas Lippen erneut wie unter einem physischen Schmerz zusammen, und auf der rechten Wange begannen wieder die Gesichtsmuskeln zu zucken.
»Gehen Sie, gehen Sie!« schrie sie noch erregter als zuvor. »Und reden Sie mir nicht von Ihrer Leidenschaft und Schändlichkeit!«
Sie schickte sich an, das Zimmer zu verlassen, wankte aber und griff nach einer Stuhllehne, um sich zu stützen. Das Gesicht Stepan Arkadjitschs verzog sich, die Lippen schwollen an, und seine Augen füllten sich mit Tränen.
»Dolly!« stammelte er, gegen das Schluchzen ankämpfend. »Um Gottes willen, denke an die Kinder, sie sind schuldlos. Ich bin schuld, und du kannst mich bestrafen, kannst mich meine Schuld büßen lassen. Ich bin zu allem bereit, was in meiner Macht steht! Ich bin schuld. Es gibt keine Worte dafür, wie groß meine Schuld ist! Aber dennoch, Dolly, verzeih mir!«
Sie setzte sich. Er hörte ihre schweren, lauten Atemzüge, und sie tat ihm unsagbar leid. Sie setzte mehrmals zum Sprechen an, war aber nicht fähig, ein Wort hervorzubringen. Er wartete.
»Du denkst an die Kinder, weil du mit ihnen spielen willst, aber ich denke an sie, weil ich weiß, daß sie so zugrunde gerichtet werden.« Sie sprach offenbar einen der Gedanken aus, die sie sich während dieser drei Tage unzählige Male wiederholt hatte.
Er blickte sie dankbar an, weil sie ihn mit du angeredet hatte, und schickte sich an, nach ihrer Hand zu greifen; doch sie wandte sich mit Widerwillen von ihm ab.
»Ich denke an die Kinder und würde deshalb alles nur Erdenkliche tun, um sie zu retten. Aber ich weiß selbst nicht, wie ich sie retten soll: indem ich sie ihrem Vater entziehe oder indem ich sie einem Wüstling von Vater überlasse – ja, ja, einem Wüstling von Vater … Sagen Sie selbst, ist denn nach dem … was geschehen ist, noch ein Zusammenleben zwischen uns möglich? Ist das überhaupt möglich? Sagen Sie selbst, ist es überhaupt möglich?« wiederholte sie mit erhöhter Stimme. »Nachdem mein Mann, der Vater meiner Kinder, ein Verhältnis mit der Gouvernante seiner Kinder angefangen hat …«
»Aber was soll man nun machen? Was soll man machen?« stammelte er mit kläglicher Stimme, ohne selbst zu wissen, was er sprach, und ließ den Kopf immer tiefer sinken.
»Sie sind mir zuwider, ich verabscheue Sie!« schrie sie, sich mehr und mehr ereifernd. »Ihre Tränen sind nichts als Wasser! Sie haben mich nie geliebt, Sie besitzen weder Herz noch Ehrgefühl! Sie sind mir verhaßt, widerwärtig, ein Fremder – ja, ein ganz Fremder!« fügte sie zornig und mit besonderer Verbitterung das ihr so schrecklich klingende Wort »Fremder« hinzu.
Er blickte sie an, und der Zorn, der aus ihrem Gesicht sprach, erschreckte und verwunderte ihn. Er begriff nicht, daß sein Mitleid für sie nur dazu beitrug, sie noch mehr zu reizen. Sie sah zwar, daß er sie bemitleidete, nicht aber, daß er sie liebte.
Nein, sie haßt mich, sie wird mir nicht verzeihen, ging es ihm durch den Kopf. Es ist furchtbar! Wirklich furchtbar!
In diesem Augenblick ertönte im Nebenzimmer der Schrei eines Kindes, das anscheinend hingefallen war. Darja Alexandrowna horchte auf, und ihr Gesicht nahm plötzlich einen milderen Ausdruck an.
Sie besann sich ein paar Sekunden, als wüßte sie nicht, wo sie sei und was sie tun solle; dann stand sie schnell auf und ging auf die Tür zu.
Demnach liebt sie doch mein Kind, sagte sich Stepan Arkadjitsch, als er die Veränderung ihres Gesichts beim Aufschrei des Kindes sah. Es ist mein Kind – wie kann sie mich da hassen?
»Dolly, noch ein Wort«, sagte er und folgte ihr.
»Wenn Sie mir nachkommen, rufe ich die Leute zusammen, die Kinder! Mögen alle erfahren, was für ein Schuft Sie sind! Ich reise noch heute ab, dann können Sie mit Ihrer Liebsten hier hausen!«
Sie ging und schlug krachend die Tür hinter sich zu.
Stepan Arkadjitsch stieß einen Seufzer aus, wischte sich das Gesicht ab und trat leise zurück. Matwej sagt: »Es wird schon werden.« Aber wie? Ich sehe keinerlei Möglichkeit. Ach, ach, dieses Unglück! Und wie ordinär sie geschrien hat, sagte er zu sich selbst, als er an ihre Schreie und die Worte »Schuft« und »Liebste« dachte. Womöglich haben es sogar die Dienstboten gehört! Es ist ein Skandal, wirklich ein Skandal! Stepan Arkadjitsch blieb einige Sekunden stehen, trocknete sich die Augen, seufzte und verließ in aufrechter Haltung das Zimmer.
Es war ein Freitag, und der Uhrmacher, ein Deutscher, war gerade dabei, im Speisezimmer die Uhr aufzuziehen. Stepan Arkadjitsch lächelte, weil er sich daran erinnerte, daß er in bezug auf diesen pedantischen kahlköpfigen Uhrmacher einmal einen Witz gemacht und gesagt hatte, der Deutsche sei selbst fürs ganze Leben aufgezogen, um Uhren aufzuziehen. Stepan Arkadjitsch war ein Liebhaber guter Witze. – Vielleicht wird es auch wirklich werden? Das ist gut gesagt: Es wird schon werden! dachte er bei sich. Das muß man festhalten.
»Matwej! Für Anna Arkadjewna richtest du also mit Marja das Gästezimmer her«, trug er dem Kammerdiener auf, als dieser auf seinen Ruf erschien.
»Jawohl.«
Stepan Arkadjitsch zog seinen Pelz an und trat auf die Freitreppe hinaus.
»Kommen Sie zum Essen nach Hause?« fragte Matwej, der ihn zum Wagen begleitete.
»Wie es sich ergeben wird. Und hier – für die Einkäufe«, sagte er und gab ihm aus seiner Brieftasche zehn Rubel. »Ist’s genug?«
»Genug oder nicht genug, es muß eben reichen«, antwortete Matwej beim Zuschlagen der Wagentür und trat auf die Treppe zurück.
Darja Alexandrowna, die inzwischen das Kind beruhigt hatte, schloß aus dem Rädergerassel, daß ihr Mann abgefahren war, und kehrte ins Schlafzimmer zurück. Dies war der einzige Ort, wo sie Zuflucht vor den häuslichen Sorgen fand, die sofort auf sie einstürmten, wenn sie über die Schwelle trat. Auch jetzt, während ihres kurzen Aufenthalts im Kinderzimmer, hatten die englische Erzieherin und Matrjona Filimonowna ihr mehrere Fragen vorgelegt, die keinen Aufschub duldeten und nur von ihr entschieden werden konnten: was den Kindern für den Spaziergang anzuziehen sei, ob sie Milch bekommen sollten, ob man nicht einen neuen Koch ausfindig machen müsse.
»Ach, laßt mich in Ruhe, laßt mich in Ruhe!« hatte sie abgewehrt; und nun, als sie ins Schlafzimmer zurückgekehrt war, setzte sie sich auf denselben Platz, auf dem sie mit ihrem Mann gesprochen hatte; sie preßte die abgemagerten Hände zusammen, an deren knochigen Fingern die Ringe abrutschten, und begann in Gedanken das ganze Gespräch, das kurz zuvor stattgefunden hatte, zu rekapitulieren. Er ist losgefahren! Aber auf welche Weise hat er denn nun mit ihr Schluß gemacht? fragte sie sich. Oder kommt er am Ende auch jetzt noch mit ihr zusammen? Warum habe ich ihn nicht danach gefragt? Nein, nein, eine Versöhnung ist nicht möglich. Selbst wenn wir unter demselben Dache bleiben, werden wir füreinander Fremde sein. Fremde für immer! wiederholte sie abermals mit besonderer Betonung dieses für sie so schreckliche Wort. Und wie habe ich ihn doch geliebt, oh, mein Gott, wie habe ich ihn geliebt! Wie geliebt! Und liebe ich ihn etwa nicht auch jetzt? Vielleicht sogar noch stärker als früher? Am schlimmsten ist vor allem, daß … Sie brach ihren Gedankengang ab, weil Matrjona Filimonowna den Kopf zur Tür hereinsteckte.
»Lassen Sie doch wenigstens meinen Bruder holen«, sagte sie. »Irgendwie wird er schon ein Mittagessen herrichten; sonst kriegen die Kinder wieder so wie gestern bis um sechs nichts in den Magen.«
»Nun gut, ich komme gleich und werde alles anordnen. Ist schon nach frischer Milch geschickt?«
Und Darja Alexandrowna vertiefte sich in die alltäglichen Sorgen und unterdrückte durch sie vorübergehend ihren Kummer.
5
Das Lernen in der Schule war Stepan Arkadjitsch dank seinen Fähigkeiten nicht schwergefallen, aber er war faul und ein Luftikus gewesen und hatte daher das Abschlußexamen als einer der letzten gemacht. Doch ungeachtet seines von jeher lustigen Lebenswandels, seiner erst kurzen Karriere und seines noch jugendlichen Alters bekleidete er jetzt bereits den ehrenvollen und gutdotierten Posten des Direktors einer Moskauer Behörde. Diesen Posten hatte ihm der Mann seiner Schwester Anna verschafft – Alexej Alexandrowitsch Karenin, der in dem Ministerium, dem die betreffende Behörde unterstand, einen der wichtigsten Posten einnahm. Aber auch wenn Karenin seinen Schwager nicht auf diesen Posten gesetzt hätte, würden noch hundert andere Personen mit Hilfe von Brüdern, Schwestern, Vettern, Onkeln und Tanten dafür gesorgt haben, daß Stiwa Oblonski diesen oder einen ähnlichen Posten mit einem Gehalt von sechstausend Rubel erhalten hätte; und diese Summe brauchte er auch, weil seine finanziellen Verhältnisse trotz des ansehnlichen Vermögens seiner Frau dauernd zerrüttet waren.
Mit halb Moskau und halb Petersburg war Stepan Arkadjitsch verwandt oder befreundet. Er war in den Kreis jener Menschen hineingeboren, die zu den Mächtigen dieser Welt gehörten oder dazu geworden waren. Ein Drittel dieses Kreises, hohe Würdenträger in vorgeschrittenem Alter, hatte zum Freundeskreis seines Vaters gehört und ihn selbst schon als Baby gekannt; mit dem zweiten Drittel stand er auf Duzfuß, und der Rest bestand aus guten Bekannten. Alle, die irdische Güter zu vergeben hatten, sei es in Form guter Posten, günstiger Pachtverträge, Konzessionen und dergleichen mehr, gehörten somit zu seinem Freundeskreis und konnten einen der Ihrigen nicht übergehen. Oblonski hatte es nicht nötig, sich um einen guten Posten besonders zu bemühen; er brauchte ihn nur anzunehmen und nicht neidisch, zänkisch und übelnehmerisch zu sein, was er bei der ihm eigenen Gutmütigkeit ohnehin nie war. Es wäre ihm lächerlich vorgekommen, wenn ihm jemand gesagt hätte, er könne nicht einen Posten mit dem Gehalt bekommen, das er benötigte, zumal er keine übertriebenen Ansprüche stellte; er verlangte nur das, was seine Altersgenossen erhielten, und einen derartigen Posten ausfüllen konnte er ebensogut wie jeder andere.
Stepan Arkadjitsch war nicht nur bei allen, die ihn kannten, wegen seiner Gutmütigkeit, seines heiteren Gemüts und seiner unzweifelhaften Ehrlichkeit beliebt, sondern darüber hinaus war seiner schönen, lichten Erscheinung, den glänzenden Augen, dunklen Brauen und Haaren sowie dem frischen geröteten Gesicht auch rein körperlich ein solcher Charme eigen, daß jeder, der mit ihm zusammentraf, für ihn eingenommen und froh gestimmt wurde. »Sieh da! Stiwa! Oblonski! Da ist er ja!« riefen fast alle mit einem vergnügten Lächeln, wenn sie ihm begegneten. Und wenn sich nach dem Gespräch mitunter auch herausstellte, daß zu einer besonderen Freude gar kein Anlaß vorlag – am nächsten und übernächsten Tage wurde er von allen mit der gleichen Freude begrüßt.
In seiner Stellung als Direktor einer Moskauer Regierungsbehörde, die er seit drei Jahren einnahm, hatte sich Stepan Arkadjitsch außer der Zuneigung auch die Achtung seiner Kollegen, Untergebenen, Vorgesetzten und überhaupt aller erworben, mit denen er dienstlich zu tun hatte. Die Haupteigenschaften, die ihm diese allgemeine Achtung im Amt eingebracht hatten, bestanden erstens in seinem überaus nachsichtigen Verhalten, das auf dem Bewußtsein seiner eigenen Unzulänglichkeit beruhte, zweitens in seiner durch und durch liberalen Einstellung – nicht jener, die er aus den Zeitungen geschöpft hatte, sondern derjenigen, die ihm im Blute lag und auf Grund derer er jedermann, unabhängig von Stand und Vermögen, völlig gleichmäßig behandelte, und drittens – das war die Hauptsache – in dem völligen Gleichmut, mit dem er sein Amt versah, so daß er stets die Ruhe bewahrte und sich niemals zu unbedachten Handlungen hinreißen ließ.
An Ort und Stelle angekommen, ging Stepan Arkadjitsch, ehrerbietig geleitet vom Portier und mit seiner Aktentasche unter dem Arm, in sein kleines Privatbüro, legte den Dienstrock an und begab sich in den Sitzungssaal. Dort erhoben sich bei seinem Eintritt sämtliche Schreiber und Beamte und verneigten sich freundlich und respektvoll zu seiner Begrüßung. Stepan Arkadjitsch ging wie immer mit schnellen Schritten auf seinen Sessel zu, drückte den Herren am Sitzungstisch die Hand und nahm Platz. Nachdem er mit dem einen und anderen ein paar Worte gewechselt und gescherzt hatte – gerade so viel, wie es schicklich war –, wandte er sich den Akten zu. Niemand verstand es besser als Stepan Arkadjitsch, jene Mittellinie zwischen zwangloser und offizieller Haltung zu bestimmen, die zu einer angenehmen Abwicklung der dienstlichen Angelegenheiten nötig war. Der Sekretär trat freundlich und respektvoll, wie sich alle in Stepan Arkadjitschs Gegenwart verhielten, mit einem Aktenstück an ihn heran und sagte in dem ungezwungenfreimütigen Ton, den Stepan Arkadjitsch eingeführt hatte:
»Wir haben nun doch noch die Unterlagen von der Pensaer Gouvernementsverwaltung beschafft. Wünschen Sie vielleicht …«
»Ja? Ist es endlich gelungen?« sagte Stepan Arkadjitsch und schob einen Finger zwischen das Aktenstück. »Nun denn, meine Herren …« Und die Sitzung nahm ihren Anfang.
Wenn sie ahnten, dachte er, während er mit bedeutungsvoll auf die Seite gelegtem Kopf einen Bericht anhörte, als was für ein begossener Pudel ihr Vorsitzender vor knapp einer halben Stunde dagestanden hat! Und in seinen Augen spiegelte sich beim Verlesen des Berichts ein Lächeln.
Die Sitzung sollte programmgemäß ohne Unterbrechung bis zwei Uhr andauern; um zwei sollte dann eine Frühstückspause folgen. Es war noch nicht ganz zwei Uhr, als die große Glastür plötzlich geöffnet wurde und jemand den Sitzungssaal betrat. Von allen Seiten blickten sich die über eine kleine Abwechslung erfreuten Beamten neugierig zur Tür um; aber der an der Tür postierte Portier hatte den Eingetretenen sofort hinausgewiesen und schloß die Glastür hinter ihm.
Nachdem der Vortrag beendet war, stand Stepan Arkadjitsch auf, reckte die Glieder, entnahm, liberalen Gepflogenheiten der Zeit huldigend, noch im Sitzungssaal seinem Etui eine Zigarette und ging in sein Privatbüro. Zwei seiner Kollegen, der im Dienst alt und grau gewordene Nikitin und der Kammerjunker Grinewitsch, schlossen sich ihm an.
»Nach dem Frühstück werden wir fertig«, bemerkte Stepan Arkadjitsch.
»Ohne weiteres!« bekräftigte Nikitin.
»Na, dieser Fomin muß doch ein ganz durchtriebener Bursche sein«, äußerte sich Grinewitsch über eine der Personen, die in der vorliegenden Sache eine Rolle spielten. Stepan Arkadjitsch runzelte die Stirn und gab damit zu verstehen, daß es ungehörig sei, vor Abschluß der Sache ein Urteil abzugeben; er ließ die Bemerkung Grinewitschs unbeantwortet.
»Wer war da vorhin gekommen?« fragte er den Portier.
»Irgendein Mann, Exzellenz; er ist ohne Erlaubnis eingedrungen, kaum daß ich mal den Rücken gekehrt hatte. Er wollte Sie sprechen. Ich sagte: Wenn die Herren herauskommen, dann …«
»Und wo ist er geblieben?«
»Er ist hier die ganze Zeit auf und ab gewandert und jetzt wahrscheinlich in den Flur gegangen. Da kommt er ja«, sagte der Portier und zeigte auf einen stämmigen, breitschultrigen Mann mit gewelltem Bart, der, ohne seine Lammfellmütze abzunehmen, mit leichten, schnellen Schritten die abgetretenen Stufen der Steintreppe heraufgeeilt kam. Ein hagerer Beamter, der mit einer Aktentasche unter dem Arm die Treppe hinunterging, blieb stehen, musterte mißbilligend die Füße des Laufenden und blickte dann fragend zu Oblonski hinüber.
Stepan Arkadjitsch stand am Treppengeländer. Sein gutmütig strahlendes Gesicht leuchtete über dem goldbestickten Kragen der Uniform noch heller auf, als er den Ankömmling erkannte.
»Er ist es wirklich! Lewin, endlich mal!« rief er aus und musterte den auf ihn zukommenden Lewin mit einem herzlichen, ein wenig ironischen Lächeln. »Hast du dich gar nicht gescheut, mich in diesem Sündenpfuhl aufzusuchen?« fragte er und ließ es nicht bei einem Händedruck bewenden, sondern küßte seinen Freund auch noch. »Schon lange hier?«
»Ich bin eben angekommen, und es lag mir sehr daran, dich gleich zu sprechen«, antwortete Lewin, wobei er halb verlegen, halb ärgerlich und unruhig um sich blickte.
»Nun, dann gehen wir in mein Zimmer«, sagte Stepan Arkadjitsch, der die Empfindlichkeit und übermäßige Schüchternheit seines Freundes kannte; er nahm ihn am Arm und zog ihn mit sich, als führe er ihn durch verschiedene Gefahren hindurch.
Stepan Arkadjitsch duzte sich fast mit allen seinen Bekannten: mit sechzig Jahre alten Männern und zwanzigjährigen Jünglingen, mit Schauspielern und Ministern, mit Kaufleuten und Generaladjutanten, so daß viele der Leute, die mit ihm auf Duzfuß standen, die beiden äußersten Pole der gesellschaftlichen Rangordnung einnahmen, und sie wären sehr erstaunt gewesen, wenn sie erfahren hätten, daß sie durch Oblonski als Bindeglied etwas miteinander gemein hatten. Er duzte sich mit jedem, mit dem er Champagner trank, und da er Champagner mit allen trank, kam es vor, daß er im Beisein seiner Untergebenen mit »kompromittierenden Duzbrüdern« zusammentraf, wie er scherzhaft manche seiner Freunde nannte, doch verstand er es dank dem ihm eigenen Takt, das für die Untergebenen Peinliche der Situation zu mildern. Lewin war kein »kompromittierender Duzbruder«, aber da Stepan Arkadjitsch mit seinem Feingefühl erriet, daß Lewin der Meinung war, es könnte ihm unangenehm sein, ihre intime Freundschaft in Gegenwart Untergebener zu bekunden, beeilte er sich, ihn in sein Zimmer zu führen.
Lewin und Oblonski waren fast gleichaltrig und standen nicht nur infolge gemeinsamer Champagnergelage auf Duzfuß. Lewin war Oblonskis Kamerad und Freund von frühester Jugend an. Sie liebten einander trotz der Verschiedenheit ihrer Charaktere und Neigungen, wie eben Menschen aneinander hängen, deren Freundschaft bis in die erste Jugendzeit zurückreicht. Aber sie hatten sich auch unterschiedliche Wirkungskreise erwählt, und wie es in solchen Fällen häufig geschieht, betrachtete ein jeder die Tätigkeit des andern, obwohl er sie bei objektiver Überlegung nicht verurteilen konnte, im Grunde seines Herzens doch mit Geringschätzung. Jeder glaubte, das Leben, das er führte, sei das einzig wahre Leben, das des andern hingegen nur ein Trugbild. Oblonski konnte sich nie eines leicht ironischen Lächelns erwehren, wenn er Lewins ansichtig wurde. Lewin, der auf dem Lande irgendeinen Posten bekleidete, hatte Stepan Arkadjitsch schon so oft besucht, wenn er nach Moskau gekommen war, aber worin seine Tätigkeit auf dem Lande eigentlich bestand, das hatte Oblonski nie recht begriffen und sich auch nicht dafür interessiert.
Lewin, der es bei seinen Besuchen in Moskau immer sehr eilig hatte, sich aufregte, ein wenig verschüchtert und durch die eigene Schüchternheit gereizt war, kam fast jedesmal mit neuen Ansichten an. Stepan Arkadjitsch machte sich darüber lustig und fand daran Gefallen. Umgekehrt sah auch Lewin im Grunde seines Herzens mit Spott auf die städtische Lebensweise seines Freundes und dessen Dienst herab, den er für sinnlos hielt und über den er sich seinerseits lustig machte. Ein Unterschied bestand nur insofern, als Stepan Arkadjitsch, der das tat, was alle taten, selbstsicher und gutmütig spöttelte, während Lewin, dem diese Selbstsicherheit fehlte, sich mitunter sehr ereiferte.
»Wir haben dich schon lange erwartet«, sagte Stepan Arkadjitsch, als er mit Lewin sein Privatbüro betrat und, als ob nichts mehr zu befürchten sei, dessen Arm losließ. »Ich bin sehr, sehr froh, daß du gekommen bist«, fuhr er fort. »Nun, wie geht es dir? Was treibst du? Wann bist du angekommen?«
Lewin schwieg und musterte die Gesichter der beiden ihm unbekannten Kollegen Oblonskis, insbesondere die Hände des eleganten Grinewitsch mit ihren langen weißen Fingern, den langen gelben, an ihren Spitzen gewölbten Fingernägeln und den riesigen glänzenden Manschettenknöpfen; diese Hände schienen seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen und alle seine Gedanken zu paralysieren. Oblonski merkte es sofort und lächelte.
»Ach so, darf ich bekannt machen«, sagte er. »Meine Kollegen: Filipp Iwanytsch Nikitin, Michail Stanislawitsch Grinewitsch«, und auf Lewin deutend: »Ein Mitglied des Semstwos, ein Mann der Reformen, Sportbegeisterter, der fünf Pud mit einer Hand stemmt, Viehzüchter, Jäger und mein Freund, Konstantin Dmitritsch Lewin, ein Bruder Sergej Iwanytsch Kosnyschews.«
»Sehr angenehm«, murmelte der alte Nikitin.
»Ich habe die Ehre, Ihren Herrn Bruder Sergej Iwanytsch zu kennen«, sagte Grinewitsch und reichte ihm seine schmale Hand mit den langen Fingernägeln.
Lewins Gesicht verfinsterte sich; er drückte kühl die ihm dargebotene Hand und wandte sich dann sofort zu Oblonski um. Obwohl er seinen Stiefbruder, einen in ganz Rußland bekannten Schriftsteller, sehr verehrte, konnte er es nicht ausstehen, wenn man in ihm selbst nicht Konstantin Lewin, sondern den Bruder des berühmten Kosnyschew sah.
»Nein, mit dem Semstwo habe ich nichts mehr zu tun. Ich habe mich mit allen überworfen und besuche auch die Sitzungen nicht mehr«, sagte er, zu Oblonski gewandt.
»Das ist aber schnell gegangen!« sagte Oblonski mit einem Lächeln. »Warum denn? Wieso?«
»Es ist eine lange Geschichte. Ich werde sie dir ein andermal erzählen«, sagte Lewin, fuhr aber dennoch gleich fort: »Nun, kurz gesagt, ich habe mich überzeugt, daß das ganze Semstwo keinen Sinn hat und auch nicht haben kann«, sprudelte er so erregt hervor, als ob ihn eben jemand beleidigt hätte. »Einerseits ist das Ganze eine Spielerei, man spielt Parlament, und ich bin weder jung noch alt genug, an Spielzeug Gefallen zu finden; andererseits« (er verhaspelte sich) »stellt es für die coterie dort ein Mittel dar, zu Geld zu kommen. Früher nahmen es die Treuhänder, die Gerichte, jetzt nehmen es die Semstwos, wenn auch nicht in Form von Schmiergeldern, so doch in Form unverdienter Gehälter«, sagte er mit solcher Heftigkeit, als hätte ihm jemand der Anwesenden widersprochen.
»Aha! Du schwimmst, wie ich sehe, wieder in einem neuen Fahrwasser, dem konservativen«, sagte Stepan Arkadjitsch. »Doch hierüber noch später.«
»Ja, später. Aber ich muß dich dringend sprechen«, sagte Lewin und starrte dabei wütend auf Grinewitschs Hand.
Über Stepan Arkadjitschs Gesicht huschte ein kaum merkliches Lächeln.
»Hast du nicht gesagt, du wolltest dich nie wieder nach europäischer Mode kleiden?« fragte er, als er Lewins neuen, offenbar von einem französischen Schneider stammenden Anzug musterte. »Na ja, ich sehe schon: eine neue Phase.«
Lewin wurde plötzlich rot, doch nicht so, wie gelegentlich Erwachsene erröten, ohne es selbst zu bemerken, sondern wie ein kleiner Junge, der das Komische seiner Schüchternheit fühlt, sich dessen schämt und infolgedessen noch mehr errötet und nahe daran ist, in Tränen auszubrechen. Es war so peinlich, in diesem klugen, männlichen Gesicht eine so kindliche Verlegenheit wahrzunehmen, daß Oblonski unwillkürlich die Augen abwandte.
»Wo können wir uns also treffen?« fragte Lewin. »Ich habe wirklich sehr, sehr dringend mit dir zu sprechen.«
Oblonski überlegte.
»Machen wir es so: Wir fahren zu Gurin, frühstücken dort und unterhalten uns dabei. Bis drei Uhr bin ich frei.«
»Nein«, antwortete Lewin nach kurzem Nachdenken, »ich muß vorher noch etwas erledigen.«
»Nun schön, dann essen wir eben danach gemeinsam zu Mittag.«
»Zu Mittag? Ich habe ja gar nichts Besonderes, nur zwei Worte, und aussprechen können wir uns immer noch.«
»Dann sage doch schon die zwei Worte, und beim Mittagessen plaudern wir dann gemütlich.«
»Nun, die zwei Worte – es ist übrigens nichts von Belang«, sagte Lewin.
Sein Gesicht nahm plötzlich einen bösen Ausdruck an, was von der Anstrengung herrührte, mit der er gegen seine Schüchternheit ankämpfte.
»Wie geht es bei den Stscherbazkis? Alles beim alten?« fragte er.
Stepan Arkadjitsch, der schon lange wußte, daß Lewin in seine Schwägerin Kitty verliebt war, unterdrückte ein Lächeln, und in seinen Augen erschien ein lustiges Fünkchen.
»Du sprachst von zwei Worten, aber in zwei Worten läßt sich das nicht beantworten, weil … Entschuldige einen Augenblick …«
Der Sekretär trat ein – in respektvoll-vertraulicher Haltung, in der sich zugleich ein wenig das allen Sekretären eigene Bewußtsein ausdrückte, in dienstlichen Angelegenheiten besser bewandert zu sein als der Chef; er legte Stepan Arkadjitsch ein Aktenstück vor und begann, scheinbar fragend, irgendeine Schwierigkeit zu erklären. Stepan Arkadjitsch unterbrach ihn jedoch und legte seine Hand freundlich auf den Arm des Sekretärs.
»Nein, halten Sie sich nur an meine Anweisungen«, sagte er und milderte dabei durch ein Lächeln das Kränkende der Zurechtweisung; dann erklärte er nochmals in großen Zügen, wie er die Sache behandelt wissen wollte, schob das Aktenstück zurück und schloß: »Also machen Sie es bitte so, Sachar Nikititsch.«
Der verwirrte Sekretär entfernte sich. Lewin, der seine Befangenheit während der Auseinandersetzung mit dem Sekretär endgültig abgeschüttelt und, beide Hände auf eine Stuhllehne gestützt, mit spöttischer Aufmerksamkeit zugehört hatte, sagte jetzt:
»Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht …«
»Was verstehst du nicht?« fragte Oblonski vergnügt lächelnd und griff nach einer Zigarette. Er war darauf gefaßt, von Lewin irgendeine tolle Ansicht vorgetragen zu bekommen.
»Ich verstehe nicht, was ihr hier treibt«, sagte Lewin und zuckte die Achseln. »Wie kannst du dich ernsthaft damit abgeben?«
»Wie meinst du das?«
»Es ist doch nur ein Zeitvertreib.«
»Das scheint dir so; wir aber ertrinken in Arbeit.«
»In Bürokratie. Nun ja, das liegt dir eben«, fügte Lewin hinzu.
»Willst du damit sagen, ich sei nicht ernst zu nehmen?«
»Vielleicht auch das«, antwortete Lewin. »Immerhin, ich bewundere trotzdem deine Würde und bin stolz, einen so wichtigen Mann zum Freunde zu haben. Aber meine Frage hast du mir immer noch nicht beantwortet«, fügte er hinzu und blickte seinem Freund mit verzweifelter Anstrengung gerade in die Augen.
»Na, schön, schön. Warten wir ab, und auch du wirst noch dahin gelangen. Du hast gut reden, mit deinen dreitausend Deßjatinen im Kreise Karasinsk, mit solchen Muskeln und der Frische eines zwölfjährigen Mädchens – aber einmal wirst auch du zu uns kommen. Und was deine Frage betrifft: geändert hat sich nichts, aber es ist schade, daß du so lange ausgeblieben bist.«
»Warum?« fragte Lewin bestürzt.
»Ich meinte nur so«, entgegnete Oblonski. »Wir sprechen noch miteinander. Bist du diesmal aus einem bestimmten Grunde gekommen?«
»Ach, darüber wollen wir auch später sprechen«, erwiderte Lewin und wurde wieder bis über beide Ohren rot.
»Nun gut, halten wir es so«, sagte Stepan Arkadjitsch. »Sieh mal, ich würde dich ja zu uns einladen, aber meine Frau fühlt sich nicht ganz wohl. Übrigens, wenn dir daran liegt, kannst du die Damen heute wahrscheinlich zwischen vier und fünf im Zoologischen Garten treffen. Kitty läuft Schlittschuh. Fahre hin, ich hole dich ab, und dann essen wir zusammen.«
»Ausgezeichnet. Also bis dann!«
»Paß aber auf, ich kenne dich ja – du vergißt es womöglich oder fährst plötzlich in dein Dorf zurück!« rief ihm Stepan Arkadjitsch lachend nach.
»Nein, keine Sorge!« rief Lewin zurück und besann sich erst an der Tür darauf, daß er sich auch noch von Oblonskis Kollegen verabschieden mußte.
»Das scheint ja ein sehr energischer Herr zu sein«, bemerkte Grinewitsch, als Lewin gegangen war.
»Ja, ja, mein Lieber, ein wahrer Glückspilz!« sagte Stepan Arkadjitsch und wiegte den Kopf von einer Seite auf die andere. »Dreitausend Deßjatinen im Kreise Karasinsk, das ganze Leben noch vor sich und dabei diese Frische. Anders als unsereins.«
»Worüber haben Sie sich denn zu beklagen, Stepan Arkadjitsch?«
6
Als Oblonski Lewin gefragt hatte, ob er aus einem bestimmten Grunde nach Moskau gekommen sei, war Lewin rot geworden und hatte sich deswegen über sich selbst geärgert; denn rot geworden war er, weil er sich nicht zu der Antwort entschließen konnte: »Ich bin gekommen, um die Hand deiner Schwägerin anzuhalten«, obwohl er einzig zu diesem Zweck gekommen war.
Die Familien der Lewins und Stscherbazkis waren alte Moskauer Adelsgeschlechter, die von jeher in nahen, freundschaftlichen Beziehungen zueinander gestanden hatten. Während der Studienzeit Lewins hatten sich die Beziehungen noch vertieft. Er hatte sich gemeinsam mit dem jungen Fürsten Stscherbazki, dem Bruder Dollys und Kittys, auf das Studium vorbereitet und war zur gleichen Zeit wie er in die Universität eingetreten. Damals hatte Lewin viel bei den Stscherbazkis verkehrt und sich in ihr Haus verliebt. So merkwürdig es auch klingen mag, war es wirklich so, daß er sich buchstäblich in das Haus, in die Familie Stscherbazki verliebt hatte, und ganz besonders in ihre weiblichen Mitglieder. An seine eigene Mutter hatte er keine Erinnerung, und seine einzige Schwester war älter als er, so daß er im Hause der Stscherbazkis zum ersten Male das Milieu einer alten, gebildeten und gediegenen Adelsfamilie kennenlernte, was ihm infolge des frühen Todes seiner Eltern bis dahin nicht beschieden gewesen war. Es schien ihm, alle Mitglieder der Familie Stscherbazki, und namentlich die weiblichen, seien in einen geheimnisvollen, romantischen Schleier gehüllt, und er nahm an ihnen nicht nur keine Mängel wahr, sondern vermutete darüber hinaus, daß sich hinter dem Schleier, der sie einhüllte, die edelsten Gefühle und alle möglichen Vorzüge verbargen. Warum die drei jungen Damen abwechselnd einen Tag um den anderen französisch und englisch sprechen mußten; warum sie, eine die andere ablösend, zu bestimmten Tagesstunden Klavier spielten, was auch im Obergeschoß, wo die Studenten im Zimmer ihres Bruders arbeiteten, zu hören war; warum all die vielen Lehrer für französische Literatur, für Musik, Zeichnen und Tanz ins Haus kamen; warum alle drei jungen Damen mit Mademoiselle Linon zu bestimmten Stunden am Twerskoi Boulevard vorfuhren – Dolly in einem langen, Natalie in einem halblangen und Kitty in einem ganz kurzen pelzgefütterten Atlasmäntelchen, das ihre wohlgeformten Waden in den straff anliegenden roten Strümpfen frei ließ, und warum sie in Begleitung eines Lakaien, dessen Hut mit einer goldenen Kokarde geziert war, auf dem Twerskoi Boulevard promenieren mußten – alles dies und noch vieles andere, was in dieser geheimnisvollen Welt vor sich ging, war ihm ein Rätsel, aber er hielt alles, was dort vor sich ging, für wunderschön und war geradezu in das Geheimnisvolle der Vorgänge verliebt. In seiner Studentenzeit hätte er sich beinahe in Dolly verliebt, die indessen sehr bald den Fürsten Oblonski heiratete. Anschließend bildete er sich ein, die zweite Schwester zu lieben. Er hatte gleichsam das Gefühl, daß er sich in eine der Schwestern verlieben müsse, und wußte nur nicht, in welche von ihnen. Aber auch Natalie fand, kaum daß sie in die Gesellschaft eingeführt war, einen Freier und heiratete den Diplomaten Lwow. Kitty war, als Lewin sein Studium abschloß, noch ein Kind. Der junge Fürst Stscherbazki war zur Marine gegangen und in der Ostsee ums Leben gekommen, worauf sich die Beziehungen Lewins zu den Stscherbazkis, ungeachtet seiner Freundschaft mit Oblonski, gelockert hatten. Doch als er in diesem Jahr zu Anfang des Winters nach einem einjährigen Aufenthalt auf dem Lande nach Moskau gekommen war und die Stscherbazkis besucht hatte, war ihm endgültig klar, welcher der drei Schwestern seine Liebe galt.
Nichts schien hiernach einfacher zu sein, als daß er, ein zweiunddreißigjähriger Mann von guter Herkunft, der eher reich als arm zu nennen war, um die Prinzessin Stscherbazkaja anhielt; alles sprach dafür, daß man ihn als gute Partie betrachtet hätte. Lewin aber war verliebt, und deshalb schien es ihm, Kitty verkörpere in jeder Hinsicht so sehr den Gipfel aller Vollkommenheit und sei ein alles Irdische so hoch überragendes Wesen, er selbst hingegen ein so armseliges Erdengeschöpf, daß man unmöglich annehmen könne, sie und die andern würden ihn als ihrer würdig befinden.
Nachdem er zwei Monate wie in einem Rausch in Moskau zugebracht hatte und mit Kitty fast täglich in Gesellschaften zusammengetroffen war, die er nur ihretwegen besuchte, war er plötzlich zu dem Ergebnis gelangt, daß aus der Sache nichts werden könne, und war aufs Land zurückgefahren.