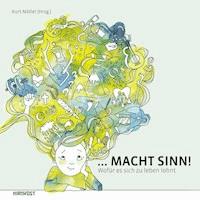
Macht Sinn E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Frage nach dem Sinn des Lebens … … naja, offensichtlich stellst du sie dir noch. Sonst hättest du ja nicht dieses Buch aufgeschlagen und angefangen, diese Zeilen zu lesen. Aber sag mal: Wenn wir uns schon duzen, können wir ja auch mal 'n bisschen intimer miteinander reden: Findest du es nicht etwas spät, diese Frage erst jetzt zu verfolgen? Ach so, du stellst sie dir heute zum wiederholten Male! Immer wieder taucht sie in deinem Leben auf. Und du kommst auf keine wirklich befriedigende Antwort. Oder mal auf die eine, mal auf die andere. Und deshalb hirnst du mehr oder weniger andauernd darüber. Sollen wir ehrlich sein? Das macht es nicht besser! Du bist nämlich viel zu spät dran. Viel zu spät. Denn das Problem ist doch längst gelöst. Und du solltest das wissen! Oder bist du nie per Anhalter durch die Galaxis getrampt? Nie? Wirklich nie? Echt? Na, dann lass dir erklären: Die Antwort lautet … Nun denn, es hört sich vielleicht etwas komisch an, aber die Antwort heißt … Sitzt du auch gerade gut, hast geistlichen Beistand – oder kannst wenigstens weich fallen? Ja? Dann gut. Die Antwort lautet – aber nicht lachen jetzt … Die Antwort ist: Zweiundvierzig. Schlicht und einfach 42. Dieses Buch entstand im Zusammenhang eines zweisemestrigen und von Prof. Dr. Kurt Möller geleiteten Lehrforschungsprojekts an der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege der Hochschule Esslingen, in dem Studierende und Jugendliche zum Thema befragten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Originalausgabe
© 2018 Hirnkost KG
Lahnstraße 25
12055 Berlin
www.jugendkulturen-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
April 2018
Vertrieb für den Buchhandel: Runge Verlagsauslieferung ([email protected])
Auslieferung Schweiz: Kaktus (www.kaktus.net)
E-Books, Privatkunden und Mailorder: shop.hirnkost.de
Dieses Buch entstand im Zusammenhang mit einem von Prof. Dr. Kurt Möller geleiteten zweisemestrigen Lehrforschungsprojekt an der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege der Hochschule Esslingen.
Die Autor*innen: Lidia Aristov, Sarah Baisch, Sarah Deppisch, Anja Heusel, Leonore Mair, Tobias Metz, Kurt Möller, Nadine Natterer, Eva Neuffer, Franziska Platzer, Katrin Rafensteiner, Michael Schneider, Tanja Schnier, Marie Scoob, Nadezhda Sill, Josua Stoll, Hülya Taze, Ulrike Thumm, Maike Watzlawik, Eva Wölfle, Julia Schäfer, Anna Lowe
Covergestaltung: Claudia Weber
Layout: Linda Kutzki
Lektorat: Gabriele Vogel
ISBN
PRINT: 978-3-945398-77-7
PDF: 978-3-945398-78-4
EPUB: 978-3-945398-79-1
Dieses Buch gibt es auch als E-Book – bei allen Anbietern und für alle Formate.
Unsere Bücher kann man auch abonnieren: shop.hirnkost.de
Inhalt
Mal vorneweg …
Kaum jemals satt werden – Hunger nach SINN
1 fromm & frei
„Aber dann gab es diesen einen Tag, also dieses eine bestimmte Ereignis, was dann bei mir ausgelöst hat, mehr in Richtung Glauben zu gehen. Ich nenn es mal ’ne Erfahrung mit Gott.“
„Seit ich Gott kenne, egal was wegfallen würde aus meinem Leben, ich würde niemals in ein Loch fallen.“
„Hier bin ich, und ich trage Kopftuch, aber ich bin ein normaler Mensch.“
„die tiefsten Tiefen sind bei vielen Menschen irgendwie leer.“
„Für mich ist mein Glaube in dem Sinne wahr, dass er mir Sinn gibt, dass er mir Halt gibt und ich mich orientieren kann, manchmal.“
2 laut & bunt
„Wenn’s dann sein muss, diss ich den Bürgermeister.“
„schocken und ’n bisschen Anarchie reinzubringen, anders zu sein, nicht Schema F durchzuspielen …“
„Ich glaub daran, dass jeder Mensch irgend ’ne Leidenschaft in sich hat und die auch irgendwann findet.“
„Sinn macht es, wenn es ein Paradox gibt, wenn es Reibepunkte gibt, eben nicht die absolute Freiheit, die total eben ist.“
„Versackt nicht einfach in ’nem normalen Job und vorm Fernseher! Das Ende ist erst, wenn man stirbt.“
3 nah & näher
„Der Wendepunkt war die Schwangerschaft … Das war der Aufwachschuss: Wach jetzt auf, tu mal was!“
„in der Zeit damals habe ich mich sehr erwachsen gefühlt, nicht wie 18, sondern viel, viel älter ...“
„Mich gibt es so, wie ich bin. Alles andere ist einfach kein Ich.“
„Wenn einer ein kleines Fellstück entdeckt hat, aber dann erzählt: ‚Ich hab drei Biber auf einmal gesehen!‘, dann ist der kein richtiger Freund.“
4 hin & weg
„Jeder sollte unbedingt allein reisen. Dann wär die Menschheit eine bessere, ganz klar!“
„generell einfach weg von diesem ganzen Stress, von der Zivilisation ...“
„Ich habe gar nichts mehr in Syrien. Alles zerstört. Warum soll ich sagen, da ist meine Heimat?“
5 auf & ab
„Eigentlich bleibt nur die Hoffnung, dass ich noch mal irgendwie drumrumkomm.“
„Ich habe mir mein Leben selbst so gestaltet, dass ich sagen kann: Es macht Sinn.“
„... so wie Ikarus, Flügel an den Armen und einfach weg.“
„Die Situation kommt, haut mich um, und ich muss es immer wieder schaffen, aufzustehen. Es ist ein Dauerkampf.“
„Man möchte halt etwas erreichen, was umsetzen und die Welt verändern.“
„Sinn ins Leben bringt der Lebenswille, der einen antreibt.“
„Ich möchte noch ein paar Sachen mit dem Motorrad erfahren … vielleicht nach Kuba, nach Amerika …“
6 schön & sportlich
„’ne Frau, die Bodybuilding macht, ist einfach nicht die Regel.“
„Die gleichen Chancen wie ein Mensch, der nichts hat, hat man eben nicht …“
„Motorradrennsport … meine Leidenschaft und meine Verwirklichung.“
7 für & gegen
„Ich fände es erstrebenswert, wenn alle Menschen mehr ihren eigenen Stil leben würden.“
„Es ist reiner Zufall, dass ich in Deutschland geboren bin. Ich hätte genauso gut in Gambia oder in Äthiopien oder in Eritrea geboren werden können.“
„hald blöd für d Menschheit, wenn koiner ema andere hilft.“
„auf die Demo der Revolutionären gehen … und einfach Präsenz zeigen …: Wir sind da! Die Jugend ist nicht nur dumm und kauft bei Primark!“
„jede kleinste Sache, die man macht, kann eine Veränderung bewirken.“
Making-of …
Mal vorneweg …
Die Frage nach dem Sinn des Lebens …
… naja, offensichtlich stellst du sie dir noch. Sonst hättest du ja nicht dieses Buch aufgeschlagen und angefangen, diese Zeilen zu lesen. Aber sag mal: Wenn wir uns schon duzen, können wir ja auch mal ’n bisschen intimer miteinander reden: Findest du es nicht etwas spät, diese Frage erst jetzt zu verfolgen? Ach so, du stellst sie dir heute zum wiederholten Male! Immer wieder taucht sie in deinem Leben auf. Und du kommst auf keine wirklich befriedigende Antwort. Oder mal auf die eine, mal auf die andere. Und deshalb hirnst du mehr oder weniger andauernd darüber. Sollen wir ehrlich sein? Das macht es nicht besser! Du bist nämlich viel zu spät dran. Viel zu spät.
Denn das Problem ist doch längst gelöst. Und du solltest das wissen! Oder bist du nie per Anhalter durch die Galaxis getrampt? Nie? Wirklich nie? Echt? Na, dann lass dir erklären: Die Antwort lautet … Nun denn, es hört sich vielleicht etwas komisch an, aber die Antwort heißt … Sitzt du auch gerade gut, hast geistlichen Beistand – oder kannst wenigstens weich fallen? Ja? Dann gut. Die Antwort lautet – aber nicht lachen jetzt … Die Antwort ist: Zweiundvierzig. Schlicht und einfach 42.
Du hast es zwar nicht gewusst, aber immer schon geahnt? Weil sechs mal sieben 42 ist? Und sieben ja als magische Zahl gilt? Und sechs eine schöne Ziffer ist? Und außerdem die Quersumme aus 42, nämlich vier plus zwei? Sollen wir dir mal was sagen? Ganz offen und ehrlich? Du bist alles andere als ein Intelligenzbolzen! Du hast keinen blassen Schimmer! Denn die 42 wurzelt viel tiefgründiger. Der komplexeste Computer der Welt hat sie errechnet und ausgespuckt. Vor fünfundsiebzigtausend Generationen wurde er schon programmiert und nun mühevoll wieder restauriert und in Gang gebracht. Er hat sogar einen Namen: DeepThought. Merkst du was? DeepThought – du kannst doch englisch? Frei übersetzt: Tiefschürfender Gedanke. Wenn er schon so heißt, wie könnte er da irren?
Aber werden wir mal in unserer Argumentation noch seriöser und so richtig wissenschaftlich! Was machen Wissenschaftler? Richtig: Sie forschen rum und zitieren andauernd irgendwelche Geistesgrößen. Also zitieren wir mal. Und das selbstverständlich aus dem epochalen Werk umfänglicher Sinndeutung schlechthin – und zwar die Kernaussage überhaupt: „‚Was ist der Sinn meines Lebens?‘ […] Die Spannung war unerträglich […] Die Antwort auf die Große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem??? ‚Zweiundvierzig‘, sagte DeepThought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe.“1
Alles paletti? Kommst du bei derart frei schwebenden intellektuellen Höhenflügen mit? Ja? Auch wenn es hier nur Auszüge sind? Wie schön! Gratulation!
Bloß: Einen Haken hat die Sache schon noch: DeepThought, die Rechenmaschine, fragt uns, ob wir überhaupt sicher sind, dass wir die richtigen Fragen stellen:
„‚Es war eine sauschwere Aufgabe‘, sagte DeepThought mit sanfter Stimme. ‚Zweiundvierzig!‘, kreischte Luunquoal los. ‚Ist das alles, nach siebeneinhalb Millionen Jahren Denkarbeit?‘ ‚Ich hab’s sehr gründlich nachgeprüft‘, sagte der Computer, ‚und das ist ganz bestimmt die Antwort. Das Problem ist, glaub ich, wenn ich mal ganz ehrlich zu euch sein darf, dass ihr wohl selber nie richtig gewusst habt, wie die Frage lautet.‘“2
Puuh, muss man mal ’n Weilchen drüber nachdenken, nicht wahr? Keine leichte Hirnkost, oder? Doch keine Bange: Hilfe naht! Bevor du dich nämlich jetzt in deinen jämmerlichen Gedankengespinsten komplett verhedderst, stehen wir dir unterstützend zur Seite. Schließlich sind wir die Gruppe 42 – und unser Name ist Programm! Wir wissen Bescheid. Denn die einzig richtige Frage stellen wir! Schau dir mal den Untertitel dieses Buches auf seinem Cover an. Er bringt zum Ausdruck, wonach wir fragen: Wofür es sich zu leben lohnt …
Diese Frage – und, um ehrlich zu sein, noch ein paar mehr – haben wir Expert_innen gestellt. Wahren Expert_innen. Nämlich (jungen) Menschen wie du und ich. Normalos also. Das heißt: So ganz „normal“ sind sie vielleicht nicht – zumindest nicht, wenn „normal“ mittelmäßig und langweilig bedeutet. Bei manchen von ihnen läuft das Leben in eher ruhigen Bahnen, manche sind aber auch ganz schön von ihm durchgeschüttelt worden – und werden es zum Teil noch. Aber sieh selbst! Gönn dir eine Schnuppertour durchs Buch! Und wenn du heute noch kein gutes Werk getan hast: Kaufe es! Noch besser wäre: Du liest es dann auch. Wir freuen uns drüber.
Wir – das ist eine Gruppe Studierende der Sozialen Arbeit an der Hochschule Esslingen und ihr Prof. Über ein Jahr hinweg sind wir ausgeschwärmt ins wahre Leben – raus aus den Elfenbeintürmen der Uni. Wir haben unendlich viele Gespräche geführt mit jungen Menschen. Genauer: mit jungen Leuten, die auf Sinnsuche sind und/oder ihren Lebenssinn schon gefunden haben. Selten auf gepflasterten, geraden Pfaden, oft auf ebenso kurvigen wie steinigen Umwegen. Diesen Gesprächspartner_innen gilt unser aufrichtiger, heißer Dank. Wie es die Vorsehung – oder ist es doch der Zufall? – so will: Es sind in der Summe genau 42 Interviews. Nun gut: Ungefähr wenigstens; einige mussten wir aus Platzgründen schweren Herzens streichen. Doch im Grunde sind sie in diesem Buch enthalten – bloß eben nicht sichtbar. Was sonst würde wirklich ultimativen Sinn ergeben?
Aber mach dir selbst ein Bild! Vielleicht erkennst du ja einen Teil von dir in der einen oder anderen Person wieder, die hier zur Sprache kommt – wenigstens einen Teil von deinen persönlichen Fragen und womöglich Antworten, die du noch auf die Große Frage suchst ...
Esslingen, im Februar 2018
Gruppe 42
1 Douglas Adams: Per Anhalter durch die Galaxis. Roman. Ullstein, Frankfurt a. M./Berlin 1993: 158. 2 Ebd.: 159.
Kaum jemals satt werden – Hunger nach SINN
Kurt Möller
SINN – ein menschliches Grundbedürfnis
„Das, was ich tue, macht Sinn.“ „Was ich denke, macht Sinn.“ „Mein Leben insgesamt macht Sinn.“ Wollen wir nicht alle mit einem tiefen Brustton der Überzeugung solche Sätze sagen können? Wahrscheinlich heißt die Antwort fast ausnahmslos: „ja!“ Warum eigentlich? Weil der Wunsch, Sinn empfinden zu können, zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehört. Menschen wollen eben nicht nur irgendwie über die Runden kommen. Sie wollen nicht nur genügend zu essen und zu trinken, ein Dach überm Kopf, möglichst gesund und sicher sein, schlafen etc. – kurzum: elementare vitale Grundbedürfnisse als befriedigt verspüren. Sie wollen auch ihr eigenes Leben gestalten, sich dabei authentisch und unverwechselbar fühlen, Kompetenz und Selbstwirksamkeit verspüren, nicht isoliert sein, sondern anerkannt, wertgeschätzt und geliebt werden, ihr Leben genießen, ja möglichst auch so etwas wie Glück erleben können. Sie wollen all dies – und vielleicht auch noch mehr: dafür sorgen, dass es auch anderen gut geht, politisch mitmischen, sich von Gott getragen wissen oder was auch immer. Erfahren, dass es sich zu leben lohnt, weil sich Bedürfnisse wie diese realisieren lassen – irgendwo darin muss sich wohl der Sinn von menschlicher Sinnsuche auffinden lassen.
„Was ich auch anstelle: Hat alles keinen Sinn.“ „Was ich mir so denke – nichts als Blödsinn.“ „Alles in allem: Mein Leben hat keinen Sinn.“ Möchten wir nicht in jedem Fall vermeiden, solche Selbstbeschreibungen von uns abgeben zu müssen? Vermutlich doch. Selbst wenn die meisten von uns ehrlicherweise einräumen: „Nicht alles, was ich mache, ist supersinnvoll“, „da ist auch ’ne Menge Unsinn in meinem Kopf“ und „es gibt auch Momente und Phasen in meinem Leben, wo mir der Lebenssinn abhandenkommt“ – in der Gesamtbilanzierung unseres bisherigen Lebens möchten wir in ihm Sinn erblicken. Sind „Blödsinn“ und „Unsinn“ (machen) durchaus noch als Beschreibung netter Episoden akzeptiert, so ist Sinnlosigkeit auf Dauer nicht auszuhalten (auch wenn sogenannte ‚sinnlose’ Tätigkeiten einen gewissen Entspannungseffekt bieten mögen – und eben darüber Sinn erlangen). Sinn ist also eindeutig positiv konnotiert. Und auch wenn jetzt jemand anmerken sollte, nicht Sinn, sondern Lustgewinn, Genuss und Freude sei sein/ihr zentrales Lebensmotto, dann wird ja damit kein Gegenentwurf zu einem möglichst sinnvollen Leben präsentiert. Vielmehr wird Sinn dann in spezifischer Weise interpretiert: als Priorisierung hedonistischen Strebens, als Erleben von Glücksgefühlen. Es bleibt dabei: Irgendwo drin Sinn sehen zu wollen, ist ein Grundbedürfnis des Menschen.
Spätestens jetzt stellt sich freilich die Frage: Was ist „Sinn“ denn eigentlich, wie lässt sich Sinn definieren, und wie ist er von Begriffen wie „Glück“ oder auch weiteren, zum Teil synonym gebrauchten Termini wie „Bedeutung“, „Zweck“, „Funktion“ u. a. m. abgrenzbar (zu weiteren Synonymen und Abgrenzungen vgl. auch Bohnsack 2016)? Und: Steckt nicht auch Sinn in natürlichen Gegebenheiten, menschengemachten Sachverhalten und vielleicht auch gottgewollten Existenzbedingungen der Menschheit, ohne dass wir deren Sinn begreifen (können)? Mit anderen Worten: Gibt es so etwas wie einen objektiven Sinn, obwohl wir ihn subjektiv nicht sehen? Gibt es ihn etwa in Krieg, Krankheit oder Tod eines geliebten Menschen?
SINN – begriffliche Sortierungen
Das vorliegende Buch ist nicht zufällig „… MACHT SINN!“ betitelt. Bewusst angezielt ist die Doppeldeutigkeit, die in diesem Titel steckt: Einerseits ist Sinn eine Macht, mit dem die Individuen konfrontiert sind, andererseits ist Sinn etwas, das von jeder einzelnen Person hergestellt wird und nicht per se außerhalb ihrer selbst existiert.
Blenden wir zunächst auf die erstgenannte Bedeutung: Sinn stellt insofern eine Macht dar, als er das Resultat von Setzungen ist, die den Anspruch erheben, Bewertungen vornehmen und dabei mit jeweiligen Sinndefinitionen Positives von existenzieller Tragweite beschreiben zu können. Genauer: Die Stiftung von Sinn und das Ergebnis dieser Stiftung, also der hergestellte Sinn selber, gelten als etwas Gutes: Wenn eine Handlungsweise, ein Denkmodell oder eine Struktur als sinnhaft dargestellt wird und sich mit dieser Sinnzuweisung gesellschaftlich entsprechend durchsetzt, kann dem allenfalls aus Minderheiten- oder Außenseiterpositionen Unsinnigkeit zugesprochen werden – wobei solche Widerständigkeit nur in funktionierenden Demokratien ohne existenzielle Selbstschädigung möglich ist. So hat etwa die Kirche über die Jahrhunderte hinweg lange Zeit ihre Vorstellungen von Sinn ungehindert durchsetzen können. Sie hat z. B. erreicht, dass Hexenverbrennungen oder Kreuzzügen Sinn attestiert wurde und bspw. Epidemien wie die Pest als gerechte Strafe Gottes erscheinen sollten. In ähnlicher Weise konnte es in Feudalzeiten den Herrschenden gelingen, das Königtum als gottgewollt und Folter als angemessen, Ungehorsam und Aufbegehren von Untertanen dagegen als strafwürdig darzustellen. Manche Diktatoren und Despoten schaffen es auch heute noch, ihre Herrschaftsform als sinnhaft und bspw. Expansionskriege oder die Todesstrafe als unerlässlich zu erklären und dabei Gefolgschaft zu finden. Noch alltagsnäher: In unserer Gesellschaft wird „Shopping“ faktisch als sinnvolle Freizeitbeschäftigung ‚verkauft’ und die Durchkapitalisierung des Fußballs wird zwar von manchen moralisch-ethisch kritisiert, kann ihren ‚Sinn’ aber praktisch durchsetzen, indem sie immer mehr Zuschauer_innen auf der Suche nach Vergnügen in die Stadien und vor die Medien lockt. Um in Weiterführung der Argumentation beim letztgenannten Beispiel zu bleiben: Auch das, was an Regelungen in Hinsicht auf den Profifußball getroffen wird, generiert – mehr oder weniger – Sinn: die Regularien beim Kauf und Verkauf von Spielern, die Verträge zum Verkauf von Fernsehrechten, das Angebot von Interview-Trainings für junge Spieler zur mediengerechten Präsentation ihrer Person, die Vereinbarungen zur Sicherung von sportlichen Großveranstaltungen zwischen Vereinsvertretern und Sicherheitsbehörden etc.
Abstrakter: Sinn, genauer: ein bestimmter Sinnbezug, wird zu Macht, wo er sich verobjektiviert: wo er a) in Strukturen gegossen wird (z. B. zur Gründung von Organisationen und zur Abfassung von Verträgen führt), b) dazu beiträgt, bestimmte historische Rahmenbedingungen zu schaffen bzw. festzuschreiben (z. B. feudale oder kapitalistische Verhältnisse), c) bestimmte Handlungsweisen und -kompetenzen bei Akteuren erzwingt (z. B. Interviewfähigkeiten oder Fähigkeiten zum Vertragspoker bei Profisportler_innen), d) ‚stillschweigende’ Basisregeln des Interagierens etabliert (z. B. Shopping als gängiges Gesprächsthema und die unverbindliche Kommunikation über die letzte Shopping-Queen-Sendung im TV als Kontakt erhaltendes Alltagsgespräch) und e) die (Ausbildung der) Handlungsfähigkeiten des Individuums prägt (z. B. die Schnäppchenjagd beim Shopping). Kurzum: Wir leben in einer Umwelt von Sinnsetzungen, die unseren eigenen Sinnkonstruktionen, die wir als Individuen vornehmen, ihren Stempel aufdrückt.
Auf der anderen Seite sind wir nicht gezwungen, ihnen zu folgen. Je stärker sich die Chancen zu individualisiertem Leben durchsetzen, umso mehr Freiräume bestehen, ‚sein eigenes Ding’ zu machen. In diesem Sinne gilt: Sinn wird nicht nur zur Macht. Sinn wird auch ge-macht. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens eine Verschiebung im Umgang mit dem Sinn-Begriff im deutschsprachigen Raum. Während früher im Deutschen die Formulierung „… macht Sinn“ nicht gebräuchlich war und an ihrer Stelle Ausdrücke wie „hat Sinn“ oder „ergibt Sinn“ standen, ist im Zuge der Bedeutungszunahme angelsächsischen Sprachgebrauchs das „making sense“ inzwischen analogisierend auch ins Deutsche übernommen worden. Dieser Umstand verweist auf die gewachsene Wahrnehmung der Konstruktion(sleistungen) von Sinn(stiftungen) und damit auf die aktive Seite von Subjekten im Umgang mit Sinnrelevantem. Er macht deutlich, dass die Subjekte das, was sie für sinnvoll halten, jeweils für sich bestimmen: das, was sie an äußeren Zuständen und Entwicklungen, die sie wahrnehmen, für sinnvoll halten, und das, was sie in der ‚Innenbetrachtung‘ an der eigenen Lebensführung als sinnvoll ansehen. Die weiteren Ausführungen wie auch das vorliegende Buch insgesamt fokussieren auf diesen Aspekt der „inneren Selbstschöpfung von Lebenssinn“, der die Kernaufgabe gegenwärtiger Identitätsarbeit kennzeichnet wie kein zweiter (Keupp 2015: 32), ohne die Verobjektivierungsprozesse von Sinn, deren Produkte und deren Macht- und Einflusspotenziale zu ignorieren. Nicht die Frage, ob und wodurch etwas ‚objektiv’ Sinn ergibt, sondern das Anliegen, aufzuzeigen, wie subjektiv Sinn bei jungen Leuten generiert wird, steht hier im Mittelpunkt. Dies macht allerdings weitere Begriffsschärfungen unter Abgrenzung verwandter Termini erforderlich.
„Der Sinn einer Gabel besteht nicht darin, Suppe mit ihr zu essen.“ – Das Verständnis von „Sinn“, das sich in einem Satz wie diesem ausdrückt, verweist offenbar auf die Funktion und den Nutzen, die einem Gegenstand (hier: nicht) zugeschrieben werden, um bestimmte Zwecke mit ihm zu erreichen. In dieser Funktion ist offenbar die „Gegenstandsbedeutung“ (Holzkamp 1973), also die objektive Bedeutung, die in diesen Gegenstand hineingearbeitet worden ist und seinen Einsatz nicht für völlig beliebige Zwecke erlaubt, aufgehoben. „Funktion“, „Zweck“, „Nutzen“ und „objektive Bedeutung“ ist jedoch nicht das, was der in dieser Publikation verfolgte Sinnbegriff ausdrückt. Er ist auch nicht deckungsgleich mit einer Zuweisung subjektiver Bedeutung. Dinge, Sachverhalte, Vorgänge und Personen können von großer subjektiver Bedeutung sein, ohne dass ihnen Sinn zugeschrieben wird. So ist die Kanzlerschaft von Angela Merkel für einen Pegida-Aktivisten vermutlich von großer Bedeutung, in ihr sieht er aber höchstwahrscheinlich alles andere als Sinn. So kann auch eine Arbeit von hoher subjektiver Bedeutung sein, ohne dass mit ihr Sinn verbunden wird (z. B. weil sie nur zum – durchaus als bedeutsam betrachteten – Zwecke des Geldverdienens ausgeführt wird).
„Was ist eigentlich der Sinn ihrer Äußerung?“ „Das willst du wirklich tun? Worin besteht denn da der Sinn?“ – Wer so fragt, ist meist an der Bedeutung des wirklich Gemeinten oder Gewollten interessiert, vielleicht auch an der Absicht, die dahinter gewähnt wird, oder am Motiv, das entschlüsselt werden soll. Wenn in dieser Veröffentlichung von „Sinn“ die Rede ist, ist allerdings Spezifischeres als das gemeint. Es geht um mehr als einzelne Handlungsantriebe, ihre Legitimation und ihr Verständnis.
Sinnkonstruktion wird hier in Anlehnung an Niklas Luhmann (1987) als der Prozess der Auswahl unter Optionen verstanden, die für das Subjekt vom Standpunkt der Aktualität aus am Horizont der Möglichkeiten aufscheinen, und der sich dabei an einem Ensemble von Kriterien ausrichtet, die aus der Perspektive des Subjekts essentielle, ja (zumindest tendenziell) existenzielle Relevanz für soziale Zusammenhänge und individuell-psychische Zustände und Prozesse besitzen. Im Spannungsfeld zwischen objektiven Gegebenheiten und dem Interesse am produktiv-konstruktiven Umgang mit ihnen wird eine Selektion von wahrgenommenen Denk-, Erlebens- und Handlungsoptionen vorgenommen, die von dem erwähnten Kriterienkomplex so gesteuert wird, dass ihr Sinn zugeschrieben werden kann. Sinnsetzungen reduzieren in dieser Weise die Komplexität zeitlicher, räumlicher, sachlicher und sozialer Bezüge, indem sie Bewertungen vornehmen. Die konkreten Bezugnahmen, die die Konstitution von Sinn leiten, können sich von Subjekt zu Subjekt erheblich unterscheiden. Sie hängen vor allem von seinen Erfahrungen, Kompetenzen, Vorlieben und Verfügungsmöglichkeiten ab. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Kriterien, an denen entlang solche Bezüge aufgenommen werden und Sinn aufgebaut wird, neben dem basalen Bedürfnis nach Sinn(stiftungs)erfahrung weiteren grundlegenden menschlichen Bedürfnissen folgen.
SINN – KISSeS als Kontext
Sich auf Sinnsuche begeben – kann das jede_r? Oder muss man/frau sich das leisten können? Müssen zunächst physiologische Bedürfnisse, Bedürfnisse nach Sicherheit und sozialer Einbindung, Bedürfnisse nach Selbstwerterleben und Selbstverwirklichung (vgl. Maslow 1977) befriedigt sein, damit ich in der Lage bin, Sinn als einer Art Luxusgut nachzuspüren? Wohl kaum. Nicht nur für den sprichwörtlichen ‚armen Poeten’ gilt: Auch wer darben muss, in unsicheren Lebensbedingungen lebt und einen geringen Selbstwert hat, sucht früher oder später nach Sinn: Sinn in den vorgefundenen materiellen Verhältnissen, Sinn in Werten und Normen, Sinn im eigenen Tun und Unterlassen, Sinn im Handeln der anderen, Sinn in der Interaktion mit ihnen usw. Das Bedürfnis nach Sinnerfahrung ist offenbar eingebettet in eine Reihe anderer Bedürftigkeiten, die menschliches Leben kennzeichnen, ja es durchwirkt geradezu deren Umsetzungen. Das Akronym KISSeS fasst diesen Komplex zusammen (vgl. auch Möller u. a. 2016):
K wie Kontrolle: Allen Menschen ist ein grundlegendes Bedürfnis nach Realitätskontrolle (vgl. Holzkamp-Osterkamp 1975; 1976) prinzipiell eigen. Über die wichtigsten eigenen Lebensbedingungen will man/frau weitestgehend selbst verfügen. Zumindest wird angestrebt, soweit Selbstbestimmung real werden zu lassen, dass über die Bedingungen unvermeidlich erscheinender Abhängigkeiten (mit)bestimmt wird. Dazu gehört basal, sich in der Welt orientieren zu können, vor allem aber auch sich selbst als wirksam und handlungssicher erleben zu können. Das eigene Handeln soll nicht ‚umsonst’ sein und verpuffen; es soll erkennbare Folgen haben und Spuren hinterlassen, es soll die Möglichkeit beinhalten, entlang entwickelter Intentionen zielsicher eigene Lebensvollzüge zu planen und umzusetzen und dafür relevante Umweltfaktoren zu beeinflussen. Die Erwartungen an das jeweilige Level derartigen Kontrollvermögens mögen zwischen einzelnen Personen differieren und zwischenzeitlich bei dem einen oder der anderen vielleicht auch einmal fast völlig heruntergefahren werden (in Phasen von fundamentalen Selbstzweifeln und bei Depressionen z. B.), aber an ihnen wird in der Gesamtbilanzierung von Lebensgestaltungsmöglichkeiten bemessen, inwieweit das Realitätskontrollbedürfnis als befriedigt erlebt wird.
Dabei gilt keineswegs die Devise: Kontrolle um jeden Preis, koste es, was es wolle. Vielmehr regeln ethische Prinzipen und ihnen folgende Werte und Normen, wie viel und was an Kontrolle zugestanden wird, damit Kontrollinteressen nicht ausufern und bspw. zur Schädigung anderer führen. Insofern sind Kontrollerfahrungen etwas, was Sinn vermittelt. Aber auch die Regularien, unter denen sie in gesellschaftlich akzeptabler Weise gemacht werden (dürfen), werden am Kriterium ihrer Sinnhaftigkeit beurteilt.
I wie Integration: Menschen wollen kein Leben als Monade führen. Sie benötigen sozialen Anschluss und soziale Einbindung. Genauer: Sie wollen irgendwo zugehörig sein, anerkannt und persönlich wertgeschätzt werden, an materiellen Gütern und als wichtig erachteten Handlungs- und Kommunikationszusammenhängen teilhaben (können) und sich mit (mindestens) einem Kollektiv – wenigstens bis zu einem gewissen Ausmaß – identifizieren können (z. B. „Wir Europäer“ oder „Wir VfB-Fans“, „Wir aus der … straße“ oder „unsere Familie“). Damit sich diese Aspirationen realisieren können, brauchen sie einen für sie hinreichend erscheinenden Zugang zu Subsystemen der Gesellschaft (z. B. Bildungsinstitutionen, dem Arbeitsmarkt, der Welt des Konsums); sie müssen die Chance haben, ihre individuellen Interessen in Abgleich mit den Interessen des Kollektivs, dem sie sich zurechnen, zu artikulieren und mit weiteren Personenkreisen auszuhandeln und Konflikte zu regulieren, die dabei oder anderenorts entstehen (etwa in Orten und auf Plattformen wie Kirchen, Vereinen, Verbänden und Parteien); nicht zuletzt benötigen sie in ihren kleinen Lebensfeldern, etwa denen der Familien und Freundeskreise, Erfahrungen von Kontakt, affektiv-emotionaler Bindung und realen oder potenziellen Unterstützungsleistungen.
Auch wenn – wie bei der Kontrolle – diesbezüglich die Erwartungen von Person zu Person unterschiedlich sind und manch eine_r bestimmte Integrationen für die eigene Person gar nicht oder mit geringerer Tiefe als andere anstrebt, gilt: In dem Maße, wie sich entsprechende Erwartungen ausbilden und umsetzen lassen, wird solchen sozialen Zusammenschlüssen und dem eigenen Handeln darin Sinn zugeschrieben.
S wie Sinnlichkeit: Menschen sind bekanntlich weder technische Apparaturen noch rein rationale Wesen, die computeranaloge Entscheidungen treffen. Menschen haben Körper, eine Psyche und eine darauf bezogene Empfindsamkeit. Das körperliche und psychische Wohl spielt deshalb im Leben eine zentrale Rolle. Menschen tendieren daher dazu, Situationen, in die sie geraten, danach zu beurteilen, ob sie sich angenehm anfühlen, und versuchen darüber hinaus auch aktiv, sich angenehme Empfindungen zu verschaffen. Sinnliches Erleben, etwa von Wärme, Genuss und Lust, ist sowohl ein entscheidender Bezugspunkt für die Bewertung von Wahrgenommenem und Erfahrenem als auch ein wesentliches Kriterium der Ausrichtung des eigenen Verhaltens. In der umfänglich individualisierten „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze 1992) unserer Tage erhält dieses Faktum einen noch größeren Stellenwert als früher. Entlang der Losung „Erlebe dein Leben!“ sieht man/frau sich aufgefordert, das ganz persönliche, letztlich aber doch auf die Vorinszenierungen der Warenwelt angewiesene und insofern kaum noch eigensinnig-autonome Projekt des schönen Lebens zu realisieren. Es lässt sich der Eindruck gewinnen: In ihm wird die ganze Welt als „Selbstbefriedigungsgerät“ gedeutet (Schulze 1999: 35) und der Mensch zum Endverbraucher seiner selbst.
Einerlei, ob man/frau diese Einschätzung teilt oder nicht: Zumindest dort, wo das schöne Leben nicht nur schlicht reflexionslos genossen wird, sondern zum Projekt wird, wird das Aufsuchen von Erlebensmöglichkeiten positiver Wertigkeit auch mit Sinn besetzt. Selbst wenn der Genuss selbst nicht unbedingt sinnvoll oder sinnfrei erscheint, wenn also bei ihm die unmittelbare Körpererfahrung im Vordergrund steht und er nicht reflektierend mit Kriterien von Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit beurteilt wird: Das bewusste Ansteuern von Situationen des Genusserlebens wird als etwas betrachtet, was Sinn macht, um das Projekt umzusetzen.
S wie Sinn: Wenn – wie dargelegt – das Streben nach Sinnerfahrung die Befriedigung(ssuche) von Kontroll-, Integrations- und Sinnlichkeitsbedürfnissen durchzieht, ist das Bedürfnis nach Sinnzuschreibung und -erfahrung dennoch als eigenständiges Bedürfnis aufzufassen. Denn Sinnsetzungen durch das Subjekt erfüllen einen eigenständigen Funktionskreis. Mindestens sechs unterscheidbare Funktionen lassen sich benennen (vgl. auch Kaufmann 1989; Wippermann 1998):
Sinnattestate reduzieren Komplexität, indem sie Selektion und Ordnung herstellen. Sie teilen den auf den ersten Blick schier unübersichtlich und chaotisch erscheinenden Gesamtkomplex der Welttatbestände auf einem Kontinuum zwischen absolut sinnhaft und völlig sinnlos ein. Durch die damit einhergehende Kategorisierung und Bewertung schaffen sie Orientierung.Sinnattestate dienen der Kontingenzbearbeitung. In dem Maße, wie die Gesellschaft komplexer wird, eine Vielfalt von Möglichkeiten an Interpretationen und Lebensweisen präsentiert und Entscheidungs- und Handlungsspielräume für das Individuum anwachsen, erscheint das Bestehende und bislang Praktizierte auch anders möglich. Angesichts des gestiegenen Bewusstseins der prinzipiellen Offenheit menschlicher Lebensführung und im Spannungsfeld des dadurch bedingten Sowohl-als-auch schaffen sie Klärungen zu den Fragen, wieso etwas so beschaffen ist, wie es ist, inwiefern es nicht zufällig so ist und ob und wie das, was ist, auch anders existieren oder geschaffen werden könnte. Sie bilden Ankerpunkte im Sog der Dynamik, Variabilität und scheinbar chaotischen Verläufe der Geschehnisse.Sinnattestate verschaffen und erhalten Identität. Über sie vergewissere ich mich meiner personalen Identität und bilde meine Ich-Identität aus: wer ich bin, warum und wofür ich lebe und dass ich unverwechselbar bin. Meine soziale Identität betreffend positioniere ich mich mit ihnen zu meiner Umwelt, etwa dadurch, dass sie Antworten auf die Frage geben, wohin und wozu ich gehöre oder auch für wen ich durch mein Dasein und meine Leistungen wichtig bin. Sinnattestate vermögen meinen Standort und meine Perspektiven im Kosmos zu verorten. Sie setzen mich nicht nur in Beziehung zu meiner unmittelbaren oder ferneren Umwelt. Sie weisen über eine globale Lokalisierung des Menschen hinaus, indem sie als Platzanweiser für das Subjekt und die von ihm gesehenen Relevanzen im gesamten Weltall und auf dem Strahl der Zeit fungieren.Sinnattestate können die Funktion der Weltdistanzierung und der Transzendierung erfüllen. In diesem Fall beziehen sie sich entweder auf außeralltägliche Erfahrungen in speziellen Sinnprovinzen, z. B. von Traum, Trance oder Rausch, oder sie verweisen auf die Existenz und Einflussnahmemöglichkeit von Außerweltlichem, z. B. in religiösen Kontexten auf eine göttliche Instanz, die als objektive Sinnstruktur jenseits der biologischen Natur des Menschen und des Kosmos gefasst wird.Sinnattestate steuern nicht zuletzt die individuelle Lebensführung – gerade aufgrund der Ordnungs- und Orientierungsfunktion, die sie besitzen. Zentral ist dabei die Herausbildung und Weiterentwicklung des Kohärenzsinns (Antonowsky 1987). Es handelt sich um das Gefühl, dass es verstehbare Zusammenhänge im Leben gibt und das Leben nicht einem nicht beeinflussbaren Schicksal unterworfen ist. Als geistige Haltung ausgearbeitet signalisiert es a) die Verständlichkeit, innere Stimmigkeit und Ordnung bzw. Einordbarkeit der für das eigene Leben wichtigen Dinge, b) die prinzipielle Fähigkeit, Herausforderungen meistern zu können und dafür c) eigene Anstrengungen unternehmen zu können, um mit Aussicht auf Erfolg Ressourcenpotenziale entdecken und aktivieren zu können, über die wiederum man/frau in der Lage ist, eine authentische – gleichsam ich-identitäre – und hinreichend souveräne Gestaltung des eigenen Lebens vorzunehmen. Der Kohärenzsinn ist also eine ganz wesentliche Basis für Gestaltungskompetenz.E wie erfahrungsstrukturierende Repräsentationen: Menschen agieren und leben nicht nur in der Sphäre der unmittelbaren, sinnlich zugänglichen Erfahrung. Um sich gedanklich und vielleicht auch emotional mittelbare Weltaspekte vergegenwärtigen und mit ihrer Hilfe aktuelle, abgelaufene oder in Zukunft noch vermutete Erfahrungen strukturierbar machen zu können, entwerfen sie mentale Abbilder der Realität. Das heißt, sie stellen aus rationalen Überlegungen, aber mehr noch mit Hilfe von Vorlagen aus einem kollektiv vorhandenen Ensemble von Bildern, Metaphern und symbolischen Verweisungen, das ihnen intuitiv und assoziativ zugänglich ist (vgl. Moscovici 1988), Konzepte zusammen, mit denen Phänomene in schon bekannte Kategorien eingeordnet, gegebenenfalls neue Rasterungen produziert und Kodizes für den kommunikativen Austausch mit anderen entwickelt und genutzt werden. In dieser Weise entstehen mentale Repräsentationen dessen, was als Realität begriffen wird. Diese Repräsentationen produzieren und reproduzieren in bestimmter Weise Sinn. Sie bilden z. B. die Genderthematik, den Klimawandel oder die Probleme um die Zuwanderung und Integration von Geflüchteten in spezifischer inhaltlicher und symbolischer Konturierung ab und bestimmen, was diesbezüglich Sinn macht oder eben nicht: z. B. die Gender-gap-Schreibweise zu benutzen oder nicht, den Klimawandel auf die CO2-Belastung zurückzuführen bzw. ihn zu negieren oder von „Flüchtlingskrise“ zu sprechen, wenn jene Probleme und Konfliktlagen gemeint sind, die mit der zahlenmäßig großen Zuwanderung von Geflüchteten nach Europa bzw. Deutschland zusammenhängen.
Hier stoßen wir wiederum ganz vehement an das Macht-Problem der Sinnzuschreibung: Wer die Repräsentation zu bestimmen vermag, die im medialen und öffentlichen Diskurs Vorherrschaft behaupten kann, ist darüber auch imstande, Sinnverständnissen seinen Stempel aufzudrücken und vielleicht sogar den Sinn der Kommunikation über sie infrage zu stellen.
S wie Selbst- und Sozialkompetenzen: Kein Mensch will vor sich selbst und vor anderen unfähig erscheinen. Schließlich bauen sich Selbstwert und Anerkennung nicht zuletzt über Handlungsfähigkeit und Kompetenz(nachweise) auf. Auch wenn sich nicht alle jedwede Fähigkeit zutrauen und nicht jede_r mit Verve und in der Breite das Erlernen und die Entwicklung eigener Fertigkeiten und Fähigkeiten jederzeit verfolgt, so werden doch eine Reihe von Selbst- und Sozialkompetenzen als basal erachtet. Ungeachtet dessen, dass darunter nicht immer dasselbe verstanden wird und auch Gewichtungen differieren, gilt dies für ein gewisses Ausmaß an Impulskontrolle, Reflexionsvermögen, Perspektivenwechselfähigkeiten, Verstehenswillen, Empathie, Neugierde und Offenheit, Rollendistanz, Ambiguitäts-, Ambivalenz- und Frustrationstoleranz, Bedürfnisartikulation, Kommunikationsfähigkeit, Konflikt (regulierungs)fähigkeit u. ä. m. Solche Kompetenzen zu entwickeln und zu entfalten, wird im Allgemeinen als sinnvoll, weil individuell persönlichkeitsbildend sowie sozial zuträglich bewertet. Wo dies nicht der Fall ist (z. B. in extremistischen oder kriminell auffälligen Randbereichen der Gesellschaft), wird immerhin anderen Selbst- und Sozialkompetenzen Sinnhaftigkeit zugeschrieben: Kampfbereitschaft, physischer Durchsetzungsfähigkeit, Schmerzresistenz, Gehorsam u. a. m. Dass ihnen dann auch Sinn attribuiert wird, steht damit nicht in Frage.
Fazit und Ausblick
Sinnsuche und der Wunsch nach Sinnerleben sind grundlegende menschliche Bedürfnisse. Eingewoben in das basale Streben nach Realitätskontrolle, Integration, befriedigendem sinnlichem Erleben, mentaler Repräsentation der Realität und Kompetenzentwicklung steuern sie ihre Befriedigung in diversen Vorlieben, Vorstellungswelten und Aktivitäten an, wie die folgenden Interviews mit jungen Leuten zeigen: in der Sphäre der Politik, in Liebe und Freundschaft, in der Hilfe für andere, über religiöse Orientierungen, mittels Sport, durch kulturelle Betätigung, bei der Modellierung und Inszenierung des eigenen Körpers, beim Reisen. In diesen Bereichen sind ihre Aktivitäten mehr als bloße Hobbys oder Leidenschaften. Sie sind für sie von existenzieller Bedeutung. Der Versuch, für sich Sinn zu kreieren, verläuft allerdings fast nie krisenfrei; das verdeutlichen die im Anschluss an diesen Beitrag abgedruckten Gespräche ebenso: Physische Krankheiten, psychische Belastungen und Störungen, der Tod naher Angehöriger, eigene Suchtmittelabhängigkeit, Kriminalität und ihre Sanktionierung u. a. m. bilden zum Teil erhebliche Erschwernisse. Aber – auch darauf verweisen die Interviews –: Sie sind in den Griff zu bekommen – nicht ganz und nicht immer dauerhaft, aber doch so, dass die wichtigste Erfahrung übrigbleibt: Das Leben lohnt sich – mindestens im Hier und Jetzt.
Literatur
Antonovsky, Aaron: Unraveling the Mystery of Health. Jossey Bass, San Francisco 1987.
Bohnsack, Fritz: Sinnvertiefung im Alltag. Zugänge zu einer lebensnahen Spiritualität. Barbara Budrich Verlag, Opladen, Berlin/Toronto 2016.
Holzkamp, Klaus: Sinnliche Erkenntnis. Historischer Ursprung und gesellschaftliche Funktion der Wahrnehmung. Campus, Frankfurt a. M. 1973.
Holzkamp-Osterkamp, Ute: Psychologische Motivationsforschung. Bd. 1 und 2. Campus, Frankfurt a. M. 1975; 1976.
Kaufmann, Franz-Xaver: Religion und Modernität. Mohr, Tübingen 1989.
Keupp, Heiner: „Alter ist auch nicht mehr das, was es einmal war!“, in: Dill, Helga/Keupp, Heiner (Hrsg.): Der Alterskraftunternehmer. transcript-Verlag, Bielefeld 2015: 17–48.
Luhmann, Niklas: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1987.
Maslow, Abraham H.: Motivation und Persönlichkeit. Walter-Verlag, Olten 1977.
Möller, Kurt/Grote, Janne/Nolde, Kai/Schuhmacher, Nils: „Die kann ich nicht ab!“ – Ablehnung, Diskriminierung und Gewalt bei Jugendlichen in der (Post-)Migrationsgesellschaft. Springer VS, Wiesbaden 2016.
Moscovici, Serge: „Notes towards a description of social representation“, in: European Journal of Social Psychology 3/1988: 211–250.
Schulze, Gerd: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Campus, Frankfurt a. M./New York 1992.
Schulze, Gerhard: „Sauscharf. Die Rationalisierung der Sinnlichkeit“, in: Ders.: Kulissen des Glücks. Campus, Frankfurt a. M./New York 1999.
Waibel, Eva Maria: Erziehung zum Sinn – Sinn der Erziehung. Grundlagen einer existenziellen Pädagogik. Beltz, Weinheim/Basel 2017.
Wippermann, Carsten: Religion, Identität und Lebensführung. Leske + Budrich, Opladen 1998.
1 fromm & frei
„Aber dann gab es diesen einen Tag, also dieses eine bestimmte Ereignis, was dann bei mir ausgelöst hat, mehr in Richtung Glauben zu gehen. Ich nenn es mal ’ne Erfahrung mit Gott.“
Lukas (30)
studiert nach vielen Umwegen Gesundheitsmanagement; Siebenten-Tags-Adventist
Lukas, du bist ein gläubiger Siebenten-Tags-Adventist. Wie kam’s dazu, dass du das geworden bist?
Ich bin bei meiner Mutter groß geworden und hatte, bis ich vier war, einen Vater, danach nicht mehr. Und dann bin ich früh meine eigenen Wege gegangen und hab mit elf, zwölf Jahren angefangen, Drogen zu nehmen und Alkohol zu trinken und alles Mögliche. Die Schule wurde immer schlechter und schlechter, ich bin beim Schulpsychologen gelandet und hab die Schule drei-, viermal gewechselt. Und irgendwann mal hat sich meine Mutter gedacht: Okay, dem Jungen geht’s nicht so gut und mir auch nicht, wir ziehen um, raus aus der Stadt aufs Land, in ein Dorf. Und wir sind nach Pfalzgrafenweiler gezogen, wo meine Mutter aufgewachsen ist. Und dann wollte sie eigentlich ein Jahr nach Venezuela, durch die Kirche. Da wäre man in ein kleines Dorf in der Nähe vom Strand gezogen, hätte von dem selbst angebauten Essen gelebt. Das heißt, man wäre jeden Tag auf dem Acker gewesen. Aber darauf hatte ich überhaupt keine Lust mit damals 13, 14 und bin einfach abgehauen, wieder zurück nach Darmstadt. Da hat mich meine Mutter dann natürlich gesucht, aber nicht finden können und hat die Polizei auf mich gehetzt. Aber die konnte mich auch nicht finden, und das wurde dann immer schlimmer mit den Drogen und allem Möglichen. Irgendwann kam Pepp dazu, ich hab auch Heroin geraucht. Das ging dann so ungefähr, bis ich 18, 19, 20 war.
Am Ende hatte ich nicht mal ’nen Hauptschulabschluss, nur ’n Abgangszeugnis. So bin ich dann noch im BVJ gewesen und im BVB, einer sogenannten Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, und am Ende hab ich einfach gar nichts mehr gehabt, schulisch gesehen. Innerlich, muss ich sagen, bin ich immer mehr abgestumpft: Mit meiner Mutter hatte ich Schwierigkeiten, mit meiner Familie sowieso, weil sie mir sozusagen mit ihrer Glaubenskeule auf den Keks gegangen sind [lacht]: „Das, was du machst, ist falsch.“ Natürlich wusste ich irgendwo, das ist nicht so ideal, nicht gut für meine Gesundheit, meine Entwicklung, aber so, wie die das gesagt haben, war es einfach für mich abstoßend. Es hat mich eher weiter weggedrängt vom Glauben. Irgendwie hab ich aber immer mehr und mehr gemerkt: Es hat keinen Sinn mehr, wie lange will ich das noch so weitermachen? Irgendwann habe ich dann eine Arbeitsstelle bekommen, hab da im Lager angefangen. Da hab ich mich ein bisschen auf die Reihe bekommen. Ich hab dann Arbeit gehabt, Beschäftigung, und irgendwie konnte ich mich damit identifizieren. Ich hab meine Arbeit gut gemacht und der Teamleiter hat’s gesehen. Und ich hab gemerkt: Okay, ich kann da wirklich vorwärtskommen.
Nebenher hab ich aber weiterhin Drogen genommen, Alkohol getrunken und es echt übertrieben. Trotzdem ging’s irgendwie. Aber dann gab’s irgendwann mal einen Tag, da hab ich mir gedacht, ich muss mal meinen Schulabschluss ändern, und hab mir gedacht: Ich versuch’s mal mit Fernkursen. Da hab ich versucht, meinen Realabschluss zu machen. Hab’s aber überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt, weil das bedeutet, ganz schön Disziplin zu haben. Und das hatte ich einfach nicht. So kam dann der Zeitpunkt, an dem es wieder runterging. Ich wollte unbedingt aufhören mit den Drogen und ich hab dann wenigstens mal mit den Zigaretten aufgehört. Nur: Noch schlimmer wurde es dann mit dem Kiffen und dem ganzen anderen Zeug. Aber dann gab es diesen einen Tag, also dieses eine bestimmte Ereignis, was dann bei mir ausgelöst hat, mehr in Richtung Glauben zu gehen. Ich nenn es mal ’ne Erfahrung mit Gott. Wenn du willst, kann ich dir davon erzählen.
Ja, klar, sehr gern!
Also an dem Abend war ich bei einem Kumpel, mit seiner Freundin und einem anderen Freund. Wir haben Pepp gezogen, wir haben Alkohol getrunken, wir haben gekifft. Aber an diesem Tag hab ich mich komisch gefühlt, irgendwas war anders: Ich hab gezogen und gezogen und geraucht und geraucht und irgendwie hab ich den Eindruck gehabt, das schlägt nicht so an. Ich hab gemerkt: Ich will eigentlich nur nach Hause. Ich hab mich nach draußen gedrängt gefühlt, aus dem Haus heraus. Dann bin ich rausgegangen. Ich weiß noch, wie es angefangen hat, wie in meinem Kopf ein Kampf stattfand. Und das war damals an ’nem Samstag und Samstag ist ja bei uns der Gottesdienst. Das war, glaube ich, so um acht oder halb neun, so um den Dreh.
Morgens?
Morgens, genau. Ich bin einfach losgegangen und dann stand ich irgendwann nicht wie sonst üblich in solchen Situationen vor meinem Bett zu Hause, sondern vor der Gemeinde. Und ich dachte mir: Was mach ich jetzt hier eigentlich? Hab hin und her überlegt. Dann hab ich gedacht: Okay, jetzt geh ich rüber auf die andere Straßenseite. Da wohnte der Gemeindeleiter. Hab einfach geklingelt und gesagt: „Hey, könnt ihr mir helfen? Ich weiß nicht, was gerade los ist!“ Und dann meinte er so: „Komm doch einfach mal hoch!“ Ich hab zu dem gesagt: „Augenblick‚ kannst du meine Mutter rufen?“ Ich muss dazusagen: Obwohl ich bei meiner Mutter gewohnt hab, hab ich nicht wirklich viel zu tun gehabt mit ihr. Das Einzige, was ich mit ihr geredet hab, war, wenn ich besoffen war. Dann konnte ich gute Sätze mit ihr wechseln oder nach Geld fragen, mehr auch nicht. Es war ’ne sehr schlechte Beziehung mit ihr. Aber in dem Augenblick hatte ich den Eindruck, meine Mutter könnte mir vielleicht helfen. Und dann kam sie, und mir wurde klar, warum ich da war. Ich habe den Eindruck gehabt, Gott oder Jesus möchte mich vor eine Entscheidung stellen. Was heißt vor eine Entscheidung stellen? Er wollte mir helfen aus der ganzen Situation. Und ich wusste: Wenn ich mich für ihn entscheide, dann wird er mich auch befreien von diesen Drogen und dem Alkohol und so weiter. Also von dem, was mich gelähmt hat in meinem Leben. Und dann hab ich einfach ein Übergabegebet, so nennen wir das, gesprochen und ich bin heulend zusammengebrochen. Das war wirklich eine emotionale Sache. Ich hab gebetet, fast zwei Stunden lang. Ich hab quasi meine Seele ausgeschüttet und lag dann am Boden. Dann bin ich aufgestanden und ich hab mich gefühlt wie ein freier Mensch, quasi wie neugeboren. Und seit dem Augenblick war ich dann auch frei. Also ich hab dann nicht mehr das Verlangen gehabt nach den Drogen und dem ganzem Zeug, überhaupt nicht. Ich bin wieder zurück zu meiner Arbeit gegangen, es war alles gut und ich war echt happy.
Also kurz nach deinem Übergabegebet?
Ja, ich bin dann nach Hause gegangen und alles war Friede, Freude, Eierkuchen. Ich hab versucht, mit Gott zu leben, so wie ich’s verstehe. Aber im Nachhinein muss ich sagen: Das war ein bisschen zwanghaft. Dann irgendwann mal hab ich eine Frau kennengelernt bei meiner Arbeitsstelle und in die hab ich mich knallhart verliebt. Und damit hab ich irgendwie Gott aus meinen Augen verloren. Ich war nur noch fixiert auf diese Frau, völlig blind vor Liebe sozusagen. War schön, war echt gut, wir sind zusammengezogen so nach ’nem Jahr, haben zweieinhalb Jahre zusammengelebt. Aber irgendwas hat mir gefehlt. Es war irgendwie nicht vollständig. Und ich hab für mich den Eindruck gewonnen: Das ist Gott, der mir fehlt in meinem Leben. Und dann stand ich wieder vor der Wahl, weil ich konnte nicht beides: meinen Glauben leben und die Beziehung führen. Sie war Atheistin, nicht ’ne Gläubige, und für mich spielt das eine wichtige Rolle, dass meine Frau eine gläubige Frau ist. Denn das Glaubensleben dringt einfach in alle Bereiche ein. Ich hab dann irgendwann mal gedacht, ich versuch’s mal und werde wieder in die Gemeinde gehen zum Gottesdienst.
Bist du in den zweieinhalb Jahren nicht in den Gottesdienst gegangen?
Nee, da war nix, nix mit Gott, Gottesdienst oder irgendwas mit Religion. Das ging dann auch wieder so tief, dass ich wieder mit Alkohol angefangen habe. Ich hab sogar angefangen, Drogen richtig zu verkaufen, also ein Geschäft daraus zu machen, Haschisch und so weiter. Bin immer nach Darmstadt gefahren und zurück und hab so meine Verkaufsstellen gehabt. War ein nettes Einkommen, aber das hat mich verrückt gemacht mit der Zeit. Irgendwann wurde ich unruhig und dann kam wieder so ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe: Gott, bitte hilf mir da raus! Ich habe einfach gemerkt: Das ist ein völliger Widerspruch, mein ganzes Leben. Auf einer Seite such ich dich, auf der anderen Seite dies – total zwiegespalten. Und irgendwann kriselte es in meiner Beziehung. Es lag wahrscheinlich an mir, weil ich mich selbst nicht so richtig wohlgefühlt hab, und dann ging es halt auseinander. Das war dann auch die Möglichkeit, das Leben mit Gott neu zu beginnen. Ich bin dann auch von den Drogen losgekommen. So hatte ich wieder meinen Frieden, meine Ruhe und auch wieder meinen Sinn im Leben. Ich hab wieder angefangen, meinen Hauptschulabschluss zu machen, auf der Abendschule. Danach hab ich gedacht: Okay, ich will weiter, mein Hauptschulabschluss reicht mir nicht. Ich bekam die Chance, in meinem alten Unternehmen wieder anzufangen und ein Versandwerk zu leiten. Und dann gab’s später die Chance, mit ausreichender Berufserfahrung den Logistikmeister zu machen. Mit dem Logistikmeister konnte man dann auch den Zugang finden zum Studium. Ich wollte studieren. So dachte ich: Ich fang jetzt an, Pastor zu studieren, typischer Werdegang: von Drogen zum Pastor. Ich hab dann auch ein Jahr lang in Österreich studiert, Theologie in unserer Kirche. Aber irgendwann hab ich mich so unwohl gefühlt, da hab ich angefangen, Gesundheitsmanagement zu studieren. Bevor ich mit Gesundheitsmanagement angefangen hab, hatte ich noch mal ’ne richtige Krise, mit Panikattacken und allem Möglichen. Das war richtig krass. Ich konnte manchmal nicht mal mehr aus dem Haus gehen vor Wahnvorstellungen. Das war echt extrem, ich konnte teilweise nicht mit dem Auto fahren, nicht mal richtig einkaufen. Das war richtig heftig. Da bin ich irgendwann einfach in die Küche gegangen: Herr, was soll ich jetzt machen? Ich hab gedacht, ich muss jetzt in die Klapse oder so. Aber an dem Morgen habe ich ein Buch gelesen, da ging es um das Leben Jesu und da wurde so eine Geschichte illustriert, die handelte davon, dass er mit seinen Jüngern auf dem See war, und da war ein großer Sturm gewesen. Währenddessen war Jesus hinten auf dem Boot und hat geschlafen und seine Jünger waren total in der Krise, sozusagen in einer Todeskrise. Die haben versucht, das Wasser aus dem Boot zu kriegen und sich zu retten, aber es hat nicht geklappt. Sie sind dann zu Jesus gegangen und haben ihn aufgeweckt: „Herr, willst du uns nicht helfen? Wir kommen hier um!“ Dann stand er auf und sagte ein paar Worte und der Sturm hörte auf. Und ich hatte in diesem Augenblick, als diese Krise da war, in der Küche dieses Bild vor Augen, wie Jesus im Boot stand, ganz ruhig, ganz besonnen, so als ob er die ganze Situation im Griff hätte, und die Jünger im Hintergrund, wie sie versuchen, mit Eimern das Wasser aus dem Boot rauszukriegen. Und dann hab ich mich hingesetzt, die Hände vor meinen Augen, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Im Buch stand dann auch noch, wenn man in so einer Lebenskrise zu ihm ruft, dann hört er diesen Rettungsruf. Ich hab dann gerufen: „Herr, hilf mir!“ Und plötzlich hat alles aufgehört: Keine Gedanken waren mehr in meinem Kopf. Ich war frei, also wirklich völlig frei. Ich bin aufgestanden und konnte das in dem Moment einfach nicht fassen. Und seit diesem Tag war das auch nicht mehr der Fall. Es hat aufgehört, diese starke Krise ist weg. Panikattacken, Ängste hab ich keine mehr.
Du hast vorhin mal gesagt, Gott fehlte mir. Das fand ich ganz interessant. Kannst du mir noch genauer erklären, was dir da gefehlt hat?
Also das Gespräch mit Gott fehlte mir. Ich hatte und hab den Eindruck, ich spreche mit Gott und Gott antwortet auch. Vielleicht nicht unmittelbar und vielleicht auch nicht punktgenau auf meine Fragen oder auf meine Bitten, aber er antwortet immer, sei es, dass er mir Frieden gibt, dass ich weiß: Okay, er kümmert sich um meine Sachen, die ich nicht geregelt kriege, sei es ein innerlicher oder vielleicht sogar ein äußerlicher Konflikt. Das hab ich bis jetzt immer erlebt. Einfach dieses Bewusstsein, dass Gott für mich da ist und mich begleitet im Alltag, ist mir sehr wichtig. Das gibt mir sehr viel Halt.
Ich war vorher ein Mensch, der dachte, ich brauche nicht jemanden, der mir Stärke oder Kraft gibt. Aber ich hab gemerkt, dass ich an einen Punkt komme, an dem ich nicht mehr vorwärtskomme. Und da war Gott für mich einfach dieser sinnbringende Teil in meinem Leben. Er ist mit mir, er hört mir zu und er reagiert auch. Es ist ein Halt also. Wenn ich nicht mehr weiterweiß, kann ich mich bei ihm melden. Es geht jetzt nicht darum, dass Gott alles für mich ausbadet. Er ist wie ein Vater, der einen durchs Leben begleitet, mit dem man reden kann und bei dem man sich auskotzen kann und der immer für einen ein Ohr hat. Und immer eine Lösung hat, auch wenn sie einem vielleicht nicht immer passt. Aber es passt dann schlussendlich doch.
Ganz am Anfang unseres Gespräches hast du mir erzählt, dass du deinen Vater früh verloren hast, und gerade sagtest du, dass Gott für dich wie ein Vater ist. Jetzt kommt mir gerade der Gedanke, ob Gott da auch eine Lücke schließt …
Ich hab auch schon sehr viel drüber nachgedacht. Ich hatte auch schon Gespräche mit Ärzten oder Seelsorgern aus meiner Kirche darüber. Ich weiß: Ich hatte Schwierigkeiten, also Mangel an Selbstwert und an sonstigen Dingen auch. Damit hab ich auch jetzt immer noch manchmal zu kämpfen. Ja, klar, der Vater hat mir wahrscheinlich gefehlt, aber ich bin schlussendlich sehr gut ohne meinen Vater ausgekommen.
Und könntest du mir dein jetziges Leben beschreiben? Wie sieht dein Alltag aus? Wie ist da der Glaube eingebunden?
Ich steh morgens auf und hab meine Zeit mit Gott. Ich bete und schütte mein Herz aus und lese in der Bibel, jeden Morgen. Es gibt immer irgendetwas, was passend ist für meine Situation und was mir hilft und mir Kraft schenkt für den Tag. Ich hab auch hier im Ort ein Ohr für manche Jugendliche, die auch ihre Krisen haben. Und für meine Gemeinde bin ich da. In letzter Zeit hab ich ’n bisschen was organisiert: Gesundheitsvorträge. Und ich helfe in der Gottesdienstleitung.
Sind das jetzt nicht so Aufgaben, die in den Bereich der Nächstenliebe fallen?
Das sind keine Aufgaben. Das wäre zu regelhaft. Das ist etwas, was ich gerne mache. Das bereichert mich auch. Das war auch in meiner Krise sehr hilfreich, sehr aufbauend. Ich nehme keine Drogen mehr, ich hab mein Lebensziel komplett umgeändert, mag es sehr, Sport zu treiben, ernähre mich auch gesund, versuche auf mich zu achten.
Du sagst „Lebensziel“. Kannst du mir das genauer erzählen?
Ja, ich würde den Menschen einfach gerne Gutes tun. [lacht] Ich will den Menschen helfen, dass sie mehr Freude haben im Leben und dass sie einen Sinn haben. Ich würde mich gerne mehr für Jugendliche einsetzen und würde gerne ein Gesundheitszentrum hinkriegen, das sich selbst unterhält. Ich hab schon von anderen gehört, dass es funktioniert, weltweit. Aber ich würde es machen, weil ich weiß, dass es gut ist, dass es Leuten hilft. Es gibt viele Christen, Jugendliche und Erwachsene, die haben Schwierigkeiten: Depressionen, Burn-out, Angstzustände, persönliche Krisen. Man kann ihnen helfen. Deswegen das Studium, deswegen die Gemeindearbeit und die Vorbereitung der Gesundheitsvorträge. Ich versuche, Schritt für Schritt vorzugehen und nicht einfach so vorzupreschen und dann gegen die Wand zu laufen. Früher war ich so, ich bin einfach vorgerannt, bin dann immer irgendwo reingeflogen. Ich werde ein wenig vernünftiger. Ich möchte nicht stehenbleiben, versuche aber, vorsichtiger zu sein.
Hast du auch so was wie Glaubensziele?
Meine Glaubensziele? Ich will Gott besser kennenlernen. Weil es für mich selbst bereichernd ist. Es ist, als würde man ein Geschenk auspacken, jeden Tag. Da ist immer wieder was Neues. Das ist wie eine gute Beziehung, mit Höhen und Tiefen.
Wenn ich ehrlich bin, wusste ich bis vor Kurzem gar nicht, dass es Siebenten-Tags-Adventisten gibt. Kannst du mir noch erklären, was gerade diesen Glauben so besonders für dich macht?
Das sagt ja schon der Name: der siebte Tag, der Samstag, der Sabbat als Ruhetag statt des Sonntags. Und Adventist, das zielt ab auf eine Art Bewegung, die darauf wartet, dass Jesus bald wiederkommt. Wir haben 28 Glaubenspunkte.
So was wie die zehn Gebote?
Eher Grundsätze, herausgefiltert aus der Bibel. Da gehört auch ein gesunder Lebensstil dazu.
Kannst du mir dazu noch ein Beispiel sagen, einen Punkt, der dir besonders wichtig ist?
Also ich hab für mich gemerkt, dass, wenn ich mich mit der Liebe beschäftige, also nicht einfach einen Text lese und „Aha‚ schön“ sage, sondern tief hineintauche, dann hat es heilende Wirkung auf mich.
Und gibt es auch Bereiche deines Glaubens, bei denen du sagst, das hat jetzt nicht so ’ne Bedeutung für mich?
Manche Leute glauben, dass Gott straft, wenn du das oder jenes nicht tust. Und dass man viel getan haben muss, um perfekt zu sein vor Gott. Das ist aber für einen Menschen total ungesund. Du kannst es dir vielleicht vorstellen: Angst entwickelt sich, Druck baut sich auf. Das ist einfach nicht gut.
Was glaubst du stattdessen?
Dass Gott gut ist, dass Gott Liebe ist, dass Gott nicht zwingt, dass Gott nicht unter Druck setzt, dass er uns einen eigenen Willen gegeben hat, den man nutzen darf, wie man möchte, dass er einen bedingungslos liebt. Also nicht, dass er irgendwelche Voraussetzungen hat, die ich brauch, um von ihm angenommen zu werden. Und dass er einem helfen möchte, sein Leben in den Griff zu kriegen und vielleicht Probleme, die man hat, zu bewältigen, um glücklich zu werden, ein erfülltes Leben zu haben.
In vielen christlichen Glaubensrichtungen ist es so, dass man keinen Sex vor der Ehe hat. Wie ist das bei euch?
[lacht] … schon längst vorbei. In der Bibel steht, dass wir vor der Ehe keinen Sex haben sollten. Dieses Verbot hat schon einen Grund – dass man es sich aufspart für diese eine Person. Natürlich ist es in meinem Fall schon vorbei. Aber es heißt halt bei uns: Wenn man ein Leben mit Gott beginnt, dann ist es wie ein neues Leben. Ich hab wieder zu Gott gefunden und damit hat alles andere aufgehört. Und das hat meinem Leben wieder einen Sinn gegeben.
Gibt es trotzdem Momente des Zweifelns?
Ja doch. Ich neige immer noch dazu, mich emotional hin- und herreißen zu lassen. Da ist es manchmal schwer, am Ball zu bleiben. Dann kommen Zweifel hoch: Wozu machst du das? Macht das überhaupt noch einen Sinn? Ich muss mich immer wieder neu greifen, neu orientieren. Aber das hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich hab gewisse Texte aus der Bibel, die mir dann immer sehr helfen und Mut geben.
Würdest du da einen mit uns teilen?
Ja, gerne: „Hab ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehst.“ Oder: „Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus.“
Was kommt nach dem Tod? Wie geht’s weiter?
Da beginnt das Leben erst so richtig! [lacht] Doch, wirklich! Da gibt es keinen Schmerz mehr, keine Beziehungskrisen, man versteht sich einfach. Weil alle die Grundlage der Liebe verstanden haben. Und dann erzählt die Bibel: Jeder bekommt ein Stück Land und darauf ein Haus und da kann er sich dann austoben sozusagen. Man kann alle Planeten umreisen, also fliegen. Es ist ein Leben, wie ich es mir vorstellen könnte.
Wird es dann auch eine körperliche Auferstehung geben?
Ja. Es ist nichts Transzendentes oder so. Wie der Körper aussieht, weiß ich nicht, aber es ist ein Körper.
Nach wie vor ein Geist in einem Körper?
Ja, genau. So wie heute, so auch dann. Da gibt’s keinen Unterschied.
Und was ist mit der Hölle?
[lacht] Also von der Hölle haben wir kein so katholisches Verständnis, dass die Leute dann abbrennen und in Ewigkeit brennen. Die Bibel gibt so etwas nicht wider, dass es auch ’ne Hölle geben würde. Also es gibt einfach nur diesen einen Zustand: Man stirbt auf Ewigkeit. Manche Leute gehen ins ewige Leben und manche in den ewigen Tod. Leute, die sich für Gott entschieden haben, ins ewige Leben.
Wie ist das mit Andersgläubigen?
Keine Ahnung. Also es gibt schon relativ klare Aussagen in der Bibel, dass, wenn jemand an Jesus glaubt, er ewiges Leben hat. Und die Schlussfolgerung wäre ja, wenn er es nicht tut, hat er kein ewiges Leben. Aber ich bin nicht Gott.
„Seit ich Gott kenne, egal was wegfallen würde aus meinem Leben, ich würde niemals in ein Loch fallen.“
Julia (21)
Studentin, hat als Jugendliche zum christlichen Glauben gefunden
Julia, das Gespräch führe ich jetzt mit dir als meiner Partnerin, weil du Christin geworden bist und vorher konfessionslos warst. Zum Einstieg würde mich interessieren, wie du denn deinen Glauben im Alltag lebst?
Zurzeit habe ich eher Probleme damit, weil ich in einer Gemeinde war, wo ich sehr nah am Gottesdienst, am Lobpreis war, dann aber gemerkt hab, dass die Gemeinde nix für mich ist. Ich bin daher nicht mehr in die Gemeinde gegangen, sondern hab zu Hause Lobpreis gehört und gesungen und auch ab und zu mal versucht, so Online-Predigten anzuhören – es gibt ja manche Gemeinden, die ihre Predigten live übertragen. Ne Zeit lang war ich dann in so ’ner Art Hausgemeinde und hab versucht, da ’nen Anknüpfungspunkt zu finden. Allerdings fiel’s mir auch da relativ schwer, denn so gut wie alle dort wurden schon als Christen aufgezogen und sind schon immer Christen gewesen – anders als ich. Deswegen hab ich mich nicht unbedingt verstanden gefühlt. Momentan bete ich noch ’n bisschen, ich mach mir auch öfter Gedanken darüber, wie ich Gott wieder mehr in mein Leben lassen kann und wie ich damit umgehen soll, aber ich bin eher grad auf so ’ner Durststrecke, wo ich halt versuch’, wieder den Anlauf zu finden und den Schwung, wieder reinzukommen. Denn eigentlich vermiss ich das extrem. Ich weiß aber nicht, an wen ich mich wenden kann, weil die einzigen Christen, die ich kenne, die waren schon immer Christen. Alle Leute in meiner Umgebung sind Atheisten. Und du kommst zwar aus ’ner christlichen Familie, aber glaubst halt nicht an Gott.
Und im Studium gibt’s auch Christen, oder?
Also mit einem Mitstudenten hatte ich ’ne Zeit lang Kontakt. Der hat mal an Gott geglaubt, aber drei Monate, nachdem er mit dem Studium angefangen hat, seine Mutter durch Krebs verloren. Deswegen hat er Gott nicht mehr wirklich vertraut. Er hat zwar versucht, das Vertrauen wiederaufzubauen, aber es hat nicht funktioniert. Sonst – ich kenne einen, von dem ich nicht wirklich weiß, ob er ... er hat so ’n christliches Festival-Band an, aber wenn’s zur Sprache kam, dann hat er sich dazu nie wirklich geäußert. Sonst kenn ich eigentlich niemanden. Parvati glaubt eher an Meditation und lauter so ’n Zeug. Sie glaubt nicht an irgendwas Bestimmtes. Kerstin glaubt an Geister, Lily glaubt an gar nichts, Paul ist überzeugter Atheist.
Die Gemeinde fehlt dir?
Ich denk, dass ich da jemanden bräuchte, bei dem ich mich komplett öffnen könnte und auch über solche Themen wie Homosexualität reden könnte. Weil in der vorherigen Gemeinde, da war die Ansicht vorherrschend, dass Homosexualität Sünde ist. Dagegen ist es in meinen Augen hundertprozentig keine Sünde. Ich bin auch überzeugt davon, dass Gott das nicht als Sünde ansieht. Ich hab aber jedes Mal die Befürchtung, wenn ich’s anspreche, dass jemand anderes mir nicht zustimmt. Ich brauch nicht unbedingt die Bestätigung von anderen Menschen, dass das, was ich glaube, richtig ist, sondern in erster Linie brauch ich einfach jemanden, mit dem ich offen reden kann, der mich in meinem Glauben anerkennt und das nicht negativ bewertet. Die Leute in dieser Gemeinde hatten eine ganz bestimmte Vorstellung vom christlichen Glauben und weil ich das nicht so gesehen habe, wurde ich von ihnen extrem gejudged. Und deswegen hab ich jetzt bei anderen Christen immer Angst, dass sie mich genauso judgen, und mir fällt’s da extrem schwer, eine Gemeinde zu finden, in der ich mich wohlfühle.
Heißt das, du brauchst jemanden, der deine Meinung einfach nur anerkennt, nicht jemanden, der sie teilt?
Ich möchte einfach, dass es anerkannt wird. Denn Simone, meine beste Freundin, die jetzt in dieser Gemeinde ist, hat auch irgendwann mal gesagt, sie glaubt mir schon, dass ich glaube, aber sie ist sich nicht sicher, woran. Das heißt, sie hat angezweifelt, dass ich tatsächlich Christ bin. Und dann war da Marcus, der mir vorgeworfen hat, dass ich Jesus zum Weinen bringe. Ich hatte nie die Sicherheit oder den Rückhalt von irgendjemand, außer in der kurzen Zeit, wo Simone auch zum Christ wurde, und das hat sich dann relativ schnell verloren, als sie dann dieses Anti-Homosexuelle angenommen hat. Ich hab keine Freunde, die das irgendwie unterstützen können. Ich hab Angst, dass andere Christen das Gefühl haben, es gibt ein Konzept von einem richtigen Christen. Ich dagegen denk, jeder erlebt Gott anders und jeder hat eine andere Beziehung zu Gott.
Du hast also eigentlich ein extrem aufgeklärtes christliches Bild, wie ich finde. Du bist da anders im Vergleich zu Leuten, die schon immer drin waren im Glauben beziehungsweise in der Kirche und die da total versteift sind in ihrem Bild …
Ich glaub, dass es damit zu tun hat, dass ich nicht so aufgezogen wurde. Weil wenn du damit großgezogen wirst, bringen dir deine Eltern bei, wie sie Gott erleben und wie sie Gott in ihren Alltag einbringen. Das heißt, du bekommst erst mal ’ne Vorlage von deinen Eltern und du erlebst Gott durch die Augen deiner Eltern, bis du ihn dann selbst durch deine Augen erlebst. Man wird auf jeden Fall vorgeprägt. Und bei mir war’s so, dass ich nicht an Gott geglaubt habe, aber irgendwann dazu gekommen bin – dadurch, dass ich Gott direkt erlebt habe.
Denkst du, es war gut, dass du vom Atheismus zum Glauben gekommen bist?
Also ich denk, dass es auf jeden Fall Gottes Weg für mich war und dazu beigetragen hat, weshalb mein Glaube jetzt stark ist und nicht so ein: „Ja, ich denk schon, dass es vielleicht ’nen Gott gibt, aber ich brauch ihn nicht unbedingt in meinem Leben.“ Wenn ich christlich großgezogen worden wäre, hätte ich eventuell gar nicht so stark an Gott geglaubt. Dadurch, dass ich ihn selbst entdecken und selbst erleben durfte, ist mein Glaube erst so stark geworden. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass ich mich manchmal extrem allein fühle in meiner Familie. Mit meinen Brüdern geht’s einigermaßen, weil die interessiert tatsächlich, was ich zu sagen hab. Sie finden’s immer noch Schwachsinn, aber sie interessieren sich zumindest dafür und fragen nach. Trotzdem kamen schon so Sachen, wie „Was muss man eigentlich kiffen, damit man daran glaubt?“ und „Auf dem Trip wär ich auch gerne!“ Mein Vater findet auch: „Das sind abstruse Gedanken“, und meine Mutter ist die einzige, die gegen das Christentum an sich überhaupt nichts hat, aber eben einfach nicht daran glaubt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, in einem christlichen Haushalt zu leben und christliche Weihnachten zu feiern. Dass man nicht einfach nur zusammenkommt, Geschenke verteilt und was isst, sondern tatsächlich ’n Grund hat, dieses Fest zu feiern, ’nen tieferen Zweck. Ich werd wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nie wissen, wie es ist, in einem christlichen Haushalt zu leben.





























