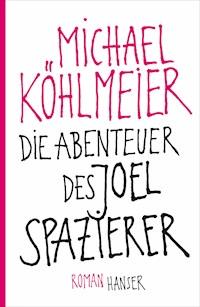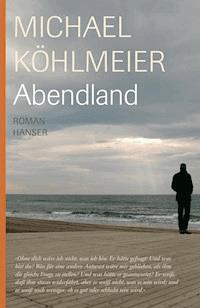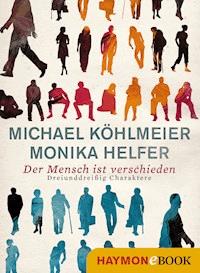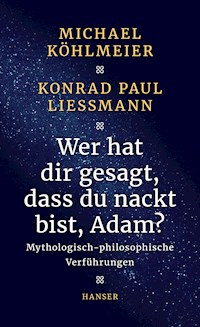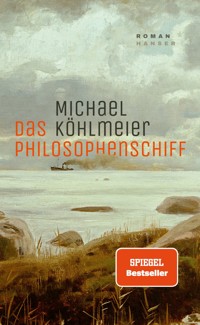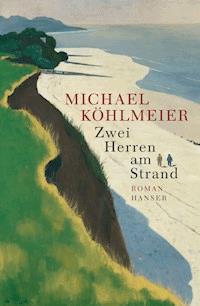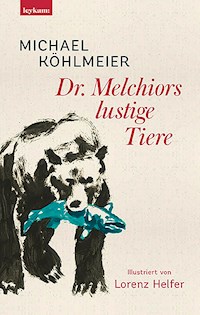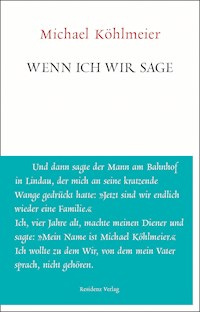Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sebastian Lukasser, Schriftsteller, kennt Madalyn seit ihrem fünften Lebensjahr. Sie kann ihm Dinge anvertrauen, die ihre Eltern nicht verstehen würden. Jetzt ist sie vierzehn und erlebt ihre erste, ausweglos komplizierte Liebesgeschichte. Kompliziert, weil Moritz alles andere als ein leichter Fall ist - er wurde bei einem Einbruch erwischt und ist ein notorischer Lügner. Oder spricht er vielleicht doch die Wahrheit? Michael Köhlmeiers Roman über Madalyn und Moritz ist eine herzzerreißende Erzählung über die erste Liebe und große Gefühle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Köhlmeier
Madalyn
Carl Hanser Verlag
eBook 978-3-446-23615-8
© Carl Hanser Verlag München 2010
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
1
Im Frühling 09 war Madalyn noch nicht vierzehn Jahre alt.
Ich kannte sie seit ihrer Geburt. Als ihre Eltern in unser Haus in der Heumühlgasse zogen, war Frau Reis mit ihr schwanger. Herr Reis arbeitete in einem Unternehmen, das Maschinen zur Herstellung von Computerchips konstruierte und – allerdings nicht in Wien – auch baute; er war Techniker oder Manager oder beides. Sowohl die Firma als auch er hätten einiges in petto, hieß es. Ich erfuhr davon über das Gerede im Haus, an dem ich mich gern beteiligte, vor allem, wenn es sich um die Kombination von Geld und Zukunft drehte. Es war die Zeit, als fast jeder Aktien kaufte, ich für eine Million Schilling aus einem brasilianischen Telekommunikationsfond, die fünf Jahre später nur noch knapp ein Zehntel wert waren. Herr Reis und seine Frau investierten klüger, sie kauften die Wohnung ein Stockwerk unter mir; woraus ich außerdem schloss, dass sie vorhatten, hier zu bleiben. Von meinem Arbeitszimmer aus konnte ich auf ihren Balkon schauen. Dort standen eine Bank aus silbrig grauem Holz und ein Tischchen, dessen Platte den Venuskopf von Botticelli, zusammengefügt aus Mosaiksteinchen, zeigte. Ich hatte nie jemanden dort sitzen sehen. Einmal war ich mit der Hochschwangeren allein im Lift gefahren und hatte gesagt, weil mir nichts anderes einfiel und weil es auch stimmte, dass wir uns auf das Kind freuten, wir alle im Haus, und hatte hinzugefügt, dass sie hier reichlich Auswahl an Babysittern fände. Sie war nicht sehr gesprächig, und ich bin mir hinterher töricht und aufdringlich vorgekommen. Das Ehepaar Reis – sagte mir Frau Malic, die Koordinatorin allen Geredes im Haus – gehöre irgendeiner christlichen Abspaltung an. Darüber wollte ich nichts wissen; ich wehrte mich gegen meine eigene Neugierde und war durchaus erfolgreich. Aber mit ihrer Tochter, mit Madalyn, verband mich durch deren Kindheit hindurch eine besondere Freundschaft, und dafür gab es einen Grund.
Zu ihrem fünften Geburtstag bekam Madalyn ein Fahrrad geschenkt. Es war Herbst. Sie brachte sich das Fahren ganz allein bei, schob das Rad jeden Nachmittag nach dem Kindergarten über den Naschmarkt in den kleinen Park an der Linken Wienzeile und rollte dort über den flachen künstlichen Hügel hinunter. Und zufällig war ich der erste, dem sie ihre fertige Kunst vorführte. Manchmal setzte ich mich auf eine Bank unter den Ahornbäumen zwischen Schaukeln und Rutschen – eigentlich nur im Herbst und im Winter tat ich das, wenn keine Kinder anwesend waren, dann wurde der kleine Park auch von den Erwachsenen vergessen, und es war still wie im Wald und das mitten in der Stadt. So saß ich und las, als Madalyn mit ihrem Rad daherkam. Im Gegensatz zu ihren Eltern redete sie gern, sehr gern sogar, schüchtern war sie nicht. Sie hatte mir bereits im Stiegenhaus ausführlich von ihrem ersten Tag im Kindergarten erzählt und mir bei jedem weiteren Treffen Zwischenberichte geliefert, hatte mir die Papierflieger gezeigt, die sie in der Kreativgruppe gefaltet hatten, und wir haben sie durch das Stiegenhausfenster in den Innenhof geschickt. Sie spielte gern im Stiegenhaus, und sie spielte immer allein. Sie redete laut mit sich selbst, offenbar gefiel ihr die Akustik. Es war Evelyn und mir oft eine Freude gewesen, sie dabei zu belauschen. Wir mochten ihre heisere Stimme, die gut zu ihren wilden, krausen, kaum frisierbaren Haaren und zu ihrem Gesichtchen passte, das ein wenig derb war. Evelyn erinnerte sie an sich selbst – nicht nur wegen des Gleichklangs der letzten Silbe ihrer Namen, wie sie sagte –, sie habe als Kind ebenfalls die meiste Zeit allein gespielt und dabei laut gesprochen, ganze Nachmittage hindurch, und wie Madalyn im Dialog mit einer fiktiven Freundin.
Madalyn sagte, sie wolle mir zeigen, was sie könne, setzte sich aufs Rad und fuhr los und kreischte dabei, trat in die Pedale und fuhr Kurven über den Rasen. Mit dem Absteigen hatte sie allerdings Probleme. Sie lenkte zu mir hin und rief, ich solle sie aufhalten. Sie war stolz, weil sie bisher nur ohne zu treten gefahren war. Ich sagte, das bedeute, von heute an könne sie tatsächlich Fahrrad fahren, denn ohne zu treten sei nicht wirklich Fahren, erst bei Treten könne man von Fahren sprechen. Und in der folgenden Stunde – ich war Zeuge – lernte sie auch, zu bremsen und abzusteigen.
»Kann ich jetzt wirklich Radfahren?« fragte sie.
»So gut wie jeder andere auch«, sagte ich.
Ich hätte es nicht so kräftig betonen sollen. Ein paar Tage später raste sie, ohne auf die Straße zu achten, aus der Einfahrt unseres Hauses und direkt vor ein Auto. Sie wurde in die Luft geschleudert und landete fünf Meter weiter auf der Fahrbahn. Was ein Glück war. Sie hätte ebensogut unter die Räder kommen können – wie ihr Fahrrad. Und zufällig war ich wieder Zeuge gewesen. Ich kam die Straße vom Naschmarkt herauf und habe alles gesehen. Ich bin gleich zu ihr hingelaufen. Die Fahrerin blieb einfach in ihrem Wagen sitzen, die Hände am Lenkrad, und drückte die Augen zu. Madalyn hatte das Bewusstsein verloren, sie blutete an der Innenseite ihres Unterarms. Ich hatte mein Mobiltelefon nicht bei mir und rief laut um Hilfe. Aus einem der Fenster schaute ein Mann, ich rief, er solle die Rettung holen. »Hundertvierundvierzig wählen! Hundertvierundvierzig wählen!«
Madalyns Arm blutete so stark, dass sich eine Lache auf dem Asphalt bildete. Ein Stück Haut war an der Innenseite aufgerissen. Ich zog mir einen Schuh aus und band ihr mit meinem Strumpf den Arm ab. Sie öffnete die Augen, und als sie mich sah, verzog sie den Mund und begann zu schluchzen. Ich sagte, es sei alles gut, ich sei bei ihr, die Mama werde gleich kommen und in ein paar Tagen werde sie darüber lachen.
»Das verspreche ich dir, Madalyn. Ich sag es, weil ich es weiß.«
Ich traute mich nicht, ihren Oberkörper hochzuheben, um sie in den Arm zu nehmen.
Inzwischen standen Leute um uns herum, auch eine Frau aus unserem Haus. Ich sagte, sie solle bei Familie Reis klingeln und Madalyns Mutter verständigen. Ihr Vater war bei der Arbeit, der war sicher nicht zu Hause. – Die Mutter auch nicht.
Die Rettung kam, Madalyn wurde auf eine Bahre gelegt. Sie hielt meine Hand fest und bat mich mit kleiner Stimme, nicht wegzugehen. Der Arzt meinte, es sei in Ordnung, ich könne mit ihnen mitfahren. Während der Fahrt ins Allgemeine Krankenhaus ließ sie meine Hand nicht los. Ich streichelte ihr über die Stirn, und der Arzt versorgte ihre Wunden. Auch am Kopf hatte sie eine Wunde, die hatte ich nicht bemerkt. Ich sprach mit ihr, bemühte mich um einen ruhigen gewöhnlichen Ton. Was mir schwerfiel. Sie versuchte zu lächeln, zog aber gleich wieder die Mundwinkel nach unten und begann zu schluchzen, und ich musste an mich halten, damit ich nicht einstimmte.
Außer der Verletzung am Unterarm, die sich niemand recht erklären konnte, und einer leichten Gehirnerschütterung hatte Madalyn keinen Schaden davongetragen. Man behielt sie im AKH, bis ihre Mutter komme, um sie abzuholen. Das dauerte bis zum Abend! Sie war nicht erreichbar gewesen. Ebenso Madalyns Vater. In der Firma sagte man, er habe einen wichtigen Auswärtstermin, sein Handy habe er nicht eingeschaltet, das sei Firmenphilosophie. Der Arzt wollte die Eltern zur Rede stellen, er überlege sogar, ob er nicht Anzeige wegen Vernachlässigung erstatten solle, sagte er – ein Kind von fünf Jahren von Mittag bis Abend allein zu lassen! Als Frau Reis kam, zog er sich zurück und überließ alles mir.
Sie hatte eine einschüchternde Art, fixierte einen mit den Augen und bewegte sich dabei kein bisschen; als wäre sie eingefroren. Ich erklärte ihr, was geschehen war, enthielt mich aber der Kritik. Nahm mir allerdings vor, in den nächsten Tagen einen Stock tiefer zu gehen und meine Meinung zu deponieren. Große Sorgen schien sich diese Frau nicht zu machen. Und bei mir bedankt hat sie sich auch nicht. Ich trug Madalyn hinaus ins Auto. Frau Reis bot mir nicht einmal an, mich mitzunehmen. Ich fuhr mit dem Bus und der U-Bahn vom AKH nach Hause. Jeder hat seinen eigenen Stil, schockiert zu sein, dachte ich, bei Frau Reis geht es halt so.
Ein paar Tage später klingelte es an meiner Tür. Madalyn stand draußen, Arm und Kopf im Verband. In der Hand hielt sie eine Kinderzeichnung, die sie für mich angefertigt hatte. Darauf war in mehreren Sequenzen ihr Unfall dargestellt.
»Ich möchte danke sagen und hab das da gemalt. Für Sie.«
»Das freut mich sehr«, sagte ich. »Ich werde das Bild in einen Rahmen geben und es mir an die Wand hängen.«
»Wirklich!« fragte sie. »Wie ein Kunstbild?«
»Ich finde, es ist ein Kunstbild«, sagte ich. »Und außerdem erzählt es eine Geschichte. Die meisten Kunstbilder erzählen keine Geschichte, dieses schon.«
Das Bild stellte unser gemeinsames Abenteuer dar. Auf jeder Sequenz war auch ich zu sehen: Ich, wie ich auf der Straße gehe und sehe, wie Madalyn durch die Luft fliegt; ich, wie ich neben ihr am Boden hocke, zwischen uns ein See von Blut; ich, wie ich im Rettungsauto mit dem roten Kreuz sitze und Madalyns Hand halte. Ich habe das Bild zum Kunstgeschäft Wolfrum bei der Albertina gebracht und einen schwarzen Lackrahmen mit goldenem Streifen ausgesucht. Nachdem ich es in der Bibliothek an den einzigen freien Platz gehängt hatte, ging ich nach unten. Madalyn war wieder allein. Ich sagte, ich würde gern ihren Vater und ihre Mutter und natürlich auch sie zu einem Tee oder Kaffee oder Kakao einladen und das gerahmte Bild zeigen. Sie wollte nicht auf ihre Eltern warten, sie wollte es gleich sehen.
Evelyn war hingerissen von dem Bild (damals steckten wir mitten in der Diskussion der Frage, ob wir zusammenziehen sollten), am meisten aber faszinierte sie die Tatsache, dass Madalyn Sie zu mir sagte.
»Das ist mehr als ungewöhnlich«, schwärmte sie. »Ihre Eltern legen offensichtlich Wert auf Manieren.«
»Ganz offensichtlich«, sagte ich.
Madalyn und ich unterhielten uns von nun an noch ausführlicher, wenn wir einander auf der Stiege oder auf der Straße vor dem Haus begegneten oder im Hof, wenn wir den Müll entsorgten. Sie erzählte mir von ihrem ersten Schultag, präsentierte ihr erstes Zeugnis, zeigte mir, was sie zu Weihnachten bekommen hatte; schilderte mir einen Schulausflug in den Lainzer Tiergarten, wo sie Wildschweine mit Jungen gesehen hätten; und jubilierte im Sommer, weil sie schwimmen gelernt habe und wie wunderbar es sei. Auf dem Fensterbrett im Stiegenhaus habe ich ihr einmal bei der Mathehausaufgabe geholfen; und als sie mir einen Witz erzählte, habe ich ohne zu spielen laut gelacht. Einmal hat sie mich gefragt, ob sie meine Schuhe putzen dürfe. Ich sagte, tun wir es gemeinsam, du putzt deine, ich putz meine. Und so waren wir auf der Stiege gesessen und hatten gebürstet und poliert und geplaudert.
Wenn ich sie eine Woche lang nicht gesehen oder gehört hatte, wurde ich unruhig. Nicht nur einmal stand ich vor der Tür der Familie Reis, den Finger bereits auf dem Klingelknopf, weil ich mich nach ihr erkundigen wollte. Draufgedrückt habe ich freilich nicht. Seit Madalyns Unfall hatte ich den Eindruck, ihre Mutter sei nicht mehr nur wortkarg, sondern sie gehe mir aus dem Weg. Was ich irgendwie nachvollziehen konnte. Aber ich bildete mir zudem ein, einen Vorwurf in ihren Augen zu sehen. Erklärbar ist wahrscheinlich auch dieses Verhalten; geärgert habe ich mich trotzdem.
Aber Madalyn mochte mich gern, und es machte mir Freude, dies in ihrem Gesicht zu lesen.
Einmal sagte sie zu mir: »Sie haben mir das Leben gerettet.« Da wollte ich ihr nicht widersprechen.
»Etwas Schöneres habe ich in meinem Leben nicht getan«, antwortete ich.
2
Im Frühling 09 – Ende März – stand sie vor meiner Tür und war sehr verlegen. Ich hatte sie schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Ich war erst vor ein paar Tagen aus Amerika zurückgekehrt, wohin ich aus einem einzigen Grund gefahren war, nämlich, um nach den deprimierenden acht Jahren von George W. Bush wieder hoffnungsfroh amerikanische Luft zu atmen. Immerhin hatte ich in den Achtzigern fast zwei Jahre dort gelebt und das mit der Erwartung, für immer zu bleiben. Ich hatte meine Freunde Antonia und Lenny Redekopp in North Dakota besucht, die inzwischen ein sehr altes Paar waren, aber rüstig genug, um für den Demokraten Barack Obama zu werben.
Madalyn hielt mit beiden Händen eine Ringmappe vor ihrer Brust. »Ich störe wahrscheinlich«, sagte sie.
»Du störst mich nie«, sagte ich.
»Aber wenn es Ihnen lieber ist, dass ich ein anderes Mal komme? Ich hätte vorher anrufen sollen, aber ich weiß die Nummer nicht, und Sie stehen nicht im Telefonbuch.«
»Komm rein«, sagte ich und trat beiseite. Nach ihren Eltern fragte ich nicht, das hätte sie womöglich missverstanden; als ob sie bei jedem Schritt erst um Erlaubnis fragen müsste – was ihre Eltern auch tatsächlich von ihr erwarteten.
Noch während sie ihre Schuhe auszog, fing sie an: »Wir sprechen in der Schule viel über Literatur zur Zeit, besonders über österreichische Literatur, und da habe ich gesagt, dass ich den Schriftsteller Sebastian Lukasser kenne, und da war unsere Professorin wahnsinnig aufgeregt, weil Sie so berühmt sind, und ich habe das wirklich nicht gewusst, und Frau Prof. Petri hat gesagt, ich soll Sie bitte fragen, ob Sie mir vielleicht ein Interview geben, und wenn Sie das tun und wenn es gut wird, bekomme ich eine gute Note.«
Madalyn ging in die vierte Klasse des Gymnasiums in der Rahlgasse. Es war die am nächsten bei uns liegende Schule – von der Heumühlgasse über den Naschmarkt, am Café Sperl vorbei (nicht selten winkten wir uns durch das Fenster zu, wenn sie am Morgen mit dem Fahrrad zur Schule fuhr und ich beim Frühstück saß) – eine bemerkenswerte Schule übrigens, es gab dort reine Mädchenklassen, zum Beispiel die 4 a, die Madalyn besuchte. Die Direktorin sei eine »gute Feministin«, hatte mir Madalyn bei anderer Gelegenheit erzählt. Madalyn war eine gute Schülerin.
Das Interview war kein Vorwand, das sicher nicht. Wir brachten es auch tadellos hinter uns. Ich fühlte mich geschmeichelt und sagte es ihr auch; befürchtete zugleich, unsere bisherige Unbefangenheit könnte unter meinem »Ruhm« leiden; so weit her sei es damit nicht, sagte ich. Ich borgte ihr mein altes Diktiergerät, erklärte ihr den Mechanismus und versprach, in kurzen Sätzen zu sprechen, damit sie nicht soviel Arbeit beim Abschreiben habe. Sie hatte sich eine Reihe von Fragen notiert und las sie vor. Erstens, warum ich Schriftsteller geworden sei. Zweitens, wie mein Tagesablauf aussehe. Drittens, was mein Lieblingsbuch von mir sei. Ich beantwortete ihre Fragen und berichtete darüber hinaus – auch, weil ich ein bisschen vor ihr angeben wollte –, dass ich nach meinem letzten Buch, das sehr umfangreich gewesen und tatsächlich mein Lieblingsbuch sei, endlich wieder an einem Roman arbeite, an der Geschichte eines Mannes, der im Alter von – »ja, ungefähr in deinem Alter, Madalyn, ein bisschen älter nur« – einen Mord begangen habe und wie sein weiteres Leben verlaufen sei. Viertens – ihre Professorin habe sie gebeten diese Frage, an mich zu richten –, was für mich die größte Schwierigkeit beim Schreiben sei.
»Wer die Geschichte erzählt«, antwortete ich, ohne zu zögern. »Der Mörder selbst oder ein allwissender Erzähler, oder ob ich, Sebastian Lukasser, sie erzählen soll.«
»Ist es eine wahre Geschichte?« Diese Frage stand nicht in ihrem Heft. »Kennen Sie den Mörder persönlich?«
»Ja«, sagte ich, »ich kenne ihn.«
Darüber staunte sie nicht im geringsten. »Ist es nicht am allerbesten, Sie erzählen die Geschichte. Das tun Sie sowieso. Warum sollten Sie so tun, als ob jemand anderer die Geschichte erzählt?«
Das leuchtete mir ein.
Ein Vorwand war ihr das Interview nicht, nein. Aber ich merkte bald, dass es wohl auch eine Gelegenheit für sie war oder wenigstens hätte sein können, etwas anderes loszuwerden. Und als ich am Ende doch in lange Sätze verfiel, sah ich ihr an, dass ihre Gedanken abschweiften, und ihr pflichtbewusstes Nicken, mit dem sie meine Ausführungen begleitete, verriet weniger Interesse als Ungeduld.
Aber sie brachte es nicht über sich, von dem anderen, das sie bedrückte, zu sprechen. Jedenfalls nicht an diesem Tag.
Sie kam wieder.
Am nächsten Tag gleich nach der Schule – sie sei gar nicht zu Hause gewesen – stand sie mit ihrem Rucksack vor meiner Tür, und diesmal fragte sie nicht, ob sie störe, sondern trat an mir vorbei in den Flur und klinkte die Tür hinter sich ins Schloss.
Einige Fragen und Antworten hatte sie bereits in ihr Heft abgeschrieben und wollte sie mir zeigen.
»Ich habe bis spät in die Nacht hinein das Tonband abgehört«, sagte sie, und weil ihr diese Floskel so gut gefiel, gleich noch einmal: »Bis spät in die Nacht hinein habe ich gearbeitet.«
Ihre Handschrift war sehr kindlich. Sie hatte mit Tinte geschrieben. Das rührte mich. Sie hatte klug aus meinen Antworten ausgewählt. Ich sagte, ich hätte wirklich keine Idee, was sie verbessern könnte.
»Dann ist das Interview schon fertig?« fragte sie.
»Es sieht so aus«, sagte ich.
Wir saßen wieder in der Bibliothek, sie in dem grünen Lederfauteuil, ich auf dem Sofa. Ich hatte uns Kaffee gebrüht, den sie – wie schon bei ihrem letzten Besuch – kalt werden ließ. Sie wundere sich jedes Mal, wie etwas, das so gut rieche, so gar nicht besonders schmecke, sagte sie, aber ob ich ihr dennoch wieder einen bringen könne. Sie hatte die Haare geschnitten, das fiel mir erst jetzt auf, gestern waren sie unter einem grünen Tuch versteckt gewesen, dessen lange Enden ihr über die Schultern gehangen hatten. Die neue Frisur ließ sie ein wenig brav aussehen, musterschülerhaft, die wilden Locken waren gebändigt, ins Unscheinbare zurückgestutzt; andererseits kam nun die schöne Form ihres Kopfes zur Geltung. Ihr Mund war sehr ernst. Nicht konzentriert ernst wie gestern, als sie sich Notizen gemacht hatte – was nicht notwendig gewesen wäre, sie hatte ja das Diktiergerät, aber es hatte ihr wohl gefallen, ein wenig Kino zu spielen, sie die Reporterin, ich der Schriftsteller in Kordhosen und Flanellhemd, wie es sich gehörte. Dieser neue Zug in ihrem Gesicht drückte Leid aus, ich konnte es nicht anders deuten, und das gab mir einen Stich ins Herz. Es war mehr als Bedrücktheit oder Sorge; etwas tat ihr sehr weh, und sie war gekommen, um mit mir darüber zu sprechen. Ich spürte wieder die alte Empörung in mir. Was ging dort unten vor, in dieser Wohnung, aus der nie ein Laut drang? Seit Madalyns Unfall, also seit fast neun Jahren, hatte ich mit Frau Reis nichts Wesentliches gesprochen. Mit Herrn Reis hatte ich überhaupt nur einmal gesprochen, am Neujahrstag. Er stand vor der Tür, um mir alles Gute zu wünschen, was mich mehr als verwunderte, hereinkommen wollte er nicht. Er sagte, das Jahr 2009 werde ein apokalyptisches werden, und zwar nicht nur in wirtschaftlicher, sondern in jeder Hinsicht, Wetter, Moral, Politik. Ein sehr gut aussehender Mann, groß, keine Spur von einem Bauch, eine schlaksige, dandyhafte Erscheinung, das Lockenhaar hatte Madalyn von ihm. Während er sprach, ging er im Flur auf und ab, wenige Schritte hin, wenige Schritte her, als müsste er dringend aufs Klo. Für einen so schlanken Mann hatte er einen erstaunlich schweren Schritt. Ich meinte, in seinen leicht nach oben gekrümmten Mundwinkeln eine Schadenfreude zu erkennen. Wie kann, dachte ich, ein Mann, dem alles Irdische offensteht, sich einer lebensunfreundlichen religiösen Bewegung anschließen – vorausgesetzt, die Vermutungen von Frau Malic trafen zu –, die aus ihm einen verklemmten, grüblerischen Misanthropen machte … Ich traf ihn bereits am nächsten Tag wieder. Er öffnete mir die Haustür, hielt sie offen, bis ich auf die Straße getreten war, und ging mit einem kameradschaftlichen Lächeln davon – ohne Gruß allerdings –, beschwingt und gar nicht schweren Schrittes. Dass es weder er noch seine Frau nach Madalyns Unfall für notwendig erachtet hatten, mit mir zu sprechen, fand ich auch nach neun Jahren empörend. Evelyn hatte damals gemeint, es liege an mir, ich sei es, der die Leute einschüchtere, der ihnen ein so schlechtes Gewissen einjage, dass sie lieber unhöflich seien, als Gefahr zu laufen, von mir als verantwortungslos beschimpft zu werden. Mein Freund Robert Lenobel hingegen, immerhin Psychiater und Psychoanalytiker, hatte für mich Partei ergriffen: Ich solle, hatte er gesagt, sofort für mein neu erworbenes Sorgenkind ansparen, damit sie bei ihrem vierzehnten Lebensjahr mit einer Therapie beginnen könne; ihre Eltern hätten, wie ich sie ihm beschriebe, dafür vermutlich kein Geld übrig. – Nun, in einem halben Jahr würde Madalyn vierzehn sein.
Sie trug eine hübsche blauweiße Sportjacke, die vermutlich hip war und sie älter aussehen ließ. Sie beugte sich vor, klemmte die gefalteten Hände zwischen ihre Knie und blickte vor sich nieder. Sie hatte die Ärmel ihres Pullis nach oben geschoben. Ich sah die Narbe auf ihrem rechten Unterarm, eine weiße Triangel. Einen Augenblick überlegte ich, sie darauf anzusprechen, vielleicht würde es sie von ihrem Kummer ablenken, wenn wir uns die alte Geschichte erzählten, die wir uns schon oft, aber schon lange nicht mehr erzählt hatten.
Ich hatte allerdings den Eindruck, sie wollte nicht abgelenkt werden, im Gegenteil. Sie atmete schwer, und manchmal hielt sie die Luft an, blickte schnell in meine Richtung, aber entweder wusste sie nicht, wie sie beginnen sollte, oder sie zweifelte, ob ich der Richtige sei, ihr zuzuhören. Nur bitte nicht etwas beichten, dachte ich, damit will ich nichts zu tun haben; weil ich inzwischen (nach der realen Begegnung mit der realen Hauptfigur meines in Arbeit befindlichen Romans) mit fast gar nichts etwas zu tun haben wollte, was sich außerhalb meines Kopfes abspielte. Es ist eine schlechte Eigenschaft, hinter Worten, Mienen, Gesten und verschiedenen Körperhaltungen zunächst eine Absicht zu vermuten, die den Worten, Mienen, Gesten nicht entspricht, sondern diese nur als Mittel verwendet, um jemanden rumzukriegen; aber über diese schlechte Eigenschaft verfüge ich eben, leider. Ich wollte mich in nichts einmischen. Wenn sie mir etwas mitteilen wollte, sollte sie es tun. Danach fragen würde ich nicht.
Sie sagte – und sprach dabei so leise, dass ich mich zu ihr hinneigen musste, um sie zu verstehen: »Ich kann meine Eltern nicht leiden. Ich kann sie nicht leiden. Wenn ich fünfzehn bin, hau ich ab. Das steht fest. Dann bin ich weg. Die Mama kann ich noch weniger leiden als den Papa. Ich kann sie beide nicht leiden. Er ist ein Versager, ein Loser. Traut sich nichts zu sagen. Zu mir sagt er so, und zu ihr sagt er so. Ich könnt mich anspeiben.«
»Das interessiert mich bitte nicht, Madalyn«, sagte ich.
Sie blickte mich erstaunt an. »Wirklich nicht? Wieso nicht? Ich dachte, Sie können meine Mutter auch nicht leiden.«
»Wie kommst du darauf? Wie kannst du so etwas sagen!«
Sie drehte den Kopf beiseite, holte einmal tief Luft, zischte eine Entschuldigung und eilte hinaus in den Flur.
Ich, nun tatsächlich verwirrt, nicht zuletzt wegen meiner glatten Scheinheiligkeit, lief hinter ihr her. »Hast du schon etwas gegessen, Madalyn? Oder ist deine Mutter wieder nicht zu Hause? Ich kann uns etwas aufwärmen, es ist ein Risotto von vorgestern im Kühlschrank.«
Sie verdrehte die Augen, stieg in ihre Schuhe, schnürte sie erst gar nicht zu, warf sich den Rucksack über die Schulter und war zur Tür draußen.
Dabei hatte ich ihr einen deutlichen Hinweis gegeben, dass ich auf ihrer Seite stand – Oder ist deine Mutter wieder nicht zu Hause? –, das war doch eine unüberhörbare Anspielung auf ihren Unfall gewesen. Über ihr Bild, das in meiner Bibliothek hing, hatte weder sie noch ich ein Wort verloren.
3
Aber am nächsten Tag kam sie wieder, und wieder um die Mittagszeit. Das Risotto hatte ich inzwischen ins Klo versenkt. Es war von einem Abend mit Robert und Hanna Lenobel und einer gemeinsamen Bekannten übriggeblieben. Wie immer hatte ich zuviel gekocht. Diesmal fragte ich Madalyn gleich, ob sie Hunger habe. Hatte sie. Ich lud sie in dieses neue Lokal am Naschmarkt ein, das, wie geworben wurde, die Frau von Samy Molcho führte und das wie sie hieß – Neni.
In meinem Kopf war Madalyn immer noch das sanfte, ein wenig melancholische, ein wenig ängstliche, zufrieden mit sich selbst spielende, allein gelassene Mädchen, das während der Fahrt im Rettungsauto meine Hand nicht losgelassen hatte. Als sie mir nun gegenübersaß und den Rhythmus der Musik mit den Knöcheln auf den Tisch dippte, dachte ich, ich kenne sie in Wahrheit nicht, sie ist erwachsen, natürlich kenne ich sie nicht, woher auch; und dachte, nein, sie ist nicht erwachsen. Und dachte: Ich hatte über all die Jahre kein richtiges Bild von ihr. Ich hatte ein Bild von ihr, aber das hatte ich aus der Luft gegriffen, aus der Sentimentalität meines unbedankten Heldentums, ein präliterates Ding war sie für mich gewesen, eine Inspiration. Tatsächlich hatte ich irgendwann eine Erzählung begonnen, in der ein Abenteuer wie das unsere im Mittelpunkt stehen sollte. Das hier aber strengte mich an, ich wollte Charaktere in den Computer hacken und nicht in der Wirklichkeit ein Bild korrigieren, das ich mir einmal gemacht hatte und das mehr über meine Rührseligkeit mir selbst gegenüber verriet als über Madalyn. Vielleicht würde sie nach diesem Tag meiner Einbildungskraft entgleiten, und ich war mir nicht sicher, ob ich ihr außerhalb derselben meine volle Aufmerksamkeit schenken konnte – und wollte.
Bis das Essen kam, saßen wir da und sagten nichts. Die Holzbänke waren wie alte Schulbänke geformt, der Innenarchitekt musste in meinem Alter sein, dachte ich, ein Nostalgiker wie ich. Neni kam an unseren Tisch und gab zuerst Madalyn die Hand, dann mir. Ich nannte Madalyns Namen, sagte aber nicht, wie sie zu mir stand. Neni fragte, ob sie uns auf eine Mango-Lassi einladen dürfe. Madalyn nickte, blieb ernst, lächelte nicht. Ein Herz sei dem anderen ein Spiegel – blanker Unsinn.
»Haben Sie keine Kinder?« fragte sie, als wir wieder allein waren – eine merkwürdige Frage.
»Einen Sohn«, sagte ich. »Er heißt David, ist neunundzwanzig und lebt in Frankfurt und arbeitet als Programmierer in einer kleinen, aber sehr erfolgreichen Computerfirma, an der er auch irgendwie beteiligt ist, frag mich nicht wie. Sie entwickeln dort Software für Sprachbehinderte, wenn ich das richtig verstanden habe. Er macht also etwas Ähnliches wie dein Vater. In Amerika lässt sich damit gutes Geld verdienen und in Zukunft bei uns wahrscheinlich auch, es ist ein krisensicherer Bereich. Wir telefonieren manchmal miteinander. Aber er hat mich erst einmal in Wien besucht …«
Das interessierte sie alles nicht. Ich redete drauflos, weil ich fürchtete, es könnte sich im Schweigen sehr schnell wieder eine fremde Stimmung ausbreiten, aus der wir irgendwann nicht mehr so ohne weiteres herausfänden, und das hätte ich mir angekreidet. Sie spürt meinen Widerwillen, dachte ich, ich bin ein eigenbrötlerischer Egoist. Das wollte ich nie werden. Merkwürdig war ihre Frage deshalb, weil ich ihr – ich erinnerte mich sehr gut daran – von David erzählt hatte, und das nicht nur einmal. Damals war ich für sie wohl mehr eine Instanz gewesen als ein Mensch mit dem üblichen Wagen voller Möglichkeiten, vielleicht war ich für sie ja auch eine Inspiration gewesen wie sie für mich. Ein Herz ist dem anderen eben doch ein Spiegel.
»Warum kommt Ihre Frau nicht mehr?« unterbrach sie meine Gedanken.
»Wen meinst du?«
»Die oft bei Ihnen war. Ich weiß schon, dass Sie nicht mit ihr verheiratet sind, aber wie soll ich denn dazu sagen? Einmal haben Sie sie mir vorgestellt. Erinnern Sie sich nicht mehr? Warum erinnern Sie sich nicht mehr? Wir haben miteinander geredet. Sie war nett. Und schön. Sie hat mich auch nett gefunden. Ihre Haare haben so geglänzt. Wie lackiert. Was hat sie mit den Haaren gemacht? Und so schwarz. Hundertprozentig gefärbt.«
Ich antwortete der Reihe nach, wie in unserem Interview: Dass Evelyn und ich uns getrennt hätten. Dass ich keine Ahnung habe, warum ihre Haare so geglänzt hatten. Dass ich aber – ebenfalls hundertprozentig – wisse, dass sie ihre Haare färbe.
»Und jetzt ist nichts mehr?«
»Nein.«
»Und man sieht sich auch nicht mehr?«
»Manchmal. Ich lade sie zum Essen ein, und sie sagt, sie möchte lieber nicht, und ich frage, warum möchtest du lieber nicht, und sie sagt, weil ich keinen Hunger habe.«
»Warum leben Sie allein?« fragte sie weiter.
»Ich weiß es nicht«, sagte ich wahrheitsgetreu. »Es hat sich so ergeben.«
»Mögen Sie Ihren Namen?«
»Meinen Vornamen oder meinen Nachnamen?«
»Beide.«
»Ich habe mich daran gewöhnt.«
»Ich mag meinen Vornamen, aber den Nachnamen hasse ich. Wenn ich achtzehn bin, gebe ich mir einen anderen Namen. Das kann man, das weiß ich.«
»Es ist ein guter Name. Reis. Einsilbige Namen sind gut. Kann man sich gut merken.«
»Ich heiße wie eine Speise. Ist das gut?«
»Ein Reis ist ein Zweig.«
»Das höre ich zum ersten Mal.«
»Reisig. Das kennst du doch. Daher kommt Reis. Oder umgekehrt, Reisig kommt von Reis.«
»Reisig ist das, was man wegschmeißt, wenn man im Garten arbeitet, hab ich recht?«
Darauf antwortete ich nicht. Und wenn sie Gold oder Edelstein geheißen hätte, ihr wäre im Augenblick garantiert das Richtige dazu eingefallen.
Sie mischte und schichtete ihr Wokgemüse um, probierte und salzte nach, bestellte eine große Flasche Mineralwasser und eine Cola light und aß in heftigen Schüben. Sie war ausgehungert, aber mitten im Schlingen fiel ihr ein, dass sie eigentlich nichts oder zumindest weniger essen wollte. So sei es bei Klara gewesen, hatte Hanna erzählt. Klara war zwanzig und hatte eine fünfjährige Karriere als Bulimikerin hinter sich – hoffentlich hinter sich.
Und nun meldete sich endlich doch der Samariter in mir, der bereits in meiner Kindheit neben der entzündlichsten Stelle meines Herzens Quartier bezogen und mir ein Leben lang eingeredet hatte, ohne meine Hilfe würden die Welt und die lieben Menschen darin vor die Hunde gehen.
»Was ist los, Madalyn? Was bedrückt dich? Sag es mir! Was bedrückt dich?«