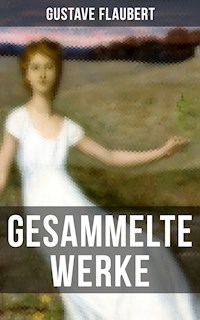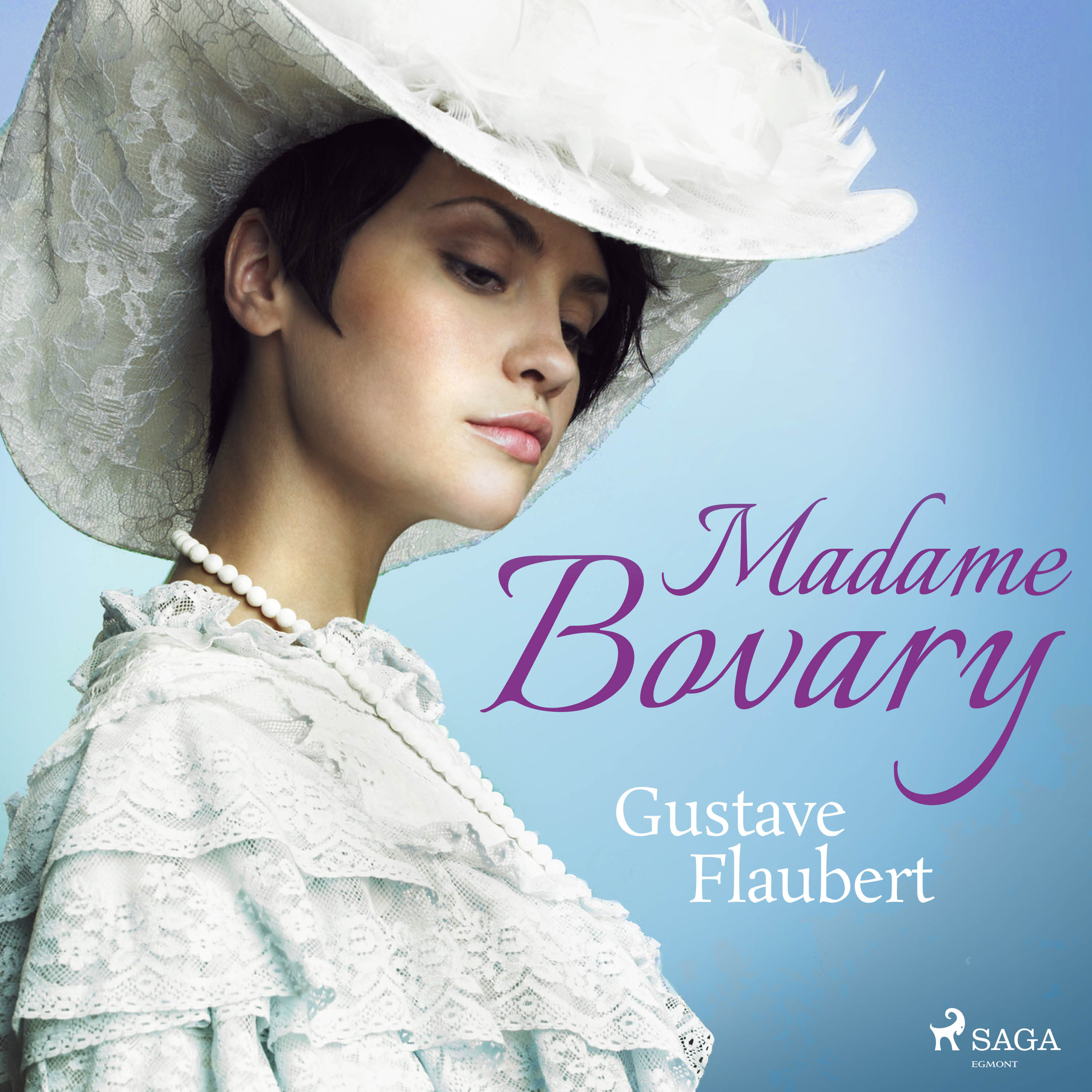
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Penguin Edition
- Sprache: Deutsch
Das faszinierendste Meisterwerk der literarischen Moderne.
Emma Bovary fragt sich Tag für Tag, ob das, was ihr das Leben bietet, schon alles war. Hat sie, eine kluge, begehrenswerte und immer noch attraktive Frau, denn kein Anrecht auf Glück, Sinnlichkeit - auf die Erfüllung weiblicher Leidenschaften? Denn für Erfüllung ist in ihrer Ehe mit einem Landarzt und in ihrem aufopferungsvollen Dasein als Mutter kein Platz. Und so folgt sie der Stimme ihres Herzens, die ihr rät, aufs Ganze zu gehen …
Mit einer in der Romankunst einzigartigen Offenheit schildert Flaubert das Schicksal einer verheirateten Frau, die von ihrer Liebessehnsucht zum Äußersten getrieben wird.
PENGUIN EDITION. Zeitlos, kultig, bunt. – Ausgezeichnet mit dem German Brand Award 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Große Emotionen, große Dramen, große Abenteuer – von Austen bis Fitzgerald, von Flaubert bis Zweig. Ein Bücherregal ohne Klassiker ist wie eine Welt ohne Farbe.
Gustave Flaubert (1821–1880) studierte Jura in Paris und musste aufgrund eines Nervenleidens seinen Beruf aufgeben. Er lebte fortan in strenger Askese in Rouen. Mit großer Präzision und ganz ohne Gefühlsduselei beschreibt er in seinen Romanen und Erzählungen Menschen und ihre Schicksale. Madame Bovary (1857) – in den Augen der Öffentlichkeit ein Buch der Unmoral – provozierte bei Erscheinen prompt einen Skandal.
«Madame Bovary hat die Zeit überdauert. Sie liest sich, als sei sie heute geschrieben. Es gibt keinen klassischeren Roman.» Otto Flake
«Bei ‹Madame Bovary› fühlt man von der ersten Zeile an, niemals enttäuscht zu werden.» William Faulkner
«Flauberts Roman scheint gnadenlos gegen jedermann. Und doch enthält dieser Roman ein Plädoyer für Emma Bovary.» Eberhard Lämmert, DIEZEIT
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Gustave Flaubert
MADAME BOVARY
Roman
Aus dem Französischen von Hans Reisiger
Mit Nachworten von Guy de Maupassant und Hans Reisiger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 1952 der deutschsprachigen Ausgabe by Manesse Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Regg Media in Adaption der traditionellen Penguin Classics Triband-Optik aus England
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-26840-4V001
www.penguin-verlag.de
ERSTER TEIL
1
Wir waren im Arbeitszimmer bei den Schulaufgaben, als der Direktor eintrat. Ihm folgten ein «Neuer», noch in «Zivil», und ein Schuldiener mit einem großen Pult. Wer gerade schlief, wachte auf, und alle sprangen von den Plätzen und taten, als seien sie mitten aus der eifrigsten Arbeit herausgerissen worden.
Der Direktor winkte ab: Setzen! und wandte sich dann an den Studienaufseher.
«Monsieur Roger», sagte er halblaut, «hier ist ein Schüler, den ich Ihrer Obhut empfehle. Er kommt zunächst mal in die Quinta. Wenn seine Leistungen und sein Betragen entsprechend sind, soll er zu den ‹Großen› versetzt werden, zu denen er seinem Alter nach gehört.»
Der Neue, der im Winkel hinter der Tür stehen geblieben war, sodass man ihn kaum sah, war ein Junge vom Lande, etwa fünfzehn Jahre alt und größer als wir alle. Er trug die Haare über der Stirn grade geschnitten wie die Chorknaben in der Dorfkirche und sah ganz verständig aus, nur sehr verlegen. Obgleich er nicht breitschultrig war, war ihm seine grüne, mit schwarzen Knöpfen besetzte Tuchjacke sichtlich zu eng in den Achseln. Durch den Schlitz der Ärmelaufschläge schauten rote Handgelenke hervor, denen man ansah, dass sie für gewöhnlich bloß waren. Seine Beine, in blauen Strümpfen, kamen aus einer gelblichen, von den Trägern übermäßig straff gespannten Hose. Die Füße steckten in derben, schlecht geputzten Nagelschuhen.
Man begann mit dem Vorlesen der Schularbeiten. Der Neue hörte mit beiden Ohren zu, aufmerksam wie bei der Predigt, und wagte weder die Beine übereinanderzuschlagen noch den Ellenbogen aufzustützen. Als um zwei Uhr die Glocke läutete, musste der Studienaufseher ihn erst eigens auffordern, mit uns anzutreten.
Es war bei uns Brauch, beim Eintritt in das Klassenzimmer unsere Mützen auf den Boden zu werfen, um die Hände frei zu haben. Und zwar musste man sie gleich von der Tür aus unter die Bank feuern, dass sie bis an die Wand sausten und möglichst viel Staub aufwirbelten. Das gehörte zum «Schick».
Entweder hatte der Neue dieses Manöver nicht beachtet oder nicht mitzutun gewagt – jedenfalls war das Gebet schon beendet, als er seine Mütze noch immer auf den Knien hielt. Es war dies eine jener ländlich grotesken Kopfbedeckungen, die aus den verschiedenartigsten Elementen zusammengebaut sind, ein Wechselbalg aus Bärenmütze, Tschapka, Filzhut, Pelzbarett und Zipfelmütze, kurz, eines jener bedauernswerten Dinge, deren stumme Hässlichkeit einen so unergründlich anblickt wie das Gesicht eines Idioten. Eiförmig, durch Fischbein gestützt und ausgebaucht, begann sie mit drei wurstartigen Wülsten; dann folgten, durch rote Einfassungen voneinander getrennt, Rauten, abwechselnd aus Samt und Kaninchenfell, darüber eine Art Beutel, der oben von einem mit verzwickter Bortenstickerei überzogenen Vieleck aus Pappdeckel abgeschlossen wurde, von dem an einer langen, unverhältnismäßig dünnen Schnur eine kleine Troddel aus Goldfäden herabhing. Die Mütze war neu, der Schirm glänzte.
«Steh auf», sagte der Klassenlehrer.
Er stand auf, seine Mütze fiel herunter. Die ganze Klasse fing zu kichern an.
Er bückte sich, um sie aufzuheben. Ein Nachbar schubste sie mit dem Ellenbogen hinunter, er hob sie abermals auf.
«So trenne dich doch endlich von deinem Helm», sagte der Lehrer, der ein Mann von Humor war.
Das darauf losplatzende Gelächter brachte den armen Jungen so aus der Fassung, dass er nicht wusste, sollte er die Mütze in der Hand behalten, auf dem Boden lassen oder auf den Kopf stülpen. Schließlich setzte er sich hin und legte sie auf seine Knie.
«Steh auf», fing der Lehrer wieder an, «und sage mir, wie du heißt.»
Der Neue murmelte hastig einen unverständlichen Namen.
«Noch mal!»
Wieder ließ sich unter dem Hohngeschrei der Klasse das gleiche Silbengehaspel vernehmen.
«Lauter!», rief der Lehrer, «lauter!»
Da fasste der Neue einen verzweifelten Entschluss, riss seinen Mund überweit auf und schrie aus vollem Halse, als ob er jemanden rufen wolle: «Charbovari!»
Mit einem Schlage erhob sich ein Spektakel, der zum Orkan anwuchs, spitze Stimmen schrillten dazwischen, man heulte, bellte, trampelte und echote immer wieder: «Charbovari! Charbovari!», bis dann schließlich das Getöse in einzelne Ausrufe verebbte und sich nach und nach wieder legte; nur hie und da zischte noch auf einer Bank ein halbersticktes Lachen auf, ähnlich wie ein Schwärmer, der am Verlöschen ist.
Unter dem Hagel von Strafarbeiten, der auf die Klasse niederprasselte, stellte sich die Ordnung wieder her, und nachdem es dem Lehrer endlich gelungen war, den Namen Charles Bovary zu verstehen, indem er sich ihn buchstabieren und dann nochmals vorsprechen ließ, befahl er dem armen Schlucker sogleich, sich auf die Faulenzerbank am Fuß des Katheders zu verfügen. Charles Bovary setzte sich in Bewegung, zögerte jedoch noch.
«Was suchst du denn?», fragte der Lehrer.
«Meine Mü…», brachte der Neue schüchtern hervor und schaute mit unruhigen Blicken um sich.
«Fünfhundert Verse die ganze Klasse!»
Dieses «quos ego», von wütender Stimme gedonnert, erstickte einen neuen Sturm im Keim.
«So gebt doch Ruhe!», fuhr der entrüstete Schulmeister fort und wischte sich mit seinem Taschentuch, das er unter seinem Käppchen hervorholte, den Schweiß von der Stirn. «Und du, der Neue, du wirst mir zwanzigmal aufschreiben ‹ridiculus sum›.» Dann mit milderer Stimme: «Na, und deine Mütze, die wirst du schon wiederfinden, gestohlen hat sie dir keiner.»
Alles war wieder still. Die Köpfe beugten sich über die Hefte, und der Neue verharrte zwei Stunden lang in mustergültiger Haltung, ungeachtet dessen, dass ihm von Zeit zu Zeit eine Papierkugel, von einer Federspitze abgeschnellt, ins Gesicht flog. Er wischte sich dann jedes Mal nur mit der Hand ab und blieb unbeweglich mit niedergeschlagenen Augen sitzen.
Am Abend im Arbeitszimmer holte er seine Ärmelschoner aus dem Pult, brachte seinen kleinen Kram in Ordnung, linderte sorgfältig sein Papier. Wir sahen, dass er mit großer Gewissenhaftigkeit arbeitete, alle Wörter im Wörterbuch nachschlug und sich viel Mühe gab. Sicherlich hatte er es auch nur dem Umstand, dass er so viel guten Willen zeigte, zu verdanken, dass er nicht in eine niedrigere Klasse kam, denn, wenn er auch leidlich seine Regeln konnte, so war er doch ganz ungewandt in Stil und Ausdruck; er war nur durch den Pfarrer seines Dorfes in die Anfangsgründe des Lateins eingeführt worden, da seine Eltern ihn aus Sparsamkeitsgründen so spät wie möglich in die Schule geschickt hatten.
Sein Vater, Charles-Denis-Bartholomé Bovary, war vor seiner Ehe, um 1812, als Stabsarzt in einen Aushebungsskandal verwickelt worden und hatte den Abschied nehmen müssen. Daraufhin hatte er seine persönlichen Vorzüge ausgenutzt, beiläufig in den Besitz einer Mitgift von sechzigtausend Franc zu gelangen, die sich ihm in der Person der Tochter eines Mützenfabrikanten bot, dem sein Auftreten den Kopf verdreht hatte. Schöner Mann, Renommist, sporenklirrend, mit Schnurr- und Kotelettenbart, die Finger voller Ringe, in auffallende Farben gekleidet, vereinte er das Aussehen des schneidigen Militärs mit der schwungvollen Gewandtheit des Geschäftsreisenden. Nach der Heirat lebte er zwei, drei Jahre von dem Vermögen seiner Frau, aß gut, stand spät auf, rauchte große Porzellanpfeifen, ging jeden Abend ins Theater und saß Tag für Tag im Kaffeehaus. Dann starb der Schwiegervater und hinterließ wenig. Empört darüber, verlegte er sich nun selber auf die Fabrikation, setzte aber nur Geld dabei zu und zog sich aufs Land zurück, wo er rationell wirtschaften wollte. Da er jedoch von Ackerbau nicht mehr verstand als von Mützen und Mützentuchen, seine Pferde selber ritt, anstatt sie aufs Feld zu schicken, seinen Apfelwein selber trank, anstatt ihn zu verkaufen, das beste Geflügel seines Hofes aufaß und seine Jagdstiefel mit dem Speck seiner Schweine schmierte, dauerte es nicht lange, bis er merkte, dass es mit dem rationellen Wirtschaften auch nicht ging.
Schließlich fand er in einem Dorf an der Grenze zwischen Caux und der Picardie ein Anwesen, halb Bauernhof, halb Herrenhaus, das er für zweihundert Franc im Jahr mietete. Dorthin zog er sich mit fünfundvierzig Jahren, vergrämt, von Reue geplagt, mit seinem Schicksal hadernd und auf alle Welt neidisch, zurück; die Menschen ekelten ihn an, erklärte er; er wolle nur noch in Frieden leben.
Seine Frau hatte ihn in der ersten Zeit ihrer Ehe rasend geliebt und sein Herz durch tausendfache demütige Unterwürfigkeiten zu gewinnen versucht, die ihn aber nur noch mehr von ihr abgewendet hatten. Von Natur heiter, mitteilsam und liebevoll, war sie mit zunehmendem Alter, gleich wie verderbender Wein sich in Essig verwandelt, reizbar, zänkisch und nervös geworden. Sie hatte unsäglich gelitten, wenn sie mitansehen musste, wie er hinter jeder Dorfdirne herlief und abends abgestumpft und nach Fusel riechend aus irgendwelchen üblen Lokalen heimkam. Anfangs war es darüber zu heftigen Szenen gekommen, aber dann hatte sich ihr Stolz empört, und sie war stumm geworden; sie schluckte ihren Kummer hinunter und hüllte sich in einen schweigenden Stoizismus, den sie bis an ihren Tod bewahrte. Sie war ständig in irgendwelchen Angelegenheiten unterwegs. Sie lief zu den Rechtsanwälten, zum Gericht, dachte daran, wenn Wechsel fällig waren, erwirkte Zahlungsaufschub. Zu Hause plättete, nähte und wusch sie, überwachte die Arbeiter und zahlte sie aus, während der Herr Gemahl, ohne sich um irgendetwas zu kümmern, immer nur übellaunig und schläfrig am Kamin hockte, rauchte und in die Asche spuckte und aus seinem Dösen nur aufwachte, um seiner Frau etwas Gehässiges zu sagen.
Als sie ein Kind bekam, musste man es zu einer Amme geben. Als sie es wieder bei sich hatte, wurde der Bengel verwöhnt wie ein Prinz. Die Mutter fütterte ihn mit Süßigkeiten; sein Vater, den Philosophen à la Rousseau spielend, ließ ihn barfuß gehen und behauptete, eigentlich müsste er ganz nackt herumlaufen wie die Jungen der Tiere. Im Gegensatz zu den Ansichten der Mutter schwebte ihm ein gewisses Ideal von Männlichkeit vor, nach dem er seinen Sohn zu modeln versuchte; spartanisch sollte der Junge erzogen werden, damit er recht stark und abgehärtet würde. Er ließ ihn im ungeheizten Zimmer schlafen. Rum musste der Bengel trinken lernen, in großen Schlucken, wie ein Mann, und sich über den «Klimbim» bei den Kirchenumzügen lustig machen, das gehörte auch dazu. Da der Kleine jedoch von Natur friedfertig war, schlug diese Methode nicht recht an. Seine Mutter hatte ihn immer am Schürzenbändel. Sie schnitt ihm Pappfiguren aus, erzählte ihm Geschichten und unterhielt sich mit ihm in endlosen, melancholisch spaßigen, kindlich geschwätzigen Monologen. In ihren Lebenserwartungen getäuscht und vereinsamt, übertrug sie jetzt alle ihre Hoffnungen auf den Knaben. Sie träumte von hohen Stellungen, sah ihn schon als schönen, klugen jungen Mann vor sich, wohlbestallt bei der Straßen- und Brückenbauverwaltung oder bei der Stadtbehörde. Sie lehrte ihn lesen und brachte ihm sogar ein paar Lieder bei, die sie auf ihrem alten Klavier begleitete. Alles das erklärte Monsieur Bovary, der nicht viel von Lernen und Wissen hielt, für «nicht der Mühe wert»; würden sie denn jemals in der Lage sein, den Jungen auf eine höhere Schule zu schicken oder ihm ein Amt oder ein Geschäft zu kaufen? Im Übrigen: «Mit ein bisschen Maulwerk kommt einer sowieso schon durch die Welt.» Madame Bovary biss sich die Lippen, und der Knabe trieb sich im Dorfe umher.
Er lief den Feldarbeitern nach und scheuchte die Krähen mit Erdklumpen auf. Er aß von den Brombeeren an den Rainen, hütete wohl auch einmal mit der Gerte in der Hand die Truthähne, half beim Heuwenden oder streifte im Wald umher. An Regentagen spielte er unter dem Kirchenportal Murmeln, und an den hohen Feiertagen bettelte er beim Küster, bis er ihn die Glocken läuten ließ. Dann hängte er sich mit seinem ganzen Gewicht an das Seil und ließ sich von seinem Schwung mittragen.
Bei alldem wuchs er auf wie eine Eiche, bekam starke Hände und gesunde Farbe.
Als er zwölf Jahre alt war, setzte seine Mutter endlich durch, dass er Unterricht bekam. Man beauftragte damit den Pfarrer. Die Stunden waren jedoch so kurz und wurden so unregelmäßig eingehalten, dass nicht viel dabei herauskam, sie wurden meist nur so nebenbei in der Sakristei erteilt, in aller Eile, im Stehen, zwischen einer Taufe und einer Beerdigung; manchmal auch ließ der Pfarrer seinen Schüler nach dem Abendläuten kommen, wenn er nicht ausgehen musste; dann stiegen sie hinauf in sein Zimmer und setzten sich zurecht. Nachtfalter und Fliegen tanzten um die Kerze, es war heiß, der Junge schlief ein, und bald auch der gute Mann, die Hände auf dem Bauch gefaltet und mit offenem Munde schnarchend. Manchmal wieder, wenn der Herr Pfarrer etwa einem Kranken in der Umgegend die letzte Wegzehrung gebracht hatte und auf dem Heimweg Charles erwischte, der sich gerade auf dem Feld herumtrieb, rief er ihn heran, redete ihm ein Viertelstündchen ins Gewissen und benutzte die Gelegenheit dazu, ihn rasch unterm nächsten Baum ein Verb konjugieren zu lassen, wobei sie dann freilich des Öfteren durch den Regen oder durch einen vorübergehenden Bekannten unterbrochen wurden. Im Übrigen war er immer mit ihm zufrieden und meinte sogar, der «junge Mann» hätte ein vortreffliches Gedächtnis.
So ging das nicht weiter mit Charles. Madame Bovary wurde energisch. Beschämt und mehr noch gelangweilt, gab Monsieur Bovary den Widerstand auf. Man wartete noch ein Jahr, bis der Junge die erste Kommunion hinter sich hatte.
Dann vergingen nochmals sechs Monate, und im Jahr darauf wurde Charles endgültig auf das Gymnasium nach Rouen geschickt. Sein Vater brachte ihn gegen Ende Oktober, zur Zeit des Jahrmarkts, selbst hin.
Es wäre wohl keinem von uns mehr möglich, sich noch irgendwie besonders an ihn zu erinnern. Er war ein ziemlich ruhiger Junge, der in der Freizeit spielte, im Arbeitszimmer fleißig büffelte, in der Klasse aufmerksam zuhörte, im Schlafsaal gut schlief und im Speisesaal tüchtig aß. Ein Bekannter seiner Eltern, ein Eisenhändler en gros aus der Handschuhmacherstraße, der es übernommen hatte, sich ein bisschen um ihn zu kümmern, ließ ihn allmonatlich einmal, an einem Sonntag, nach Ladenschluss zu sich kommen, führte ihn am Hafen spazieren, wo er sich die Schiffe anschauen konnte, und brachte ihn, sobald es sieben Uhr war, noch vor dem Abendbrot, wieder ins Gymnasium zurück. Jeden Donnerstagabend schrieb er mit roter Tinte einen langen Brief an seine Mutter, den er mit drei Oblaten verschloss. Dann vertiefte er sich wieder in seine Geschichtshefte oder las wohl auch in einem alten Exemplar des «Anacharsis»*, das im Arbeitszimmer herumlag. Bei den Schulspaziergängen unterhielt er sich am liebsten mit dem Hausdiener, der auch vom Lande war.
Dank seinem Fleiß hielt er sich immer in der Mitte der Klasse, einmal bekam er sogar in Naturkunde einen ersten Preis. Am Ende des dritten Schuljahres nahmen seine Eltern ihn jedoch wieder von der Schule, um ihn Medizin studieren zu lassen, überzeugt, dass er sich allein bis zum Examen durchbringen würde.
Seine Mutter mietete ihm bei einem ihr bekannten Färber am Robec-Ufer ein Zimmer im vierten Stock, gab ihn dort auch in Kost, beschaffte einen Tisch und zwei Stühle, ließ von daheim ein altes Bett aus Kirschbaumholz kommen und kaufte außerdem noch einen kleinen Eisenofen, nebst einem Holzvorrat, damit ihr armes Kind nicht zu frieren brauchte. Dann fuhr sie am Ende der Woche wieder ab, nachdem sie ihm noch tausendmal ans Herz gelegt hatte, sich jetzt, da er ganz auf sich allein gestellt sei, recht brav zu halten.
Das Verzeichnis der Vorlesungen, das er am Schwarzen Brett las, verursachte ihm ein Schwindelgefühl: Anatomie, Pathologie, Physiologie, Pharmazeutik, Chemie, Botanik, Klinik, Therapeutik, ganz abgesehen von Hygiene und Diätetik – lauter Namen, bei denen er sich nicht einmal über ihre sprachliche Herkunft klar war und die ihn ebenso viele Pforten zu Heiligtümern voll erhabenen Dunkels dünkten.
Er verstand anfangs nichts; er konnte noch so eifrig zuhören, er begriff einfach nicht. Trotzdem arbeitete er, füllte eifrig die Kolleghefte und versäumte keine Vorlesung und keine Visite. Er erledigte sein tägliches Pensum wie ein Zirkuspferd, das mit verbundenen Augen immer im Kreise herumläuft und keine Ahnung hat, wobei es eigentlich mitmacht.
Um ihm Ausgaben zu ersparen, schickte ihm seine Mutter jede Woche durch einen Boten ein Stück Kalbsbraten, von dem er morgens frühstückte, wenn er auf einen Sprung aus der Klinik kam. Dann musste er zu den Vorlesungen rennen, in die Anatomie, wieder in die Klinik und wieder heim durch all die Straßen. Abends, nach dem mageren Essen bei seinem Wirt, stieg er in sein Zimmer hinauf und setzte sich an die Arbeit, oft in durchnässten Kleidern, die vor dem glühenden Ofen ihm am Leibe dampften.
An den schönen Sommerabenden, um die Stunde, wo die heißen Straßen leer sind und die Dienstmädchen vor den Türen Federball spielen, öffnete er sein Fenster und lehnte sich hinaus. Unter ihm floss zwischen Brücken und Wehren, gelbviolett oder blau schillernd, der kleine Fluss, der diesen Teil von Rouen zu einem schmuddeligen Klein-Venedig macht. Am Ufer hockten Arbeiter und wuschen sich die Arme im Wasser. An langen, aus den Speicherluken ragenden Stangen waren die Baumwollsträhnen zum Trocknen aufgehängt. Vor ihm, über den Dächern, dehnte sich der klare weiße Himmel, ging die Sonne rot leuchtend unter. Wie schön musste es jetzt daheim sein! Und im Buchenwald wie frisch! Er öffnete die Nüstern weit, als könne er die gute Landluft atmen, die doch nicht bis zu ihm kam.
Er magerte ab; seine Gestalt ging in die Länge, und sein Gesicht nahm einen schmerzlichen Ausdruck an, der es beinahe interessant machte.
Wie nicht anders zu erwarten war, ließ er nach und nach, aus Lässigkeit, alle seine guten Vorsätze fahren. Einmal versäumte er die Visite, das nächste Mal die Vorlesung, und schließlich behagte ihm die Faulheit so gut, dass er überhaupt nicht mehr hinging.
Er gewöhnte sich an, in die Kneipe zu gehen und mit Leidenschaft Domino zu spielen. Sich allabendlich in ein schmutziges Lokal einzusperren und mit schwarzpunktierten Hammelknöchelchen auf Marmortischen herum zu klappern, schien ihm ein glorreicher Akt männlicher Freiheit, der ihn in seiner eigenen Achtung steigen ließ. Es bedeutete ihm so etwas wie Eintritt in die große Welt, Zugang zu verbotenen Freuden, und schon wenn er ankam und die Hand auf die Türklinke legte, geschah es mit einer fast wollüstigen Empfindung. Vieles Verdrängte in ihm entfaltete sich nun; er lernte allerlei Schlager auswendig, die er bei Gelegenheit vortrug, begeisterte sich für Béranger, machte sich die Geheimnisse des Punschbrauens zu eigen und entdeckte schließlich auch die Liebe.
Dank diesen Vorbereitungen fiel er im Staatsexamen gründlich durch. Und am selben Abend erwartete man ihn daheim, um seinen Erfolg zu feiern.
Er machte sich zu Fuß auf, und als er am Eingang des Dorfes angelangt war, ließ er seine Mutter herbeirufen und beichtete ihr alles. Sie verzieh ihm, schob die Schuld auf die Ungerechtigkeit der Examinatoren, sprach ihm Mut zu und übernahm es, die Angelegenheit ins Reine zu bringen.
Erst fünf Jahre später erfuhr Monsieur Bovary die Wahrheit; da war schon Gras darüber gewachsen, und er regte sich nicht mehr auf; auch war es ja doch nicht denkbar, dass ein Sprössling von ihm ein Dummkopf sein sollte.
Charles setzte sich also wieder an die Arbeit, wich nun keinen Augenblick mehr von seinen Büchern und paukte sich die Antworten auf sämtliche nur erdenklichen Fragen auswendig ein. Er bestand mit einer leidlichen Note. Das gab einen Freudentag für seine Mutter und wurde mit einem großen Festessen gefeiert.
Wo sollte er nun seine Kunst ausüben? In Tostes. Dort gab es nur einen alten Arzt, auf dessen Tod Madame Bovary schon seit Langem lauerte. Der alte Herr hatte denn auch noch kaum sein Bündel fürs Jenseits geschnürt, als Charles sich bereits ihm gegenüber als Nachfolger niedergelassen hatte.
Doch nicht genug damit, dass sie ihren Sohn aufgezogen, ihm das Studium ermöglicht und eine Praxis für ihn gefunden hatte: nun musste er auch noch eine Frau haben. Auch die fand sie für ihn in der Witwe eines Gerichtsvollziehers aus Dieppe, die fünfundvierzig Jahre alt war und zwölfhundert Pfund Rente bezog.
Obgleich Madame Dubuc alles andere als schön war, dürr wie eine Hopfenstange und das Gesicht voller Blütchen, als wäre sie der leibhaftige Lenz, war sie doch eine begehrte Partie, und um zu ihrem Ziel zu kommen, musste Madame Bovary erst eine ganze Schar anderer Freier aus dem Felde schlagen, wobei sie sogar sehr geschickt die Ränke eines Metzgermeisters vereitelte, dessen Werbung durch die Geistlichkeit unterstützt wurde.
Charles hatte gehofft, sich durch die Heirat ein angenehmeres Leben zu schaffen, und sich eingebildet, er werde nun freier über sich und sein Geld verfügen können. Stattdessen zeigte sich bald, dass seine Frau der Herr im Hause war; sie schrieb ihm vor, was er vor den Leuten sagen oder nicht sagen durfte; sie zwang ihn, jeden Freitag zu fasten, sich zu kleiden, wie sie es für richtig hielt. Sie war hinterher, dass er säumige Patienten mit Mahnungen verfolgte, sie öffnete seine Briefe, überwachte seine Gänge, und wenn Frauen bei ihm in der Sprechstunde waren, horchte sie an der Wand.
Sie musste jeden Morgen ihre Schokolade haben und nahm tausend Rücksichten für sich in Anspruch. Ewig hatte sie zu klagen, bald waren es die Nerven, bald die Brust, bald der Kopf. Das Geräusch von Schritten tat ihr weh. Ging man von ihr weg, stöhnte sie über die Einsamkeit, kam man zu ihr, so hieß es, man könne wohl nicht erwarten, sie sterben zu sehen. Wenn Charles abends heimkam, streckte sie ihre langen, hageren Arme aus der Bettdecke hervor, umschlang ihn, zog ihn auf den Bettrand nieder, und dann ging das alte Lied an: er vernachlässige sie, er liebe eine andere! Man habe ihr ja vorausgesagt, dass sie unglücklich werden würde! Zum Schluss bat sie ihn jedes Mal um einen Löffel Sirup und ein bisschen mehr Liebe.
2
Eines Nachts gegen elf Uhr wurden sie durch das Getrappel eines Pferdes geweckt, das gerade vor ihrer Haustür anhielt. Das Dienstmädchen öffnete die Bodenluke und verhandelte eine Zeitlang mit einem Mann, der auf der Straße stand. Er komme den Doktor holen und habe einen Brief mit. Nastasie stieg fröstelnd die Treppe hinab und öffnete umständlich die Schlösser und Riegel. Der Mann ließ das Pferd stehen und folgte der Magd auf dem Fuße bis ins Schlafzimmer der Herrschaft. Hier zog er aus seiner grauen Troddelmütze einen in einen Lappen gewickelten Brief und überreichte ihn ehrerbietig dem Hausherrn, der sich mit dem Ellbogen auf sein Kopfkissen stützte, um ihn zu lesen. Nastasie stand am Bett und hielt das Licht; Madame Bovary blieb schamhaft der Wand zugekehrt und zeigte nur ihren Rücken.
In dem Brief, der mit einem kleinen blauen Siegel verschlossen gewesen war, wurde Monsieur Bovary gebeten, sich sofort zum Gutshof Berteaux zu begeben, um ein gebrochenes Bein zu kurieren. Von Tostes bis Berteaux sind es, über Longueville und Saint-Victor, sieben gute Meilen. Die Nacht war dunkel. Madame Bovary fürchtete, dass ihrem Mann etwas zustoßen könnte. Es wurde also beschlossen, dass der Stallknecht vorausreiten sollte. Charles wollte drei Stunden später bei Mondaufgang nachkommen. Man sollte ihm einen Jungen entgegenschicken, der ihm den Weg zum Hof zeigen und das Tor öffnen würde.
Gegen vier Uhr morgens machte sich Charles, warm in seinen Mantel gewickelt, auf den Weg nach Berteaux. Noch schlaftrunken von der Bettwärme, ließ er sich durch den friedlichen Trott seines Pferdes wieder einwiegen. Als das Tier vor einer mit Dorngestrüpp bedeckten Grube, wie man sie an Ackerrainen findet, von selber stehen blieb, fuhr Charles aus dem Halbschlummer auf. Sogleich fiel ihm das gebrochene Bein wieder ein, und er suchte sich sämtliche Knochenbrüche, die er gelernt hatte, ins Gedächtnis zurückzurufen. Es regnete nicht mehr; der Tag graute, und auf den Zweigen der kahlen Apfelbäume hockten unbeweglich die Vögel, ihr kleines Gefieder im kalten Morgenwind aufgeplustert. Endlos dehnte sich das flache Land. Die Baumgruppen um die in großen Abständen verstreuten Höfe bildeten blau-schwarze Flecken auf dieser weiten grauen Fläche, die sich gegen den Horizont hin in die düstere Tönung des Himmels verlor. Im Weiterreiten duselte Charles, obwohl er ab und zu die Augen gewaltsam aufriss, bald wieder ein und verfiel in eine Art Dämmerzustand, in dem die jüngsten Eindrücke mit Erinnerungen verschmolzen, sodass er sich gleichsam doppelt empfand und sich als Ehemann im Bett liegen und gleichzeitig als Student durch den Operationssaal schreiten sah, wie einst. Der warme Dunst der Umschläge mischte sich in seinem Kopf mit dem herben Geruch des Morgentaus; er hörte das Klirren der Eisenringe an den Vorhangstangen der Krankenbetten und zugleich das Schnarchen seiner Frau …
Als er durch Vassonville kam, sah er am Grabenrand einen Jungen im Grase sitzen.
«Sind Sie der Doktor?», fragte das Kind.
Als Charles bejahte, nahm der Kleine seine Holzpantoffeln in die Hand und lief vor ihm her.
Unterwegs erfuhr er aus den Reden seines kleinen Führers, dass Monsieur Rouault einer der wohlhabendsten Landwirte der Gegend war. Er hatte sich das Bein gestern Abend gebrochen, als er von einem Nachbarn heimkehrte, bei dem er das Dreikönigsfest gefeiert hatte. Seine Frau war schon seit zwei Jahren tot, und er hatte nur das «Fräulein» bei sich, das ihm den Haushalt führte.
Die Radspuren wurden tiefer. Man näherte sich Berteaux. Der Kleine zwängte sich durch ein Loch in der Hecke, verschwand und tauchte schließlich in einiger Entfernung am Hoftor wieder auf, um es zu öffnen.
Das Pferd trabte weich über das taufeuchte Gras, und Charles musste sich bücken, um an den tief hängenden Zweigen vorbeizukommen. Die Hofhunde vor ihren Hütten bellten und rissen an ihren Ketten. Als Charles auf Berteaux einritt, scheute sein Pferd und machte einen großen Satz.
Es war ein ansehnlicher Hof. In den Stallungen, deren Türen offen standen, sah man kräftige Ackerpferde gemächlich aus blanken Raufen fressen. An den Gebäuden entlang zog sich ein großer, dampfender Misthaufen; unter den Hühnern und Truthähnen pickten auch fünf oder sechs Pfaue darauf herum: besonderer Stolz jedes Geflügelhofes in Caux**. Der Schafstall war groß, die Scheune hoch, ihre Wände glatt wie eine Hand. Im Schuppen standen zwei große Leiterwagen und vier Pflüge, samt Peitschen, Kumten und allem Geschirr; die blauen Wolldecken, die auf ihnen lagen, waren mit dem feinen Staub bedeckt, der von den Schüttböden herunterfiel. Der Hof stieg zum Wohnhaus hin ein wenig an und war in regelmäßigen Abständen mit Bäumen bepflanzt. Vom Tümpel her erscholl das fröhliche Geschnatter einer Schar Gänse.
Auf der Schwelle des Hauses erschien jetzt ein junges Mädchen in einem blauen, mit drei Volants besetzten Merino-Wollkleid, um Monsieur Bovary zu empfangen. Sie nötigte ihn in die Küche, wo ein großes Feuer loderte. Rings um das Feuer herum schmorte in großen und kleinen Töpfen das Frühstück für das Gesinde. Im Kamin hingen feuchte Kleidungsstücke zum Trocknen. Kohlenschaufel, Feuerzange und Blasebalg, alle von riesiger Größe, funkelten wie blanker Stahl. An den Wänden entlang hing reiches Küchengerät, darin sich zuckend die Herdflammen spiegelten, vereint mit den ersten Sonnenstrahlen, die durch die Fensterscheiben fielen.
Charles stieg in das erste Stockwerk hinauf zu dem Kranken. Der lag im Bett, schwitzte unter seinen Decken und hatte seine Nachtmütze weit von sich geworfen. Es war ein kleiner, beleibter Mann von fünfzig Jahren, mit weißer Haut, blauen Augen, kahler Stirn und mit Ringen in den Ohren. Neben sich hatte er auf einem Stuhl eine große Flasche Branntwein, aus der er sich von Zeit zu Zeit einschenkte, um «Mumm in die Knochen zu kriegen». Als er den Arzt sah, wurde er sogleich ganz zahm, und anstatt weiter zu fluchen, wie er es seit zwölf Stunden getan hatte, fing er nun schwach und kläglich zu stöhnen an.
Der Bruch war einfach, ohne irgendwelche Komplikation; Charles hätte sich keinen leichteren Fall wünschen können. Im Gedanken daran, wie seine Lehrmeister sich an den Krankenbetten verhalten hatten, redete er zunächst dem Patienten gut zu mit allerlei tröstlichen Redensarten und mit der wohlwollenden Milde des Chirurgen, die gleichsam wie das Öl ist, mit dem man die Seziermesser einfettet. Dann ließ er sich, um das Bein zu schienen, aus dem Holzschuppen ein paar Latten holen, wählte eine aus und glättete sie mit einer Glasscherbe. Derweil riss das Dienstmädchen ein Stück Leinwand in Streifen, und Mademoiselle Emma übernahm es, kleine Verbandpolster zu nähen. Als sie ihren Nähkasten nicht gleich finden konnte, fuhr ihr Vater sie ungeduldig an. Sie erwiderte nichts, stach sich jedoch beim Nähen in die Finger, die sie darauf an die Lippen führte, um das Blut aufzusaugen.
Charles war überrascht, wie gepflegt ihre Nägel waren. Sie waren mandelförmig geschnitten, mit feinen Spitzen, und glänzender poliert als die Elfenbeinwaren aus Dieppe. Die Hand selber war weniger schön; vielleicht nicht weiß genug und an den Fingergliedern ein wenig zu mager; auch zu lang und in den Linien nicht weich genug. Schön waren ihre Augen; eigentlich braun, wirkten sie durch die langen Wimpern fast schwarz, und ihr offener Blick strahlte einen mit dem Freimut der Unschuld an.
Als der Verband angelegt worden war, wurde der Doktor von Monsieur Rouault höchstselbst eingeladen, vor der Abfahrt noch «einen kleinen Happen» zu nehmen. Charles stieg in das Esszimmer hinunter, das im Erdgeschoss lag. Hier war am Fuße eines großen Himmelbettes mit Zitzvorhängen, auf denen allerlei türkische Gestalten zu sehen waren, ein kleiner Tisch für zwei Personen gedeckt. Silberne Becher glänzten neben den Tellern. Dem Fenster gegenüber stand ein großer Eichenschrank, dem ein Duft von Veilchenwurzel und feuchtem Leinen entströmte. In den Ecken des Zimmers standen ein paar Getreidesäcke, die in der nebenan gelegenen Kornkammer, zu der drei Stufen hinaufführten, keinen Platz mehr gefunden hatten. Als Zimmerschmuck hing mitten an der Wand, deren grüner Anstrich hier und da schon vom Salpeter zerstört war und abblätterte, eine Kreidezeichnung in goldenem Rahmen, einen Minervakopf darstellend, unter dem in gotischen Lettern geschrieben stand: «Meinem lieben Papa».
Sie sprachen zunächst über den Kranken, dann über das Wetter, die große Kälte und die Wölfe, die nachts die Gegend unsicher machten. Mademoiselle Rouault gefiel es gar nicht auf dem Lande, zumal jetzt, wo sie fast ganz allein für den Hof zu sorgen hatte. Es war so kalt im Zimmer, dass ihr bei der Mahlzeit die Zähne klapperten, wodurch sich ihre vollen Lippen entblößten, an denen sie, wenn sie schwieg, immer herumnagte.
Ihr Hals erhob sich aus einem weißen Umlegekragen. Ihr schwarzes Haar lag so glatt an, dass es aussah wie aus einem Stück, getrennt nur durch den feingeschwungenen Scheitel in der Mitte, und nach hinten zu, gerade noch die Ohrläppchen freilassend, in einen üppigen Knoten geflochten; nur an den Schläfen war es leicht gewellt, was der Landarzt zum ersten Mal in seinem Leben sah. Ihre Wangen waren rosig. Zwischen zwei Knöpfen ihrer Bluse schaute, wie bei einem Mann, ein Lorgnon aus Schildpatt hervor.
Als Charles, nachdem er sich oben bei Vater Rouault verabschiedet hatte, vor der Abfahrt noch einmal ins Zimmer trat, sah er Emma am Fenster stehen, die Stirn an die Scheiben gelehnt, in den Garten hinaus schauend, wo der Wind die Bohnenstangen umgeworfen hatte. Sie wandte sich um.
«Suchen Sie noch etwas?», fragte sie.
«Verzeihung, meine Reitpeitsche», sagte er und fing an, auf dem Bett, hinter den Türen und unter den Stühlen herumzusuchen. Die Peitsche war zwischen den Säcken und der Mauer zu Boden gefallen. Emma entdeckte sie und beugte sich über die Säcke. Charles stürzte galant hinzu, und sich gleichfalls nach der Peitsche bückend, fühlte er, wie seine Brust den Rücken des jungen Mädchens streifte. Als sie sich wieder aufrichtete, war sie ganz rot und reichte ihm mit einem Blick über die Schulter hinweg seinen Ochsenziemer.
Anstatt nach drei Tagen, wie er es versprochen hatte, kam er bereits am nächsten Tag wieder und von da an regelmäßig zweimal in der Woche, die Besuche nicht mitgezählt, die er so zwischendurch, so gleichsam aus Versehen, machte.
Im Übrigen ging alles gut; die Heilung verlief glatt, und als man Vater Rouault nach sechs Wochen wieder auf eigenen Füßen, wenn auch noch behutsam, in seiner «Bude» herumstiefeln sah, fing man an, Monsieur Bovary als große Kapazität zu betrachten. Vater Rouault erklärte, auch die ersten Ärzte aus Yvetot oder Rouen hätten ihn nicht besser kurieren können.
Was Charles betrifft, so dachte er gar nicht daran, sich zu fragen, warum er so gern nach Berteaux kam. Hätte er es getan, so würde er sich wahrscheinlich vorgeredet haben, es gehe ihm nur um den interessanten Fall und um das schöne Honorar, das ihm hier winke. War es aber wirklich nur dies, was die Besuche auf dem Gut zu einer so reizvollen Abwechslung in dem Einerlei seines gewohnten Lebens machte? Er stand an den Tagen immer schon früher als sonst auf und ritt, sein Pferd anspornend, im Galopp davon. Kurz vor der Ankunft stieg er jedes Mal ab, säuberte seine Schuhe im Gras und zog seine schwarzen Handschuhe an, und wenn er dann auf dem Hof ankam und das Gatter mit der Schulter aufschob, wenn der Hahn auf der Mauer krähte und die Dorfjungen ihm entgegenliefen, war ihm richtig wohl ums Herz. Er liebte die Scheune und die Pferdeställe, er liebte den alten Rouault, der ihm auf die Schulter klopfte und ihn seinen lieben Retter nannte; er liebte die kleinen Holzüberschuhe, in denen Mademoiselle Emma auf den blank gescheuerten Fliesen der Küche hin und her trappelte; ihre Absätze machten sie ein wenig größer, und wenn sie vor ihm herging, schlugen die raschbewegten Holzsohlen mit einem spröden kleinen Klappern gegen das Leder der Schuhe.
Wenn er aufbrach, begleitete sie ihn immer bis an die erste Stufe der Vortreppe und blieb bei ihm stehen, bis sein Pferd vorgeführt war. Verabschiedet hatte man sich schon, gesprochen wurde nichts mehr; die freie Luft wehte um sie her, zauste die widerspenstigen Härchen in ihrem Nacken oder spielte mit den Schürzenbändern an ihrer Hüfte, dass sie wie Wimpel flatterten. Einmal, es war Tauwetter, und von den Ästen der Bäume und den Dächern der Gebäude tropfte der geschmolzene Schnee, kehrte sie auf der Türschwelle wieder um, holte ihren Schirm und öffnete ihn. Durch die in Taubenhalsfarben schillernde Seide warf die Sonne spielende Reflexe auf ihr weißes Gesicht. Sie lächelte in der lauen Wärme unter ihrem Schirm, und man hörte, wie Tropfen um Tropfen auf die gespannte Seide fiel.
In der ersten Zeit, seit Charles nach Berteaux kam, versäumte Madame Bovary nicht, nach dem Befinden des Kranken zu fragen. Sie hatte sogar in ihrer doppelten Buchführung eigens eine schöne neue Seite für Monsieur Rouault eingerichtet. Als sie jedoch hörte, dass er eine Tochter habe, zog sie nähere Erkundigungen ein und erfuhr, dass Mademoiselle Rouault im Kloster bei den Ursulinen aufgewachsen sei und dort die sogenannte gute Erziehung genossen habe und dass sie infolgedessen im Tanzen, in der Geographie, im Zeichnen, im Sticken und im Klavierspielen bewandert sei. Das war zu viel!
Also deshalb, sagte sie sich, strahlt er immer so, wenn er zu ihr fährt; deshalb zieht er immer die neue Weste an, auf die Gefahr hin, dass der Regen sie ihm ruiniert! Ah, diese Person! Diese Person …!
Und sie hasste sie instinktiv. Anfangs machte sie sich durch Anspielungen Luft, die Charles nicht verstand; dann durch allerlei streitsüchtige Betrachtungen, auf die er sich nicht einließ, um nicht ein Gewitter heraufzubeschwören; schließlich durch ganz unverblümte Vorwürfe, auf die er nicht zu antworten wusste. Woher kam es denn, dass er immer noch nach Berteaux fuhr, obgleich Monsieur Rouault längst geheilt war und diese Leute immer noch nicht bezahlt hatten? Nur daher, weil dort jemand war, eine Person, die recht zu schwatzen verstünde und sich gebildet aufspielte, eine Schöngeistige! Das war ja wohl so nach seinem Geschmack, das brauchte er ja wohl: ein Stadtdämchen! Hah! höhnte sie geringschätzig, die Tochter des alten Rouault! Die und eine feine Dame! Ihr Großvater war Schäfer, und ein Vetter von ihr ist beinah mal vors Schwurgericht gekommen, weil er bei einem Krakeel das Messer gezogen hat! Die hat es gerade nötig, so viel Trara zu machen und sonntags in der Kirche im seidenen Kleid daherzukommen wie eine Gräfin! Der gute Rouault! Als ob nicht jeder wüsste, dass er ohne die gute Rapsernte im vorigen Jahr nicht ein und aus gewusst hätte vor Schulden!
Um des lieben Friedens willen stellte Charles schließlich seine Besuche in Berteaux ein. In einem großen Liebesausbruch, unter vielen Tränen und Küssen, hatte seine Heloïse ihn auf das Messbuch schwören lassen, dass er nie mehr dorthin gehen werde. Er gehorchte also; aber sein Herz empörte sich gegen seine eigene Fügsamkeit, und in einer Art Bauernschläue legte er es sich so aus, dass dieses Verbot, Mademoiselle Rouault wiederzusehen, ihm nunmehr ein Recht gäbe, sie zu lieben. Und seine Witwe war so mager und hatte so lange Zähne; sie trug Sommer wie Winter ein kleines schwarzes Halstuch, dessen Enden ihr beständig hinten zwischen den Schulterblättern herum baumelten; ihre knochige Gestalt war immer in zu enge und zu kurze Kleider gezwängt wie in Futterale, darunter ihre Knöchel in den grauen Strümpfen mit den gekreuzten Bändern der großen Schuhe hervorschauten.
Von Zeit zu Zeit kam Charles’ Mutter zu Besuch, aber der Schwiegertochter gelang es immer schon nach wenigen Tagen, sie auf ihre Seite zu bringen, und dann hackten sie beide wie zwei Messer mit ihren Vorwürfen und Ermahnungen auf ihm herum: Wie konnte er nur so viel essen! Warum immer gleich jedem x-beliebigen Besucher etwas zu trinken anbieten! Was für ein Eigensinn, kein wollenes Unterzeug zu tragen! Und so fort.
Da geschah es zu Beginn des Frühlings, dass der Notar in Ingouville, der das Vermögen der Witwe Dubuc verwaltete, sich eines schönen Tages bei günstigem Winde einschiffte und unter Mitnahme sämtlicher ihm anvertrauter Gelder über den Ozean entschwand. Nun besaß Heloïse zwar außer einem auf sechstausend Franc geschätzten Schiffsanteil noch ihr Haus in der Rue St-François, aber von dieser Herrlichkeit, von der so viel Aufhebens gemacht worden war, war bis jetzt außer ein paar Möbelstücken und Nippsachen nichts zum Vorschein gekommen; da musste Klarheit geschaffen werden. Es stellte sich heraus, dass das Haus in Dieppe bis in die Balken von Hypotheken zerfressen war wie von Holzwürmern; wie viel sie beim Notar hinterlegt hatte, wusste Gott allein, und der Schiffsanteil betrug nicht mehr als tausend Taler. Sie hatte gelogen, die gute Dame! In seiner Wut zerschlug Vater Bovary einen Stuhl auf den Fliesen und beschuldigte seine Frau, ihren Sohn ins Unglück gestürzt zu haben, indem sie ihn mit so einer Schindmähre eingespannt habe, die nicht mal mehr das Futter wert sei. Sie fuhren nach Tostes. Es gab eine Auseinandersetzung und große Szenen. Heloïse warf sich schluchzend in die Arme ihres Gatten und beschwor ihn, sie gegen seine Eltern zu verteidigen. Charles wollte vermitteln, aber da wurden die Alten böse und fuhren ab.
Heloïse konnte jedoch den Schlag nicht überwinden. Acht Tage später, als sie im Hof beim Wäscheaufhängen war, bekam sie einen Blutsturz, und am nächsten Morgen, als Charles gerade den Rücken gewandt hatte, um den Vorhang zu schließen, sagte sie: «Ach, mein Gott», stieß einen Seufzer aus und verlor das Bewusstsein. Sie war tot. Wie sonderbar!
Als auf dem Friedhof alles vorbei war, ging Charles in sein Haus zurück. Unten im Erdgeschoss war niemand. Er stieg in den ersten Stock hinauf, trat ins Zimmer, sah ihr Kleid noch im Alkoven hängen. Dann setzte er sich an den Schreibtisch und blieb so, den Kopf aufgestützt, bis in den Abend hinein in schmerzliche Betrachtungen versunken. Sie hatte ihn immerhin geliebt.
3
Eines Morgens erschien Vater Rouault und brachte Charles das Honorar für sein geheiltes Bein: fünfundsiebzig Franc in barer Münze und eine Truthenne. Er hatte von dem Trauerfall erfahren und tröstete ihn, so gut er konnte.
«Ich weiß, wie das ist», sagte er und klopfte ihm auf die Schulter, «ich habe das auch durchgemacht! Als ich meine arme Selige verloren hatte, da lief ich hinaus in die Felder, um allein zu sein; unter einem Baum warf ich mich hin, flennte, rief zum lieben Gott und sagte ihm allerlei Torheiten; ich hätte einer von den Maulwürfen sein mögen, wie ich sie manchmal am Weg liegen sah, verreckt, die Würmer schon im Bauch. Und wenn ich dann dachte, dass die anderen nun ihre lieben, netten Weiberchen noch hatten und sie ans Herz drücken konnten, da prügelte ich vor Wut die Erde mit meinem Stock; ich war wie verrückt, aß keinen Bissen mehr; der Gedanke, allein ins Café zu gehen, widerte mich an. Na ja, und dann, so ganz sachte, wie ein Tag nach dem anderen verging und ein Frühling nach dem Winter und ein Herbst nach dem Sommer, da ist das so von mir abgebröckelt, Stückchen um Stückchen, fort, weg oder hinunter, will ich sagen, denn etwas bleibt ja immer in einem stecken, ganz tief im Grunde, so was wie … ein Klumpen, da in der Brust! Aber da das ja nun einmal unser aller Schicksal ist, darf man deswegen nicht gleich meinen, es sei alles aus, und sterben wollen, weil andere vor einem gestorben sind. Sie müssen sich aufrappeln, Monsieur Bovary, das geht alles vorüber! Besuchen Sie uns doch mal; meine Tochter denkt manchmal an Sie, müssen Sie wissen, und meint schon, Sie hätten sie ganz vergessen. Jetzt wird’s bald Frühling; wir werden Sie mit ins Revier nehmen, auf die Karnickeljagd; das wird Sie ein bisschen zerstreuen.»
Charles folgte seinem Rat und kam wieder nach Berteaux. Er fand alles wieder, als hätte er es gestern erst verlassen und nicht vor fünf Monaten. Die Birnbäume blühten schon, und der gute alte Rouault, der nun wieder obenauf war, kam und ging und brachte Leben auf den Hof.
Er hielt es für seine Christenpflicht, dem Doktor in seiner Trauer mit aller erdenklichen Rücksicht zu begegnen; er bat ihn, doch ja die Mütze aufzubehalten, sprach nur mit gedämpfter Stimme zu ihm, wie zu einem Kranken, und stellte sich ganz zornig darüber, dass man nicht eigens für den Gast noch etwas Leichteres, einen Rahmpudding oder gedünstete Birnen, zubereitet hatte. Er erzählte allerhand Geschichten. Charles ertappte sich dabei, dass er darüber lachte; aber dann kam ihm plötzlich wieder die Erinnerung an seine Frau und machte ihn traurig. Als man jedoch den Kaffee brachte, dachte er schon nicht mehr daran.
Je mehr er sich an das Alleinsein gewöhnte, um so seltener dachte er daran. Das angenehme, ihm neue Gefühl der Unabhängigkeit machte ihm die Einsamkeit bald erträglicher. Jetzt konnte er seine Mahlzeiten einnehmen, wann es ihm passte, kommen und gehen, ohne darüber Rechenschaft abzulegen, und, wenn er so recht müde war, sich in seinem Bett breitmachen und alle viere von sich strecken, kurz, er pflegte und hätschelte sich gründlich und ließ sich auch alle die Tröstungen gerne gefallen, die ihm zuteil wurden. Übrigens hatte der Tod seiner Frau ihm in seinem Beruf nur Vorteile gebracht, denn dadurch, dass es einen Monat lang immer wieder geheißen hatte: «Der arme junge Mann! Was für ein Unglück!», hatte sein Name sich herumgesprochen und der Kreis seiner Patienten sich vergrößert. Nach Berteaux ritt er, sooft er konnte; eine ziellose Sehnsucht, ein unbestimmtes Glücksgefühl war in ihm. Wenn er jetzt so vor dem Spiegel stand und seinen Backenbart bürstete, fand er, dass er doch gar nicht so übel aussähe.
Eines Tages kam er nachmittags gegen drei Uhr auf dem Hof an. Alles war auf dem Feld. Er ging in die Küche, gewahrte jedoch zunächst Emma nicht, da die Fensterläden geschlossen waren. Durch die Ritzen schoss die Sonne lange feine Strahlen, die über die Fliesen glitten, sich an den Kanten der Möbel brachen und an der Decke zitterten. An den gebrauchten Gläsern, die auf dem Tisch standen, krochen die Fliegen herum, um sich schließlich summend in den Apfelweinresten zu ertränken. Durch den breiten Rauchfang drang ein wenig Tageslicht, in dem das rußige Kaminblech wie Samt und die kalte Asche ganz bläulich aussah. Zwischen Fenster und Kamin saß Emma und nähte. Sie hatte ihr Busentuch abgelegt, und auf ihren nackten Schultern glänzten kleine Schweißperlen.
Nach ländlichem Brauch bot sie ihm etwas zu trinken an. Er dankte, aber sie bestand darauf und lud ihn schließlich lachend ein, ein Gläschen Likör mit ihr zu genehmigen. Sie holte eine Flasche Curaçao nebst zwei Gläsern aus dem Schrank, füllte das eine bis zum Rande, goss in das andere nur ein paar Tropfen und führte es, nachdem sie mit ihm angestoßen hatte, an den Mund. Da es fast leer war, musste sie sich weit zurückbeugen, und so, den Kopf nach hinten geworfen, die Lippen gespitzt und die Kehle gestrafft, stand sie da und lachte, weil immer noch nichts kommen wollte, während ihre Zungenspitze zwischen den feinen Zähnen herausfuhr und den Boden des Glases in kleinen Stößen ausleckte.
Dann setzte sie sich wieder und wandte sich von Neuem ihrem Nadelwerk zu. Ein weißer, baumwollener Strumpf war zu stopfen. Sie arbeitete mit gesenkter Stirn und sagte nichts. Charles auch nicht. Ein Luftzug fuhr unter der Tür herein und trieb ein wenig Staub über die Fliesen. Charles sah zu, wie er dahinstrich und hörte nichts als das Pochen des Blutes in seinem Kopf und ganz in der Ferne das Gegacker einer Henne, die irgendwo auf einem der Höfe ein Ei gelegt hatte. Von Zeit zu Zeit hielt Emma ihre Handflächen an den kalten Eisenknauf eines der großen Feuerböcke und führte sie dann zur Kühlung an ihre Wangen.
Sie klagte darüber, dass sie seit Beginn des Frühjahrs an Schwindelanfällen leide, und fragte, ob Seebäder wohl gut dagegen seien. Sie begann vom Kloster zu erzählen, Charles von seinem Gymnasium; so gerieten sie allmählich in ein ganz lebhaftes Gespräch. Sie stiegen in ihr Zimmer hinauf. Sie zeigte ihm ihre Notenhefte von damals, die Bücher, die sie als Schulpreise bekommen hatte, und kleine Kränze aus Eichenlaub, die verlassen unten in einem Schrank lagen. Auch von ihrer Mutter erzählte sie, vom Friedhof, auf dem sie lag, und zeigte ihm sogar im Garten das Beet, von dem sie die Blumen pflückte, die sie jeden ersten Freitag im Monat der Toten aufs Grab legte. Aber der Gärtner, den sie hätten, verstünde gar nichts, mit dem seien sie schlecht dran. Sie würde gern, wenigstens im Winter, in der Stadt wohnen, obwohl in den langen Sommertagen das Leben auf dem Lande noch langweiliger sei – und je nachdem, was sie sagte, klang ihre Stimme klar und hell oder wurde plötzlich matt, verschleiert, verlor sich fast in ein Murmeln, als spräche sie zu sich selbst –, und im gleichen Wechsel blickte sie bald fröhlich mit unschuldigen Augen auf, bald waren ihre Lider halb geschlossen, der Blick von Missmut getrübt, die Gedanken ganz woanders.
Abends auf dem Heimweg rief Charles sich alles, was sie gesagt hatte, noch einmal ins Gedächtnis zurück und suchte die Bedeutung ihrer Worte zu ergänzen, um sich ein Bild von ihr zu machen aus der Zeit, als er sie noch nicht gekannt hatte. Dabei gelang es ihm jedoch niemals, sie anders vor sich zu sehen, als wie er sie zum ersten Mal oder jetzt eben beim Abschied gesehen hatte. Dann fragte er sich, was wohl aus ihr werden würde, wenn sie sich verheiratete, und mit wem? Ach, Vater Rouault war sehr reich und sie … so schön! Aber das Gesicht von Emma schwebte ihm immer und immer wieder vor, und wie das eintönige Summen eines Kreisels klang es ihm unablässig in den Ohren: Wenn du es wärst! Wenn du es wärst! In der Nacht konnte er nicht schlafen, die Kehle war ihm wie zugeschnürt, ihn dürstete; er stand auf, um ein Glas Wasser zu trinken, und öffnete das Fenster; der Himmel war mit Sternen besät, ein warmer Wind wehte, fernab bellten Hunde. Er wandte den Kopf zu der Richtung hin, wo Berteaux lag.
Schließlich, von dem Gedanken ermutigt, dass er ja im Grunde nichts dabei riskiere, beschloss er, einen Antrag zu machen, sowie sich die Gelegenheit böte; aber jedes Mal, wenn sie sich bot, verschloss ihm die Angst, nicht die passenden Worte zu finden, die Lippen.
Vater Rouault hätte nichts dagegen gehabt, wenn man ihm seine Tochter wegholte, die ihm keine große Hilfe im Haus bedeutete. Er entschuldigte sie bei sich damit, dass sie viel zu gescheit sei für die Landwirtschaft, dieses gottverdammte Gewerbe, das noch keinen zum Millionär gemacht hatte! Er jedenfalls, der gute Rouault selber, hatte noch keine Reichtümer dabei aufgehäuft, sondern schoss jedes Jahr nur zu; wenn er auch auf dem Markt bestens zu bestehen wusste, da ihm die Kniffe und Schliche des Handels Spaß machten, die eigentliche Landwirtschaft samt der inneren Hofverwaltung lag ihm nicht. Er nahm nicht gern die Hände aus den Hosentaschen und sparte nicht gern, wo es sich um Ausgaben für seine eigene Person handelte; er legte Wert auf gutes Essen und Trinken, einen warmen Ofen, ein weiches Bett. Ein gutes Glas Apfelmost, eine saftige Hammelkeule, halb durchgebraten, ein kräftiger Mokka mit Kognak, das war nach seinem Herzen. Er nahm seine Mahlzeiten immer in der Küche ein, allein für sich, neben dem Herdfeuer, an einem kleinen Tisch, den man ihm, schon fix und fertig gedeckt, hereinbringen musste, wie im Theater.
Als er nun merkte, dass Charles immer ganz rote Backen hatte, wenn er mit seiner Tochter beisammen war, was ja doch nur bedeuten konnte, dass er eines schönen Tages bei ihm um sie anhalten würde, ließ er sich die ganze Sache schon im Voraus durch den Kopf gehen. Der junge Mann war zwar nach seiner Meinung ein bisschen schlafmützig und überhaupt nicht gerade ein Schwiegersohn, wie er ihn sich gewünscht hätte; aber er galt ja doch allgemein als solider, achtbarer Mann, sparsam und tüchtig in seinem Beruf, und vor allem war anzunehmen, dass er wegen der Mitgift keine Schwierigkeiten machen würde, und da Vater Rouault zur Zeit gerade genötigt war, zweiundzwanzig Tagwerk von seinem Bestand zu verkaufen, außerdem beträchtliche Schulden beim Maurer und Tapezierer hatte und auch die Kelter erneuert werden musste, so sagte er sich: «Wenn er sie will, soll er sie kriegen.»
Zu Michaelis war Charles drei Tage in Berteaux zu Besuch. Aber auch der letzte Tag verging wie die anderen, Viertelstunde um Viertelstunde, ohne dass etwas erfolgt wäre. Vater Rouault gab ihm das Abschiedsgeleit; sie gingen einen Hohlweg entlang; gleich mussten sie sich trennen; nun war der Augenblick gekommen! Charles gab sich noch eine letzte Frist, bis sie an der Hecke des nächsten Seitenweges wären, und dann endlich, als sie daran vorbei waren, würgte er hervor: «Monsieur Rouault, ich möchte Ihnen gern etwas sagen.»
Sie blieben stehen. Charles schwieg.
«Na, erzählen Sie nur», lachte Vater Rouault gemütlich, «ich weiß ja doch schon alles!»
«Vater Rouault … Vater Rouault …», stammelte Charles.
«Ich bin ja ganz einverstanden», fuhr der Gutsherr fort, «aber obwohl ich überzeugt bin, dass die Kleine so denkt wie ich, muss man sie doch erst noch fragen. Bleiben Sie jetzt hier, ich gehe derweilen heim und rede mit ihr. Sagt sie Ja, so brauchen Sie nicht gleich zurückzukommen, wegen der Leute, und dann würde es sie auch zu sehr aufregen. Aber damit Sie nicht so lange Blut schwitzen müssen, werde ich dann in dem Fall den Fensterladen ganz weit aufschlagen, bis an die Mauer. Von da drüben können Sie es sehen, wenn Sie sich über die Hecke beugen.» Damit ging er.
Charles band sein Pferd an einen Baum, begab sich auf den Seitenweg und wartete. Eine halbe Stunde verging, dann zählte er noch neunzehn Minuten auf seiner Uhr, und dann plötzlich hörte er einen Schlag gegen die Mauer, der Laden war zurückgeschlagen worden, die Schließkette baumelte noch hin und her.
Am nächsten Morgen war er schon um neun Uhr auf dem Hof. Emma errötete, als er eintrat, und suchte ihre Erregung hinter einem Lächeln zu verbergen. Vater Rouault umarmte den zukünftigen Schwiegersohn … Über die geschäftliche Seite der Sache redete man noch nicht; dazu war ja noch Zeit genug, denn die Hochzeit konnte natürlich nicht vor Beendigung von Charles’ Trauerjahr, nicht vor nächstem Frühjahr, stattfinden.
Der Winter verging also mit Warten, Mademoiselle Rouault beschäftigte sich mit ihrer Aussteuer. Ein Teil wurde in Rouen bestellt, Hemden und Nachthauben fertigte sie sich selber nach Modezeichnungen an, die sie sich lieh. Bei Charles’ Besuchen sprach man nur von den Hochzeitsvorbereitungen; man überlegte, in welchem Raum das Essen stattfinden sollte, wie viele Gänge gegeben werden mussten und was für Vorspeisen.
Emma hätte sich eigentlich am liebsten um Mitternacht bei Fackelschein trauen lassen; aber für diese Idee zeigte Vater Rouault nicht das mindeste Verständnis. So gab es also eine Hochzeit, zu der dreiundvierzig Personen erschienen, bei der man sechzehn Stunden bei Tische saß und die am nächsten und, etwas abflauend, auch an den darauffolgenden Tagen noch weitergefeiert wurde.
4
Die Gäste erschienen schon früh in Gefährten aller Art: Kutschen, Halbkutschen, zweirädrigen Karren, Kremsern mit Ledervorhängen, und die jungen Leute aus der nächsten Nachbarschaft auf Leiterwagen, in Reihen nebeneinanderstehend, sich an den Seitenstangen anklammernd, um bei den derben Stößen nicht umzufallen. Manche kamen zehn Meilen weit her, aus Coderville, Normanville und Cany. Sämtliche Verwandten der beiden Familien hatte man eingeladen, mit Freunden, mit denen man auseinandergekommen war, hatte man sich wieder versöhnt und an Bekannte geschrieben, die man schon seit Langem aus den Augen verloren hatte.
Immer wieder ertönte Peitschengeknall hinter der Hecke, immer wieder tat sich das Gatter auf und ließ ein neues Fuhrwerk ein. Alle galoppierten bis an die erste Stufe der Freitreppe, hielten mit einem Ruck, und die Insassen quollen zu beiden Seiten heraus, rieben sich die Knie, reckten die Arme. Die Damen, in Hauben, trugen Kleider nach städtischer Mode, goldene Uhrketten, Umhänge, deren Enden sich in der Taille überkreuzten, oder kleine farbige Schultertücher, die im Rücken, den Hals freilassend, mit einer Nadel befestigt waren. Die Knaben waren genauso angezogen wie ihre Väter, und man merkte ihnen an, dass sie sich in ihrem Staat sehr unbehaglich fühlten (viele von ihnen weihten an diesem Tag ihr erstes Paar Stiefel ein). Neben dem einen oder anderen stand wohl auch stumm und steif ein hoch aufgeschossenes Mädchen, vierzehn- oder sechzehnjährig, eine Kusine oder ältere Schwester, im weißen, für diese Gelegenheit verlängerten Kommunionskleid, mit hochgeröteten Wangen, das Haar von Rosenpomade starrend, ängstlich darauf bedacht, sich nicht die neuen Handschuhe zu beschmutzen. Da nicht genug Stallknechte zum Ausspannen da waren, krempelten die Herren ihre Ärmel hoch und griffen selber zu. Je nach ihrem Stand waren sie in Leibfräcken, Bratenröcken, Jacken oder Joppen erschienen – hochfeinen Leibfräcken, die von der ganzen Familie mit Ehrfurcht gehegt und nur zu Festzeiten aus dem Schrank geholt wurden; langschößigen Bratenröcken, die im Winde flatterten, mit hohen zylinderförmigen Kragen und mit Taschen, groß wie Säcke; Jacken aus derbem Tuch, zu denen meist Mützen mit kupferbeschlagenen Schirmen gehörten; Joppen, mit zwei Knöpfen im Rücken, die dicht beisammenstanden wie ein Paar Augen, und mit ganz kurzen Schößen, die aussahen, wie vom Zimmermann mit dem Beil aus einem Stück zurechtgehauen. Einige (und das waren natürlich die, die dann bei Tisch ganz unten sitzen mussten) trugen nur ihre Sonntagskittel mit flachem Umlegekragen, im Rücken gefaltet und zusammengehalten durch einen aufgenähten, sehr tief sitzenden Gürtel.
Wie Kürasse wölbten sich die gestärkten Hemden über den Brüsten! Alles hatte sich die Haare schneiden lassen, sodass die Ohren noch mehr von den Köpfen abstanden, und alle waren sie sorgfältig rasiert; nur einige unter ihnen, die schon vor Morgengrauen aufgestanden waren, hatten offenbar nicht genug Licht dazu gehabt, denn sie hatten große Schmisse unter der Nase oder talergroße Hautabschürfungen am Kinn, die sich unterwegs an der frischen Luft noch mehr gerötet hatten, sodass die feisten, vergnügten Gesichter ganz scheckig aussahen.
Da das Gemeindeamt nur eine halbe Stunde vom Gut entfernt war, begab man sich zu Fuß hin und kehrte, als die Feierlichkeit in der Kirche vorüber war, auch zu Fuß wieder zurück. Der Hochzeitszug, der sich zuerst wie ein buntes Band den schmalen Pfad entlang durch die grünen Saatfelder geschlängelt hatte, lockerte sich bald und zerfiel in verschiedene Gruppen, die des Öfteren stehen blieben und plauderten. Allen voran schritt der Spielmann mit seiner bunt bebänderten Fiedel. Dann kamen das junge Paar, dann die Eltern und Verwandten und schließlich die anderen Gäste, wie es sich gerade traf. Die Kinder blieben weit hinten und belustigten sich damit, die Glöckchen von den Haferähren abzureißen oder sonst allerlei Unfug zu treiben, froh, dass niemand sich um sie kümmerte. Emmas Kleid, das zu lang geraten war, schleppte ein wenig nach: Von Zeit zu Zeit blieb sie stehen, um es an sich zu raffen und behutsam mit ihren behandschuhten Händen die Raugräser und Distelhäkchen abzuzupfen, und Charles stand mit leeren Händen dabei und wartete, bis sie fertig war. Vater Rouault im neuen Zylinder und Frack, dessen Ärmelaufschläge ihm bis an die Fingernägel reichten, führte die alte Madame Bovary. Monsieur Bovary senior, der in einem einreihigen Überrock von militärischem Schnitt erschienen war, schäkerte anzüglich mit einer jungen blonden Bäuerin, die ihm artig zuhörte, errötete und nicht wusste, wie sie ihm antworten sollte. Die übrigen Gäste sprachen von ihren Geschäften oder ulkten einander an, um sich schon im Voraus in Stimmung zu bringen. Zu alledem vernahm man, wenn man hinhörte, immer das Getön des Spielmanns, der auch hier im Freien weiter fiedelte. Wenn er merkte, dass die Gesellschaft hinter ihm zurückblieb, blieb er stehen, verschnaufte, rieb umständlich seinen Bogen mit Kolophonium ein, damit die Saiten besser quietschten, und marschierte dann wieder weiter, sich selber mit dem Hals seiner Fiedel, auf und ab, den Takt schlagend; vor dem Lärm, den er erzeugte, flohen die kleinen Singvögel scheu hinweg.
Unter dem Schutzdach des Wagenschuppens war die Tafel gedeckt. Vier Lendenbraten prangten darauf, sechs Schüsseln mit Hühnerfrikassee, eine Platte mit Kalbfleisch, drei Hammelkeulen und in der Mitte, umgeben von vier in Sauerampfer gekochten Leberwürsten, ein allerliebstes, knusprig gebratenes Spanferkel. An den Tischecken standen Karaffen mit Branntwein und Flaschen mit süßem Apfelmost, der seinen dicken Schaum schon an den Korken heraustrieb, und auf der Tafel waren sämtliche Gläser im Voraus bis an den Rand mit Wein vollgeschenkt. Große Schalen mit gelber Süßspeise, die bei der geringsten Erschütterung des Tisches erbebte, zeigten in verschnörkeltem Zuckerguss die Anfangsbuchstaben der Neuvermählten. Für die Torten und Kuchen hatte man eigens einen Konditor aus Yvetot kommen lassen. Der war erst jüngst in die Gegend gezogen und hatte sich daher besondere Mühe gegeben; beim Nachtisch trug er eigenhändig ein Prunkstück seiner Kunst auf, das ein allgemeines «Ah» hervorrief. Der Unterbau aus blauer Pappe stellte einen Tempel dar, mit einem Säulenumgang und kleinen, mit Goldpapiersternen ausgezierten Nischen, in denen zierliche Statuetten aus Tragant thronten. Darüber erhob sich ein Wartturm aus Biskuit, umbaut von winzigen Brustwehren aus Bonbons, Mandeln, Rosinen und Apfelsinenschnitten, und die oberste Plattform endlich, die eine grüne Wiese darstellte, mit Felsen und Teichen aus Zuckerguss und Schiffchen aus Haselnussschalen, war gekrönt von einem kleinen Amor auf einer Schokoladenschaukel, deren Pfosten oben als Knäufe zwei natürliche Rosenknospen trugen.
Man tafelte bis zum Abend. Wer das Sitzen satt hatte, ging im Hof spazieren oder machte in der Scheune eine Partie «Stöpsel»*** mit und setzte sich schließlich wieder an den Tisch. Gegen Ende der Mahlzeit schliefen manche ein und begannen zu schnarchen. Als jedoch der Kaffee kam, wurde alles wieder munter. Nun wurden Lieder gesungen und allerlei Kraftproben veranstaltet; man stemmte Gewichte, schoss Purzelbaum, versuchte einen Wagen mit den Schultern zu heben, riss derbe Witze und küsste die Damen. Beim Aufbruch hatte man Mühe, die Pferde anzuschirren, die sich bis an die Nüstern voll Hafer gefressen hatten. Sie bockten und schlugen aus, das Geschirr fiel herunter, und die Besitzer fluchten oder lachten. Die ganze Nacht hindurch rasten beim Schein des Mondes Fuhrwerke im Galopp die Landstraße entlang, hopsten über Abzugsgräben und Meilensteine weg, verhedderten sich an den Hecken, und die Frauen beugten sich ängstlich zu den Wagentüren hinaus, um nach den Zügeln zu greifen.
Wer in Berteaux blieb, zechte die Nacht über in der Küche weiter, während die Kinder unter den Bänken lagen und schliefen.