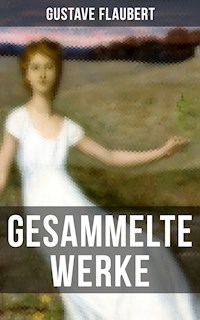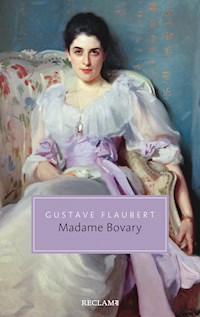
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclam Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Als Emma den Landarzt Charles Bovary heiratet, träumt sie von Liebe, Luxus und Leidenschaft, von einem Leben, wie sie es aus ihren Romanen kennt. Doch der Alltag in der Provinz ist ganz anders als erhofft. In ihrem Bestreben, ihre Sehnsüchte zu erfüllen, lässt sie sich verführen und setzt damit eine verheerende Spirale aus Betrug und Verzweiflung in Gang. Gustave Flaubert brachte sein Ehebruchroman eine Anklage wegen Verstoßes gegen die öffentliche Moral ein. Das Gericht sprach den Autor zwar frei, rügte aber insbesondere den schockierenden Realismus, der sich in der erotisch aufgeladenen und psychologisch scharfen Darstellung der Emma Bovary zeigte. – Mit einer kompakten Biographie des Autors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gustave Flaubert
Madame Bovary
Sittenbild aus der Provinz
Aus dem Französischen übersetzt von Ilse Perker und Ernst Sander
Nachwort von Manfred Hardt
Reclam
Französischer Originaltitel:Madame Bovary. Mœurs de province
2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Anja Grimm Gestaltung
Coverabbildung: akg-images
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2021
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961897-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020645-4
www.reclam.de
Inhalt
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Anmerkungen
Nachwort
Zeittafel
Erster Teil
I
Wir hatten Arbeitsstunde, als der Direktor hereinkam; ihm folgten ein »Neuer«, der noch sein Zivilzeug anhatte, und ein Pedell, der ein großes Pult trug. Die geschlafen hatten, fuhren hoch, und alle standen auf, als seien sie beim Arbeiten überrascht worden.
Der Direktor deutete uns durch eine Handbewegung an, dass wir uns wieder setzen sollten; dann wandte er sich an den Studienaufseher:
»Monsieur Roger«, sagte er halblaut zu ihm, »diesen Schüler hier möchte ich Ihrer Obhut empfehlen; er kommt in die Quinta. Wenn sein Verhalten und sein Fleiß lobenswert sind, kann er ›zu den Großen‹ kommen, zu denen er seinem Alter nach gehört.«
Der Neue war in dem Winkel hinter der Tür stehengeblieben, so dass man ihn kaum hatte wahrnehmen können; er war ein Bauernjunge, ungefähr fünfzehn Jahre alt und größer als wir alle. Das Haar trug er über der Stirn geradegeschnitten, wie ein Dorfkantor; er sah klug und sehr verlegen aus. Obwohl er keine breiten Schultern hatte, schien seine grüne Tuchjacke mit den schwarzen Knöpfen ihn an den Ärmelausschnitten zu beengen; aus den Aufschlägen sahen rote Handgelenke hervor, die es gewohnt waren, nackt zu sein. Seine blaubestrumpften Beine kamen aus einer gelblichen, von den Trägern straff hochgezogenen Hose. Seine Schuhe waren derb, schlecht gewichst und mit Nägeln beschlagen.
Es wurde mit dem Vorlesen der Arbeiten begonnen. Er spitzte die Ohren und hörte zu, aufmerksam wie bei der Predigt, und wagte nicht einmal, die Beine übereinanderzuschlagen oder den Ellbogen aufzustützen, und um zwei Uhr, als es läutete, musste der Studienaufseher ihn besonders auffordern, damit er sich mit uns andern in Reih und Glied stellte.
Es herrschte bei uns der Brauch, beim Betreten des Klassenzimmers unsere Mütze auf die Erde zu werfen, um die Hände freier zu haben; es galt, sie von der Tür aus unter die Bank zu schleudern, so dass sie an die Wand schlug und viel Staub aufwirbelte; das war so üblich.
Aber sei es nun, dass dies Verfahren dem Neuen nicht aufgefallen war, oder sei es, dass er sich nicht getraute, sich ihm anzupassen, jedenfalls war das Gebet gesprochen, und er hielt noch immer seine Mütze auf den Knien. Es war eine jener bunt zusammengesetzten Kopfbedeckungen, in denen sich die Grundbestandteile der Bärenfellmütze, der Tschapka, des steifen Huts, der Otterfellkappe und der baumwollenen Zipfelmütze vereinigt fanden; mit einem Wort, eins der armseligen Dinge, deren stumme Hässlichkeit Tiefen des Ausdrucks besitzt wie das Gesicht eines Schwachsinnigen. Sie war eiförmig und durch Fischbeinstäbchen ausgebaucht; sie begann mit zwei kreisrunden Wülsten; dann wechselten, getrennt durch einen roten Streifen, Rauten aus Samt und Kaninchenfell miteinander ab; dann folgte eine Art Sack, der in einem mit Pappe versteiften Vieleck endete; dieses war mit komplizierter Litzenstickerei bedeckt, und am Ende eines langen, viel zu dünnen, daran herabhängenden Fadens baumelte eine kleine, eichelförmige Troddel aus Goldfäden. Die Mütze war neu; der Schirm glänzte.
»Steh auf«, sagte der Lehrer.
Er stand auf; seine Mütze fiel hin. Die ganze Klasse fing an zu lachen.
Er bückte sich, um sie aufzunehmen. Einer seiner Nebenmänner stieß sie mit einem Ellbogenschubs wieder hinunter; er hob sie noch einmal auf.
»Leg doch deinen Helm weg«, sagte der Lehrer; er war ein Witzbold.
Die Schüler brachen in schallendes Gelächter aus, und das brachte den armen Jungen so sehr aus der Fassung, dass er nicht wusste, ob er seine Mütze in der Hand behalten, sie am Boden liegenlassen oder sich auf den Kopf stülpen solle. Er setzte sich wieder hin und legte sie auf seine Knie.
»Steh auf«, sagte der Lehrer wiederum, »und sag mir deinen Namen.«
Der Neue stieß mit blubbernder Stimme einen unverständlichen Namen hervor.
»Nochmal!«
Das gleiche Silbengeblubber wurde vernehmlich, überdröhnt vom Gebrüll der Klasse.
»Lauter!«, rief der Lehrer, »lauter!«
Da fasste der Neue einen verzweifelten Entschluss, machte seinen maßlos großen Mund auf und stieß mit vollen Lungen, wie um jemanden zu rufen, das Wort »Charbovari« hervor.
Es entstand ein Lärm, der mit jähem Schwung losbrach, im crescendo mit dem Gellen schriller Stimmen anstieg (es wurde geheult, gebellt, getrampelt und immer wieder gerufen: Charbovari! Charbovari!), der dann in Einzeltönen einherrollte, äußerst mühsam zur Ruhe kam und manchmal unvermittelt auf einer Bankreihe wieder losbrach, wo hier und dort ein unterdrücktes Lachen laut wurde, wie ein nicht ganz ausgebrannter Knallfrosch.
Unter dem Hagel von Strafarbeiten stellte sich die Ordnung in der Klasse allmählich wieder her, und der Lehrer, dem es endlich gelungen war, den Namen Charles Bovary zu verstehen, nachdem er sich ihn hatte diktieren, buchstabieren und nochmals vorlesen lassen, wies sofort dem armen Teufel einen Platz auf der Strafbank an, unmittelbar vor dem Katheder. Er setzte sich in Bewegung, aber ehe er hinging, zögerte er.
»Was suchst du?«, fragte der Lehrer.
»Meine Mü…«, sagte der Neue schüchtern und sah sich beunruhigt rings um.
»Fünfhundert Verse die ganze Klasse!« Die wütende Stimme, die das ausgerufen hatte, vereitelte wie das »Quos ego« einen neuen Sturmausbruch. – »Verhaltet euch doch ruhig!«, fuhr der Lehrer unwillig fort und wischte sich die Stirn mit einem Taschentuch, das er unter seinem Käppchen hervorgezogen hatte. »Und du, der Neue, du schreibst mir zwanzigmal ab ›ridiculus sum‹.«
Dann, mit milderer Stimme:
»Na, deine Mütze, die wirst du schon wiederfinden; die hat dir keiner gestohlen!«
Alles war wieder ruhig geworden. Die Köpfe neigten sich über die Hefte, und der Neue verharrte zwei Stunden lang in musterhafter Haltung, obwohl von Zeit zu Zeit ein Kügelchen aus zerkautem Papier, das mittels eines Federhalters geschleudert wurde, auf seinem Gesicht zerplatzte. Aber er wischte sich mit der Hand ab und blieb reglos mit niedergeschlagenen Augen sitzen.
Abends, bei der Arbeitsstunde, holte er seine Ärmelschoner aus seinem Pult hervor, brachte seine Habseligkeiten in Ordnung und richtete sorgsam sein Schreibpapier her. Wir beobachteten ihn, wie er gewissenhaft arbeitete, alle Vokabeln im Wörterbuch nachschlug und sich große Mühe gab. Wohl dank dieser Gutwilligkeit, die er bezeigte, brauchte er nicht in die nächstniedrige Klasse zurückversetzt zu werden; denn er beherrschte zwar ganz leidlich die Regeln, besaß jedoch in den Wendungen nicht eben Eleganz. Die Anfangsgründe des Lateinischen hatte der Pfarrer seines Dorfs ihm beigebracht; aus Sparsamkeit hatten seine Eltern ihn so spät wie möglich aufs Gymnasium geschickt.
Sein Vater, Charles Denis Bartholomé Bovary, ein ehemaliger Bataillons-Wundarzt, hatte um 1812 bei Aushebungen Unannehmlichkeiten gehabt und war damals gezwungen, aus dem Heeresdienst auszuscheiden; er hatte nun seine persönlichen Vorzüge ausgenutzt und im Handumdrehen eine Mitgift von sechzigtausend Francs eingeheimst, die sich ihm in Gestalt der Tochter eines Hutfabrikanten darbot; sie hatte sich in sein Aussehen verliebt. Er war ein schöner Mann, ein Aufschneider, der seine Sporen laut klingen ließ, einen Backen- und Schnurrbart trug, stets Ringe an den Fingern hatte und sich in Anzüge von auffälliger Farbe kleidete; er wirkte wie ein Haudegen und besaß das unbeschwerte Gehaben eines Handelsreisenden. Nun er verheiratet war, lebte er zwei oder drei Jahre vom Vermögen seiner Frau, aß gut, stand spät auf, rauchte aus langen Porzellanpfeifen, kam abends erst nach dem Theater nach Hause und war ein eifriger Café-Besucher. Der Schwiegervater starb und hinterließ wenig; er war darob empört, übernahm schleunigst die Fabrik, büßte dabei einiges Geld ein und zog sich danach aufs Land zurück, wo er es zu etwas bringen wollte. Aber da er von der Landwirtschaft nicht mehr verstand als von gefärbtem Baumwollstoff, da er seine Pferde lieber ritt, anstatt sie zur Feldarbeit zu schicken, da er seinen Zider lieber flaschenweise trank, anstatt ihn fassweise zu verkaufen, das schönste Geflügel seines Hofs selber aß und sich seine Jagdstiefel mit Schweinespeck einfettete, sah er nur zu bald ein, dass er am besten tue, wenn er auf jede geschäftliche Betätigung verzichte.
Also pachtete er für zweihundert Francs im Jahr in einem Dorf des Grenzgebietes der Landschaft Caux und der Picardie eine Heimstatt, die halb Bauernhof, halb Herrenhaus war; und zog sich, verbittert, von Reue zernagt, unter Anklagen wider den Himmel dorthin zurück; er war jetzt fünfundvierzig Jahre alt; die Menschen ekelten ihn an, wie er sagte, und er war entschlossen, fortan in Frieden zu leben.
Seine Frau war anfangs toll in ihn verschossen gewesen; unter tausend Demütigungen hatte sie ihn geliebt, und diese hatten ihn noch mehr von ihr entfernt. Ehedem war sie heiter, mitteilsam und herzlich gewesen; bei zunehmendem Alter war sie (wie abgestandener Wein, der sich in Essig umsetzt) mürrisch, zänkisch und nervös geworden. Zunächst hatte sie, ohne zu klagen, sehr gelitten, als sie ihn allen Dorfdirnen nachlaufen sah und zwanzig üble Lokale ihn ihr nachts abgestumpft und vor Besoffenheit stinkend heimschickten! Dann hatte sich ihr Stolz empört. Danach hatte sie geschwiegen und ihre Wut in einem stummen Stoizismus hinuntergewürgt, den sie bis zu ihrem Tod beibehielt. Sie war in geschäftlichen Angelegenheiten immerfort unterwegs. Sie ging zu den Anwälten, zum Präsidenten, wusste, wann Wechsel fällig wurden, erlangte Prolongationen; und im Haus plättete, nähte und wusch sie, beaufsichtigte das Gesinde und bezahlte die Rechnungen, während Monsieur, ohne sich um irgendetwas zu kümmern, beständig in maulender Schläfrigkeit befangen, aus der er nur erwachte, um seiner Frau Unfreundlichkeiten zu sagen, rauchend am Kamin saß und in die Asche spuckte.
Als sie ein Kind bekam, musste es zu einer Amme gegeben werden. Sobald der Kleine wieder daheim war, wurde er verhätschelt wie ein Prinz. Die Mutter fütterte ihn mit eingemachtem Obst; der Vater ließ ihn barfuß herumlaufen, und um sich als Philosoph aufzuspielen, pflegte er sogar zu sagen, eigentlich könne er völlig nackt gehen, wie die Jungen der Tiere. Im Gegensatz zu den mütterlichen Bestrebungen hatte er sich ein gewisses männliches Idealbild von der Kindheit in den Kopf gesetzt, nach dem er seinen Sohn zu modeln trachtete; er sollte streng erzogen werden, nach Art der Spartaner, damit er sich tüchtig abhärte. Er ließ ihn in einem ungeheizten Zimmer schlafen, brachte ihm bei, große Schlucke Rum zu trinken und den Prozessionen Schimpfwörter nachzurufen. Da jedoch der Kleine von Natur friedfertig war, sprach er schlecht auf diese Bemühungen an. Stets schleppte seine Mutter ihn mit sich herum; sie schnitt ihm Papierpuppen aus, erzählte ihm Geschichten und unterhielt sich mit ihm in endlosen Selbstgesprächen, die erfüllt waren von schwermütigem Frohsinn und geschwätzigen Zärtlichkeiten. In der Einsamkeit ihres Lebens übertrug sie auf diesen Kinderkopf alle ihre unerfüllten und zunichte gewordenen Sehnsüchte. Sie träumte von hohen Stellungen, sie sah ihn schon groß, schön, klug, versorgt, beim Amt für Brücken- und Straßenbau oder als Richter. Sie lehrte ihn lesen und brachte es an einem alten Klavier, das sie besaß, sogar fertig, dass er ein paar kleine Lieder sang. Aber von alledem sagte Monsieur Bovary, der von gelehrten Dingen nicht viel hielt, es lohne nicht die Mühe. Würden sie je in der Lage sein, ihn die staatlichen Schulen besuchen zu lassen, ihm ein Amt oder ein Geschäft zu kaufen? Übrigens setze ein Mann sich im Leben stets durch, wenn er sicher auftrete. Madame Bovary biss sich auf die Lippen, und der kleine Junge stromerte im Dorf umher.
Er folgte den Knechten aufs Feld und verjagte mit Erdklumpenwürfen die Krähen; sie flatterten davon. Er aß die längs der Chausseegräben wachsenden Brombeeren, hütete mit einer Gerte die Truthähne, half beim Heuen, lief in den Wald, spielte an Regentagen unter dem Kirchenportal »Himmel und Hölle« und bestürmte an Feiertagen den Küster, ihn die Glocke läuten zu lassen, damit er sich mit seinem ganzen Körpergewicht an das dicke Seil hängen und sich durch dessen Schwung emporheben lassen konnte.
So gedieh er wie eine Eiche. Er bekam kräftige Hände und eine schöne Gesichtsfarbe.
Als er zwölf Jahre alt geworden war, setzte seine Mutter es durch, dass mit eigentlichem Unterricht begonnen werden sollte. Damit wurde der Pfarrer beauftragt. Allein die Stunden waren so kurz und wurden so unregelmäßig abgehalten, dass nicht viel dabei herauskam. Sie wurden erteilt, wenn der Pfarrer gerade nichts Besseres zu tun hatte, in der Sakristei, im Stehen, in aller Hast, zwischen einer Taufe und einem Begräbnis; oder er ließ nach dem Angelus, wenn er das Haus nicht zu verlassen brauchte, seinen Schüler holen. Sie stiegen dann in sein Zimmer hinauf und machten es sich bequem: Mücken und Nachtschmetterlinge tanzten um die Kerze. Es war warm, das Kind schlief ein, und der wackere Pfarrer dämmerte mit den Händen auf dem Bauch ebenfalls ein, und bald schnarchte er mit offenem Mund. Es kam aber auch vor, dass der Herr Pfarrer, wenn er einem Kranken in der Umgebung die letzte Wegzehrung gereicht hatte, auf dem Heimweg Charles sich im Freien herumtreiben sah; dann rief er ihn zu sich, hielt ihm eine Viertelstunde lang eine Strafpredigt und nahm die Gelegenheit wahr, ihn am Fuß eines Baums ein Verbum konjugieren zu lassen. Dann störte sie entweder ein Regenguss oder ein vorübergehender Bekannter. Übrigens war er durchaus mit ihm zufrieden und sagte sogar, der »junge Mann« habe ein gutes Gedächtnis.
So konnte es mit Charles nicht weitergehen. Madame wurde energisch. Beschämt oder wohl eher müde gab Monsieur ohne Widerrede nach; es sollte nur ein Jahr damit gewartet werden, bis der Junge seine Erstkommunion hinter sich gebracht hatte.
Darüber gingen weitere sechs Monate hin; doch im nächsten Jahr wurde Charles tatsächlich auf das Gymnasium von Rouen geschickt; gegen Ende Oktober brachte der Vater selber ihn hin; es war um die Zeit des Sankt-Romanus-Jahrmarkts.
Heute würde es uns allen unmöglich sein, sich seiner noch deutlich zu erinnern. Er war ein ziemlich phlegmatischer Junge, der in den Pausen spielte, während der Arbeitsstunden lernte, beim Unterricht zuhörte, im Schlafsaal gut schlief und im Refektorium tüchtig zulangte. Sein Betreuer war ein Eisengroßhändler in der Rue de la Ganterie, der ihn einmal im Monat an Sonntag nach Ladenschluss abholte; er schickte ihn spazieren, damit er sich am Hafen die Schiffe ansehe; danach brachte er ihn dann gegen sieben Uhr, vor dem Abendessen, wieder zurück. Jeden Donnerstagabend schrieb Charles einen langen Brief an seine Mutter, und zwar mit roter Tinte und drei Siegeloblaten; danach vertiefte er sich in seine Geschichtshefte, oder er las auch in einem alten Band des »Anacharsis«, der im Arbeitszimmer herumlag. Bei den Spaziergängen unterhielt er sich mit dem Schuldiener, der wie er vom Lande stammte.
Durch seinen Fleiß hielt er sich stets in der Mitte der Klasse; einmal gewann er sogar einen ersten Preis in Naturkunde. Doch gegen Ende seines Tertianerjahrs nahmen ihn seine Eltern vom Gymnasium, um ihn Medizin studieren zu lassen; sie waren davon überzeugt, dass er sich allein bis zur Reifeprüfung durchhelfen könne.
Seine Mutter suchte für ihn bei einem ihr bekannten Färber ein Zimmer im vierten Stock mit Ausblick auf die Eau-de-Robec. Sie traf Vereinbarungen über den Pensionspreis, besorgte Möbel, einen Tisch und zwei Stühle, ließ von zu Hause ein altes Kirschholzbett kommen und kaufte außerdem einen kleinen gusseisernen Ofen nebst einem Vorrat an Brennholz, damit ihr armer Junge es warm habe. Dann fuhr sie am Ende der Woche wieder heim, nach Tausenden von Ermahnungen, er solle sich gut aufführen, nun er ganz sich selbst überlassen sei.
Das Vorlesungsverzeichnis, das er am Schwarzen Brett las, machte ihn schwindlig: Anatomischer Kursus, Pathologischer Kursus, Physiologischer Kursus, Pharmazeutischer Kursus, Chemischer Kursus, Botanischer, Klinischer, Therapeutischer Kursus, nicht zu reden von der Hygiene und der praktischen Medizin, lauter Bezeichnungen, deren Etymologien er nicht kannte und die ihn anmuteten wie ebenso viele Pforten zu von erhabener Finsternis erfüllten Heiligtümern.
Er verstand nichts; er mochte zuhören, soviel er wollte, er nahm nichts in sich auf. Dabei arbeitete er; er hatte gebundene Kolleghefte; er folgte allen Vorlesungen und versäumte keine einzige Visite. Er vollbrachte sein kleines tägliches Arbeitspensum wie ein Pferd im Göpelwerk, das mit verbundenen Augen im Kreise läuft, ohne zu wissen, was es zerschrotet.
Um ihm Ausgaben zu ersparen, schickte seine Mutter ihm wöchentlich durch den Botenmann ein Stück Kalbsbraten; das bildete, wenn er vom Krankenhaus heimgekommen war, sein Mittagessen; dabei trommelte er mit den Schuhsohlen gegen die Zimmerwand. Dann musste er schleunigst wieder ins Kolleg, in den Anatomiesaal, ins Krankenhaus und dann abermals heim, durch sämtliche Straßen. Abends stieg er nach dem kargen Essen bei seinem Hauswirt wieder in seine Bude hinauf und machte sich in seinem feuchten Anzug, der ihm bei der Rotglut des Kanonenofens am Leibe dampfte, abermals an die Arbeit.
An schönen Sommerabenden, um die Stunde, da die lauen Straßen leer sind und die Dienstmädchen vor den Haustüren Federball spielen, machte er sein Fenster auf und lehnte sich hinaus. Der Bach, der aus dieser Rouener Stadtgegend ein hässliches Klein-Venedig macht, floss unter ihm vorbei, gelb, violett oder blau zwischen seinen Brücken und Gittern. Am Ufer hockten Arbeiter und wuschen sich die Arme im Wasser. An Stangen, die aus den Speichergiebeln hervorragten, trockneten an der Luft Baumwolldocken. Gegenüber, hinter den Dächern, dehnte sich der weite, klare Himmel mit der roten, sinkenden Sonne. Wie schön musste es im Freien sein! Wie kühl unter den Waldbuchen! Und er weitete die Nasenlöcher, um den köstlichen Geruch der Felder einzuatmen, der gar nicht bis zu ihm hindrang.
Er magerte ab, er schoss in die Höhe, und sein Gesicht bekam einen Leidenszug, der es fast interessant machte.
Natürlich wurde er nach und nach aus Lässigkeit allen Vorsätzen untreu, die er gefasst hatte. Einmal versäumte er die Visite, am nächsten Tag seine Vorlesung, allmählich fand er Geschmack am Faulenzen und ging überhaupt nicht mehr hin.
Er wurde Stammgast in einer Kneipe und ein leidenschaftlicher Dominospieler. Allabendlich in einer schmutzigen Spelunke zu hocken, um dort mit den Spielsteinen aus schwarzbepunkteten Hammelknochen auf Marmortischen zu klappern, dünkte ihn ein köstlicher Akt seiner Freiheit, der seine Selbstachtung erhöhte. Es war wie eine Einführung in Welt und Gesellschaft, der Zugang zu verbotenen Freuden; beim Eintreten legte er mit einer beinah sinnlichen Freude die Hand auf den Türknauf. Jetzt wurde in ihm viel Unterdrücktes lebendig; er lernte Couplets auswendig und gab sie gelegentlich zum Besten; er begeisterte sich für Béranger, konnte Punsch bereiten und lernte schließlich die Liebe kennen.
Dank dieser Vorarbeiten fiel er bei der Prüfung als Arzt zweiter Klasse völlig durch. Am gleichen Abend wurde er daheim erwartet, wo sein Erfolg gefeiert werden sollte.
Er zog zu Fuß los und machte am Dorfeingang halt; dorthin ließ er seine Mutter bitten und erzählte ihr alles. Sie entschuldigte ihn, schrieb den Misserfolg der Ungerechtigkeit der Examinatoren zu und richtete ihn dadurch ein bisschen auf, dass sie es übernahm, die Sache in Ordnung zu bringen. Erst fünf Jahre später erfuhr Monsieur Bovary die Wahrheit; sie war schon alt, er nahm sie hin, im Übrigen außerstande, anzunehmen, dass ein Mensch, der von ihm abstammte, ein Dummkopf sei.
So machte Charles sich von neuem an die Arbeit und bereitete sich ohne Unterbrechung auf die Stoffgebiete seines Examens vor; er lernte alle Fragen vorher auswendig. Daher bestand er mit einer ziemlich guten Note. Welch ein Freudentag für seine Mutter! Es wurde ein großes abendliches Festessen veranstaltet.
Wo sollte er seine Kunst nun ausüben? In Tostes. Dort gab es nur einen alten Arzt. Seit langem schon hatte die Mutter Bovary auf dessen Tod gelauert, und der Gute war kaum bestattet, als Charles sich auch schon als sein Nachfolger im Haus gegenüber niederließ.
Aber nicht genug damit, dass sie ihren Sohn großgezogen, dass sie ihn Medizin hatte studieren lassen und dass sie für die Ausübung seines Berufs Tostes entdeckt hatte: er musste eine Frau haben. Sie machte für ihn eine ausfindig: die Witwe eines Gerichtsvollziehers aus Dieppe, fünfundvierzig Jahre alt und im Besitz einer Rente von zwölfhundert Francs.
Obwohl Madame Dubuc hässlich war, dürr wie eine Bohnenstange und bepickelt wie ein knospender Frühling, fehlte es ihr nicht an Bewerbern. Um zum Ziel zu gelangen, musste Mutter Bovary sie alle aus dem Feld schlagen, und sie triumphierte sogar sehr geschickt über die Machenschaften eines Metzgermeisters, der von der Geistlichkeit unterstützt wurde.
Charles hatte in der Heirat den Aufstieg in bessere Lebensbedingungen erblickt; er hatte geglaubt, er werde freier sein und könne über sich selber und sein Geld verfügen. Aber seine Frau hatte die Hosen an; er durfte vor den Leuten zwar dieses sagen, aber nicht jenes; alle Freitage musste er fasten, sich nach ihrem Geschmack kleiden und auf ihren Befehl hin die Patienten, die nicht bezahlten, hart anpacken. Sie machte seine Briefe auf, überwachte jeden seiner Schritte und belauschte, wenn es sich um Frauen handelte, durch die Zwischenwand hindurch die ärztlichen Ratschläge, die er in seinem Behandlungszimmer gab.
Morgens musste sie ihre Schokolade haben; sie forderte Rücksichtnahmen ohne Ende. Unaufhörlich jammerte sie über ihre Nerven, ihre Lunge, ihre Körpersäfte. Das Geräusch von Schritten tat ihr weh; war er außer Hause, so fand sie die Einsamkeit grässlich; kam er wieder, so sicherlich nur, um sie sterben zu sehen. Wenn Charles abends heimkehrte, streckte sie ihre langen mageren Arme unter der Bettdecke hervor, schlang sie ihm um den Hals, ließ ihn sich auf die Bettkante setzen und begann, ihm von ihren Kümmernissen zu erzählen: er vernachlässige sie, er liebe eine andre! Man habe es ihr ja gleich gesagt, dass sie unglücklich werden würde; und schließlich bat sie ihn um einen Gesundheitssirup und um ein bisschen mehr Liebe.
II
Eines Abends gegen elf Uhr wurden sie durch das Getrappel eines Pferds geweckt, das genau vor der Haustür anhielt. Das Hausmädchen öffnete die Bodenluke und unterhandelte eine Weile mit einem Mann, der unten auf der Straße stehengeblieben war. Er kommt den Arzt holen; er habe einen Brief. Nastasie stieg schlotternd die Treppenstufen hinab, schloss auf und schob die Riegel zurück, einen nach dem andern. Der Mann ließ sein Pferd stehen, folgte dem Mädchen und trat unversehens hinter ihr ein. Er zog aus seiner graubequasteten Wollkappe einen in einen Lappen gewickelten Brief hervor und reichte ihn behutsam Charles, der sich mit den Ellbogen auf das Kopfkissen stützte, um ihn zu lesen. Nastasie stand am Bett und hielt den Leuchter. Madame blieb verschämt der Wand zugekehrt liegen und zeigte den Rücken.
Dieser Brief, den ein kleines, blaues Wachssiegel verschloss, forderte Monsieur Bovary dringend auf, sich unverzüglich nach dem Pachthof Les Bertaux zu begeben, um ein gebrochenes Bein zu schienen. Nun aber sind es von Tostes nach Les Bertaux gute sechs Meilen Wegs, wenn man über Longueville und Saint-Victor reitet. Die Nacht war pechschwarz. Die jüngere Madame Bovary fürchtete, ihrem Mann könne etwas zustoßen. So wurde beschlossen, der Stallknecht solle vorausreiten. Charles wolle drei Stunden später aufbrechen, wenn der Mond aufgegangen sei. Es solle ihm ein Junge entgegengeschickt werden, um ihm den Weg nach dem Pachthof zu zeigen und die Knicktore zu öffnen.
Gegen vier Uhr morgens machte sich Charles, fest in seinen Mantel gehüllt, auf den Weg nach Les Bertaux. Er war noch benommen von der Wärme des Schlafes und ließ sich vom friedlichen Trott seines Pferdes schaukeln. Als es von selber vor einem der von Dornsträuchern umwachsenen Löcher stehenblieb, wie sie am Rand der Äcker gegraben werden, schreckte Charles auf, musste rasch an das gebrochene Bein denken und versuchte, in seinem Gedächtnis alles zusammenzukramen, was er über Knochenbrüche wusste. Es regnete nicht mehr; der Tag begann zu dämmern, und auf den Zweigen der blätterlosen Apfelbäume hockten reglose Vögel und sträubten ihr Gefieder im kalten Morgenwind. So weit man sehen konnte, erstreckte sich das flache Land, und die Baumgruppen, die die Bauernhöfe umgaben, bildeten in weiten Abständen schwärzlich-violette Flecke auf dieser großen, grauen Fläche, die am Horizont in die trübe Farbe des Himmels zerrann. Von Zeit zu Zeit riss Charles die Augen auf; danach wurde er wieder müde, und der Schlaf kam ganz von selber wieder; bald geriet er in einen traumartigen Zustand, in dem neuerliche Empfindungen mit Erinnerungen verschmolzen; er fühlte sich verdoppelt, gleichzeitig Student und Ehemann, in seinem Bett liegend wie vor kurzem noch, einen Saal mit Operierten durchschreitend wie ehemals. Der warme Geruch heißer Breiumschläge mischte sich in seinem Kopf mit dem frischen Duft des Taus; er hörte die Eisenringe an den Stangen der Bettvorhänge klirren und seine Frau schlafen … Als er durch Vassonville ritt, sah er am Grabenrand einen Jungen im Gras sitzen.
»Sind Sie der Doktor?«, fragte der Kleine.
Und auf Charles’ Antwort hin nahm er seine Holzschuhe in die Hand und begann vor ihm herzulaufen.
Unterwegs entnahm der Arzt den Reden seines Führers, dass Monsieur Rouault ein recht wohlhabender Landwirt sei. Er hatte sich das Bein gebrochen, als er am vergangenen Abend von einem Nachbarn, bei dem er das Dreikönigsfest gefeiert hatte, heimgegangen war. Seine Frau war seit zwei Jahren tot. Er hatte nur sein »Fräulein« bei sich; sie half ihm im Haushalt.
Die Radspuren wurden tiefer. Sie näherten sich Les Bertaux. Der kleine Junge schlüpfte durch ein Loch in der Hecke und verschwand; dann tauchte er am Ende einer Einfriedigung wieder auf und öffnete die Schranke. Das Pferd glitschte auf dem feuchten Gras aus; Charles bückte sich, um unter den Baumzweigen durchzukommen. Die Hofhunde im Zwinger bellten und zerrten an ihren Ketten. Als er in Les Bertaux einritt, scheute sein Pferd und vollführte einen großen Satz.
Der Pachthof machte einen guten Eindruck. Durch die offenen Oberteile der Türen sah man kräftige Ackerpferde, die geruhsam aus neuen Raufen fraßen. Längs der Wirtschaftsgebäude zog sich ein breiter Misthaufen hin, von dem Dunstschwaden aufstiegen, und zwischen den Hühnern und Truthähnen stolzierten fünf oder sechs Pfauen einher, ein besonderer Luxus der Geflügelhöfe der Landschaft Caux. Der Schafstall war lang; die Scheune hoch, mit Mauern glatt wie die Fläche einer Hand. Im Schuppen standen zwei große Leiterwagen und vier Pflüge mit den dazugehörenden Peitschen, Kummeten und sämtlichen Geschirren; die blauen Wollwoilache waren mit feinem Staub bedeckt, der von den Kornböden niederfiel. Der Hof stieg etwas an; er war symmetrisch mit weit auseinanderstehenden Bäumen bepflanzt, und vom Tümpel her erscholl das fröhliche Geschnatter einer Gänseherde.
Eine junge Frau in einem mit drei Volants besetzten blauen Merinokleid erschien auf der Haustürschwelle, um Monsieur Bovary zu begrüßen; sie führte ihn in die Küche, in der ein tüchtiges Feuer brannte. Ringsum kochte das Essen für das Gesinde in kleinen Töpfen von unterschiedlicher Form. An den Innenwänden des Kamins trockneten feuchte Kleidungsstücke. Die Schaufel, die Feuerzange und das Mundstück des Blasebalgs, alle von kolossaler Größe, funkelten wie blanker Stahl, während an den Wänden entlang eine Unmenge von Küchengerät hing; darin spiegelte sich ungleichmäßig die helle Flamme des Herdfeuers, dem sich die ersten, durch die Fensterscheiben einfallenden Sonnenstrahlen zugesellten.
Charles stieg zum ersten Stock hinauf, um nach dem Patienten zu sehen. Er fand ihn im Bett, schwitzend unter seinen Decken; seine baumwollene Nachtmütze hatte er weit von sich geworfen. Er war ein stämmiger, untersetzter Mann von fünfzig Jahren, mit heller Haut, blauen Augen und kahler Stirn; er trug Ohrringe. Neben ihm stand auf einem Stuhl eine große Karaffe Schnaps, deren er sich von Zeit zu Zeit bedient hatte, um sich Mut zu machen; allein beim Anblick des Arztes legte sich seine Erregung, und anstatt zu fluchen, wie er es seit zwölf Stunden getan hatte, fing er schwach zu ächzen an.
Der Bruch war einfach, ohne jede Komplikation. Einen leichteren Fall hätte Charles sich schwerlich wünschen können. Also erinnerte er sich der Verhaltensweise seiner Lehrer an Krankenbetten; er tröstete den Leidenden mit allen möglichen guten Worten, Chirurgen-Freundlichkeiten, die wie das Öl sind, mit dem die Operationsmesser eingefettet werden. Um Schienen zu fertigen, wurde aus dem Wagenschuppen ein Bündel Latten geholt. Charles suchte eine aus, zerschnitt sie in Stücke und glättete sie mit einer Glasscherbe, während die Magd Laken zerriss, aus denen Binden gemacht werden sollten; Mademoiselle Emma versuchte inzwischen, kleine Polster zu nähen. Da es lange dauerte, bis sie ihren Nähkasten gefunden hatte, wurde ihr Vater ungeduldig; sie antwortete nichts; und beim Nähen stach sie sich in die Finger; die steckte sie dann in den Mund, um sie auszusaugen.
Charles staunte über die Sauberkeit ihrer Fingernägel, Sie glänzten, waren vorn gefeilt und reinlicher als die Elfenbeinschnitzereien in Dieppe, und mandelförmig geschnitten. Dabei war ihre Hand nicht schön, vielleicht nicht blass genug, und die Fingerglieder waren ein bisschen mager und ohne weiche Biegungen der Linien in der Kontur. Schön an ihr waren lediglich die Augen; obwohl braun, wirkten sie schwarz der Wimpern wegen, und ihr Blick traf einen unverhohlen mit naiver Kühnheit.
Als der Verband fertig war, wurde der Arzt von Monsieur Rouault persönlich eingeladen, »einen Happen zu essen«, ehe er wieder aufbreche.
Charles ging in das im Erdgeschoss gelegene große Wohnzimmer hinunter. Es lagen zwei Gedecke und standen zwei Silberbecher auf einem Tischchen am Fußende eines großen Bettes mit einem Kattunhimmel, auf dem Türken dargestellt waren. Es roch nach Iris und feuchten Betttüchern; der Geruch kam aus einem hohen Eichenschrank, der dem Fenster gegenüberstand. Am Fußboden, in den Ecken, waren aufrecht stehende Kornsäcke aufgereiht. Die anstoßende Kornkammer war übervoll; zu ihr hin führten drei Steinstufen. Als Zimmerschmuck hing an einem Nagel mitten an der Wand, deren grüne Tünche des Salpeters wegen abblätterte, in goldenem Rahmen eine Bleistiftzeichnung, ein Minervakopf, und darunter stand in altfränkischen Lettern: »Meinem lieben Papa.«
Zuerst wurde von dem Patienten gesprochen, dann vom Wetter, von den starken Frösten, von den Wölfen, die nachts über die Felder streiften. Mademoiselle Rouault hatte keine Freude am Landleben, zumal jetzt nicht, nun fast die ganze Last der Gutswirtschaft auf ihr allein ruhte. Da es im Zimmer kalt war, fröstelte sie während der ganzen Mahlzeit; dabei öffnete sie ein wenig ihre vollen Lippen, auf denen sie herumzubeißen pflegte, wenn sie schwieg.
Ihr Hals entstieg einem weißen Umlegekragen. Ihr Haar, dessen beide schwarze Streifen aus je einem einzigen Stück zu bestehen schienen, so glatt lagen sie an, war in der Mitte des Kopfes durch einen dünnen, hellen Scheitel geteilt, der sich, der Wölbung des Schädels entsprechend, leicht vertiefte; die Ohrläppchen waren kaum sichtbar; hinten wurde es zu einem üppigen Knoten zusammengefasst, mit einer Wellenbewegung nach den Schläfen zu, was der Landarzt hier zum erstenmal in seinem Leben sah. Ihre Wangen waren rosig. Zwischen zwei Knöpfen ihres hochgeschlossenen Kleides trug sie ein Schildpattlorgnon, wie ein Mann.
Als Charles, der hinaufgegangen war, um sich von dem alten Rouault zu verabschieden, nochmals in das Zimmer trat, ehe er fortritt, fand er sie am Fenster stehen und in den Garten schauen, wo der Wind die Bohnenstangen umgeworfen hatte. Sie wandte sich um.
»Suchen Sie etwas?«, fragte sie.
»Meine Reitgerte, wenn Sie gestatten«, antwortete er.
Und er machte sich daran, auf dem Bett nachzusehen, hinter den Türen, unter den Stühlen; sie war zwischen den Säcken und der Wand zu Boden gefallen. Mademoiselle Emma entdeckte sie; sie beugte sich über die Kornsäcke. Charles wollte ihr galant zuvorkommen, und als auch er den Arm mit der gleichen Bewegung reckte, spürte er, wie seine Brust den Rücken des unter ihm sich bückenden jungen Mädchens streifte. Sie war ganz rot, als sie sich aufrichtete, blickte ihn über die Schulter hinweg an und hielt ihm seinen Ochsenziemer hin.
Anstatt drei Tage später wieder nach Les Bertaux zu kommen, wie er es versprochen hatte, sprach er bereits am nächsten Tag dort vor, und dann regelmäßig zweimal die Woche, ganz abgesehen von den unerwarteten Besuchen, die er hin und wieder machte, wie aus Versehen.
Übrigens ging alles gut; die Heilung vollzog sich vorschriftsmäßig, und als man nach sechsundvierzig Tagen den alten Rouault versuchen sah, ganz allein auf seinem alten Hof umherzugehen, fing man an, Monsieur Bovary für eine Kapazität zu halten. Der alte Rouault sagte, besser hätten ihn die ersten Ärzte aus Yvetot oder sogar aus Rouen auch nicht heilen können.
Was Charles betraf, so gab er sich keine Rechenschaft, warum er so gern nach Les Bertaux kam. Hätte er darüber nachgedacht, so würde er sicherlich seinen Eifer dem Ernst des Falles zugeschrieben haben, oder vielleicht auch dem Honorar, das er sich davon erhoffte. Aber waren das wirklich die Gründe dafür, dass seine Besuche auf dem Pachthof eine köstliche Abwechslung im armseligen Einerlei seines Daseins bildeten? An jenen Tagen stand er frühzeitig auf, ritt im Galopp fort; trieb sein Pferd an, saß dann ab, reinigte sich die Füße im Gras und streifte seine schwarzen Handschuhe über, ehe er einritt. Er liebte sein Ankommen auf dem Hof, er liebte es, an seiner Schulter das nachgebende Eingangstor zu fühlen, den Hahn, der auf der Mauer krähte, und die Buben, die ihm entgegenliefen. Er liebte die Scheune und die Ställe; er liebte den alten Rouault, der ihm die Hand gab, dass es nur so klatschte, und ihn seinen Lebensretter nannte; er liebte Mademoiselle Emmas kleine Schuhe auf den gescheuerten Fliesen der Küche; ihre hohen Hacken machten sie ein bisschen größer, und wenn sie vor ihm herging, schlugen die schnell sich hebenden Holzsohlen mit einem trockenen Geräusch gegen das Oberleder.
Sie geleitete ihn jedesmal bis an die erste Stufe der Freitreppe. Wenn sein Pferd noch nicht vorgeführt worden war, blieb sie bei ihm stehen. Sie hatten schon Abschied genommen; sie sagten nichts mehr; die freie Luft umgab sie und wehte wirr ihre flaumigen Nackenhärchen hoch oder ließ ihre Schürzenbänder um die Hüfte flattern; sie verdrehten sich wie Spruchbänder. Einmal, als Tauwetter war, schwitzte die Rinde der Bäume im Hof, und der Schnee auf den Dächern der Gebäude schmolz. Sie stand auf der Schwelle; sie ging hinein und holte ihren Sonnenschirm, sie spannte ihn auf. Der Schirm war aus taubenhalsfarbener Seide; das Sonnenlicht drang hindurch und bildete tanzende Reflexe auf ihrer weißen Gesichtshaut. Sie lächelte darunter in die laue Wärme, und man hörte die Wassertropfen einen nach dem andern auf das straff gespannte Moiré fallen.
In der ersten Zeit von Charles’ häufigeren Ritten nach Les Bertaux hatte seine Frau sich nach dem Patienten erkundigt, und in dem Buch, in das sie Ausgaben und Einnahmen eintrug, sogar für Monsieur Rouault eine schöne weiße Seite ausgesucht. Doch als sie vernahm, er habe eine Tochter, zog sie Erkundigungen ein; und nun erfuhr sie, dass Mademoiselle Rouault im Kloster erzogen worden sei, bei den Ursulinerinnen, und also sozusagen ›eine höhere Bildung‹ erhalten habe, dass sie infolgedessen Unterricht im Tanzen, in Geographie, im Zeichnen, in Gobelinstickerei und im Klavierspielen gehabt hatte. Das war der Gipfel!
»Deswegen also«, sagte sie sich, »macht er ein so heiteres Gesicht, wenn er sie besucht, und zieht seine neue Weste an, auf die Gefahr hin, dass der Regen sie verdirbt? Oh, dieses Weib! Dieses Weib …!«
Und instinktiv hasste sie sie. Anfangs erleichterte sie sich durch Anspielungen. Charles verstand sie nicht; dann durch anzügliche Bemerkungen, die er ihr aus Furcht vor einer Szene hingehen ließ; schließlich jedoch durch unverhohlene Vorwürfe, auf die er nichts zu entgegnen wusste. Wie es komme, dass er in einem fort nach Les Bertaux reite, wo doch Monsieur Rouault längst geheilt sei und die Leute da noch immer nicht bezahlt hätten? Haha, nur, weil dort »eine Person« sei, jemand, der zu plaudern wisse, eine, die sich aufspiele, eine Schöngeistige. So was möge er: Stadtdamen müsse er haben! Und dann fuhr sie in ihrer Rede fort:
»Die Tochter vom alten Rouault und eine Stadtdame? Geh mir doch! Deren Großvater war Schafhirt, und sie haben einen Vetter, der wäre beinah vors Schwurgericht gekommen, weil er bei einer Prügelei einen fast totgeschlagen hätte. Die braucht sich wirklich nicht aufzuspielen und sonntags in einem Seidenkleid zur Kirche zu gehen wie eine Gräfin. Übrigens hätte der Alte ohne seinen Raps vom vorigen Jahr schwerlich seine Pachtrückstände bezahlen können!«
Charles wurde es müde; er stellte seine Besuche in Les Bertaux ein. Héloïse hatte ihn nach vielen Schluchzern und Küssen in einem großen Liebesausbruch auf ihr Messbuch schwören lassen, er werde nicht mehr hinreiten. Also gehorchte er; aber die Heftigkeit seines Verlangens protestierte gegen das Knechtische seines Verhaltens, und aus einer gewissen naiven Scheinheiligkeit heraus meinte er, dieses Verbot, sie zu besuchen, räume ihm gewissermaßen ein Recht ein, sie zu lieben. Und überdies war die Witwe mager; sie hatte lange Zähne; sie trug zu jeder Jahreszeit einen kleinen schwarzen Schal, dessen Zipfel ihr zwischen den Schulterblättern herabhing; ihre eckige Gestalt war in Kleider eingezwängt, die wie ein Futteral wirkten; sie waren zu kurz und ließen ihre Fußgelenke und die auf grauen Strümpfen sich kreuzenden Bänder ihrer plumpen Schuhe sehen.
Dann und wann kam Charles’ Mutter zu Besuch; aber nach ein paar Tagen schien die Schwiegertochter sich an ihr zu wetzen, und dann fielen sie wie zwei Messer mit ihren Betrachtungen und Bemerkungen über ihn her. Er solle nicht so viel essen! Warum immer gleich dem Erstbesten was zu trinken anbieten? Welch eine Dickköpfigkeit, keine Flanellwäsche tragen zu wollen!
Zu Frühlingsbeginn geschah es, dass ein Notar aus Ingouville, der Vermögensverwalter der Witwe Dubuc, übers Meer das Weite suchte und alles Geld mitnahm, das sich in seinem Büro befand. Freilich besaß Héloïse noch außer einem Schiffsanteil, der auf sechstausend Francs geschätzt wurde, ihr Haus in der Rue Saint-François, und dabei hatte sie von dem ganzen Vermögen, das so laut gerühmt worden war, nichts mit in die Ehe gebracht als ein paar Möbelstücke und ein bisschen abgetragene Kleidung. Der Sache musste auf den Grund gegangen werden. Das Haus in Dieppe erwies sich als bis an die Dachbalken mit Hypotheken belastet, und der Schiffsanteil war keine tausend Taler wert. Sie hatte also gelogen, die gute Dame! In seiner Wut zerschlug der Vater Bovary einen Stuhl auf dem Steinpflaster und beschuldigte seine Frau, den Sohn ins Unglück gestürzt und ihn mit dieser alten Schindmähre zusammengekoppelt zu haben, deren Geschirr nicht ihr Fell wert sei. Sie fuhren nach Tostes. Es kam zu Auseinandersetzungen. Es gab Auftritte. Héloïse warf sich schluchzend in die Arme ihres Mannes und beschwor ihn, sie gegenüber seinen Eltern in Schutz zu nehmen. Charles wollte ein Wort für sie einlegen. Das nahmen die Eltern übel; sie reisten ab.
Aber der Hieb hatte gesessen. Acht Tage später, beim Aufhängen von Wäsche in ihrem Hof, bekam sie einen Blutsturz, und am folgenden Tag, als Charles ihr den Rücken zukehrte, um den Fenstervorhang zuzuziehen, sagte sie: »Ach, mein Gott!«, stieß einen Seufzer aus und verlor das Bewusstsein. Sie war tot! Wie sonderbar!
Als auf dem Kirchhof alles vorüber war, ging Charles nach Hause. Unten war niemand; er ging hinauf in den ersten Stock in das Schlafzimmer und sah ihr Kleid noch immer am Fußende des Alkovens hängen; da lehnte er sich gegen das Schreibpult und verblieb dort bis zum Abend, in schmerzliche Grübelei versunken. Alles in allem hatte sie ihn doch geliebt.
III
Eines Morgens kam der alte Rouault und brachte Charles das Honorar für sein wiederhergestelltes Bein: fünfundsiebzig Francs in Vierzigsousstücken und eine Truthenne. Er hatte von seinem Unglück gehört und tröstete ihn, so gut er konnte.
»Ich weiß, wie einem da zumute ist!«, sagte er und klopfte ihm auf die Schulter; »auch mir ist es gegangen wie Ihnen! Als ich meine arme Selige verloren hatte, bin ich hinaus ins Freie gelaufen, um allein zu sein; am Fuß eines Baums bin ich niedergesunken, habe geweint, den lieben Gott angerufen und ihm Dummheiten gesagt; am liebsten wäre ich gewesen wie die Maulwürfe, die ich an den Ästen angenagelt hängen sah und denen schon die Würmer im Bauch wimmelten, mit anderen Worten: endlich verreckt. Und wenn ich daran dachte, dass in diesem Augenblick andere Männer mit ihren guten kleinen Frauen beisammen waren und sie an sich drückten, dann schlug ich mit meinem Stock wild auf die Erde; ich war gewissermaßen verrückt, ich aß nichts mehr; der Gedanke, allein ins Café zu gehen, ekelte mich an, Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr. Na, und so nach und nach, wie ein Tag den andern verjagte, einen Frühling lang nach einem Winter, einen Herbst nach einem Sommer, da ist es vorübergegangen, Halm für Halm, Krümchen für Krümchen; hingeschwunden ist es, weg war es, hinabgesunken, will ich lieber sagen, denn es bleibt tief in einem stets etwas sitzen, man könnte sagen … etwas, das einem auf die Brust drückt! Aber da das nun mal unser aller Schicksal ist, darf man sich nicht davon überwältigen lassen und sterben wollen, weil andere gestorben sind … Sie müssen sich aufrappeln, Monsieur Bovary; es wird schon vorübergehen! Besuchen Sie uns mal; meine Tochter denkt oft an Sie, müssen Sie wissen, und sie sagt immer, Sie hätten sie vergessen. Es wird nun bald Frühling; wir lassen Sie im Gehege ein Kaninchen schießen, damit Sie ein bisschen abgelenkt werden.«
Charles folgte seinem Rat. Er ritt wieder nach Les Bertaux; er fand dort alles so vor, wie es gestern gewesen war, das heißt, vor fünf Monaten. Schon standen die Birnbäume in Blüte, und der wackere Rouault, der jetzt völlig wiederhergestellt war, lief hin und her, und das machte den Pachthof lebendiger.
Der Meinung, es sei seine Pflicht, ihn mit besonderer Zuvorkommenheit zu umgeben, seiner schmerzlichen Lage wegen, bat er ihn, die Mütze aufzubehalten, sprach mit gedämpfter Stimme mit ihm, wie wenn er krank gewesen wäre, und tat sogar, als gerate er in Zorn, wenn für Charles nicht, wie er angeordnet hatte, etwas Leichtes aufgetischt worden war, vielleicht kleine Schüsseln mit Rahmspeise oder geschmorte Birnen. Er erzählte Geschichten. Zu seiner eigenen Verwunderung musste Charles lachen; allein die Erinnerung an seine Frau, die ihn plötzlich überkam, stimmte ihn düster. Der Kaffee wurde gebracht; er dachte nicht mehr an sie.
Er dachte um so weniger an sie, je mehr er sich an das Alleinleben gewöhnte. Das neue Behagen an der Unabhängigkeit machte ihm die Einsamkeit bald erträglicher. Jetzt konnte er die Stunde der Mahlzeit nach seinem Ermessen festsetzen, er konnte kommen und gehen, ohne die Gründe dafür anzugeben, und, wenn er mal sehr müde war, alle viere von sich strecken und sich in seinem Bett breitmachen. Er hegte und pflegte sich und ließ die Trostesworte, mit denen er bedacht wurde, über sich ergehen. Andererseits hatte der Tod seiner Frau keine ungünstige Wirkung auf seine Praxis gehabt; denn einen ganzen Monat lang hieß es wieder und wieder: »Der arme junge Mensch! Wie traurig!« Sein Name hatte sich herumgesprochen, sein Patientenkreis sich vergrößert; und ferner konnte er nach Les Bertaux reiten, wann es ihm beliebte. Er trug eine ziellose Hoffnung in sich, ein unbestimmtes Glücksgefühl; er fand sich sympathischer aussehend, wenn er vor dem Spiegel seinen Backenbart bürstete.
Eines Tages langte er gegen drei Uhr nachmittags an; alles war draußen auf den Feldern; er ging in die Küche, und zunächst bemerkte er Emma gar nicht; die Fensterläden waren geschlossen. Durch die Ritzen des Holzes warf die Sonne lange, dünne Streifen auf die Fliesen; sie brachen sich an den Kanten der Möbel und zitterten an der Zimmerdecke. Auf dem Tisch krabbelten Fliegen an den Gläsern herum, aus denen getrunken worden war, und summten, wenn sie in dem Ziderrest, der am Boden haftete, ertranken. Das durch den Kamin hereinfallende Tageslicht ließ den Ruß der Herdplatte wie Samt wirken und färbte die kalte Asche bläulich. Emma saß zwischen dem Fenster und dem Herd und nähte; sie trug kein Brusttuch, auf ihren nackten Schultern glänzten Schweißperlen.
Nach ländlichem Brauch bot sie ihm zu trinken an. Er dankte; sie nötigte ihn und bat ihn schließlich lachend, mit ihr zusammen ein Glas Likör zu trinken. Also holte sie aus dem Schrank eine Flasche Curaçao, suchte zwei Gläschen hervor, füllte das eine bis zum Rand, goss ganz wenig in das andere, und nachdem sie angestoßen hatten, führte sie es zum Munde. Da es fast leer war, musste sie sich beim Trinken zurückbeugen; den Kopf nach hinten geneigt, den Hals gestrafft, stand sie da und lachte, weil sie nichts spürte, während ihre Zungenspitze zwischen den feinen Zähnen hervorkam und in kleinen Stößen den Boden des Glases ableckte.
Sie setzte sich wieder und machte sich abermals an die Arbeit, die darin bestand, einen weißen Baumwollstrumpf zu stopfen: sie arbeitete mit gesenktem Kopf; sie sagte nichts, Charles schwieg ebenfalls. Der hinter der Tür hindurchstreichende Luftzug wirbelte auf den Fliesen ein wenig Staub auf; er sah zu, wie er wegwehte, und hörte dabei nichts als das Hämmern in seinem Kopf und dazu in der Ferne das Gackern eines Huhns, das irgendwo gelegt hatte. Von Zeit zu Zeit kühlte Emma ihre Backen, indem sie die Handfläche darauf presste; danach kühlte sie diese wieder auf den eisernen Knäufen der großen Feuerböcke.
Sie klagte über Schwindelanfälle, die sie seit Frühlingsanfang heimsuchten; sie fragte, ob Seebäder ihr guttun würden; sie fing an, von ihrem Klosteraufenthalt zu plaudern, Charles vom Gymnasium; die Sätze kamen ihnen ganz von selbst. Sie stiegen in ihr Zimmer hinauf. Sie zeigte ihm ihre alten Notenhefte, die kleinen Bücher, die sie als Preise in der Schule bekommen hatte, und die Kränze aus Eichenlaub, die vergessen in einem Schrankschubfach lagen. Auch von ihrer Mutter erzählte sie, vom Kirchhof, und sie zeigte ihm sogar im Garten das Beet, von dem sie jeden ersten Freitag im Monat Blumen pflückte, die sie dann auf das Grab legte. Aber der Gärtner, den sie hätten, tauge nichts; man werde so schlecht bedient! Am liebsten möchte sie in der Stadt wohnen, zumindest während des Winters, obwohl die langen schönen Tage das Landleben im Sommer noch langweiliger machten; – und je nachdem, was sie sagte, klang ihre Stimme hell, scharf oder, wenn sie plötzlich weich und sehnsüchtig wurde, schleppte sie sich in Modulationen hin, die fast in ein Flüstern einmündeten – bald war sie fröhlich und schlug naive Augen auf, dann schlossen sich ihre Lider zur Hälfte, ihr Blick ertrank in Langeweile, ihre Gedanken schweiften umher.
Abends auf dem Heimritt wiederholte Charles sich nacheinander die Sätze, die sie gesagt hatte; er versuchte, sich ihrer zu erinnern, ihren Sinn zu ergänzen, um sich den Teil ihres Daseins anzueignen, den sie durchlebt hatte, als er sie noch nicht kannte. Aber nie konnte er sie in seinen Gedanken anders erblicken als so, wie er sie zum erstenmal gesehen, oder so, wie er sie gerade eben beim Abschied vor sich gehabt hatte. Dann fragte er sich, was aus ihr werden würde, wenn sie heiratete, und wen? Ach, der alte Rouault war ziemlich reich, und sie … sie war so schön! Doch immer wieder sah er Emmas Gesicht vor sich, und etwas Monotones wie das Summen eines Kreisels surrte ihm im Ohr: »Wenn du dich nun aber verheiratetest! Wenn du dich verheiratetest!« Nachts fand er keinen Schlaf; die Kehle war ihm wie zugeschnürt; er hatte Durst; da stand er auf, um aus seiner Wasserkaraffe zu trinken, und öffnete das Fenster; der Himmel war voller Sterne, ein warmer Wind strich vorüber, in der Ferne bellten Hunde. Er wandte den Kopf in Richtung auf Les Bertaux.
Der Meinung, man riskiere dabei nicht Kopf und Kragen, gelobte sich Charles, seinen Heiratsantrag zu machen, wenn die Gelegenheit sich böte; doch jedesmal, wenn sie sich bot, verschloss ihm die Angst, nicht die passenden Worte zu finden, die Lippen.
Dabei wäre es dem alten Rouault ganz lieb gewesen, wenn jemand ihm die Tochter vom Hals geschafft hätte; sie war im Haus zu nichts nütze. Innerlich entschuldigte er sie; er fand, sie sei zu intelligent für die Landwirtschaft, dieses Gewerbe, das der Himmel verflucht hatte, weil man darin niemals Millionäre sah. Er selber war weit davon entfernt, es dabei zu Vermögen gebracht zu haben; der gute Mann setzte alle Jahre zu; denn wenn er auch auf den Märkten glänzte, wo er sich in den Kniffen und Pfiffen seines Gewerbes erging, war er für die Landwirtschaft im eigentlichen Sinn und für die Leitung des Pachthofs ganz und gar nicht geschaffen. Er zog ungern die Hände aus den Taschen und scheute keine Ausgabe, wenn sie ihm selbst von Nutzen war; er wollte gut essen und trinken, eine warme Stube haben und gut schlafen. Er hatte eine Schwäche für Zider, halb durchgebratene Hammelkeulen und gut umgerührten Kaffee mit Calvados. Seine Mahlzeiten nahm er ganz allein in der Küche ein, dem Feuer gegenüber, an einem Tischchen, das für ihn fertig gedeckt hereingetragen wurde, wie auf der Bühne.
Als er merkte, dass Charles, wenn die Tochter zugegen war, einen roten Kopf bekam, was bedeutete, dass er eines schönen Tages um ihre Hand gebeten werden könne, überlegte er die Sache schon im voraus. Er fand ihn zwar ein bisschen schwächlich; er war nicht der Schwiegersohn, den er sich gewünscht hätte; aber er war als ein anständiger, sparsamer, sehr gebildeter Mann bekannt und würde schwerlich allzu sehr um die Mitgift feilschen. Da nun aber der alte Rouault zweiundzwanzig Morgen seines eigenen Grunds und Bodens hatte verkaufen müssen, da er dem Maurer, dem Sattler viel Geld schuldete und die Spindel der Apfelpresse der Erneuerung bedurfte, sagte er sich:
»Wenn er um sie anhält, dann gebe ich sie ihm.«
Um den Michaelistag herum war Charles für drei Tage nach Les Bertaux gekommen. Der letzte Tag war verflossen wie die vorhergehenden, von Viertelstunde zu Viertelstunde hatte er es verschoben. Der alte Rouault begleitete ihn; sie gingen durch einen Hohlweg, sie mussten sich verabschieden; der Augenblick war gekommen. Charles gab sich noch Zeit bis zur Heckenecke, und endlich, als sie schon daran vorbeigegangen waren, murmelte er:
»Papa Rouault, ich würde Ihnen gern etwas sagen.«
Sie blieben stehen. Charles schwieg.
»Heraus mit der Sprache! Schließlich bin ich doch längst im Bilde«, sagte der alte Rouault und lachte gemütlich.
»Papa Rouault …, Papa Rouault …«, blubberte Charles.
»Ich selber wünsche mir nichts Besseres«, fuhr der Pächter fort. »Obwohl die Kleine sicherlich denken wird wie ich, muss sie um ihre Meinung gefragt werden. Also reiten Sie los; ich gehe zurück ins Haus. Wenn sie ja sagt, verstehen Sie mich recht, dann brauchen Sie nicht nochmal reinzukommen, der Leute wegen, und außerdem würde es sie allzu sehr mitnehmen. Aber damit Sie nicht lange Blut schwitzen, werde ich einen Fensterladen kräftig gegen die Hauswand klappen lassen: Sie können es von hier aus sehen, wenn Sie sich über die Hecke beugen.«
Und er ging davon.
Charles band sein Pferd an einen Baum. Er eilte auf den Fußpfad; er wartete. Eine halbe Stunde verstrich; dann zählte er auf seiner Taschenuhr neunzehn Minuten nach. Plötzlich gab es einen Bums gegen die Hauswand; der Fensterladen war dagegengeschlagen, der Riegel wackelte noch.
Am andern Morgen um neun war er bereits wieder auf dem Pachthof. Emma wurde rot, als er hereinkam; dabei zwang sie sich, ein wenig zu lachen, um Haltung zu bewahren. Der alte Rouault schloss seinen künftigen Schwiegersohn in die Arme. Die geschäftlichen Dinge wurden auf später verschoben; zudem hatte man Zeit, da die Heirat anstandshalber nicht vor Ablauf von Charles’ Trauerjahr stattfinden konnte, das hieß also, zu Beginn des nächsten Frühlings.
Über diese Wartezeit ging der Winter hin. Mademoiselle Rouault beschäftigte sich mit ihrer Aussteuer. Ein Teil davon wurde in Rouen bestellt; Hemden und Nachthauben nähte sie selber nach geliehenen Schnittmustern. Bei Charles’ Besuchen auf dem Pachthof wurde von den Vorbereitungen zur Hochzeit gesprochen; sie überlegten, in welchem Raum das Essen stattfinden sollte; sie erwogen die erforderliche Zahl der Gänge und die Vorspeisen.
Emma wäre es das liebste gewesen, wenn die Trauung um Mitternacht bei Fackelschein stattgefunden hätte; aber für diesen Einfall hatte der alte Rouault kein Verständnis. Es sollte also ein Hochzeitsfest mit dreiundvierzig Gästen geben; sechzehn Stunden sollte bei Tisch gesessen werden; am andern Tag sollte es von vorn losgehen, und an den folgenden Tagen so ähnlich.
IV
Die Hochzeitsgäste stellten sich beizeiten ein, in Kutschen, Einspännern, leichten zweirädrigen Wagen mit Bänken, alten Kabrioletts ohne Verdeck, Kremsern mit Ledervorhängen, und das junge Volk aus den nächstgelegenen Nachbardörfern kam in Leiterwagen angefahren, in einer Reihe stehend, die Hände an den Seitenstangen, um nicht zu fallen; sie fuhren im Trab und wurden tüchtig durchgeschüttelt. Manche kamen zehn Meilen weit her, aus Goderville, Normanville und Cany. Sämtliche Verwandten der beiden Familien waren eingeladen worden; man hatte sich mit Freunden ausgesöhnt, mit denen man uneins gewesen war; es war an Bekannte geschrieben worden, die man seit langem aus den Augen verloren hatte.
Von Zeit zu Zeit wurde hinter der Hecke Peitschenknall laut; bald darauf öffnete sich das Hoftor: eine Halbkutsche fuhr herein. Im Galopp ging es bis zur ersten Stufe der Freitreppe, dort hielt sie mit einem Ruck, und die Insassen stiegen nach beiden Seiten aus, rieben sich die Knie und reckten die Arme. Die Damen, Hauben auf dem Kopf, trugen städtische Kleider, goldene Uhrketten, Umhänge mit langen Enden, die sie kreuzweise in den Gürtel geschoben, oder kleine, bunte Busentücher, die sie am Rücken mit einer Nadel festgesteckt hatten und die ihren Hals hinten frei ließen. Die Knaben waren genauso angezogen wie ihre Väter; sie fühlten sich in ihren neuen Anzügen recht unbehaglich (viele trugen sogar an diesem Tag zum erstenmal in ihrem Leben Stiefel), und neben ihnen waren vierzehn- bis sechzehnjährige Mädchen zu sehen, offenbar ihre Kusinen oder älteren Schwestern, in weißen Kommunionskleidern, die zur Feier des Tages verlängert worden waren; alle hatten rote, verlegene Gesichter, fettiges, pomadisiertes Haar, und alle waren voller Angst, sich die Handschuhe zu beschmutzen. Da nicht Knechte genug da waren, um alle ankommenden Wagen abzuspannen, streiften die Herren die Rockärmel hoch und machten sich eigenhändig daran. Je nach ihrem gesellschaftlichen Rang waren sie im Frack, im Gehrock oder im Jackett erschienen; – guten Kleidungsstücken, aus denen die ganze Würde einer Familie sprach und die nur bei feierlichen Gelegenheiten aus dem Schrank geholt wurden; Bratenröcke mit langen, im Wind flatternden Schößen, mit zylindrischen Kragen und sackweiten Taschen; Jacken aus derbem Tuch, meist im Verein mit Mützen, deren Schirm einen Messingrand hatte; ganz kurze Röcke mit zwei dicht nebeneinander sitzenden Knöpfen auf dem Rücken, die wie zwei Augen aussahen; ihre Schöße schienen vom Zimmermann mit der Axt aus einem Block herausgehauen worden zu sein. Einige (aber diese mussten ganz sicher am untersten Ende der Festtafel sitzen) trugen Sonntagsblusen, also solche, deren Hemdkragen über die Schultern zurückgeschlagen ist, die am Rücken kleine Falten haben und deren Taille sehr tief durch einen genähten Gürtel gehalten wird.
Und die steifen Hemden wölbten sich über der Brust wie Kürasse! Alle hatten sich das Haar schneiden lassen; die Ohren standen von den Schädeln ab; alle waren glatt rasiert; manche sogar, die schon vor dem Morgengrauen aufgestanden waren, hatten nicht genug Licht zum Bartschaben gehabt; sie hatten diagonale Schmisse unter der Nase, oder längs des Kinns Hautfetzen, die groß wie Drei-Francs-Taler waren; die frische Morgenluft hatte sie während der Fahrt entzündet, und deshalb waren diese hellen, blühenden Gesichter ein bisschen durch rosa Flecken marmoriert.
Da das Bürgermeisteramt eine halbe Stunde vom Pachthof entfernt lag, ging man zu Fuß dorthin, und ebenso kehrte man nach beendeter Zeremonie in der Kirche heim. Der Hochzeitszug war anfangs gut geordnet gewesen, ein einziges, buntes Band, das sich durch die Landschaft wand, den schmalen Fußpfad entlang, der sich zwischen den grünen Kornfeldern hinschlängelte; doch bald teilte er sich in mehrere Gruppen, die langsamer gingen, um plaudern zu können. Allen voran schritt der Dorfmusikant mit seiner an der Schnecke mit Bändern geschmückten Geige; dann folgten das Brautpaar, die Eltern und Verwandten, die Freunde, wie es gerade kam, und die Kinder blieben ganz hinten; sie vergnügten sich damit, die Glöckchen der Haferrispen abzureißen oder sich untereinander zu kabbeln, wenn keiner hinsah. Emmas Kleid war zu lang und schleppte ein bisschen; dann und wann blieb sie stehen und raffte es, und dabei las sie behutsam mit ihren behandschuhten Fingern die harten Gräser und die kleinen, stacheligen Distelspießchen ab, während Charles untätig wartete, bis sie damit fertig war. Der alte Rouault trug einen neuen Seidenzylinder, und die Ärmel seines schwarzen Fracks bedeckten seine Hände bis zu den Fingernägeln; er hatte der Mutter Bovary den Arm gereicht. Was nun den Vater Bovary betrifft, der diese ganze Sippschaft tief verachtete, so war er einfach in einem einreihigen Gehrock von militärischem Schnitt gekommen; er traktierte eine junge, blonde Bäuerin mit Kantinen-Galanterien. Sie hörte respektvoll zu, errötete und wusste nicht, was sie antworten sollte. Die übrigen Hochzeitsgäste sprachen von ihren Geschäften oder ulkten einander an, um schon im Voraus in heitere Stimmung zu geraten; und wer hinhorchte, hörte in einem fort das Gefiedel des Dorfmusikanten, der auch auf freiem Feld weitergeigte. Wenn er merkte, dass der Zug weit hinter ihm zurückgeblieben war, blieb er stehen, schöpfte Atem, rieb umständlich seinen Bogen mit Kolophonium ein, damit die Saiten noch besser kratzten, und dann setzte er sich wieder in Marsch, wobei er den Hals seiner Violine abwechselnd senkte und hob, um sich selbst den Takt anzugeben. Das Gequietsch des Instruments verscheuchte die kleinen Vögel schon von weitem.
Die Festtafel war im Wagenschuppen aufgestellt worden. Es prangten darauf vier Lendenbraten, sechs Hühnerfrikassees, geschmortes Kalbfleisch, drei Hammelkeulen und in der Mitte, umlegt mit vier Sauerampferwürsten, ein hübsches, geröstetes Spanferkel. An den Tischenden stand in Karaffen der Schnaps. Der Zider schäumte aus den Flaschenhälsen, und alle Gläser waren schon im voraus bis an den Rand mit Wein gefüllt. Große Schüsseln mit gelber Cremespeise, die beim leisesten Stoß gegen den Tisch ins Wabbeln geriet, trugen auf ihrer glatten Oberfläche die von kleinen Schnörkeln umrahmten Monogramme des jungen Paars. Für die Torten und das Nougat hatte man eigens einen Konditor aus Yvetot kommen lassen. Da er sich in dieser Gegend zum erstenmal betätigte, hatte er sich besondere Mühe gegeben; beim Nachtisch trug er eigenhändig ein Prunkstück auf, das Ausrufe der Bewunderung auslöste. Auf einem quadratischen Unterbau aus blauer Pappe, darstellend einen Tempel mit Portikus, Säulengängen und ringsherum Gipsfigürchen in mit Sternbildern aus Goldpapier beklebten Nischen erhob sich als zweites Stockwerk ein Burgturm aus Pfefferkuchen, umgeben von winzigen Befestigungswerken aus Engelwurzbonbons, Mandeln, Rosinen und kandierten Orangenschnitten; und schließlich, auf der obersten Plattform, die aus einer grünen Wiese bestand, auf der es Felsgruppen mit Zuckerteichen und Booten aus Haselnussschalen gab, war ganz oben ein kleiner Amor zu sehen, der sich in einer Schokoladenschaukel wiegte; oben auf den Pfeilern steckten, statt der Kugeln, zwei natürliche Rosenknospen.
Gegessen wurde bis zum Abend. Wer vom Sitzen zu müde war, ging im Hof umher oder machte eine Partie Pfropfenspiel in der Scheune und setzte sich dann wieder zu Tisch. Einige nickten gegen Ende der Mahlzeit ein. Aber beim Kaffee wurde alles wieder munter; jetzt wurden Lieder angestimmt, Kraftübungen gemacht, Gewichte gestemmt, Purzelbäume geschossen, es wurde versucht, Karrenwagen mit den Schultern hochzuheben; saftige Witze wurden erzählt und die Damen abgeknutscht. Abends beim Aufbruch war es nicht leicht, die Pferde, denen der vertilgte Hafer bis an die Nüstern stand, in die Deichselgabeln zu bringen; sie bockten und schlugen aus; Riemen rissen; ihre Herren fluchten oder lachten, und die ganze Nacht hindurch ratterten auf den vom Mondschein erhellten Landstraßen in vollem Galopp heimrollende Fuhrwerke, sprangen über die Abzugsrinnen, hüpften über Steine, streiften die Böschungen, und die ängstlichen Frauen beugten sich über den Wagenschlag, um die Zügel zu fassen.
Die in Les Bertaux Verbleibenden zechten die Nacht hindurch in der Küche weiter. Die Kinder waren unter den Bänken eingeschlafen.
Die Braut hatte ihren Vater inständig gebeten, dass sie von den üblichen Späßen verschont bleibe. Aber einer der Vettern, ein Fischhändler (der als Hochzeitsgeschenk zwei Seezungen mitgebracht hatte), war drauf und dran, mit dem Mund Wasser durchs Schlüsselloch zu spritzen, als der alte Rouault gerade noch rechtzeitig dazu kam, um ihn daran zu hindern; er machte ihm klar, dass dergleichen Ungehörigkeiten sich nicht mit der Würde seines Schwiegersohns vertrügen. Der Vetter gab jedoch diesen Gründen nur widerwillig nach. Insgeheim hielt er den alten Rouault für aufgeblasen, und er ging weg und setzte sich in eine Ecke zu vier oder fünf andern Gästen, die während des Essens zufällig mehrmals hintereinander bei den Fleischspeisen Missgriffe getan hatten; sie meinten, sie seien schlecht bewirtet worden, tuschelten auf Kosten ihres Gastgebers und wünschten ihm andeutungsweise den Ruin.
Die Mutter Bovary hatte während des ganzen Tages den Mund nicht aufgetan. Sie war weder was die Toilette ihrer Schwiegertochter noch was die Speisenfolge des Festmahls betraf um Rat gefragt worden; sie zog sich beizeiten zurück. Anstatt ihr zu folgen, ließ ihr Mann sich aus Saint-Victor Zigarren holen, rauchte bis zum Tagesanbruch und trank Grog aus Kirschwasser, ein für die Dabeisitzenden unbekanntes Gemisch, das für ihn zur Quelle einer noch höheren Achtung wurde.
Charles war von Natur alles andere als witzig; er hatte während des Hochzeitsessens nicht geglänzt. Gegenüber den Späßen, Kalauern, Zweideutigkeiten, Komplimenten und Possen, mit denen ihn zu überschütten man sich von der Suppe an zur Pflicht gemacht hatte, war er die rechte Antwort schuldig geblieben.
Am nächsten Morgen indessen mutete er an wie ein völlig anderer Mensch. Er und nicht Emma war am Vortage sozusagen die Jungfrau gewesen, wogegen die Braut sich nichts anmerken ließ, aus dem man etwas hätte ersehen können. Den ärgsten Schandmäulern verschlug es die Sprache; sie musterten sie,