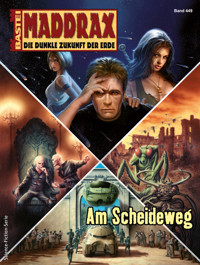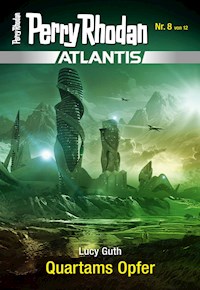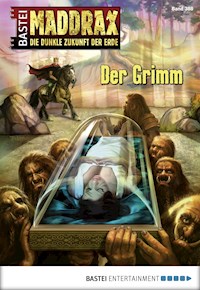
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Maddrax
- Sprache: Deutsch
Die Tür flog auf und ein Fremder stürzte herein. Die Köpfe der Dörfler ruckten herum. Der Mann sah panisch über seine Schulter und warf die Tür wieder zu, legte den schweren hölzernen Riegel vor. "Hey Mann, was soll'n das?", fragte Chenloo, ein grobschlächtiger Bauer, der Fremde nicht mochte. Der Mann beachtete ihn nicht, sondern wich von der Tür zurück und rang nach Atem.
Chenloo stand auf und legte ihm schwer eine Hand auf die Schulter. Der Fremde fuhr herum. Schreckgeweitete Augen starrten Chenloo unter der Kapuze des Reisemantels hervor an. Der Mann stammelte: "Um euer Dorf schleicht ein schrecklicher Fish'manta'kan! Ich habe ihn gesehen! Er ... er hat ein kleines Mädchen gefressen!"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Hilfreiche Links
Was bisher geschah
Der Grimm
Leserseite
Autorenartikel von Lucy Guth
Cartoon
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Lektorat: Michael Schönenbröcher
Titelbild: Néstor Taylor/Bassols
Autor: Lucy Guth
E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-0557-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Hilfreiche Links zu diesem Roman:
Serie
Covermaler/in
Autor/in
Am 8. Februar 2012 trifft der Komet „Christopher-Floyd“ die Erde – in Wahrheit eine Arche Außerirdischer, der Daa’muren. Die Erdachse verschiebt sich und ein Leichentuch aus Staub legt sich für Jahrhunderte um den Planeten. Nach der Eiszeit bevölkern Mutationen die Länder und die Menschheit ist – bis auf die Bunkerbewohner – degeneriert. In dieses Szenario verschlägt es den Piloten Matthew Drax, dessen Staffel beim Einschlag durch ein Zeitphänomen ins Jahr 2516 gerät. Nach dem Absturz wird er von Barbaren gerettet, die ihn „Maddrax“ nennen. Zusammen mit der telepathisch begabten Kriegerin Aruula erkundet er diese für ihn so fremde Erde.
In einem „zeitlosen Raum“, der Schnittstelle vieler Paralleluniversen, kollabiert ein Tor und schleudert gefährliche Artefakte in unsere Welt. Mit einem Scanner spürt Matt die ersten davon auf und macht sie unschädlich. Doch dann verlieren er und Aruula nach einer Reise durch den Zeitstrahl ganze 16 Jahre – und treffen auf Robot-Nachbildungen historischer Führer, die „Schwarze Philosophen“ (SP) als Statthalter einsetzen. In Glasgow rettet eine junge Frau Matts Leben. Er weiß nicht, dass Xaana seine Tochter aus der Zukunft ist, mit der seine im zeitlosen Raum verschollene Ex-Freundin Xij schwanger war.
In Schottland wurde die Burg ihres Freundes Rulfan zerstört! Die SP wollen die Artefakte im Hort des Wissens rauben. Rulfan vernichtet alle und sein Sohn Juefaan schließt sich Matt und Aruula an. Er besitzt einen wandelbaren Symbionten, der sich von Blut ernährt. In der Schweiz werden sie Zeuge, wie sich im CERN-Forschungszentrum ein Wurmloch öffnet. Während Xaana zum neuen Hort des Wissens reist, treffen sie in Marseille erstmals auf die SP und erfahren von einem weiteren Statthalter, der Washington übernehmen soll: die Robot-Version von Professor Dr. Smythe, Matts totem Erzfeind! Matt und Aruula brechen nach Meeraka auf, während Juefaan die Basis des Feindes in Tibet aufspüren will.
In Waashton plant Smythe die Übernahme. Matt und Aruula stoßen zu den Rebellen, um seinen Plan zu vereiteln und General Crow zu stürzen. Es kommt zur Schlacht, bei der auch Jacob Smythe, der mit seinem Hass auf Matt die Programmierung der SP überwindet, mitmischt. Am Ende ist Crow tot und von Smythe und Matt fehlt jede Spur. Letzteren findet Aruula nach sechs Tagen an Bord eines Trawlers. Was mit ihm passiert ist, weiß Matt nicht. Sie suchen nach weiteren Artefakten und finden einen Strahler, der Menschen zu Berserkern macht, aber verloren geht.
In Nepal stößt Juefaan auf das fliegende Kloster der SP, wird von ihnen entdeckt und gefangen genommen. Und nicht nur das – ihnen fällt der Meng-âmok in die Hände, die Berserker-Waffe!
Derweil holt Jacob Smythe Matt und Aruula ein und greift sie an. Dabei wird Matt vom Blitz eines hydritischen Schockstabs getroffen, was dramatische Folgen hat: Etwas in seinem Nacken brennt durch und schädigt sein Gehirn. Er sucht Hilfe bei den SP und erfährt eine erschreckende Wahrheit: Er ist ein Klon, der im Auftrag der Feinde handelte – und dem Tod geweiht! Als letzte Tat verhilft er seinem Original und Aruula zur Flucht. Sie wollen nun auf schnellstem Weg zu Juefaan gelangen. Ihr Weg führt sie über die vereiste Landbrücke nach Asien und durch Japan in Richtung Tibet …
Der Grimm
von Lucy Guth
Mai 2542, an der Küste Cinnas
Die Tür flog auf und ein Fremder stürzte herein. Die Köpfe der Dörfler ruckten herum. Der Mann sah panisch über seine Schulter und warf die Tür wieder zu, legte den schweren hölzernen Riegel vor.
„Hey Mann, was soll ’n das?“, fragte Chenloo, ein grobschlächtiger Bauer, der Fremde nicht mochte. Der Mann beachtete ihn nicht, sondern wich von der Tür zurück und rang nach Atem. Chenloo stand auf und legte ihm schwer eine Hand auf die Schulter.
Der Fremde fuhr herum. Schreckgeweitete Augen starrten Chenloo unter der Kapuze des Reisemantels hervor an. Der Mann stammelte: „Um euer Dorf schleicht ein schrecklicher Fish’manta’kan! Ich habe ihn gesehen! Er … er hat ein kleines Mädchen gefressen!“
Für einige Sekunden herrschte atemlose Stille. Dann begannen die Bauern, wild durcheinanderzureden. In dem Raum waren alle Männer des Dorfes versammelt – ein Dutzend Erwachsene und noch einmal so viel Halbwüchsige. Sie waren müde und frustriert in die einzige Schänke des Dorfes gekommen, um etwas Ablenkung im billigen Schnaps und dem dünnen Biir zu suchen, das hier ausgeschenkt wurde.
Der Fremde, der bebend und bleich wie der Tod neben Chenloo stand, versprach nun eine ganz andere Art von Ablenkung.
„Schnauze!“, brüllte Chenloo. Augenblicklich verstummten die Dörfler. Chenloo war nicht der Beliebteste, aber dafür der Stärkste unter ihnen. Kaum einer wagte ihm je zu widersprechen.
Der kräftige Cinnese hatte noch immer die Hand auf der Schulter des Fremden liegen. Jetzt schob er den Zitternden durch den Dunst aus Schweiß und Qualm zu einem der wackligen Tische. „Los, erzähl. Was soll das heißen, ein Fish’manta’kan wäre hier?“
„Es ist Jahre her, dass man zuletzt welche gesehen hat“, platzte ein anderer Dörfler heraus, ehe der Fremde antworten konnte. Die Männer waren nervös. Die meisten von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt als Fischer. Ihr Tagewerk war schwer und in den vergangenen Monden umso schwerer geworden. Nicht nur, dass die in dieser Jahreszeit typischen Stürme gegen die Küste peitschten, auch auf die Gezeiten war kein Verlass mehr. Das Meer kam und ging, wie es wollte. Manchmal überspülte es ihr Land. Wenn nun auch noch schreckliche Fish’manta’kan ihr Unwesen trieben, bedeutete das noch mehr Gefahr.1)
Der Fremde atmete tief durch und schlug seine Kapuze zurück. Er war kein junger Mann mehr, aber auch noch nicht alt. Keiner im Raum hatte ihn je zuvor gesehen. Er griff in seinen Beutel und nestelte einen Weinschlauch hervor, den er auf den Tisch warf. „Ich gebe eine Runde Wein aus! Auf den Schrecken brauche ich etwas zu trinken.“
Die Dörfler murmelten erfreut und hielten ihm ihre Becher entgegen. Der Wirt sah weniger begeistert aus, war aber offensichtlich selbst gespannt – sowohl auf die Geschichte des Fremden als auch auf den Wein.
Der Fremde schenkte ein und setzte sich dann, immer noch zitternd. „Ich bin auf dem Weg nach Waancun zur Familie meiner Schwester. Ich kenne mich in der Gegend nicht aus und musste auf der Küstenstraße östlich von hier vom Weg abweichen – dort ist die Straße unterspült worden und ein Stück Felsen ist ins Meer gestürzt. Also ging ich … in den Wald.“ Der Fremde schauderte.
Die Dörfler tranken schweigend und starrten ihn an. Der Fremde schluckte und fragte mit heiserer Stimme: „Kennt ihr die Stelle, an der ein verkrüppelter Baum auf einem roten Felsen wächst?“
Die Männer nickten unisono. „Das ist nicht weit von unserem Dorf“, sagte Chenloo.
Der Fremde fuhr sich mit zitternden Fingern über die Augen. „Ich kam dort vorbei, irrte mich aber in der Richtung und ging tiefer in den Wald hinein – dort, wo ein kleiner Bachlauf fließt. Und dann … kam ich an eine Lichtung … und da sah ich ihn.“
In der Schänke war es jetzt totenstill. Alle hingen an den Lippen des Fremden, der im flackernden Licht der Kerzen wie ein Kuuuei-Dämon wirkte. „Es war einer der schrecklichen Fischmenschen“, sagte er mit zitternder Stimme. „Er hockte mitten auf der Lichtung und … und er fraß …“ Der Fremde stöhnte gequält. „Ich … glaube, es war ein kleines Mädchen.“
Die Dörfler reagierten unterschiedlich – einige mit entsetzten Rufen, andere mit schockiertem Schweigen. Ein verhärmt wirkender Mann mit dunklen Ringen unter den Augen drängte sich dicht an den Fremden und fragte heiser: „Das Mädchen … trug es ein blaues Kleid?“
Die anderen Fischer hielten den Atem an. Der Mann hatte vor wenigen Stunden seine Tochter verloren. Sie hatte am Strand gespielt und war nach einer unerwarteten Flut nicht mehr auffindbar gewesen. Ein Opfer des Meeres, hatte man im Dorf gedacht.
Der Fremde zögerte erstaunt, blickte dem Mann in die Augen. Dann sagte er leise: „Ja, ich glaube, es war blau.“
Der Mann schluchzte auf. Zwei seiner Nachbarn stützten ihn und boten ihm noch mehr Wein an. Chenloo klopfte ihm auf die Schulter und knurrte: „Wir werden ihren Tod rächen.“
„Wie meinst ’n das?“, fragte ein Dörfler.
Ein anderer wies auf die Tür und fragte fast panisch: „Willste da rausgehen und dich von den Monstern fressen lassen?“
„Wir sin’ nur einfache Fischer, keine Kämpfer“, jammerte ein Dritter.
„Ich kann euch gut verstehen“, sagte der Fremde. „Auch ich hatte Angst und habe mich so schnell wie möglich davon gemacht.“ Er blickte sich um, als fiele ihm erst jetzt etwas auf. „Andererseits seid ihr viele und dieses Fischmonster ist allein. Und ihr wisst, wo ihr es heute Nacht findet.“ Er senkte beschwörend die Stimme. „Wenn ihr bis morgen wartet, ist der Fish’manta’kan wahrscheinlich verschwunden.“
„Er hat recht“, meldete sich der Vater des verschwundenen Mädchens zu Wort. „Wir können ihn nich’ einfach abhauen lassen.“
Die Dörfler tuschelten, unschlüssig. Der Fremde stand auf. Seine Stimme erhielt einen unheilvollen Klang, als er sagte: „Wenn ihr diese Chance nicht nutzt und das Monster nicht tötet, holt es sich vielleicht schon morgen das nächste Kind aus dem Dorf.“
Eine Stunde später bewegte sich ein Zug von Menschen auf der Küstenstraße Richtung Osten. Chenloo ging entschlossen voran, die rechte Hand um einen Knüppel und die linke um eine Sturmlaterne verkrampft. Die Dörfler hatten sich mit dem bewaffnet, was ihnen zur Verfügung stand – vor allem mit Fackeln.
Der Fremde hatte viel über die Fish’manta’kan gewusst und ihnen geraten, dem Monster den Weg zum Meer abzuschneiden.
„Gibt es eine Möglichkeit, es in die Enge zu treiben?“, hatte er gefragt. Chenloo hatte genickt und ihm von dem kleinen Talkessel erzählt. Der Fremde hatte ein feines Lächeln gezeigt: „Perfekt!“
Ein bisschen ärgerte sich Chenloo, dass der Fremde es vorgezogen hatte, im Dorf zu bleiben. Gewundert hatte es ihn eigentlich nicht. Er kannte Typen wie diesen – eine große Klappe und alles besser wissen als die anderen, aber im Ernstfall den Schwanz einziehen. Erbärmlich. Aber sie brauchten ihn nicht. Dank seiner Beschreibung wussten sie ganz genau, wo sie das Monster finden würden.
Fra’nuk rannte um sein Leben. Der Hydrit hätte nie gedacht, dass er außerhalb des Meeres in der Lage sein würde, sich so schnell zu bewegen. Es ist schon erstaunlich, was Todesangst bewirken kann, dachte er mit der analytischen Schärfe des Wissenschaftlers.
Äste und Zweige peitschten Fra’nuk ins Gesicht wie die Tentakel einer Qualle, während er versuchte, den Abstand zwischen sich und seinen Verfolgern zu vergrößern. Er begriff nicht, wie sie ihn gefunden hatten – und warum sie so wütend waren. Er war sicher, dass ihn niemand aus dem Dorf gesehen hatte, seitdem er vor zwei Tagen an Land gegangen war. Der getarnte Forschungsposten, von dem aus man das Dorf im Blick hatte, war schon vor Jahren eingerichtet worden. Niemals war ein Mensch darauf gestoßen.
Doch heute Abend waren sie aufgetaucht, lärmend und nach Zorn stinkend. Natürlich hatte er sofort zurück zum Meer flüchten wollen, doch der Weg dorthin war Fra’nuk versperrt – von unheilvoll geballten Fäusten und reichlich Mistgabeln. Im Wald suchte er nun nach einem anderen Weg zur Küste. Doch zu seinem eigenen Verdruss musste er sich eingestehen, sich nie großartig für das Umland interessiert zu haben.
Die Felswand ragte so plötzlich vor Fra’nuk auf, dass er fast dagegen gerannt wäre. Keuchend stützte sich der Hydrit an dem glatten Gestein ab. Die Luft brannte in seinen Lungen, und nie zuvor hatte er sich so sehr danach gesehnt, kühles Wasser durch die Kiemen zu saugen.
Fra’nuk erkannte, dass er in der Falle saß. Er drehte sich um und presste seinen Rücken gegen den kühlen Felsen, starrte in den dunklen Wald. Was hatten die Menschen vor? Wann würde der Erste von ihnen hier auftauchen? Würden sie überhaupt versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen?
Ein seltsamer Laut drang an Fra’nuks Ohröffnungen: ein leises Knacken und Zischen. In seiner Welt gab es diesen Laut nicht, obwohl die Sprache der Hydriten fast nur aus Knack- und Zischlauten bestand. Erst als er es roch, stellte er alarmiert seinen Flossenkamm auf. Feuer! Sie hatten Feuer gelegt! Dann sah er auch den rötlichen Schein zwischen den Bäumen.
Fra’nuk wusste, dass dies sein Todesurteil war. Die Hitze würde ihn bereits umgebracht haben, ehe ihn die Flammen erreichten.
Da traf etwas Schweres Fra’nuks Schulter. Ein Seil baumelte plötzlich dicht an seiner Seite! Der Hydrit zuckte erschreckt zusammen und starrte das Tau an. Ehe er reagieren konnte, hörte er von oben eine leise Stimme in der Sprache der Wandernden Völker rufen: „Schnell, herauf zu mir!“
Das ließ sich Fra’nuk nicht zweimal sagen. Er packte das Seil, mobilisierte seine letzten Kräfte und zog sich nach oben.
Das Seil fühlte sich seltsam an. Nicht wie dieses Kunststoff-Zeug, das die Menschen über die Jahrhunderte ihres Niedergangs hinweg bewahrt hatten. Fra’nuk schnupperte unwillkürlich und tastete, während er sich immer weiter in die Höhe zog. Das Seil roch nach Mensch. Das Material war faserig. Plötzlich erkannte Fra’nuk, dass es aus Menschenhaar bestand!
Viel Zeit, um diesen schaurigen Umstand zu hinterfragen, blieb ihm nicht. Er erreichte den Rand der Felswand, wo sich ihm eine hilfreiche Hand entgegen streckte. Fra’nuk ergriff sie dankbar und ließ sich nach oben ziehen. Dort brach er entkräftet und dehydriert zusammen.
Er kam wieder zu sich, weil jemand ihm eine Flasche mit einer Flüssigkeit an den Mund hielt. „Trink, lieber Freund, dann geht es dir schnell besser“, hörte er dieselbe Stimme wie kurz zuvor. Ein Mensch, ein Cinnese, rückte in sein Gesichtsfeld. Er war es, der die Flasche hielt.
„Danke!“, keuchte Fra’nuk. Der Fremde im Kapuzenmantel nickte und streckte ihm erneut auffordernd die Hände entgegen. „Wenn du leben willst, komm mit mir.“
Dezember 2540
Ein scharfkantiger Stein flog haarscharf an ihrem Kopf vorbei. „Verschwinde, du Monster!“, brüllte der kleine Junge.
Maao reagierte nicht darauf. Auch nicht, als die anderen Kinder zu lachen und zu spotten begannen. Hoch erhobenen Hauptes schritt sie weiter die staubige Straße entlang, den Weidenkorb mit den noch blutigen Tierhäuten fest in den Händen, die Ohren angelegt, den Schwanz anmutig zu einem Bogen geformt.
Weitere Steine pfiffen ihr um die Ohren. Maao sah einige Erwachsene am Straßenrand stehen. Sie verfolgten das Schauspiel. Keiner griff ein.
Plötzlich durchschoss ein heftiger Schmerz Maaos linkes Handgelenk, und mit einem Fauchen ließ sie den Korb fallen. Einer der Steine hatte getroffen. Erschrecktes Schweigen umhüllte Maao wie eine stinkende Wolke. Alle Aufmerksamkeit war auf sie gerichtet.
Maao stand steif da. Ihr Handgelenk pochte. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass einer der Männer seine Hand auf den Griff des Messers senkte, das er im Gürtel stecken hatte. Sie atmete tief ein. Dann bückte sie sich gemächlich, sammelte die in den Straßendreck gefallenen Häute ein und legte sie in den Korb zurück. Langsam stand sie auf und setzte ihren Weg fort. Die Stille begleitete sie.
Erst als das Dorf hinter ihr lag, entkrampften sich Maaos Hände, die den Korb hielten. Sie erlaubte sich, stehen zu bleiben, den Korb abzustellen und ihr Handgelenk zu massieren. Es blutete nicht, würde aber sicherlich bald anschwellen. Wenn sie Pech hatte, würde sie die Hand die nächsten paar Tage nur unter Schmerzen gebrauchen können. Maao zuckte wütend mit dem Schwanz. Und das ausgerechnet jetzt, wo sie so viele Tierhäute zum Bearbeiten bekommen hatte.
Nicht, dass sie ihr Handwerk gerne tat. Es war das Einzige, das man sie überhaupt tun ließ, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Schon ihre Mutter war die Gerberin des Dorfes gewesen. Maao nahm den Korb auf und stieß ein leises, wütendes Fauchen aus, als sie ihren Weg fortsetzte.
Ihre Mutter. Mit ihr hatte das Unglück angefangen. Schon tausend Mal hatte Maao verflucht, dass die unglückselige Kreatur sie überhaupt zur Welt gebracht hatte. Ihre Mutter, hieß es im Dorf, war einst nach dem großen Sterben vom Kratersee hergekommen – eins jener seltsamen Wesen, die damals auftauchten, halb Mensch, halb Tier. Ihre Mutter hatte viel von einer Frau, aber auch viel von einer wilden Kazze gehabt. Die Dörfler hatten sie geduldet, weil sie sich geschickt beim Gerben anstellte.
Die Frauen hatten sie gehasst, die Männer gefürchtet. Allerdings nicht so sehr, um nicht eines Nachts im Biir-Rausch über sie herzufallen. So war Maao gezeugt worden – mehr Cinnesin als Kazze, aber nicht genug.
Ihrer Mutter hatte man die Zunge herausgeschnitten – zur Strafe, damit sie nie wieder einen Mann verführen sollte. So hatte Maao niemals mehr über ihre Geschichte erfahren – nur das, was die alte Krämerin, die ihr die Felle abnahm, manchmal erzählte.
Außer diesen wenigen Worten hatte ihr Leben aus Schweigen bestanden – Schweigen im Dorf, wenn sie Felle gegen Waren eintauschten und neue Häute holten, und Schweigen in ihrer kargen Hütte am Rand des Steppengrases. Aber wenigstens ließen die Männer sie in Ruhe. Noch.
Vor wenigen Wochen war Maaos Mutter gestorben. Sie fragte sich, wie lange sie ihre Zunge wohl noch behalten durfte.
Schon von weitem sah Maao, dass ein Fremder vor ihrer Hütte saß. Sofort war die Anspannung wieder da. Doch der Mann machte einen harmlosen Eindruck. Er saß in seinem Kapuzenmantel einfach auf dem wackligen alten Hocker und sah ihr entgegen.
Maao näherte sich schweigend. Wahrscheinlich ein Händler, der Felle von ihr kaufen wollte. Das kam vor. Ihre Arbeit war gut.
Der Fremde grüßte sie mit einem freundlichen Nicken. Maao neigte ebenfalls den Kopf und stellte ihren Korb ab. Nervös verlagerte sie ihr Gewicht von einem Bein auf das andere. Sie mochte keine Fremden in ihrer Hütte. Fremde bedeuteten meistens Ärger.
Der Mann lächelte. „Keine Angst, Maao. Ich möchte nur mit dir reden“, sagte er.
Maao deutete erstaunt auf ihre Brust und fragte: „Maao?“ Der Fremde lächelte weiter und zog einen Weinschlauch aus seinem Mantel hervor. „Ich habe deinen Namen im Dorf erfahren. Möchtest du etwas Wein?“
Maao zögerte. Sie wusste nicht, wie sie sich dem Fremden verständlich machen sollte. Sie verstand die Sprache der Menschen gut, sprach sie aber nur schlecht. Sie wusste nicht, wie sie ihm sagen sollte, dass sie noch nie Wein getrunken hatte und es eigentlich auch nicht wollte.
Doch der Fremde war nett zu ihr. Netter, als es je ein Dörfler gewesen war. Also nickte sie.