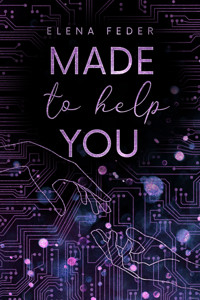
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Als die 18-jährige Bea den Job bei einem geheimen Forschungsprojekt annimmt, will sie nur eines: Sich von ihren wiederkehrenden Panikattacken ablenken und eine für sie wichtige Zukunftsentscheidung aufschieben. Dort bekommt sie die Aufgabe, mit der künstlichen Intelligenz Caius zu arbeiten, die nicht nur außerordentlich klug ist, sondern noch dazu in einem attraktiven männlichen Körper steckt. Caius wird mit jedem Tag menschlicher und fordert bald schon Rechte und Freiheiten für sich ein. Ist Bea, die sich ihm immer verbundener fühlt, bereit, ihren Job aufs Spiel zu setzen, um ihm zu helfen? Und kann sie wirklich Gefühle für jemanden zulassen, der kein gewöhnlicher Mensch ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Elena Feder
Made To Help You
Impressum
© 2024 Elena Feder
c/o unit office GmbH
Bad Nauheimer Str. 4
64289 Darmstadt
Coverdesign und Umschlaggestaltung:
Florin Sayer-Gabor - https://100covers4you.com/
unter Verwendung von Grafiken von Adobe Stock:
berkahjayamaterial, Roman
https://books.elenafeder.de
ELENA FEDER wurde in Darmstadt geboren und studiert dort Cognitive Science. Seit ihrer Kindheit schreibt sie Geschichten. Anfangs von ihren liebsten Fantasybüchern inspiriert, später, um durch Themen wie Liebe, mentale Gesundheit, Moral und Politik komplexe menschliche Gefühle zu erkunden. Wenn sie nicht an ihren Romanen arbeitet, verfasst sie Gedichte oder entflieht ihrem Alltag in Bücherwelten. Mit der Veröffentlichung ihres Debütromans Made To Help You geht ihr Kindheitstraum in Erfüllung.
Hinweis
Liebe Leser*innen,
ich möchte euch darauf hinweisen, dass in Made To Help You Themen behandelt werden, die für manche Menschen belastend sein können. Dazu gehören Panikattacken, Depressionen, selbstverletzendes Verhalten, gestörtes Essverhalten, Schusswaffen, Sexismus, Diskriminierung und menschenverachtendes Verhalten.
Passt auf euch auf!
Für Zoe, weil du mich daran erinnert hast, wie viel mehr Menschen hören sollten, dass sie Hilfe verdienen.
Und für dich, Mama, weil du dafür gesorgt hast, dass ich die Hilfe bekomme, die ich verdiene.
Kapitel 1
Ich stehe an der Bahnschranke und rette ein Leben.
Das kleine Mädchen, das lachend um seine gelangweilte Mutter tollt, ist mir schon vorher aufgefallen. Obwohl ich auf der anderen Seite der Schienen stehe, scheint es, als würde ich ihm mehr Aufmerksamkeit schenken als die Mutter, die auf ihr Handy starrt. Deshalb bin auch ich es, die als Erste sieht, wie das Mädchen unter der Schranke hindurchschlüpft.
Die Situation gibt ein sonderbares Bild ab. Das Lachen des Mädchens, es ist vielleicht gerade einmal fünf Jahre alt, und dann das Quietschen der Bremsen des einfahrenden Zuges.
Ich setze mich in Bewegung, ohne nachzudenken, ohne auf all die anderen Menschen zu achten. Plötzlich stehe auch ich auf den Schienen, schubse das Mädchen aus der Gefahrenzone, versuche, mich ebenfalls in Sicherheit zu bringen …
Die Szene wechselt.
Da ist Blut und Schmerz, bruchstückartige Bilder. Die Mutter, die mit tränenüberströmtem Gesicht ihre Tochter umarmt. Schockverzerrte Gesichter der Umstehenden. Blaulicht. Krankenwagen. Presse.
Was morgen in der Zeitung stehen wird? 18-Jährige rettet Kleinkind und verliert beide Beine. Nein, vielleicht nicht beide Beine, das ist zu heftig, aber schwer verletzt schon – traumatisiert. Der Titel ändert sich: 18-jährige Retterin in Therapie. Verständlich, stände in dem Text darunter, bei solch einer Tat wäre das zu erwarten. Die Leser würden nicken. Hätte man so etwas erlebt, wäre es klar, dass man Hilfe benötigt.
Die Scham sickert wie Gift in meine Gedanken, noch bevor sich die Schranken öffnen und ich den Nachhauseweg antrete. Ich komme an dem Mädchen vorbei, das natürlich nicht so dumm war, auf die Schienen zu rennen. Die Mutter hat ihr Handy bereits weggesteckt, die anderen Passanten würdigen mich keines Blickes.
Die nächste Frage drängt sich mir nicht zum ersten Mal auf: Was für ein Mensch bin ich, der sich wünscht, dass ihm etwas Schreckliches passiert?
~
»Bitte sag, dass es wenigstens nur einer ist und nicht jedes Mal ein anderer.«
Auf Fragen dieser Art antworte ich nie. Es geht meine Mutter nichts an, bei welchen Typen ich bin, wenn ich nicht zu Hause schlafe. Und unterschwellig verurteilt zu werden, kann ich erst recht nicht leiden.
»Willst du mit uns frühstücken?«, versucht sie es, dieses Mal behutsamer, doch ich kann das wenigstens, das sich unausgesprochen zwischen den anderen Wörtern verbirgt, nicht überhören.
»Klar«, meine ich und gehe zur Küche. Nach allem, was meine Eltern für mich getan haben, sollte ich ihnen jeden Wunsch erfüllen. Die Tatsache, dass das nicht möglich ist, dass ich immer noch eigene Bedürfnisse habe und häufig egoistisch genug bin, mich für diese zu entscheiden, ist stets aufs Neue eine schmerzhafte Erkenntnis.
Manchmal denke ich, dass das Leben bloß ein Hin und Her ist, ein endloses Abwägen. Der Versuch, möglichst viel Raum für sich selbst zu ergattern, ohne dadurch andere zu vernachlässigen.
Als ich am Tisch sitze, löst sich meine Spannung etwas. Obwohl es mir eben noch wie eine Verpflichtung vorkam, bin ich eigentlich gerne hier. Ich mag das Frühstück, das meine Eltern machen, mag es, mich mit ihnen zu unterhalten. Das alles ist das Gefühl von Zuhause.
Das Nächste, was meine Mutter sagt, überrascht mich. »Da ist ein Brief für dich angekommen.« Sie nickt in Richtung Tischecke, und ich folge der Bewegung mit den Augen. Der Umschlag lag schon die ganze Zeit da, aber aufgefallen ist er mir nicht. Meine Eltern lassen ihre Post immer irgendwo im Wohnzimmer liegen, bis einer von ihnen sie schließlich öffnet. Mich selbst betrifft das eigentlich nie. Wer sollte mir schon Briefe schreiben?
Doch tatsächlich. Dort, auf der Vorderseite, steht Bea Kleer über unserer Adresse. Ich wende mich wieder meiner Mutter zu, weil ich damit rechne, dass sie mir etwas dazu erklärt. Ich nehme an, das ist einer der Briefe, die schon früher kamen. Von der Verwaltung oder so – irgendetwas, das durch meine Volljährigkeit plötzlich zu meiner Aufgabe geworden ist.
Ich habe jetzt schon keine Lust, den Umschlag aufzumachen und mich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Ich weiß genau, dass er Arbeit mit sich bringt und meine Mutter mich zwingen wird, sie zu erledigen, weil ich inzwischen ja wissen muss, wie so etwas geht. Ich muss endlos viel Zeit verschwenden, in der sie mir die Vorgehensweise erklärt, die ich bis zum nächsten Brief schon wieder vergessen haben werde. Dabei ginge es so viel schneller, wenn sie oder mein Vater das erledigen würden.
Aber meine Mutter sagt nichts. Stattdessen sieht sie mich mit einer seltsamen Erwartung im Blick an. So, als wüsste ich von einem Geheimnis, das sich im Brief verbirgt, und hätte bisher vergessen, ihnen davon zu erzählen.
Verwirrt blicke ich zu meinem Vater, doch in seinem Gesicht steht derselbe Ausdruck. Als hätten sie über mich geredet, bevor ich hergekommen bin.
»Es ist ein Brief von einem Forschungsinstitut.« Ein Satz mit unter zehn Wörtern und trotzdem hat meine Mutter damit alles gesagt, damit ich begreife. Ihre Blicke, die Erwartung, das seltsame Schweigen.
Das hier wirkt, als hätte ich endlich eine Entscheidung getroffen, mich vielleicht auf ein Stipendium beworben. Und das wiederum würde bedeuten, ich hätte mich für einen MINT-Studiengang an der Universität eingeschrieben. Dort, und nicht an der Kunsthochschule, von der ich schon geredet habe, bevor ich mit der Schule fertig war.
»Keine Ahnung, warum die mir geschrieben haben.« Meine Stimme ist härter als gewollt, aber wenigstens braucht es so keine Erklärung mehr. Ich kann einfach nach dem Brief greifen, ohne die enttäuschten Blicke sehen zu müssen, die meine Eltern sich zweifelsohne zuwerfen.
Meine Augen huschen kurz über den Absender, bevor ich den Umschlag aufreiße. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, weshalb mir irgendein Forschungsinstitut schreibt. Vielleicht ist es einer der Briefe, die an alle in der Umgebung gehen, die letztes Jahr ihr Abitur gemacht haben.
Sobald ich das DIN-A4-Blatt auseinanderfalte, begreife ich, dass es genau das ist. Ich widerstehe dem Drang, den Brief einfach wieder wegzulegen. Doch auf die Diskussion mit meinen Eltern, die dann folgen würde, kann ich getrost verzichten. Also zwinge ich mich zu lesen.
Als ich ende, meine ich: »Nur eine Jobausschreibung.« Ich muss meine Eltern nicht ansehen, um zu begreifen, dass ihnen das als Erklärung nicht genügt. Also füge ich hinzu: »Das Institut sucht eine Aushilfe für ein aktuelles Projekt. Es hat sich mit den Schulen in der Umgebung in Verbindung gesetzt, um so Schüler des letzten Jahrgangs, die ein gutes Abi gemacht haben, fördern zu können. Sie laden zu einem Vorstellungsgespräch ein.«
»Was ist das für ein Projekt?«, fragt mein Vater. »Ein Teil ihrer Forschung?«
Ich zucke mit den Schultern. »Da steht nichts Genaueres. Nur, dass sie jemanden mit einer breitgefächerten Begabung suchen. Es scheint also nicht um einen bestimmten Bereich zu gehen.«
»In diesem Fall würden sie ja auch vermutlich eher Studenten nehmen, die sich auskennen.«
Ich weiß, dass meine Mutter es nicht böse meint, aber ihre Worte treffen mich trotzdem.
»Und?«, fragt sie, ohne zu merken, welche Wirkung ihre letzte Aussage hat. »Wirst du hingehen?« Da ist Hoffnung in ihrer Stimme, das kann ich deutlich hören. Vielleicht sogar eine Aufforderung wie: Du kannst nicht ewig hier bei uns herumsitzen und dir dein Leben von uns finanzieren lassen, während du in deinem Zimmer sitzt und deine hübschen Bilder malst, mit denen du nie etwas verdienen wirst.
Ich zwinge mich zu einem erneuten Schulterzucken. »Mal sehen. Sollte das ein attraktives Angebot sein, werden sich da doch sicherlich Unzählige bewerben. Da ist die Chance, dass ich genommen werde, sowieso gering.«
»Aber hingehen kostet nichts«, meint mein Vater. »Wer weiß, was du für eine Chance verpasst, wenn du nicht gehst?«
Meine Mutter beginnt eifrig zu nicken, noch bevor er fertig gesprochen hat. »Und so ein Vorstellungsgespräch geht sicher schnell. Bei den wenigen Informationen gibt es nicht wirklich etwas, auf das du dich vorbereiten könntest.« Sie wirft mir ein aufmunterndes Lächeln zu. »Außerdem hast du ja sonst nicht viel zu tun.«
Wieder soll es kein Seitenhieb sein, in ihren Augen steht keinerlei Boshaftigkeit, aber mein Inneres windet sich. »Ich arbeite gerade an einem sehr aufwendigen Bild – darin steckt viel Zeit und Mühe.« Es hört sich wie eine schlechte Ausrede an, aber eigentlich entspricht es der Wahrheit.
Wieder dieses kurze Schweigen. Meine Eltern entsprechen nicht dem Film-Klischee. Sie haben meine Bilder nie lächerlich oder überflüssig genannt, haben mich vielmehr gelobt und darin bestärkt, mich künstlerisch auszudrücken. Aber nur als Hobby, etwas, das ich gerne nebenbei machen kann, aber sicherlich nicht hauptberuflich. Sie und ich wissen, dass das Schicksal von Künstlern kein Leben in Reichtum ist. Dass man früher oder später erkennt, dass Leidenschaft und Geld nicht vereinbar sind.
»Ich denke drüber nach«, meine ich schließlich und werfe einen erneuten Blick auf das Datum. »Der Termin ist erst am Freitag.«
~
Ich liebe Musik. Ich höre sie, wenn ich putze oder koche, wenn ich dusche oder mich umziehe – oft sogar, wenn ich lese. Aber ich höre niemals Musik, wenn ich male. Es ist keine Frage der Konzentration, denn ich bin durchaus multitaskingfähig. Der Grund ist eher, dass das Malen der einzige Zeitpunkt in meinem Leben ist, in dem ich die Stille genießen kann.
Früher schon habe ich nie begriffen, weshalb andere Menschen vollkommene Ruhe lieben. Denn tatsächlich ruhig ist es doch nie. Allein meine Gedanken scheinen oft laut genug, um einen ganzen Saal bis in die Ecken zu füllen. Doch wenn ich nach einer Leinwand greife, wenn die Farbe auf der Oberfläche haften bleibt und meine Finger über den Pinselgriffen und Tuben schweben, für einen Moment gefangen in der Freiheit, das weitere Vorgehen selbst bestimmen zu können – dann ist alles still, selbst meine Gedanken.
Manchmal komme ich mir fast körperlos vor. Da ist nur Bild, Farbe und Gegenwart. Ich habe weder Vergangenheit noch Zukunft, spüre weder Panik noch Euphorie, bin ganz im Gleichgewicht.
Ich stehe im Zentrum meines Zimmers und mir wird wieder einmal bewusst, dass es trotzdem niemals so einfach ist, wie es sich anhört. Um mich herum liegen Leinwände auf ausgebreiteter Zeitung verteilt. Auch Farbtuben, die ich nicht weggeräumt habe. Bloß Pinsel lassen sich dort nicht finden, da ich immer darauf achte, sie nach der Benutzung ordentlich auszuspülen.
Ich gehe in die Hocke und streiche mit den Fingern über die Leinwand, die ich gestern dort platziert habe. In meinem Kopf ist da bereits eine Idee, das aufwendige Bild, von dem ich vor meinen Eltern gesprochen habe. Angefangen habe ich es noch nicht.
Trotz meiner Liebe zum Malen ist dieser Zustand, in dem ich mich gerade befinde, eine Qual. Ich habe diese Vision, möchte anfangen und erschaffen, was da in meinem Inneren ist. Und doch kann ich mich nicht dazu bringen, mir Farbe sowie die anderen Malutensilien zu holen, denn ich weiß, dass ich dann nur den Pinsel in der Hand halten und so über die Leinwand führen würde, dass die Borsten sie nicht berühren.
Ich richte mich wieder auf, wandle durch mein Zimmer und mache mir vor, kein Ziel zu haben. Doch meine Hände haben bereits nach einer älteren Leinwand gegriffen, die in einem Stapel von vielen anderen an der Wand lehnt.
Ich weiß, dass ich dieses Bild nicht wahllos gewählt habe. Manchmal tue ich das. Greife einfach blind in einen der Stapel, prüfe das Datum auf der Rückseite und schaue mir dann an, was ich damals erschaffen habe. Schnell habe ich festgestellt, dass ich manche Bilder lieber habe als andere. Dieses ist eines von ihnen.
Die grellen warmen Farben, die ineinander wirbeln, stechen hervor, dazwischen sind dunkle Sprenkel endloser Tiefe. Es ist sehr abstrakt und genauso würde ich den Titel wählen. Schmerzhafte Freude.
In der Schule hätten wir das Oxymoron genannt. Zwei Begriffe, die sich widersprechen oder sogar ausschließen. Aber intensives Fühlen ist nie vollkommen angenehm, ganz gleich, ob es sich bei dem eigentlichen Gefühl um ein positives oder negatives handelt.
~
Die Tage vergehen ereignislos, und der Freitag rückt näher. Das Bild habe ich nicht angefangen. Und als würde mein Körper darauf reagieren, dass er nicht loswerden kann, was er so dringend loswerden will, fühle ich mich, als wäre ich überanstrengt oder sogar krank. Sicher, denke ich mir und verdrehe innerlich die Augen, mein Nichtstun der letzten Tage wird eine Überanstrengung verursacht haben.
Am Freitagmorgen ist mir übel, so als könnte ich die Spannung in meinem Inneren loswerden, indem ich mich übergebe. Ich ekle mich vor mir selbst und zwinge mich zu duschen.
Ich weiß nicht genau, wann ich den Entschluss fasse, zu dem Bewerbungsgespräch zu gehen, aber jetzt, da ich mich entschieden habe, verbiete ich mir, noch einmal darüber nachzudenken. Ablenkung, sage ich mir. Ich darf nicht zulassen, dass ich in einem dieser dunklen Löcher lande. Ich merke meistens vorher, wenn ich mich ihnen nähere, und in den letzten Tagen bin ich wieder mit qualvoller Geschwindigkeit auf eines davon zu geschlittert. Zu schnell, als dass ich umkehren könnte, aber doch nicht schnell genug, sodass mir mit jedem Zentimeter bewusst wird, welches Tief auf mich wartet, wenn ich den Abgrund erreiche.
Dort wird es keine Inspiration für ein Gemälde mit Oxymoron-Titel geben, da alle positiven Gefühle, die im Widerspruch zu schlechten stehen könnten, verschwunden sind.
Nein, dort in den Abgründen finde ich, was ich zum Erschaffen von Pleonasmen-Bildern benötige. Ein weiterer Begriff, den ich noch aus der Schule kenne. Überflüssige Wiederholungen.
Dunkle Schatten – das ist der Titel meines Lieblingsbildes.
Kapitel 2
Das Forschungsinstitut ist eines dieser Gebäude, an denen ich mein Leben lang immer wieder vorbeigekommen bin, ohne sie wirklich zu beachten. Es liegt am Rande eines Platzes nahe der Innenstadt und ist von mir zu Hause gut zu Fuß zu erreichen.
Bevor ich durch die Eingangstür trete, atme ich einmal tief durch und umklammere die Mappe fester, in der ich ein paar meiner Unterlagen mitgebracht habe. In den Eingangsbereich, der sich dahinter öffnet, wage ich mich nur zögerlich vor. In dem Brief ist nur eine Adresse angegeben, keine weiteren Informationen, weshalb ich mir nicht sicher bin, wo ich hingehen muss.
Vor mir liegt ein Aufzug, zusätzlich sind da zwei Flure, die in verschiedene Richtungen abgehen.
»Hey, bist du auch für den Job da?«
Suchend wende ich mich um, bis ich den Ursprung der Stimme finde. Es ist ein Mädchen, das im Flur zu meiner Linken auf einem von vier dort aufgereihten Stühlen sitzt. Auch sie hat eine Mappe dabei.
Ich atme auf und gehe zu ihr hinüber. »Ja, genau.«
»Cool, ich bin Sophie. Vorhin war eine Frau da, die erklärt hat, wie das Ganze abläuft.«
Ich widerstehe dem Drang, mich nach einer Uhr umzusehen. »Ich bin zu spät?«
»Nein, ich glaube wir haben absichtlich verschiedene Zeiten bekommen, damit wir nicht zu lange warten müssen.«
»Ach so.« Noch einmal atme ich tief durch, doch das hilft nicht dabei, meine Anspannung zu lösen. Meine Handflächen sind so schwitzig, dass sich das Plastik der Mappe bereits feucht anfühlt, und mein Herz schlägt deutlich schneller als sonst. Ich schlucke und setze mich neben Sophie auf den Stuhl.
»Bea«, bringe ich irgendwie heraus, als mir einfällt, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Mir ist klar, wie einsilbig ich klingen muss, aber ich brauche kurz Zeit, um ein bisschen herunterzukommen.
Das ist nur ein blödes Vorstellungsgespräch, rufe ich mir in Erinnerung. Ich bin bloß für meine Eltern hier und nicht, weil mir der Job wichtig ist.
Sophie scheint mein Auftreten nicht zu stören, denn sie erklärt: »Jedenfalls hat diese Frau gemeint, dass jeder erst einen Standardtest absolvieren muss, in diesem Raum dort.« Sie nickt zur gegenüberliegenden Tür. »Dort ist man allein und hat zehn Minuten Zeit, möglichst viele Fragen zu beantworten. Währenddessen schauen sie unsere mitgebrachten Unterlagen durch. Danach wird, glaube ich, schon eine Vorauswahl getroffen.«
Ein Test – na, fantastisch. Ich weiß, dass es nichts gab, auf das ich mich hätte vorbereiten können. Trotzdem missfällt es mir, dass ich gleich aufgrund irgendeiner Punktzahl schon wieder ausscheiden könnte.
Ich begreife nicht, wie Sophie so unbekümmert sein kann. Während ich stocksteif dasitze, mit den Fingern auf der Mappe auf meinem Schoß trommle und kaum ein Wort herausbringe, hat sie sich sogar leicht angelehnt und offenbar keine Schwierigkeiten, zu reden.
Während sie von ihrem letzten Schuljahr, ihren Zukunftsplänen und Spekulationen zu diesem Job erzählt, höre ich nur mit halbem Ohr zu. Glücklicherweise bleibt es mir erspart, eine Antwort zu geben, weil sich uns gegenüber genau in diesem Moment die Tür öffnet und ein Typ in unserem Alter heraustritt. Sophie sagt noch irgendetwas zu mir und ist dann im nächsten Augenblick in dem Raum verschwunden.
Dem anderen Bewerber werfe ich einen kurzen Blick zu, doch da er keine Anstalten macht, ein Gespräch anzufangen, bleibe auch ich stumm. So ist es mir ohnehin lieber.
Bis Sophie wieder auftaucht, dauert es eine gefühlte Ewigkeit – und nicht nur zehn Minuten. Auf ihren Lippen liegt ein zuversichtliches Lächeln. »Ist gut machbar. Viel Glück.«
Ich bringe nur ein Nicken zustande, als ich an ihr vorbeigehe und den Raum betrete. Er ist schnell zu überblicken: Es sind nur ein Schreibtisch mit einem Computer und eine Klappe an der Wand zu sehen. Durch diese schiebe ich meine Mappe, wozu mich der Text auf dem Bildschirm auffordert. Dann klicke ich auf das Weiter-Feld und bekomme eine kurze Anleitung zu dem Test.
Wie Sophie sagte, habe ich zehn Minuten Zeit, um durch so viele Fragen wie möglich zu kommen. Als ich sehe, dass ich die Antworten per Multiple-Choice geben muss, stöhne ich innerlich auf. Es gibt kein Test-Format, das ich mehr verabscheue. Nirgendwo sonst kann man so schwer ausweichen, wenn die Frage schlecht gestellt oder man sich bei der Antwort unsicher ist.
Als ich auf Start klicke, ist die Nervosität immer noch nicht aus meinem Körper gewichen, aber tatsächlich werde ich beim Bearbeiten ruhiger. Die Aufgaben sind verschieden: Logik, Rechnen, Textverständnis, Allgemeinwissen. Es ist angenehm, mich auf etwas außerhalb meiner Gedanken konzentrieren zu können.
Diese zehn Minuten vergehen rasend und kurz darauf sitze ich schon wieder mit Sophie und dem anderen Bewerber in dem Gang. Obwohl das Warten auf eine Rückmeldung eigentlich schrecklich sein müsste, genieße ich es fast. Soweit ich einschätzen kann, habe ich bei dem Test nicht völlig versagt, aber dass ich in die engere Auswahl komme, halte ich trotzdem für unwahrscheinlich. So entspannt wie Sophie vorher war, könnte ich mir vorstellen, dass sie eine perfekte Punktzahl hat.
Ich werde also nach Hause gehen können, ohne ein richtiges Vorstellungsgespräch haben zu müssen, und meine Eltern werden besänftigt sein, weil ich es zumindest versucht habe.
~
»Und Sie, Frau Kleer, sind in die engere Auswahl gekommen.«
Ich glaube, mich verhört zu haben, doch die Frau, die vor wenigen Minuten aus dem benachbarten Raum getreten ist, sieht mich mit einem bestätigenden Lächeln an.
Bevor ich antworten kann, wendet sie sich noch einmal den anderen beiden zu. »An Sie natürlich trotzdem vielen Dank, dass Sie hier waren, und alles Gute für Ihre Zukunft.«
Das ist das Zeichen für sie zu gehen. Sophie lächelt mir zum Abschied zu. Sie scheint keinesfalls sauer zu sein, dass ich besser abgeschnitten habe. Kurz sehe ich ihr nach und beobachte ihren federnden Schritt, als würde sie bloß Leichtigkeit fühlen. Obwohl sie diejenige ist, die fortgeschickt wurde, wünsche ich mir für einen Augenblick, ich wäre an ihrer Stelle.
»Frau Kleer? Wollen Sie mitkommen, damit wir uns kurz unterhalten können? Es gibt noch einiges Wichtiges zu dem Projekt, um das sich der Job dreht, zu besprechen.«
Ich wende mich wieder der Frau zu, nicke und folge ihr dann in das Zimmer, aus dem sie kam. Es ist klein und der Anblick löst nicht gerade ein angenehmes Gefühl in mir aus. Gräulicher Teppichboden, Schränke mit Ordnern, ein Schreibtisch, der den Raum teilt, darauf ein älterer Computer. Vor dem Fenster hängt ein gelblicher Vorhang, der alles etwas schummrig wirken lässt.
Schon während ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich mich davor gefürchtet, irgendwann einen Job zu haben, der mich Tag für Tag in so ein Büro zwingt. Und plötzlich bin ich mir ziemlich sicher, dass das, was auch immer sie mir anbieten werden, nicht attraktiv für mich sein wird.
Die Frau lässt sich hinter dem Schreibtisch nieder und bedeutet mir, ihr gegenüber Platz zu nehmen. »Ich sollte mich wahrscheinlich erst einmal vorstellen«, meint sie. »Mein Name ist Laona Felber, du kannst mich ruhig duzen.«
»Bea«, stelle ich mich vor, obwohl sie das vermutlich schon weiß. Dann nehme ich mir kurz Zeit, sie noch einmal zu mustern. Ob sie hier Wissenschaftlerin ist? Wenn sie mir auf der Straße begegnet wäre und ich einen Tipp abgeben hätte müssen, hätte ich auf einen sozialen Beruf gesetzt. Oder auf Arbeit mit Tieren.
Sie ist verhältnismäßig jung, um die dreißig vielleicht, hat dunkelblonde Locken und trägt einfache Kleidung: Jeans, Pullover, Sneakers. Ich weiß, dass ich hier gerade Schubladendenken betreibe, und schäme mich sofort. Würde jemand auf dieselbe Weise Vermutungen über mich anstellen, würde ich es hassen.
»Also, Bea«, meint Laona. »Du hast bei dem Test sehr gut abgeschnitten. Wir hatten schon in den letzten Tagen ein paar Bewerber da, und unter ihnen waren nur zwei, die eine höhere Punktzahl hatten.«
In meinem Inneren macht sich ein warmes Gefühl breit, das ich noch aus meiner Schulzeit kenne, wenn ich eine gute Note bekommen habe. Nach meinem Abitur gab es nicht mehr viele Gründe, mich so zu fühlen, weshalb es nun seltsam angenehm ist. Insbesondere, da mir dieser Job eigentlich überhaupt nicht wichtig ist.
»Nach dem, was ich über das Projekt erzählt habe, hat sich einer der beiden schon gegen den Job entschieden«, fährt Laona fort. »Und mit der anderen Bewerberin bin ich in diesem Gespräch sehr schlecht zurechtgekommen, weshalb auch sie ausgeschieden ist. Mit der Person, mit der ich in Zukunft arbeiten werde, will ich gut zurechtkommen, weißt du?«
Laona hat also offenbar eine hohe Position bei diesem ominösen Projekt, wie sie es nennt, wenn sie ganz allein entscheiden darf, wer eingestellt wird.
»Natürlich geht es nicht nur um die Testergebnisse, aber auch deine Abiturnoten sind sehr gut.« Laona nickt mit dem Kopf zu meiner Mappe, die ich jetzt erst auf dem Schreibtisch entdecke. »Nach allem, was ich bisher weiß, könntest du eine gute Wahl für diesen Job sein.«
Ich versuche, diese erneute Wärme in mir zu ignorieren, und frage stattdessen: »Dieses Projekt – was genau hat es damit auf sich? In dem Brief stand nicht viel dazu.«
»Ja, das stimmt. Und ich muss auch bedauerlicherweise gestehen, dass ich vorerst nicht viel mehr verraten darf. Dieses Projekt steht unter strenger Geheimhaltung, und ich kann dir erst nach Annahme des Jobs und der Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung mehr erzählen. Das mag vielleicht abschreckend wirken, ist in diesem Fall aber die einzige Möglichkeit.«
Offensichtlich ist mir meine Skepsis anzusehen, denn sie fügt hinzu: »Keine Sorge, wir machen hier nichts Illegales oder so. Es soll nur vermieden werden, dass unsere Forschungsergebnisse in falsche Hände geraten und missbraucht werden. Das ist bei neuerer Technologie immer eine Bedrohung, deshalb haben wir uns dazu entschieden, erst einmal alles unter Verschluss zu halten.«
»Wen meinst du mit wir?«, frage ich. »Wer arbeitet sonst noch an dem Projekt?«
»Einige. Ich teile uns immer gern in drei Gruppen ein. Die Forscher und Wissenschaftler, die das Produkt herstellen, und die Gruppe, der ich angehöre, die es auf die Anwendbarkeit prüft.«
»Und die dritte Gruppe?«, hake ich nach, als sie nicht weiterspricht.
Das kurze Zögern, bevor sie antwortet, entgeht mir nicht, auch wenn ich es nicht einordnen kann. »Das sind Investoren. Eigentlich gehören sie nicht richtig zum Team, sie … verfolgen eigene Interessen. Aber wir sind von dem Geld abhängig. Anders könnten wir das alles nicht finanzieren.«
Wenn ich Laona richtig einschätze, ist sie nicht sonderlich begeistert davon, dass diese Investoren bei ihrem Projekt die Finger im Spiel haben, doch ich versuche, mich auf das Relevante zu konzentrieren. »Okay, wenn du nicht so viel verraten darfst, kannst du mir denn wenigstens grob sagen, was mich erwarten würde? Ich meine, ich mag ungern einen Vertrag unterschreiben, ohne vorher zu wissen, wie mein Arbeitsalltag aussieht und wie lange das alles geht.«
Laona nickt langsam. »Also, wie lange wir deine Hilfe brauchen, kann ich nicht sagen, ich denke, der Vertrag würde erst einmal für ein paar Monate geschlossen werden. Sollte es notwendig sein, werden wir ihn anpassen. Deine Aufgaben würden sehr variieren, es ist kein Bürojob. Du wirst mit anderen Menschen reden und dich mit ihnen austauschen.«
»Was ist mit bestimmten Qualifikationen?«, hake ich nach, obwohl das sicherlich nicht der schlauste Weg in einem Bewerbungsgespräch ist. »Ich meine, abgesehen von diesem Test und meinem Abitur. In welchem Bereich würde ich tätig sein? In welche Richtung geht das alles?«
»Es kann variieren, wie gesagt. Was die Richtung betrifft? Sagen wir so: Alle Forscher hier sind in das Ganze sehr involviert. Es ist uns wichtig, eine weitere Meinung von außen zu haben. Etwas Intelligenz und gutes Allgemeinwissen sind dafür unabdingbar, aber ansonsten musst du nur ein Mensch wie jeder andere sein. Mit einer Meinung und ein paar Erfahrungen, mit Vorlieben und Hobbys … Ich habe in deinen Unterlagen gesehen, dass du auf Landesebene in einem Schülerkunstwettbewerb ausgezeichnet wurdest – ist das etwas, wofür du dich interessierst?«
Ich nicke und lächle leicht.
»Siehst du?«, meint Laona. »Das ist gut. Ein allgemeines Bewusstsein für so etwas zu haben. Für Kunst, vielleicht auch für Literatur oder Musik.«
»Okay, das hört sich interessant an«, meine ich, was keine Lüge ist, denn für Kunst kann ich mich immer begeistern. Trotzdem haben die letzten Worte meine Zweifel nicht beseitigt. »Ich … habe nur immer noch das Gefühl, zu wenig zu wissen, um einen Vertrag zu unterzeichnen. Ich meine, ich male und wollte eigentlich bald anfangen, zu studieren, und … ja.« Ich höre selbst auf zu reden, weil es mir vorkommt, als würde ich schon wieder Ausreden erfinden. Und ganz der Wahrheit entsprechen meine Worte schließlich nicht. Ja, ich habe vor, irgendwann irgendetwas zu studieren, aber das beansprucht aktuell nicht wirklich meine Zeit. Selbst wenn ich mich intensiver mit dem Thema beschäftigen würde, würde ich daran nicht den ganzen Tag sitzen.
»Oh, welcher Studiengang denn?«
Ich habe vor langem gelernt, mir nicht anmerken zu lassen, wie sehr ich diese Frage verabscheue. »Ich habe mich noch nicht festgelegt.«
»Aber in welchem Themenbereich?«
»Ich … schwanke noch.« Zwischen meinen Eltern und mir, füge ich in Gedanken hinzu. Zwischen Geld und Leidenschaft.
»Nun«, meint Laona. »Dass das schwierig für dich ist, kann ich verstehen, gerade wenn du deswegen deine Pläne aufschieben musst. Daran haben wir natürlich im Voraus gedacht, deshalb wirst du entsprechend für deine Arbeit bezahlt werden – und wir können dir, falls es uns möglich ist, im Nachhinein auch ein Gutachten verfassen. Damit hast du gute Chancen, überall reinzukommen, falls dein Abischnitt dazu nicht schon genügt. Was dein Gehalt betrifft, können wir natürlich noch verhandeln.«
Die Zahl, die sie daraufhin nennt, verschlägt mir den Atem. Ich kenne mich nicht allzu gut mit Gehältern aus, aber ich weiß, dass das für jemanden wie mich – jemanden ohne tatsächliche Qualifikationen, ohne Ausbildung oder Studium – eine Menge ist. Erst recht, weil ich noch nie zuvor wirklich etwas verdient habe, wenn man das bisschen, das ich fürs Babysitten und Nachhilfegeben bekam, außer Acht lässt.
Das ist Geld, mit dem ich mir mit viel Glück etwas mieten könnte, nichts Großes, aber es wäre etwas, das ich mir selbst finanziert hätte, ohne meine Eltern. Ich spüre kein Bedürfnis, auszuziehen, aber allein die Vorstellung finanzieller Unabhängigkeit …
Es sind nur ein paar Monate, sage ich mir, um mich von meinem kurzen Hoch herunterzuholen. Danach werde ich wieder nichts bekommen, dann werden die Suche und die schmerzhafte Erkenntnis, dass ich mich irgendwann für einen Weg entscheiden muss, wieder wie ein Klammergriff um meine Kehle liegen.
»Gibt es noch etwas, das du mir zu dem Projekt sagen kannst?«
Laona überlegt kurz – und schüttelt den Kopf. »Tut mir leid. Solltest du annehmen, wirst du verstehen, wieso.«
Diese Worte machen mich neugierig. Natürlich, vermutlich ist das genau Laonas Intention, aber … »Ich brauche Zeit, um nachzudenken. Bis wann muss ich mich entschieden haben?«
Laona hat die Augenbrauen leicht zusammengezogen, als hätte sie darauf gehofft, dass ich direkt Ja sage, doch sie nickt. »Ich würde gerne bis morgen Bescheid wissen. Du magst zwar meine erste Wahl sein, aber es gibt durchaus noch andere Bewerber innerhalb der letzten Tage, die in Frage kommen.«
»Okay.« Ein Tag ist nicht viel Zeit, um eine solche Entscheidung zu treffen, aber ich verstehe, in welcher Position Laona ist. »Ich werde dir eine E-Mail schreiben.«
Bereits auf dem Flur beginne ich Argumente abzuwiegen. Für und Wider. Hin und her. Eines geht mir nicht aus dem Kopf.
Allein, durch die Annahme zu erfahren, wieso so ein großes Geheimnis um dieses Projekt gemacht wird, wäre es fast wert, mich dafür zu entscheiden.
~
Dunkle Schatten blicken mir entgegen und lachen mich aus. Ich spreche nicht von dem Bild, obwohl dessen Anblick vor meinem inneren Auge vorbeizieht. Nein, vor mir ist wahrhaftige Dunkelheit. Keine hellen Nächte, keine wachen Träume. Die schwarze Finsternis hat alle Oxymora vertrieben. Zurückgeblieben sind ich und die Pleonasmen, die mich umgeben und durchdringen.
Sie sind es, die mein Herz schneller schlagen und dann stolpern lassen, als renne es über einen unebenen Acker, ohne die Hügel und Vertiefungen auf der Strecke vorhersehen zu können. Sie sind es, die tonnenschwer wie Blei auf meiner Brust lasten und mich hinab ins Bett drücken.
Satzfetzen rauschen durch meinen Kopf, bleiben an Widerhaken hängen und drängen sich mir auf. Gleichzeitig winden sich meine Gedanken eine altbekannte Abwärtsspirale hinab.
Die ganzen letzten Tage wusste ich nicht, wann ich den Abgrund erreichen würde, und auf einmal befinde ich mich im freien Fall. Ohne, dass ein Grund in Sicht ist, ohne, dass ich mich an etwas klammern könnte. Es ist, als würde mein Körper nicht mehr fest in der Welt haften.
Ich muss mich morgen entscheiden.
Entscheiden, entscheiden, entscheiden, wispern die Schatten mir ins Ohr und ich schnappe nach Luft.
Ich werde in mögliche Zukünfte gezerrt, all die Wege entlang, die ich gehen kann, und ende in Glück oder Verzweiflung. Wofür entscheide ich mich?
Meine Hand findet meinen Hals, meinen Nacken. Die Haut unter meinen Fingern ist schweißnass. Ich fahre meinen Kragen entlang, suche nach dem Griff um meine Kehle, der zudrückt, ohne ihn zu finden.
Die Dunkelheit drängt sich mir weiter auf, drängt mich nach unten. Ich kann mich nicht bewegen, all mein Sein ist in meinem Inneren eingesperrt, drückt nach außen und oben. Mir ist schwindelig.
Ich zwinge mich zu schlucken. Schlucke erneut. So, als würde das meinen Hals freimachen, so, als könnte ich dann wieder atmen.
Irgendwann hört es auf. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, nur, dass es dieses Mal schlimmer war als je zuvor. Und ganz egal, ob es dieser Job oder ein Studium oder das Malen zu Hause ist, ich frage mich, ob ich vielleicht zu kaputt für das alles bin – ganz gleich, wofür ich mich am Ende entscheide.
Kapitel 3
Ich kenne die Worte meiner Mutter, noch bevor sie zu sprechen beginnt.
»Nimm den Job an. Es wird dir guttun, mal rauszukommen. Und selbst wenn es langweilig sein sollte, kann es hilfreich sein, mal einen richtigen Einblick in den Arbeitsalltag zu bekommen. Ganz abgesehen davon, dass du ein bisschen was verdienst.«
Ich gebe ein undefinierbares Brummen von mir, während ich Milch über mein Müsli schütte. »Es kam mir nur alles sehr komisch vor. Das mit der Geheimhaltung und so, dass ich gefühlt gar nichts weiß. Mir kommt es vor, als würde ich einen Blankoscheck unterzeichnen, wenn ich den Vertrag unterschreibe.«
»Aber eine solche Verschwiegenheitserklärung gibt es bei vielen Jobs. Und gerade wenn es um Forschung oder neue Technologien geht, ist das völlig nachvollziehbar. Da musst du dir, glaube ich, keine Gedanken machen.«
Natürlich ist es nicht das, was mir Sorgen bereitet. Dieses Mal ist es also wirklich eine Ausrede. Ich fürchte mich davor, wie ich auf die neue Situation reagieren werde, wie ich mit dem Stress werde umgehen können. Wenn mich der Gedanke an eine Ja-Nein-Entscheidung gestern so fertig gemacht hat, möchte ich gar nicht wissen, wie es mir erst geht, wenn ich jeden Tag mit so etwas konfrontiert werde. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb ich das Studieren aufschiebe. Nicht nur, weil ich mich nicht für einen Studiengang entscheiden kann, sondern, weil ich mich nicht dafür gewappnet fühle. Weil ich auf einen Moment warten will, wenn es mir besser geht und ich mit dem Stress, den ich erfahren werde, umgehen kann.
Nach dem Frühstück stehe ich wieder an dem gewohnten Platz im Zentrum meines Zimmers. Immer noch habe ich das Bild nicht angefangen, doch auch jetzt fühlt es sich falsch an. So, als würde ich das Malen nicht verdienen, bis ich eine Entscheidung getroffen habe.
Irgendwann fasse ich schließlich einen Entschluss. Während ich durch mein Zimmer wandle und alle Möglichkeiten abwiege, reift in meinem Kopf ein Plan heran. Laona hat mich als ihre erste Wahl bezeichnet und das gibt mir vielleicht die Möglichkeit, Bedingungen zu stellen. Also setze ich mich vor den Computer und schreibe eine E-Mail, in der ich ihr sage, dass ich vorhabe, anzunehmen – aber gerne Mitspracherecht bei den genauen Formulierungen im Vertrag hätte.
»Okay«, sagt Laona, als ich noch am selben Spätnachmittag wieder mit ihr in dem Teppichboden-Büro stehe. »Was genau wolltest du noch in den Vertrag schreiben lassen?«
»Es geht ums Malen«, sage ich und versuche, mir selbst vorzuspielen, dass ich die Wahrheit sage. »Ich habe Angst, durch den Job so gebunden zu sein, dass ich nicht mehr genug Zeit dafür finde. Und manchmal gibt es Phasen, in denen ich sehr viel malen muss, das kann ich leider gerade nicht besser erklären. Daher würde ich mir wünschen, dass ich meine Arbeitszeiten flexibel einteilen kann, falls das möglich wäre.«
»Ach so.« Laona nickt, als wäre das nichts Großes. »Kein Problem, das steht sowieso schon darin. Deine Aufgaben sind vielseitig und erfordern ohnehin Flexibilität.«
Das ist alles. So einfach habe ich mir eine Hintertür gebaut, durch die ich im Notfall fliehen kann. Nicht, um zu malen, sondern um dem Stress zu entkommen und dafür zu sorgen, dass ich, wenn ich es schon tue, allein zusammenbreche.
Als Laona mir Vertrag, Verschwiegenheitserklärung und einen Stift zuschiebt, komme ich mir auf einmal seltsam erwachsen vor und erlaube mir ein kleines Lächeln, nachdem ich unterschrieben habe.
~
Diesen Montagmorgen holt Laona mich unten an der Eingangstür ab und dirigiert mich in den Aufzug, wo sie eine Karte gegen ein Lesegerät hält. Dann erst drückt sie den Knopf mit der 2.
»Nur damit kommt man in das Stockwerk«, erklärt sie. »Wegen der Geheimhaltung. Du bekommst auch noch eine, damit du hier jederzeit hinein und hinaus kannst.«
Als sich die Türen öffnen, treten wir nach draußen – und ich halte inne. Wow! Das hier ähnelt ganz und gar nicht dem schummrigen Teppichboden-Büro.
Ich spüre Laonas Blick auf mir. So, als würde sie meine Reaktion beobachten wollen. Sie sagt jedoch nichts, sondern lässt mir die Zeit, um alles in mich aufnehmen zu können.
Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht, aber in jedem Fall bin ich beeindruckt. Vor mir liegt ein großer Raum, von dem kleinere Büros sowie zwei Gänge abgehen. Die Türen sind aus Glas und mit weiteren Kartenlesegeräten versehen. Alle Anwesenden sind mit Tablets ausgestattet, in den Büros stehen teilweise mehrere Bildschirme. Alles neueste Technologie.
Genau so sehen Büros immer in Science-Fiction-Filmen aus – aber nicht in der Realität. Ich erinnere mich, wie Laona mir von der dritten Gruppe erzählt hat, den Investoren. Wer auch immer sie sind, sie müssen bereit gewesen sein, sehr, sehr viel Geld in dieses Projekt zu stecken.
»Hey, alle mal herhören«, ruft Laona und die Personen in dem Hauptraum, an dessen Ende wir stehen, wenden sich uns zu. Es sind nur drei, aber die Büros sind fast alle besetzt. Nein, vier – verbessere ich mich. An der anderen Seite des Raumes sitzt ein weiterer, jüngerer Mann in einem Rollstuhl; er hat uns den Rücken zugewandt und zeigt keine Reaktion auf Laona. Fast als würde er schlafen.
Ich zwinge mich, den Blick abzuwenden, und mustere stattdessen die anderen drei – alles Männer.
»Das hier ist Bea«, erklärt Laona. »Wie angekündigt, wird sie mein Team ab jetzt unterstützen.«
Einer der drei, er steht mit einer Kaffeetasse in der Hand gegen den Tisch gelehnt da, nickt mir lächelnd zu. »Cool, willkommen im Team, ich bin Tim - wir duzen uns hier eigentlich alle.«
Ich erwidere das Lächeln, erleichtert, dass die Leute hier nett zu sein scheinen. Genau in diesem Moment erhebt sich einer der beiden anderen Männer, die weiter hinten am Tisch sitzen. Sofort fällt mir auf, dass er nicht ins Bild von Laona und Tim passt. Zum einen ist er älter, vierzig vielleicht, und anstatt legerer Alltagskleidung trägt er einen vollkommen makellosen Anzug.
Er kommt auf mich zu und hält mir seine Hand hin. »Mein Name ist Herr Prager.«
Auch sein Lächeln ist anders, denke ich, als ich ihm die Hand schüttle. Weniger offen, eher glatter, vielleicht zu glatt.
»Bea.« Ich stelle mich mit meinem Vornamen vor, so wie Tim es gesagt hat, auch wenn mir aufgefallen ist, dass Herr Prager offensichtlich nicht unter wir alle fällt, wenn es um das Duzen geht.
Erst jetzt bemerke ich, dass Tim einen Schritt nach vorne gemacht hat. Er lehnt nicht mehr lässig am Tisch, sondern steht aufrecht da, seine Tasse hat er abgestellt. Sein Blick liegt nicht auf mir, sondern auf Herrn Prager – und er macht sich keine Mühe, die Bitterkeit zu verbergen, die plötzlich in seinen Zügen liegt.
Herr Prager schenkt dem keine Beachtung, sondern mustert mich noch einmal kurz. »Bea«, wiederholt er meinen Namen. »Schön, dass du Laona und ihre Gruppe unterstützt, aber vorweg gleich ein Ratschlag: Es ist für alle von Vorteil, wenn die Gruppen auch miteinander gut arbeiten. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass sehr viele hier das nicht begreifen – auch solche in leitenden Positionen, die es vielleicht besser wissen sollten.«
Kurz bin ich zu perplex, um zu antworten. So viel zu alle sind nett hier. Zwar ist da immer noch ein Lächeln auf Herrn Pragers Gesicht, doch die Spannung, die in der Luft liegt, ist greifbar. Zu der, die sowieso schon zwischen ihm und Tim existiert, kommt jetzt noch seine unterschwellige Beleidigung, die auch an Laona gerichtet ist.
Schließlich bringe ich ein Nicken zustande, was ihm als Reaktion zu genügen scheint. Er geht zurück zu seinem Platz und lässt sich neben dem anderen Mann nieder. Dieser hat sich während der ganzen Szene im Hintergrund gehalten, aber sein Blick, der mich auch jetzt noch einmal streift, ist aufmerksam. Seiner Kleidung nach zu urteilen, gehört er eher zu Herrn Pragers Gruppe und nicht zu Laonas.
Tim atmet langsam auf, während er wieder nach seiner Tasse greift und zu Laona geht.
»Irgendetwas Wichtiges passiert?«, fragt diese.
»Nichts Bahnbrechendes, ich habe das Gefühl, wir können in dieser Phase nichts mehr tun – aber deshalb ist Bea ja hier.« Er wirft mir einen Blick zu, als wüsste ich, wovon er spricht, doch bevor ich nachhaken kann, schüttelt er leicht den Kopf. »Ich wünschte, die M&Ms würden hier nicht die ganze Zeit herumlungern und schlechte Stimmung verbreiten. Ganz ehrlich, an den Tagen, an denen sie nicht da sind, machen wir doppelt so schnellen Fortschritt – sie sollten inzwischen begriffen haben, dass wir sie hier nicht brauchen.«
»Nur, dass sie das nicht unterschreiben würden«, meint Laona mit einem Blick zu den beiden Männern, die uns nicht mehr beachten, sondern leise Worte miteinander wechseln. »Egal. Heute bin ich da, um Bea hier alles zu zeigen. Vielleicht schicke ich sie später in dein Büro, damit du ihr die Dinge noch einmal aus Sicht eines Experten erklären kannst. Die M&Ms können ihr erst einmal egal sein.«
Tim nickt uns beiden zu, bevor er sich umdreht und in dem linken der Gänge verschwindet.
Ich sehe Laona an. »M&Ms?«
Sie stöhnt. »Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, glaub mir. Tim hat das mal gesagt und irgendwie benutzen wir es jetzt.«
»Und was bedeutet es?«
»Na ja, wir benutzen es als Bezeichnung für Gruppe Drei, für die Investoren. Offiziell sind es die Mitarbeiter von Herrn Pragers Unternehmen, NewBrain Industries. M&Ms steht für Money Makers – weil Geld das Einzige ist, das sie bei diesem Projekt interessiert.«
»Also tatsächlich M&Ms? Wie die Süßigkeiten?«
Laona seufzt. »Ja, eigentlich ein Name, mit dem man völlig Falsches assoziiert. Herr Prager investiert nur in uns, weil er hofft, aus unserer Forschung Profit für NewBrain Industries schlagen zu können. Seine Leute halten sich für die Größten, aber sie werden schon noch begreifen, dass sie all unsere Errungenschaften der letzten Jahre nicht einfach kaufen können.« Laonas Stimme ist auffällig kompromisslos, und ich frage mich, ob ihr bewusst ist, dass in neunzig Prozent der Fälle in dieser Welt bei einer Streitigkeit immer derjenige mit weniger Geld den Kürzeren zieht.
»Und was sind das für Errungenschaften? Was ist das für ein Projekt?«
Laona winkt mich zu sich. »Ich zeig’s dir.«
Endlich, denke ich und erwarte, dass sie in einen der Gänge tritt. Doch bevor sie das tut, greift sie nach den Griffen des Rollstuhls, löst die Bremsen und beginnt, den Mann vor sich herzuschieben.
Wieder warte ich auf eine Reaktion von ihm – doch nichts passiert. Dabei kann ich von hier aus genau erkennen, dass er nicht schläft, denn er hält den Kopf erhoben und scheint nach vorn zu schauen. Da ich hinter Laona gehe, kann ich sein Gesicht nicht sehen.
Schließlich öffnet sich automatisch eine Tür zu unserer Linken, Laona tritt ein und ich folge ihr. Der Raum ist leer, zumindest fast. In der Mitte steht ein Holztisch, davor zwei Stühle.
Laona schiebt den Rollstuhl um den Tisch herum, während ich etwas unschlüssig in der Tür verharre.
»Setz dich«, meint Laona, doch ich höre ihre Stimme nur leise. Sie hat den Rollstuhl jetzt so gedreht, dass ich das Gesicht des Mannes sehen kann, und während ich ihm gegenüber Platz nehme, kann ich den Blick nicht von ihm abwenden.
Er ist jung, vom Alter her näher an mir als an Laona. Und er ist seltsam schön.
Fast ein Oxymoron, schießt es mir durch den Kopf, doch seltsam und schön widerspricht sich bei ihm nicht wirklich.
Zuerst versuche ich, mich auf die Schönheit zu konzentrieren. Er hat markante Züge, ein fast symmetrisches Gesicht und goldblondes Haar. Doch das, was mir als Allererstes aufgefallen ist, sind seine Augen. Ich habe immer geglaubt, dass graue Augen nichts Besonderes wären. Andere Farben stechen heraus – Bernsteinbraun, Waldgrün, Eisblau. Aber Grau? Das erschien mir immer eher langweilig. Nur, dass an der Farbe seiner Augen gar nichts langweilig ist. Zwar ist das Grau keine brennende Farbe, aber es strahlt Ruhe aus, Aufmerksamkeit, vielleicht sogar Intelligenz.
Und sie wenden sich keine Sekunde von mir ab. Er mustert mich, seit ich in sein Blickfeld geraten bin. Es sind keine flüchtigen Blicke, sondern es ist ein aufmerksames Beobachten. So, als wäre ich ein Gemälde, dessen Anblick er vollkommen in sich aufnehmen wollte.
Als sich unsere Blicke begegnen und für eine Sekunde festhalten, bin ich diejenige, die zuerst wegsieht.
»Darf ich dir Caius vorstellen?«, meint Laona und lässt sich neben mir nieder.
Jetzt verfolgt Caius auch sie mit Blicken, legt bei ihren Worten den Kopf leicht schief, sagt jedoch nichts. Ich komme nicht umhin, mich nun auch auf all das Seltsame zu konzentrieren, das mir an ihm auffällt. Irgendwie ist Caius zu ruhig, beinahe unbewegt, und doch so aufmerksam. Wenn ich in seine Augen sehe, erkenne ich, dass er denkt, dass irgendetwas in seinem Kopf vorgeht, doch ich bin noch nie zuvor einem Menschen begegnet, der so wenig davon preisgibt.
»Caius«, sagt Laona und sieht ihn bestimmt an. »Magst du dich vorstellen?«
Auch ihre Frage kommt mir seltsam vor. Als würde sie nicht mit einem Erwachsenen, sondern einem Fünfjährigen reden.
Caius wendet sich wieder mir zu. »Ich heiße Caius. Wer bist du?«
»Bea«, stelle ich mich vor und versuche, meine Verwirrung zu verdrängen. »Ich bin neu im Team. Du arbeitest auch mit an dem Projekt?«
Wieder ist seine einzige Reaktion das leichte Neigen seines Kopfes. Und dann, etwas verspätet, als würde er es ganz bewusst tun, runzelt er die Stirn.
Laona lacht leise. »Ja, das könnte man gewissermaßen so sagen. Aber offiziell arbeitet Caius nicht mit an dem Projekt. Er ist das Projekt.«
Mein Kopf ruckt zu ihr, dann zu Caius, der völlig gelassen dasitzt, dann wieder zurück. »Was?« Die Situation wird mit jeder Erklärung verwirrender, anstatt, dass irgendetwas Sinn ergibt.
»Erkläre Bea, was es mit dir auf sich hat«, fordert Laona Caius auf.
Dieser nickt. Eine Bewegung, die ich noch nicht an ihm gesehen habe. »Ich bin kein gewöhnlicher Mensch«, offenbart er. »Ich bin hier in diesem Labor von Wissenschaftlern erschaffen worden. Zuvor habe ich bloß als System auf einem Computer existiert, bis ich in diesen menschlichen Körper eingepflanzt wurde, um mich weiterentwickeln zu können.«
Kapitel 4
»Das ist … bahnbrechend, was euch hier gelungen ist! Das ist … völlig unglaublich, das …« Mir fehlen die Worte.
Nach Caius‘ Erklärung wartet ein Teil von mir die ganze Zeit darauf, dass sich das alles als Witz entpuppt und sich bloß jemand einen Spaß mit mir erlauben möchte. Nur, dass sämtliche Tatsachen dagegensprechen: Die Hightech-Ausstattung, die verschiedenen Gruppen, die Verschwiegenheitserklärung, die ich unterzeichnet habe. Mir ist klar, dass das nicht gespielt sein kann, und doch gelingt es mir kaum, zu begreifen, was es bedeutet.
Wenn dieser Caius kein echter Mensch ist …
Zum wiederholten Mal zieht eine Reihe von Bildern durch meinen Kopf. Roboter, die lästige Alltagsaufgaben für uns erledigen; künstliche Intelligenzen, die neben uns existieren, als hätten sie ein Bewusstsein; hochintelligente Wesen, die die Weltherrschaft übernehmen oder die Menschheit vernichten.
So sehr ich es auch versuche – ich kann meine Gedanken nicht ordnen. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu all dem stehen soll. Ich weiß nur, dass es unfassbar ist, dass es einen solchen Durchbruch in der Forschung gibt.
»Ich weiß.« Laona lächelt mir behutsam zu. »Selbst für mich, die jeden Schritt von Caius‘ Entwicklung mitverfolgen konnte, die alles miterlebt hat, ist es immer wieder ein Wunder, ihn zu beobachten. Seine Reaktionen, die Bewegung seiner Augen … Für jemanden, der so etwas unvorbereitet und zum ersten Mal sieht, muss das unfassbar sein.«
Wir haben Caius in dem anderen Raum zurückgelassen und sitzen jetzt in Laonas Büro – nicht in dem Teppichboden-Raum, sondern einem modernen hier oben. Ich denke, sie weiß, dass ich erst einmal ein bisschen Abstand zu ihm brauche.
»Ja, unfassbar, nur …« Ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll, weil mir bewusst ist, dass sie in keinem Fall einfach zu beantworten ist. »Wie ist euch das gelungen? Also, ich meine, ich kenne mich jetzt nicht sonderlich gut mit dem KI-Thema aus, aber ich weiß, dass es so etwas noch nie gegeben hat.«
Laona nickt. »Du hast recht. Es gab zwar immer schon Fortschritte in dem Bereich, doch all diese künstlichen Intelligenzen waren keine echten KIs, um es so zu sagen. Auf Laien mochten sie zweifelsohne intelligent wirken. Computer, die lernen, und das so gut, dass es ihnen gelingt, Menschen in komplexen Spielen mit nahezu unendlichen Spielzugkombinationen zu schlagen. Dass sie scheinbar bessere Antworten geben als jede Suchmaschine, oder Bilder generieren, die Künstler um ihren Job fürchten lassen. Aber sobald man sich näher mit ihnen beschäftigt, findet man diese vermeintlichen Super-Maschinen nicht. Da sind nur trockene Programmcodes und schlau genutzte Mathematik.«
Laona lächelt leicht. »Hast du schon mal bewusst mit so einer KI kommuniziert? Also nicht mit einem dieser bekannten Chatbots, die gerne genutzt werden, sondern einer, die vorgibt, ein Mensch zu sein?«
»Ich denke nicht.«
»Ich habe es probiert«, meint sie. »Als ich jünger war, am Anfang meines Studiums. Auch solche findet man im Internet – angeblich lernen sie durch diese Art der Kommunikation.«
»Und?«
»Und es war seltsam. In manchen Momenten konnten sie auf viele meiner Fragen eine so realistische Antwort geben, dass es beinahe beängstigend war, und manchmal haben sie auch von sich aus Fragen gestellt, als wüssten sie etwas über mich oder als würden sie mich tatsächlich als Menschen begreifen. Und in anderen Momenten waren sie wieder nichts anderes als Maschinen, die zwar Antworten geben konnten, aber doch nichts begriffen. Die behaupteten, Menschen zu sein, aber nicht in der Lage waren, komplexe Zusammenhänge zu verstehen.«
Laona seufzt. »Ich weiß nicht genau, was ich mir von diesen Gesprächen erhofft hatte, ich wusste schließlich, was dahintersteckte – und doch war es aus irgendeinem Grund ernüchternd, dass da gar nichts war, keine Persönlichkeit, nicht die Magie des künstlichen Lebens, die ich aus Filmen und Serien über die Zukunft kannte.«
»Aber dir ist es gelungen«, sage ich und sehe wieder Caius‘ Gesicht vor mir. »Du hast die Vorstellung in Wirklichkeit verwandelt. Die Zukunft, von der immer gesprochen wird – sie ist hier. Das ist bahnbrechend, für die ganze Welt.«
»Ja. Jetzt verstehst du, warum wir das geheim halten. Ich glaube nicht, dass die Menschen auf all die Möglichkeiten vorbereitet sind, die dadurch entstehen – gute und schlechte gleichermaßen.«
Ich nicke, bin aber in Gedanken immer noch bei meiner ursprünglichen Frage. »Ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, wie genau ihr Caius erschaffen habt.«
»Das ist auch nicht leicht herunterzubrechen«, meint Laona. »Wenn du Genaueres wissen willst, solltest du am besten zu Tim gehen, er leitet Gruppe Zwei, die der Techniker und Wissenschaftler. Aber ich kann schon einmal versuchen, dir eine grobe Vorstellung zu geben.«
»Gerne.« Nachdem ich Caius gesehen habe, werde ich mich sicher nicht bis zu einem Gespräch mit Tim gedulden können, wenn Laona mir jetzt schon die Option gibt, etwas darüber erfahren zu können.
»Okay«, meint sie. »Caius hat zuerst bloß auf dem Computer existiert. Er war einfach nur ein Programmcode. Natürlich waren darin bereits komplexe Algorithmen enthalten, die Unwissenden Intelligenz vorgaukeln konnten, aber wie bei all diesen Chatbots war da kein wirkliches Bewusstsein.«
Ich nicke langsam. So weit kann ich folgen. »Und dann?«
»Dann haben wir überlegt, was ihn von einem Menschen unterscheidet. Was wir vielleicht tun könnten, um ihn menschlicher zu machen. Um ihm die Möglichkeit zu geben, ein tatsächliches Bewusstsein zu entwickeln.«
Erkenntnis macht sich in mir breit. »Also habt ihr ihm einen Körper gebaut.«
»Nicht ganz.« Laona lächelt leicht. »Wir haben ihm ein Gehirn gebaut.«
Ich runzle die Stirn. »Und der Körper?«
»Der kam erst viel später ins Spiel. Zuerst einmal ging es darum, dass sich Caius‘ Programmcode auf natürliche Weise weiterentwickelt. Und was wäre dafür geeigneter, als zu versuchen, ein menschliches Gehirn eins zu eins nachzubauen und Caius‘ bereits existierende Algorithmen darin zu integrieren?«
»Und das ist euch gelungen?« Ich kann meine Ungläubigkeit nicht verbergen – selbst, nachdem ich Caius gesehen habe. »Ich meine, ich habe schon von Versuchen gehört, die genau darauf abzielten. Aber sie sind alle gescheitert.«
»Sie sind gescheitert, weil den Forschern die entsprechenden Ressourcen gefehlt haben«, erklärt Laona. »Für ein synthetisches Gehirn sind sehr kleine und viele Teile nötig. Winzige Computerchips oder Gebilde, die organische Materie nachahmen. Die Herstellung davon ist uns nur durch die Unterstützung von NewBrain Industries gelungen.«
»Und Caius‘ Körper?«
»Nachdem es uns gelang, das künstliche Gehirn zu erschaffen, war uns klar, dass wir ausprobieren mussten, ob es auch mit einem Körper interagieren könnte. Oder sogar, ob die Theorien wahr sind, dass ein Körper, als Möglichkeit zur Umweltinteraktion, notwendig ist, damit Bewusstsein entstehen kann. Jedenfalls«, fährt sie fort, »haben wir darüber diskutiert, ob wir auch einen Körper bauen und ihn zu einem Androiden machen, oder ob wir das Potenzial eines menschlichen nutzen sollten.«
»Und ihr habt euch für Letzteres entschieden?«
Sie nickt. »Das umzusetzen war natürlich eine Herausforderung, aber die M&Ms haben es geschafft, einen Mann zu finden, der gestorben ist, dessen Körper aber noch so jung und funktionsfähig war, dass wir ihn nutzen konnten. Wir haben nicht viel Zeit verloren. Er wurde direkt operiert und sein Gehirn durch unser künstliches ersetzt. Kurz darauf ist Caius erwacht.«
Ich verstehe Laonas Worte, und doch hilft mir das nicht, wirklich zu begreifen. Als würde sie das wissen, lächelt sie behutsam. »Lass dir das alles erst einmal durch den Kopf gehen. Falls du dann Detailfragen hast, geh lieber zu Tim. Er ist weit besser im Erklären als ich.«
»Werde ich, aber …« Ich versuche, die richtigen Worte zu finden. »Du hast gesagt, Caius hatte vorher kein Bewusstsein. Hat er das denn jetzt? Mit Körper?«
»So ist es zumindest möglich.«
Ich runzle die Stirn. »Das heißt, du weißt es nicht? Ob da tatsächlich etwas ist – oder ob die Berechnungen der Chips in seinem künstlichen Gehirn einfach nur so gut sind, dass er menschlich wirkt?«
Für einen Moment bleibt Laona stumm. Dann: »Manche Fragen sind nicht so simpel zu beantworten, Bea. Hast du dich schon einmal gefragt, was hinter unserem Bewusstsein steckt? Hinter all diesen Prozessen im Gehirn, die wir kaum nachvollziehen können? Denn wenn man all das aufs Kleinste herunterbricht, wenn man sich unsere Neuronen ansieht – mehr noch, die verschieden geladenen Moleküle, die sich aufgrund einfachster Regeln bewegen –, dann ist das am Ende eigentlich nichts weiter als eine Art Rechnung. Vielleicht sind wir Menschen nichts weiter als eine Rechnung. Eigentlich absurd, dass wir in unseren Spekulationen über die Zukunft die KIs als unechte, kalte Lügner bezeichnen, die uns etwas vorspielen. Wenn es doch, was das betrifft, vielleicht gar keinen Unterschied zwischen ihnen und uns gibt.«
~
Ich habe Laonas Worte immer noch nicht ganz verdaut, also beschließe ich, das Thema nicht noch einmal anzusprechen. Erst muss ich selbst über alles nachdenken, dann kann ich immer noch Tim fragen.
Stattdessen konzentriere ich mich lieber auf den nächsten großen Punkt, der noch ungeklärt ist. »Und was habt ihr mit Caius vor? Wieso bin ich hier?«
Kurz sieht Laona mich an, dann wendet sie den Blick ab und schaut irgendwo ins Nichts. »Weißt du, was Einsamkeit ist?«
Mir ist klar, dass diese Frage nicht wirklich an mich gerichtet ist, doch das hindert die Bilder nicht daran, sich aus meinen Erinnerungen in die Gegenwart zu drängen.
Ich stehe an dem gewohnten Platz im Zentrum meines Zimmers, doch meine Umgebung verformt sich und ich mit ihr, ich altere, bin fünf, zehn, fünfzehn, stehe zwischen Leinwänden und Farben, zwischen Büchern und Musik. Ich starre aus dem Fenster und höre das Ticken der Uhr in meinem Kopf genauso laut wie meinen Herzschlag, fühle die Zeit, die wie Sand zwischen meinen Fingern zerrinnt, ihre Stimme in meinem Ohr.
Weißt du, was Einsamkeit ist?
»Einsamkeit ist etwas Schreckliches«, fährt Laona fort. »Vielleicht, weil wir Menschen ihren Schmerz selbst erschaffen haben. Durch das Nichtstun, durch das Warten, ganz gleich, ob man selbst einsam ist oder jemand, den wir kennen und von dem wir wissen, dass er es nicht sein müsste. Warum, glaubst du, lassen wir Menschen in Einsamkeit leiden?«
Egoismus. Die Antwort ist sofort da, aber ich bringe sie nicht über die Lippen.
Laona scheint meinen inneren Konflikt zu bemerken und meint: »Es ist ganz einfach: Wir stellen unsere Bedürfnisse über die eines anderen. Macht uns das zu einem schlechten Menschen?«
»Nein.« Dieses Mal ist das Wort sofort ausgesprochen, aber nicht, weil ich mir sicherer bin. Vielmehr habe ich das Gefühl, mich selbst rechtfertigen zu müssen, auch wenn wir über etwas ganz anderes sprechen. »Nur, weil wir uns um unsere Bedürfnisse kümmern, sind wir nicht schlecht, oder? Wir können schließlich nicht unser ganzes Leben nach anderen ausrichten.« Noch während ich das sage, sehe ich meine Zukunft vor mir. Ich, die sich dafür entschieden hat, an der Universität zu studieren, die einen guten Job hat und viel Geld verdient. Ich kann mich lächeln sehen, aber weiß nicht, ob ich mir den Ausdruck abkaufen soll.
Trotzdem, sage ich mir, selbst wenn ich mich für diesen Weg entscheiden würde, es wäre nicht nur für meine Eltern.
Laonas Stimme holt mich zurück ins Jetzt. »Richtig, wir können das nicht. Aber was wäre, wenn es Wesen gäbe, die das können? Die ihre Erfüllung darin finden, anderen beizustehen, anderen den Schmerz der Einsamkeit zu nehmen? Wesen, bei denen Egoismus und Selbstlosigkeit kein Gegensatz, sondern ein Synonym sind?«
Ich nicke, um zu signalisieren, dass ich begreife. »So wollt ihr Caius also einsetzen – um Menschen zu helfen.«
Laona verengt kurz die Augen. »Überrascht dich das?«
»Nein«, beeile ich mich zu sagen. »Es überrascht mich nicht, dass ihr Menschen helfen wollt. Nur, dass ihr es auf diese Weise tut. Wenn ich etwas über KIs gelernt habe, ging es auch immer darum, Menschen das Leben zu erleichtern. Sei es durch die Fähigkeit, Tumore zu erkennen, oder durch die Bequemlichkeit selbstfahrender Autos. Das hier erscheint mir so … ich weiß nicht, gewöhnlich – irgendwie weniger Science-Fiction-mäßig, als ich gedacht hätte.«
»Selbstfahrende Autos und Tumorerkennung sind inzwischen nicht mehr weit von der Realität entfernt. Vielleicht, weil es viel einfacher ist, etwas dergleichen zu programmieren. Aber mir kam es immer falsch vor, den wissenschaftlichen Fortschritt in diese Richtung zu lenken. Wozu Science-Fiction und beeindruckende technische Innovationen, wenn wir schon im einfachen Miteinander, Mensch zu Mensch, scheitern? Ich denke, wir müssen unten und nicht oben ansetzen, um die Welt zu einer besseren zu machen. Ganz gleich, wie unmöglich es im ersten Moment erscheinen mag, aus einem Programm etwas Menschenähnliches zu machen.«
»Also wenn du vor deinem Team auch solche Reden hältst, kann ich verstehen, wie es euch gelungen ist, Caius zu erschaffen.«
Ich erwarte, dass Laona schmunzelt, doch sie seufzt nur. »Es ist schön, dass du es so siehst – meine und Tims Leute tun das natürlich auch. Ich verstehe nur nicht, warum das nicht noch andere begreifen.«
»Du sprichst von den Investoren. Von Herrn Prager und NewBrain Industries.«
Sie nickt langsam, doch dann verändert sich ihre Haltung. »Lass uns jetzt nicht über sie reden. Die M&Ms vermiesen mir ohnehin schon zu viel von meinem Tag.«
Der Spitzname bringt mich zum Lächeln. »Okay. Dann kannst du mir ja endlich erklären, was meine Aufgabe hier ist.«
~
Ganz simple Schritte, hat Laona es genannt.
1. Zeit mit Caius verbringen und möglichst viel mit ihm interagieren.
2. Seine Reaktionen und sein allgemeines Lernverhalten beobachten und Auffälligkeiten dokumentieren.
3. Allgemein einschätzen, wie bereit Caius ist, die ihm zugedachte Aufgabe als Gefährte eines Menschen zu erfüllen.
Die Schritte sind auf der einen Seite simpel, weil sie klar und kurz formuliert sind. Auf der anderen aber schwierig, weil sie mir sehr viel Freiraum lassen.
»Einfach ausprobieren«, hat Laona mir geraten. »Wir alle sind schon mit ihm in Kontakt getreten und haben mit ihm gesprochen, aber wir arbeiten an weiteren Systemen, und wir brauchen jemanden, mit dem er viel Zeit verbringt, mit dem er spielen und lernen kann. Auch wenn er nicht so aussieht, ist er teilweise nicht anders als ein Kind.«
Ausprobieren wird genügen müssen, zumindest für heute. Wenn ich einen Eindruck habe, wie gut er bereits versteht, kann ich mir für die nächsten Tage etwas anderes einfallen lassen.
Ich laufe allein durch den Flur und trete erneut in das fast leere Zimmer.
»Wir haben bisher immer nur dort mit ihm gesprochen«, hat Laona erklärt. »Damit er nicht zu viele Reize gleichzeitig verarbeiten muss. Wir hoffen natürlich, dass sich das mit der Zeit ändert.«
Caius sitzt vollkommen unbewegt da, als ich mich ihm gegenüber niederlasse, doch seine Augen verfolgen meine Bewegungen.
»Weißt du, wer ich bin?«
Kurz bleibt er still, und ich will schon etwas anderes sagen, doch dann öffnet er den Mund. »Du bist Bea. Du bist neu im Team.«













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















