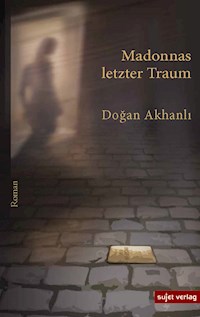
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sujet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Sabahattin Alis "Madonna im Pelzmantel" gilt als größte Liebesgeschichte der türkischen Literatur. Im burlesken Berlin lernt Raif Efendi Maria Puder kennen und verfällt ihr… Jahrzehnte später macht sich ein Schriftsteller auf die Suche nach der mysteriösen Frau. Ist Maria Puder bloß eine Romanfigur oder hat sie wirklich gelebt? War sie vielleicht unter den jüdischen Flüchtlingen auf der "Struma", die 1942 vor Istanbul versenkt wurde? Doğan Akhanlı erzählt von einer obsessiven Liebe und einer verzweifelten Suche zwischen Deutschland, Polen und der Türkei und begibt sich, zusammen mit uns, auf eine große, ergreifende Reise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roman
Madonnas letzter Traum
Doğan Akhanlı
Aus dem Türkischen von
Recai Hallaç
Originaltitel:
Madonna'nın Son Hayali
© Kanat Verlag, Istanbul, 2005
© Olasılık Verlag, Ankara, 2016
Die Übersetzung aus dem Türkischen wurde mit Mitteln
des Auswärtigen Amts unterstützt
durch Litprom e.V. – Literaturen der Welt
CIP - Titelaufnahme in die Deutsche Nationalbibliothek
Akhanlı, Doğan
Madonnas letzter Traum
Aus dem Türkischen von Recai Hallaç
ISBN 9783962020422
© der deutschen Ausgabe 2019 by Sujet Verlag
Umschlaggestaltung: Tarlan Mirshekari
Satz und Layout: Singa Feder, Larissa Michaelis
Lektorat: Susann Minter, Gerrit Wustmann
Druckvorstufe: Sujet Verlag, Bremen
Printed in Europe
1. Auflage 2019
www.sujetverlag.de
Anmerkung des Übersetzers
Bei der Lektüre dieses Romans werden Ihnen Sätze begegnen, die kursiv gedruckt und in Anführungszeichen gesetzt sind. Diese stammen aus einem der bedeutendsten türkischen Prosawerke des 20. Jahrhunderts:
»Die Madonna im Pelzmantel«, veröffentlicht im Jahre 1943, nachdem es 1940 und 1941 in der Tageszeitung »Wahrheit« als Fortsetzungsroman erschienen war.
Doğan Akhanlı greift die Liebesgeschichte zwischen Maria Puder, der Madonna im Pelzmantel, und Raif Efendi auf, verknüpft sie mit dem Leben ihres Autors Sabahattin Ali und begibt sich, zusammen mit uns, auf eine große, ergreifende Reise.
Für die Passagiere der Struma,
Sabahattin Ali
und meine Mutter
Prolog
SO IST MARIA PUDER NICHT GESTORBEN
»Der Morgen graute.«
Der seit Monaten vermisste Autor von Die Madonna im Pelzmantel wurde am Mittwoch, den 16. Juni 1948, von einem namenlosen Hirten gefunden. So wurde erzählt. Tigris, der Hund des Hirten, der in einem Gebirgspass nahe der bulgarischen Grenze seine Herde hütete, schlüpfte ins Gebüsch und fand ihn unter einer Buche. Der Ermordete war ein Haufen von zum Teil zersplitterten Knochen. Einige Gesichtsknochen fehlten, der Schädel war eingedrückt, auf der Innenseite der Delle war ein Riss und um den Riss herum rote Farbe. So wurde erzählt. Seine Knochen, seine in Fetzen aufgelöste Jacke, seine Hose, sein weißes Hemd mit gestärktem Kragen, sein weißes Unterhemd und die weiße Unterhose wurden in einen Sack aus grobem Leinen gesteckt und ins städtische Krankenhaus geschickt. Das städtische Krankenhaus war ein Ort mit sechzig Betten und zwei Ärzten. Die Autopsie wurde von einem Chirurgen und einem Internisten durchgeführt. Die Röntgenuntersuchung der Knochen, die Maße und Proportionen der langen Knochen und die Struktur der Gelenkknochen offenbarten, dass der Ermordete männlich, mittelgroß und um die vierzig war. Die Bevölkerung in den umliegenden Dörfern und Kleinstädten wurde informiert und Angehörige von Vermissten wurden aufgefordert, sich auf der Wache zu melden. So ging ein Bauer auf die Gendarmeriewache und meinte, der Tote könne sein seit Monaten vermisster Vater sein. Der Wachkommandant empfahl ihm, seinen Vater anderswo zu suchen. Denn es hieß, dass man bei dem Ermordeten eine Pfeife mit gebrochenem Kopf, eine Rundbrille mit zerbrochenem Glas, ein Buch, einen Füller mit eingetrockneter Tinte und ein Notizbuch gefunden hatte. Das alles würde bedeuten, dass er Schriftsteller oder Journalist und mit großer Wahrscheinlichkeit aus Istanbul war. Denkbar war auch, dass es sich um einen Ausländer mit Türkischkenntnissen handelte. Denn der einzige lesbare grüne Satz in seinem Notizbuch lautete: »So ist Maria Puder nicht gestorben.«
Sechs Monate später wurden die meisten Gerüchte bestätigt. Die Zeitungen berichteten, der Mörder sei in Istanbul gefasst worden. Dieser gestand, er habe den berühmten Schriftsteller Sabahattin Ali umgebracht, »weil er seine nationalen Gefühle verletzt hatte«. Er war eigentlich Unteroffizier. Wegen Waffendiebstahls aus dem Lager war er aus der Armee entlassen worden, hatte danach viele verschiedene Jobs angenommen und wurde schließlich Schmuggler. Alles konnte er über die Grenze schmuggeln: Waffen, Rauschgift, Textilien, Tabak, Menschen.
Am Montag, den 12. April 1948, war er mit einem Mann nach einem langen Marsch am Ende des Weges angekommen und als sich in der Ferne die bulgarischen Grenztürme abzeichneten, machten sie zwischen Hainbuchensträuchern Rast. Dort verriet der Mann, er sei der Schriftsteller Sabahattin Ali. Und der Schmuggler geriet außer sich, bevor er zum Mörder wurde. Denn schon lange hatte er sich immer wieder vorgestellt, die Redaktion der Zeitung Marko Pascha mitsamt aller, die sich darin befinden, in Brand zu stecken. Nun plante also dieser Mann, den er zu Asche verbrennen wollte, der finstere Ziele gegen die Türkei verfolgt, dieser minderwertige Bastard, diese Marionette der Russen, der es sich mit Wodka, Kaviar und slawischen Schönheiten gutgehen lassen wird, nach Bulgarien zu fliehen, um dort die unschuldigen Türken zu organisieren und einen Aufstand gegen die Türkei anzuzetteln. Der Mörder, dem in diesem Augenblick klar wurde, dass er die Zukunft seines Landes nicht für ein paar Kröten aufs Spiel setzen durfte und gerade im Begriff war, einem solchen Bösewicht zur Flucht zu verhelfen, fühlte sich elend, ihm wurde schwindlig, sein Blick trübte sich, und das steigerte sich so sehr, dass ein Vogel kein Vogel, eine Blume keine Blume und der Mann, dessen Kopf er gleich zertrümmern würde, kein Mensch mehr war, sondern sich in einen Riesen, dessen Oberlippe gegen den Himmel strebte und dessen Unterlippe zur Erde herabhing, in einen Menschenfresser, einen Dämon, eine böse Fee und in andere hässliche Wesen verwandelte – und ihm auf den Pelz rückte. Dem Mörder gefror das Blut in den Adern, seine Lippen wurden trocken, und schließlich fand er darin Rettung, sich seinem Gott anzuvertrauen und die Augen zu schließen. Zum Glück nahm ihn sein Gott, gelobt sei sein Name, in seinen Schutz. Sonst wäre er dort, auf der Stelle, grausam verendet. Als er wieder die Augen öffnete, sah er, dass der Mann, den er gleich kaltmachen würde, sich an eine Buche gelehnt hatte und ein Buch las. Und hin und wieder kritzelte er etwas in sein Notizbuch. Und hin und wieder schwafelte er über die Türkei. Neben ihm eine prallgefüllte Tasche. In einer so vollen Tasche können sich nur geheime Dokumente befinden, dachte der Mörder, dessen Aufregung im Zuge dieser Erkenntnis in Seelenschmerz umschlug. Er fing an zu zittern. Plötzlich fiel ihm auf, dass er einen langen Stock in der Hand hielt; er schaute auf den Stock, dann auf die Tasche mit Dokumenten über die geheimsten Geheimnisse des Landes und dann auf den Verräter, der mit seinem Füller irgendetwas schrieb. Er stand auf, begann herumzulaufen; bei jedem Schritt steigerte sich seine Nervosität, es wurde ihm schwarz vor Augen; gefesselt von diesem Gedanken an die Nation verlor er auf einmal die Selbstbeherrschung und schlug mit seinem Stock auf die linke Seite des Kopfes des lesenden Mannes ein.
I
MARIA PUDER und SABAHATTIN ALI
April 1948
Ein unnützer Mann
Ich erschrak. Der Stock des Mörders hatte meinen Kopf lädiert. Mein Gesicht, meine Brille, mein Ohr waren voller Blut. Der Mörder würde merken, dass ich noch leicht atme und noch einmal kräftig auf die gleiche Stelle zuschlagen, ich würde auf meine rechte Seite niedersinken, Blut würde mir aus Mund und Nase strömen und ich würde noch vor dem dritten Hieb auf meinen Nacken aus dem Leben scheiden, das wusste ich.
Der Schlag auf die linke Seite meines Kopfes ließ mich in einen nachtblauen Dunst und tiefe Trauer hinabstürzen. Ich wünschte, die Zeit würde stillstehen. Ich war am Boden zerstört, nicht aus Furcht vor dem Tod, sondern weil ich die Lebensgeschichte Maria Puders, der Frau, in die ich verliebt war, mit meinem eigenen Stift verfälscht hatte und jetzt nicht mehr würde korrigieren können. So war Maria Puder nicht gestorben und es gab auf der ganzen Welt nur noch zwei Menschen, die wussten, wie sie wirklich starb. Einer von ihnen war am letzten Tag ihrer letzten Reise an ihrer Seite. Die Katastrophe, die Maria Puder den Tod brachte, ließ ihn für immer verstummen, er verlor sein Vertrauen in alles, was sich bewegte, außer in seinen Hund. Er schwieg, weil er nicht über die Worte verfügte, um von dem Erlebten zu erzählen. Nun sollte er, geplagt von Schuldgefühlen, bis zu seinem letzten Atemzug umsonst eine Antwort auf diese eine Frage suchen: Warum habe ich als Einziger von den 769 Menschen überlebt, die in diesem schwimmenden Sarg 71 Tage unterwegs waren?
Aber ich war Schriftsteller. Maria Puder war nicht nur die Heldin der größten Liebe, die ich je erlebt hatte, sondern auch die Heldin meines Romans. Ich verfügte über die Worte und die Macht, um zu bestimmen, wie Maria Puder starb oder sterben sollte. Schließlich war ich derjenige, der sie mit dem Teig der Wörter formte, der sie neu erschuf. Sie war meine Geliebte, ich war ihr Gott. Aber es gab mächtigere Götter, die zwar selbst nichts erschaffen konnten, aber herrschen über jene, die etwas erschufen. Was von mir, meiner Kreativität, verlangt wurde, war eine packende Liebesgeschichte, die sich von allem Politischen fernhielt. Das war die Bedingung des Chefs der Zeitung Wahrheit. Für Mehl, Zucker und Milch musste ich mich daran halten.
Damals hatte ich noch keine Schreibmaschine. Doch selbst wenn ich eine gehabt hätte, würde ich mit dem Füllfederhalter mit der grünen Tinte schreiben, den ich auch für den Satz »So war Maria Puder nicht gestorben« benutzte. Bevor ich anfing, für die Montagsausgabe der Wahrheit den ersten Teil zu schreiben, die ersten sieben Spalten, spielte ich eine Weile mit meiner Tochter und beruhigte ihre Mutter. Sie brauchte sich keine Sorgen zu machen, die Geschichte würde geschrieben werden, auf unserem Tisch würden wir Mehl, Zucker und Milch nicht missen.
Die Ereignisse spielten sich in weiter Ferne ab, in Berlin, der Stadt, deren Straßen im Unendlichen endeten. Wie sollte ich also vorgehen, um glaubhaft zu sein? Wo sollte meine Erzählung beginnen? Wie wäre es, wenn sie fünfzig Jahre später im Schatten einer Buche, oder – wer weiß – mit der Beschreibung eines Menschen anfangen würde, der im letzten Waggon eines nach Berlin rauschenden Zuges die Biographie eines ermordeten Schriftstellers liest? Und wenn dieser Lesende, ähnlich wie ich, vielleicht ein Schriftsteller wäre? Einer, der vom Taumel erfasst wird, weil er eine Geschichte, die er früher einmal geschrieben hat, jetzt tatsächlich erlebt? Wenn er zum Beispiel Alma, der Frau mit den blauen Augen, die er sich in seiner Phantasie ausgemalt, mit der er in seiner Phantasie geschlafen hat, genauso begegnet, wie er es sich damals vorgestellt hat? Würde sich jemand finden, der an eine Begebenheit glaubt, die niedergeschrieben wurde, noch bevor sie sich ereignete?
Ich beschloss, die Frage nach der Zeit später zu klären und notierte den ersten Satz: »Unter all den Menschen, denen ich zufällig begegnet bin, hat mich einer wohl ganz besonders beeindruckt.« Das war ein sehr gewöhnlicher Satz und er zog mich mitten ins Geschehen hinein. Doch wie weit sollte ich mich hineinziehen lassen? Dieser »zufällig begegnete«, eigentlich nicht existierende, mich trotzdem ganz besonders beeindruckende Mensch durfte nicht ich selbst sein. Das wäre ungeheuerlicher Narzissmus. Ich durfte aber auch nicht der Held der Geschichte sein. Denn würde ich mich zum Liebhaber Maria Puders machen, würde ich meine über alles geliebte Ayşe kränken, sie verletzen. Der Held sollte jemand sein, der mir ähnlich war, Wesenszüge von mir trug, aber eben ein anderer ist.
Nachdem ich nun beschlossen hatte, an meiner Geschichte als ihr Erzähler, Zeuge, namenloser Autor teilzunehmen, wollte ich im zweiten Satz die Aufmerksamkeit auf die männliche Hauptfigur lenken. Der zweite Satz musste ohnehin den ersten unterstützen und dem Weg folgen, den dieser vorgezeichnet hatte. »Obwohl seither Monate vergangen sind«, schrieb ich, »lässt er mich nicht mehr los.«
Sogleich spross der dritte Satz und mein Held gab sich einen Namen: »Wann immer ich mit mir allein bin, erscheint vor meinen Augen das unschuldige Gesicht des Raif Efendi mit seinem etwas entrückten Blick, jedoch bereit zu lächeln, sobald er auf einen anderen Menschen trifft.«
Kaum hatte mein Held seinen Namen gefunden, begann er, Konturen anzunehmen. Sein Blick war meinem ähnlich, sehr weich, sogar weiblich. Ich zögerte, das Wort »weiblich« hinzuschreiben. Viele Leser könnten sich abstoßende Szenen ausmalen. Es war aber auch nicht möglich, Raif Efendi mit »männlichen« Blicken auszustatten, nur um ihm den Arsch zu retten. Denn das hätte eine andere Wirkung auf Maria Puder gehabt, der er Monate später in Berlin begegnen sollte. Sie war eine freie Frau, die sich keinem Mann unterordnete, rohe Männer nicht mochte und irgendwann auf den nachfolgenden Seiten diese Frage stellen sollte: »Warum sollen immer wir fliehen und ihr uns nachjagen? Warum sollen immer wir uns ergeben und ihr uns gefangen nehmen? Warum soll selbst in eurem Flehen etwas Gebieterisches und selbst in unserer Ablehnung etwas Hilfloses sein?« Nicht, weil ich um den Allerwertesten des Raif Efendi besorgt war, sondern eher befürchtete, man könnte mich mit ihm identifizieren, beschloss ich, ihn als eine unscheinbare Figur zu entwerfen. So musste er zu einem der Menschen werden, »die nichts Bemerkenswertes an sich haben, die wir jeden Tag zu Hunderten um uns sehen und keines Blickes würdigen«. Kurz: »Ein unnützer Mann«.
Das nun niedergeschriebene Wort »unnütz« brachte ein neues Problem mit sich. Das Gesicht des Raif Efendi entfernte sich von meinem und nahm allmählich die Züge des Chefs der Wahrheit an. Damit verschwanden auch die positiven Gefühle, die ich für ihn hegte. So sehr, dass ich ganz oben auf dem Papier in Großbuchstaben als Titel notierte: »EIN UNNÜTZER MANN«.
Dann habe ich es wieder geschwärzt. Die Lettern T und Z prallten nämlich unhaltbar aufeinander. Ich vertraute darauf, dass die Geschichte ihren Titel schon finden würde, schwächte meine Einstellung zu Raif Efendi ab und schrieb weiter.
Die Geschichte besagte, dass ich bis vor kurzem ein gewöhnlicher Bankangestellter war. (Wer mich kennt, weiß, dass ich bei einer Bank gearbeitet habe.) Aber die Begegnung mit Raif Efendi durfte nicht an meinem Arbeitsplatz stattfinden. Denn einige der Angestellten, die kurz vor der Rente standen, vielleicht sogar alle, könnten fälschlicherweise annehmen, ich hätte mich bei seiner Beschreibung von ihnen inspirieren lassen. Also musste ich mir in meiner Phantasie dringend einen neuen Job suchen. Es könnte zum Beispiel sehr wohl sein, dass ich auf der Straße einen alten Schulkameraden getroffen habe. Er könnte mir einen Job in seiner Firma besorgen, schließlich war er dort stellvertretender Direktor. Da er nun unnötigerweise in das Geschehen eingestiegen war, brauchte auch dieser alte Schulfreund einen Namen. Ich ließ ehemalige Freunde Revue passieren. Es fiel mir schwer, ein Gesicht und einen Namen zu finden, die zu diesem Charakter passen würden. Mein Freund, der in der Geschichte unsympathisch, rücksichtslos, geldgierig und hochnäsig sein sollte, durfte aber auch nicht ohne Namen bleiben, dachte ich gerade, als mir plötzlich Hamdi Bey einfiel, der Chef der Wahrheit. So wurde Hamdi Bey »stellvertretender Direktor einer Firma in Ankara, die Vermittlungsgeschäfte für Maschinen et cetera betrieb und gleichzeitig im Forst- und Holzgeschäft tätig war«. Und nun musste ich an diesem sonnigen Abend hinaus auf die Straßen Ankaras. Es war Herbst. Die Sonne stach durch den Dunst, der über den Akazien und Kiefern lag, und blendete mich. Ich verspürte Mitleid mit mir selbst. Man hatte mich unter dem Vorwand der Sparmaßnahmen entlassen und kaum eine Woche später einen anderen eingestellt. Warum wurde nicht gewürdigt, dass ich schreiben konnte, dass man möglicherweise noch in vielen Jahren meine Gedichte lesen würde? Wie viele Menschen gab es im ganzen Land, die Goethe, Schiller, Hugo, Turgenjew, Klein und sogar Fontane, von dem kein einziges Buch auf Türkisch vorlag, gelesen hatten? Und warum war die Sonne, die sich in den Fenstern des Volkshauses widerspiegelte und seine Fassade aus weißem Marmor blutrot färbte, so traurig? Ein vorbeifahrendes Auto hupte, ich sah hin und erkannte den Inhaber der Zeitung Neues Anatolien, der mich unverschämt angrinste. Ich sagte im Stillen »verpiss dich, du Schuft!« und tat so, als hätte ich ihn nicht gesehen. Seinetwegen war ich monatelang im Gefängnis gewesen. Weil er nach fünfzehn Folgen meines Fortsetzungsromans Yusuf immer noch nicht bezahlt hatte, hatte ich nicht mehr geliefert. Statt endlich zu zahlen, hatte er mich angezeigt und beschuldigt, bei einer Zusammenkunft mein Gedicht »Nachricht aus der Heimat« vorgetragen zu haben; dazu hatte er zwei falsche Zeugen gefunden. Angeblich hätte ich mit den Versen »Ist das Blut endlich verebbt, das in Strömen floss? / Hat man sie erreicht, die hehren Ziele?« eine beleidigende Anspielung auf Mustafa Kemal Atatürk gemacht. Dabei hatte ich diese Verse über die Bektaschis geschrieben und hatte nicht vor, den Staatspräsidenten auch nur andeutungsweise zu beleidigen. Vor dem Gericht habe ich mich gut verteidigt, trotzdem musste ich in den Kerker von Sinop. Dort blühten weder Blumen, noch schwebten Vögel über mir, noch leuchteten die Sterne. Dort zogen sich die Tage endlos in die Länge. Dort verbrachte ich die Nächte, indem ich den ungestümen Wellen lauschte, die die Mauern des Kerkers streiften, an den Gittern ausharrte, bis der Himmel sich blau färbte, während ich lautlos schluchzte, damit man mich nicht weinen hörte.
Der hupende Wagen blieb etwas weiter entfernt stehen, eine Tür wurde geöffnet und die Person, die eigentlich der Dreckskerl war, der mich angezeigt hatte, aber jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, sich in meinen Schulkameraden Hamdi verwandelte, streckte seinen Kopf hinaus und rief mich zu sich.
»Ich ging auf ihn zu.«
Jetzt war der Weg für eine Begegnung mit Raif Efendi geebnet. Hamdi könnte mich ja, durchaus möglich, zu sich nach Hause einladen wollen und mich zum Einsteigen auffordern, wir würden einander erst nach dem Befinden fragen und dann könnte er erfahren, dass ich arbeitslos bin und sagen: »Heute Abend reden wir darüber und finden schon was«, worauf ich seine selbstsichere und selbstzufriedene Art beneiden würde. Da wären wir auch schon bei ihm angekommen. Hamdi könnte mich seiner »nicht gerade schönen, aber netten Frau« vorstellen, und um zu zeigen, was für ein glückliches Familienleben er führt und um mir einen Stich ins Herz zu versetzen, könnte er, ohne sich im Geringsten zu genieren, in meiner Anwesenheit seine Frau küssen. Aber warum hat mich Hamdi seiner Frau nicht vorgestellt? Warum ist er duschen gegangen und hat mich wie bestellt und nicht abgeholt mitten in dem Zimmer zurückgelassen? Wollte er mir dadurch etwa klarmachen, dass er ganz oben und ich ganz unten war? Und seine Frau stand an der Tür und musterte mich unauffällig. Guck ruhig weiter, dachte ich, wenn du wüsstest, dass ich Schriftsteller bin, hättest du anders geguckt, hättest wer weiß welche intimen Bilder und unzüchtigen Filme im Kopf gehabt. Für einen Moment trafen sich unsere Blicke. Nun schaute sie mich anders an. Als hätte sie meine Gedanken gelesen, bequemte sie sich nicht einmal zu sagen: »Bitte, nehmen Sie Platz!«, bevor sie sich entfernte, um Hamdi abzutrocknen.
Ich war empört. Ich schimpfte eine ganze Seite lang über Hamdi, seine Frau und die Mühsal des Lebens und schritt langsam zur Tür. »Doch in diesem Augenblick brachte eine alte Frau vom Land mit weißer Schürze und Kopftuch, mit ihren geflickten schwarzen Strümpfen ganz leise einen Kaffee.« Dieser Satz gefiel mir nicht. Er klang so, als hätte die alte Frau den Kaffee mit ihren geflickten schwarzen Strümpfen gebracht, aber ich fand es nicht nötig, ihn zu korrigieren. Es war ohnehin fraglich, ob ich das Geld für den Text tatsächlich bekommen würde. Würde ich über jeden Satz lange nachdenken, könnte ich bis Montag unmöglich die sieben Spalten schaffen. Ich brauchte tatsächlich einen Job, nicht nur, um Raif Efendi kennenzulernen. Doch die Zufälle des wirklichen Lebens dienten nur dazu, einem Ärger zu bereiten. Da kam Hamdi herein, schon längst fertig geduscht und von seiner Frau abgetrocknet. Mit einer Hand kämmte er sein nasses Haar, mit der anderen knöpfte er sein Hemd zu. Obwohl es gar nicht nötig war, fragte er wieder, wie es mir ging und ich antwortete genauso beiläufig, wie er gefragt hatte. Auf mich herabzuschauen hatte ihn so glücklich gemacht, dass er sich wünschte, er könnte die Zeit anhalten. Ich dagegen konnte es kaum erwarten, mich von dieser nervtötenden Stimmung zu befreien, und verfasste eine sieben Zeilen lange Schimpftirade gegen Hamdi. Wahrscheinlich konnte Hamdi meine inneren Gespräche genauso gut hören wie seine Frau, denn auf einmal erinnerte er sich daran, dass ich Schriftsteller bin und fragte: »Schreibst du gerade irgendwelche Texte?« Meiner Antwort »Hin und wieder … Gedichte, Erzählungen« begegnete er mit einer weiteren Stichelei: »Und bringt das wenigstens was ein?«, sodass es mich danach gelüstete, ihm eine reinzuhauen. Aber ich bewahrte meinen Anstand, denn Hamdi hatte mir noch keinen Job verschafft. Ich hatte den schweigsamen, abwesend wirkenden, gleichgültigen Raif Efendi mit seinen grauen Haaren und seiner Hornbrille noch nicht kennengelernt, noch nicht erfahren, dass er bei der Firma als Übersetzer für Deutsch arbeitete und war noch nicht Zeuge geworden, wie er »einen Brief über die Eigenschaften des über den jugoslawischen Hafen Susak gelieferten Eschen- und Tannenholzes oder über die Funktionsweise von Bohrmaschinen für Bahnschwellen mit Leichtigkeit übersetzen konnte«. Ich hatte immer geglaubt, der einzige Mensch in diesem Land zu sein, der Romane auf Deutsch liest, aber verglichen mit dem Deutsch des Raif Efendi war meines nicht der Rede wert. Mir war klar, dass ich keine Gelegenheit haben würde, ihn richtig kennenzulernen. Denn ich musste erfahren, dass er mit seiner Frau, seinen beiden Töchtern, seiner Schwägerin und seinem Schwager zusammen wohnte. Aber ich musste so schnell wie möglich sein Vertrauen gewinnen und mir sein Notizbuch mit seinen Aufzeichnungen verschaffen, die er sein ganzes Leben lang gemacht hatte, damit ich mit der eigentlichen Geschichte beginnen, über die unvergleichliche Liebe erzählen konnte, die ich mit Maria Puder erlebt hatte.
Das Notizbuch des Raif Efendi
Nachdem ich sechs Millionen Seiten nachgedacht und zweiundvierzig Seiten geschrieben hatte, konnte ich das Notizbuch des Raif Efendi ergattern. Das schaffte ich, indem ich sein Vertrauen gewann. Raif Efendi war krank. Ich kann nicht sagen, ob er seinen nahenden Tod spürte oder nicht, aber ich hatte sein Schicksal schon längst bestimmt und wusste, ob sein Tod – wenn er denn sterben musste – durch eine Krankheit oder einen seltsamen Mord eintreten sollte. Eigentlich wäre es schön gewesen, mit dem Satz anzufangen: »Eines Tages las ich ein Notizbuch, und mein ganzes Leben veränderte sich.« Aber dann hätte ich ein Buch verhindert, das viele Jahre später geschrieben werden und mit dem Satz »Eines Tages las ich ein Buch, und mein ganzes Leben veränderte sich« beginnen sollte. Denn die Kritiker würden meinen, das sei »geklaut« und würden seinem Autor die Hölle heiß machen. Ich wollte einem anderen Schriftsteller nicht den Weg versperren, und auch die bereits geschriebenen zweiundvierzig Seiten wegzuwerfen schien mir nicht empfehlenswert.
Mit dem Besitz des Notizbuchs des Raif Efendi hatte ich aber noch längst nicht alle Probleme gelöst. Was von mir verlangt wurde, war eine harmlose Geschichte. Doch ich wollte über meine Liebe, meine Leidenschaft für Maria Puder und meinen Verrat an ihr schreiben, wollte mich schonungslos bloßstellen. Der einfache, leicht verständliche Leitgedanke musste lauten: Wer die Liebe verrät und sein Gedächtnis vergräbt, hat es verdient, bis in alle Ewigkeit verflucht zu werden. Doch diesen eigentlich unkomplizierten Gedanken zu einer Geschichte zu entwickeln war nicht so leicht wie es schien. Denn selbst wenn Hamdi Bey, der Chef der Wahrheit, etwas übersehen sollte, gab es da noch die auf Presseerzeugnisse spezialisierten Staatsanwälte, die es sich zur täglichen Aufgabe gemacht hatten, jedes Wort wie einen Tatverdächtigen zu behandeln. Deswegen durften meine Helden nicht einmal Linkshänder sein. Und wenn einer es doch war, gab ich ihm die Rolle des Bösewichts, damit der Fortsetzungsroman nicht unterbrochen werden musste und die Versorgung des Haushalts mit Mehl, Zucker und Milch für eine gewisse Zeit sichergestellt werden konnte.
Ich begann, das Notizbuch zu lesen oder eigentlich: zu schreiben. Weil es sich um ein Vermächtnis, ein Zeugnis, handelte, musste ich es datieren. Ich nehme ein beliebiges Datum, dachte ich zunächst und notierte den 24. Februar 1942. Dann habe ich es schnell wieder gestrichen. Denn in einem Roman sind Zufälle zwar sehr willkommen, aber wie jeder Zufall und jedes Wort müssen auch die Zeitangaben einen Sinn haben. Das heißt, die Literatur gab mir nicht die Erlaubnis, ein willkürliches Datum zu wählen. Ich war gefangen in dem Strudel des Satzes »So ist Maria Puder nicht gestorben« und in den engen Grenzen der Zeiträume – und in einer tödlichen Geschichte, die nach den ersten bereits geschriebenen Seiten ohnehin ihren eigenen Weg finden würde. Sie würde aus mir einen anderen Menschen machen als den, der ich jetzt war – gleichgültig, ob ich in ihr als Sabahattin oder Ali vorkommen sollte oder namenlos blieb, ob ich an der bulgarischen Grenze oder im letzten Waggon eines Zuges nach Berlin auf und ab ging, oder im Arbeitszimmer meiner Wohnung, die ich jetzt schon schmerzlich vermisse.
Ich verspürte Lust auf Tabak. Meine Pfeife lag auf dem Tisch, aber den Tabak konnte ich nicht finden. Der muss bestimmt auf dem Beistelltisch sein, dachte ich. Dort lag die aktuelle Tageszeitung. Eine Schlagzeile fiel mir auf: »Leidgeprüfte Rosa darf nach Palästina«.
Um mich nicht ablenken zu lassen, wollte ich den Bericht zunächst ignorieren. Doch die Verbitterung in Rosas Gesicht, ihr leerer Blick und ganz besonders ein Notizbuch, das sie fest an ihre Brust gedrückt hielt, zwangen mich, ihn trotzdem zu lesen. »Unser Reporter sprach mit Rosa, die vor dem Untergang des Schiffs an Land gehen durfte. Rosa Medea Salamovitz, die sehr gut Englisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch und Rumänisch spricht, sagte, sie werde die Türkei in wenigen Tagen verlassen.«
Es folgte das Interview:
»Wo wurden Sie geboren?«
»In Bukarest, 1919.«
»Leben Ihre Eltern noch?«
»Meine Mutter habe ich mit elf Jahren verloren. Mein Vater soll, wie ich zuletzt gehört habe, noch am Leben sein.«
»Wie haben Sie die Erlaubnis bekommen, an Land zu gehen?«
»Mein Schwiegervater war ein hoch angesehener Mann in Bukarest. Wir hatten ein offizielles Migrationsdokument, ausgestellt von rumänischen Behörden. Als meine Krankheit wieder ausbrach, habe ich die Genehmigung bekommen.«
»Haben Sie die Reise allein angetreten?«
»Nein, mit meinem Mann.«
»Wo sind Sie an Bord gegangen?«
»In Rumänien, am Hafen von Konstanza.«
»Hatte auch Ihr Mann ein offizielles Migrationsdokument?«
»Hatte er.«
»Und die anderen Passagiere auf dem Schiff?«
»Die meisten hatten eins. Aber es hat ihnen nichts genützt.«
»Warum bekam Ihr Mann keine Erlaubnis, an Land zu gehen?«
»Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts.«
»Ist Ihr Mann auf dem Schiff geblieben?«
»Ja.«
»Möchten Sie noch etwas sagen?«
»Sagen Sie meiner Schwiegermutter, dass alle ihre Flüche in Erfüllung gegangen sind.«
Was war das für ein seltsames Interview! Wenn ich der Chefredakteur der Zeitung wäre, würde ich diesen Reporter sofort vor die Tür setzen. Das einzig Neue, das man durch das Gespräch erfuhr, war der letzte Satz Rosa Medea Salamovitz’ und der Reporter hatte es nicht für nötig erachtet, sie zu fragen, wie der Fluch ihrer Schwiegermutter lautete. Noch schlimmer war, dass er das Notizbuch gar nicht bemerkt hatte, dabei war es mir auf dem Foto gleich aufgefallen. Nun, bis zu einem gewissen Grad war dieser Unterschied zwischen unseren Wahrnehmungen vielleicht verständlich. Denn, um ehrlich zu sein, erweckte ein ähnliches Notizbuch in mir Erinnerungen an einen wichtigen Moment in meinem Leben. Denn blaue Töne und frühlingsgrüne Tinte erinnern mich immer an Berlin, an den Wittenbergplatz und vor allem an dieses riesengroße Warenhaus KaDeWe.
Ich war mit Maria Puder nur einmal im KaDeWe. An Marias Geburtstag, dem 24. Februar. Ich wollte ihr ein Geschenk kaufen. Arm in Arm betraten wir das Kaufhaus. Ich bat die Verkäuferin, ein Notizbuch mit blauem Stoffeinband, das ich im Schaufenster gesehen hatte, als Geschenk zu verpacken. Maria begutachtete währenddessen die Trachtenpuppen. Als das Paket fertig war, überreichte ich es ihr mit einem »Herzlichen Glückwunsch!« und machte die Erfahrung, dass es sich gar nicht so übel anfühlt, sich mitten in einem Kaufhaus vor aller Augen auf den Mund zu küssen. Maria war sehr bewegt. »Ich werde es mein Leben lang bei mir tragen«, sagte sie. Dann fragte sie mich nach meinem Geburtstag. »Der offizielle oder der inoffizielle?« fragte ich zurück. Maria verstand mich nicht. Ich musste ihr ausführlich erklären, dass und warum bei uns die Kinder meistens nicht an dem Tag geboren wurden, der in dem Personenregister geschrieben steht. Als sie dann fragte: »Gut, und an welchem Tag bist du geboren?« erwiderte ich: »Bis zur Mitte am 24. Februar und der Rest am 25. Also genau um Mitternacht, als die Uhren 12 schlugen.«
Maria war außer sich. Es hätte nur wenig gefehlt und wir hätten den Marmorboden des KaDeWe in ein kuschelweiches Bett verwandelt. Nach einem Kuss, der die Kunden, die Verkäuferinnen, die Verkäufer, sogar den SA-Mann mit Hakenkreuzbinde, der gerade zur Tür hereinkam, ziemlich neidisch machte, griff sie meine Hand, zerrte mich zu der Abteilung mit den Füllfederhaltern und kaufte mir den Füller und die frühlingsgrüne Tinte, mit denen ich diese Zeilen schreibe und auch meine letzten Zeilen schreiben werde.
Nun wäre es natürlich ungerecht zu verlangen, dass das Notizbuch mit dem blauen Stoffeinband in jedem Menschen ähnliche Assoziationen erweckt, doch trotzdem hätte der Reporter bemerken müssen, wie Rosa ihres wie ein Baby an die Brust drückte. Er hätte versuchen müssen herauszufinden, was darin geschrieben stand. Vielleicht war es leer, vielleicht aber auch ein Tagebuch, in das sie ihre gesamte Vergangenheit notiert hatte. Vielleicht war es das letzte Andenken von ihrem Mann, oder möglicherweise gehörte es gar nicht ihr, sondern war ihr nur anvertraut worden. Eingehend untersuchte ich die Grautöne auf dem Schwarzweißfoto. Das Notizbuch musste tatsächlich mit blauem Stoff überzogen sein und ähnelte nicht im Geringsten dem des Raif Efendi.
Attentat in Paris
Endlich konnte ich den ersten grünen Satz aus dem Munde des Raif Efendi schreiben: »Gestern ist mir etwas Seltsames zugestoßen.«
Eigentlich war mir nichts Seltsames zugestoßen. Es hätte aber passieren können. Ich hätte auf der Straße zufällig zwei Personen begegnen können, wie es ja auch in den bereits geschriebenen Passagen geschehen war. Eine von ihnen hätte mir sehr nahestehen, ein Teil von meinem Leben sein können, obwohl ich sie zum ersten Mal sah. Zum Beispiel ein Mädchen, zehn oder elf Jahre alt, so wie meine Tochter. Die andere eine unsympathische Frau. Sie war in der Tat unsympathisch, diese Frau. Aber ich konnte nicht sofort mit ihrer Beschreibung beginnen. Zunächst musste ich meinen Charakter, das heißt, den Charakter des Raif Efendi, skizzieren. Und so schnell wie möglich aus Havran herauskommen und nach Istanbul gelangen. Denn ich wusste nicht nur nichts über diesen Ort, sondern hatte auch keine Zeit, in der Enzyklopädie herumzublättern. Ohnehin würde sie höchstwahrscheinlich keinen Eintrag enthalten. So gab es keine andere Lösung, als dass mein Vater mir sagte: »Geh und finde etwas zum Studieren« und mich nach Istanbul schickte.
Ich kam nach Istanbul. Dort versank ich immer wieder in Träume, die um die Schule der Schönen Künste kreisten, wo ich mich einschreiben ließ. Schon als Kind hatte ich in meiner Traumwelt gelebt. Ich war so schüchtern und schweigsam, dass meine Freunde mich für dumm hielten. Ich wusste, dass ich nicht dumm war, wagte es aber nicht, mich gegen sie zu wehren und weinte in einer stillen Ecke vor mich hin. Die Worte meines Vaters »Du hättest eigentlich ein Mädchen werden sollen, aber du bist falsch geboren« verletzten mich. Mein Vater dachte nie daran, was für ernsthafte Erschütterungen seine Worte in meiner Seele auslösen würden. Ich hätte mir gewünscht, er würde mich liebevoll seinen tapferen Sohn nennen. Jahrelang lebte ich mit der Angst, ich könnte mich in ein Mädchen verwandeln. Wenn meine Freunde am Flussufer um die Wette masturbierten, zog ich meine Unterhose nie aus. Aber als ich feststellte, dass meiner den ihren ähnlich sah, war ich ein wenig erleichtert. Er war nur ein bisschen klein. Hamdi hatte den größten. »Ich esse viel Walnüsse, deswegen ist er so groß«, hatte er einmal gesagt. Ich habe auch viele Walnüsse gegessen, aber er wurde weder so groß wie der von Hamdi, noch so dick. Hamdi hatte auch gesagt, er hätte Fahriye gedingst, aber ich habe ihm das nie geglaubt. Denn Fahriye würde ihn auf keinen Fall ranlassen. Fahriye wartete darauf, dass ich sie in die Berge verschleppte. Wenn ich sie in voller Montur eines Banditen in meine prächtige Höhle entführen würde, würde sie so tun, als fürchtete sie sich, würde zappeln und zittern wie Espenlaub. Dann würde sie sehen, dass die mir untergebenen Banditen in meiner Gegenwart noch heftiger zittern, und sie wäre sprachlos, würde auf der Stelle ihren Widerstand aufgeben und sich mir an den Hals werfen. Ich würde sie in mein Turkmenenzelt aus Ziegenhaar tragen, so richtig ausziehen und Hamdis Worten meine Taten folgen lassen.
Jetzt war alles vorbei. Es war vorbei mit dem Fluss, dem kollektiven Masturbieren und meinen Träumen, Fahriye in die Berge zu entführen. Istanbul hatte mir den Rest gegeben. Es gab viele junge Frauen, die Fahriye ähnelten, es gab sogar noch schönere, aber mich sahen sie nicht, warum auch immer. Und wenn eine mich doch bemerkte, war ich völlig aufgewühlt, »verschreckt wie eine Frau, die nackt und in einem intimen Moment ertappt wurde, lief ich hochrot an und ergriff die Flucht.« Und wenn ich flüchtete, kam keine der jungen Frauen, die Fahriye ähnelten und sogar noch schöner waren, mir hinterher; sie grinsten mich nur unergründlich an. Ihr Grinsen wiederum verstärkte meine Einsamkeit, die ich nur dadurch überwinden konnte, indem ich Zuflucht bei Heldinnen in den Büchern suchte, sie liebkoste und mit ihnen schlief.
Schließlich reichte es mir. Ich schrieb einen Brief an meinen Vater. Ungefähr zehn Tage später bekam ich eine Antwort. Mein Vater probierte eine letzte Maßnahme, damit aus mir etwas wird, und so wurden mir die Tore Europas aufgestoßen.
Die Situation in Europa, besonders in Deutschland, war komplizierter und hoffnungsloser als mein Seelenzustand. Das Geld hatte dort ziemlich an Wert verloren. Meinem Vater war irgendwo zu Ohren gekommen, dass das Leben in Europa günstiger war als in Istanbul und er »wollte, dass ich das Handwerk der Seifenherstellung, besonders der Duftseifenherstellung, lernen sollte und teilte mir mit, dass er ein wenig Geld für die Reise und sonstige Kosten geschickt hatte.«
Eigentlich war für mich, wie für jeden anderen auch, Europa gleichbedeutend mit Paris. Aber ich konnte nicht nach Paris gehen, um zu lernen, wie man Duftseifen herstellt. Selbst wenn ich das in der Realität tun könnte, würde es sich nicht schicken, in meinem Roman Paris und Seife im gleichen Atemzug zu erwähnen. Nach Paris mit einem anderen Ziel als Liebe und Kunst zu gehen, hätte bedeutet, diese Stadt zu missbrauchen, ja sogar zu vergewaltigen. Auf der anderen Seite war Paris eine Stadt, über die ich in meiner Liebesgeschichte mit Maria Puder nicht hinwegsehen durfte. Die Geschichte könnte sogar ihren Lauf in Paris nehmen, ein junger jüdischer Mann von siebzehn Jahren, geboren in Hannover, könnte von seiner Schwester eine Postkarte aus Polen bekommen haben. Theoretisch sprach nichts dagegen, dass Maria die ältere Schwester von Hermann wäre. Das Problem war nur, dass Maria die Heldin eines Romans und Hermann der Held eines Attentats war, das in die Geschichte eingehen sollte. Selbst wenn es theoretisch möglich war, dass die Berlinerin und der Hannoveraner, die einander nicht einmal auf der Straße begegnet sind, alle Hindernisse überwunden und es geschafft hätten, von den gleichen Eltern zu stammen, war das praktisch nicht möglich; es entsprach nicht den historischen Realitäten. Aber der Vorfall, der das Schicksal der beiden lenkte und auch meine Zukunft bestimmte, verband Maria und den homosexuellen jungen Mann, der in Familienkreisen »Hermann« genannt wurde, viel stärker als ein Band zwischen Geschwistern.
Am 3. November, vier Tage vor dem Attentat am Montag, den 7. November 1938, an dem ich am Ufer des Wannsees beinahe erfroren wäre, erhielt Hermann aus einer kleinen Grenzstadt in Polen tatsächlich eine Postkarte. Sie kam von seiner älteren Schwester Berta. Weil ich keine Kopie dieser auf den 31. Oktober 1938 datierten Karte besaß, blieb mir nur, mich in Berta zu versetzen, wie sie zu empfinden und ihre auf Deutsch geschilderten Erlebnisse auf Türkisch auszudrücken.
»Lieber Hermann«, fing ich an, »von unserem großen Unglück hast Du sicher gehört. Ich will Dir genau schildern, wie das vorgegangen ist … Am Donnerstag ging das Gerücht um, dass alle Juden mit polnischer Staatsbürgerschaft abgeschoben werden sollen. Wir haben es nicht geglaubt. Am selben Abend, gegen neun Uhr, kam ein Polizist von der SiPo und sagte, wir müssten zur Polizei und die Pässe mitbringen. Als Mutter, Vater, Markus und ich dort eintrafen, war schon unser ganzes Revier versammelt. Man sagte uns nichts, aber der Ausweisungsbefehl, den man uns in die Hand drückte, sagte alles. Wir mussten Deutschland bis zum 29. Oktober verlassen …«
Sobald ich im Kopf bis hierher geschrieben und drei Punkte gesetzt hatte, fand ich mich in Paris, in einer Mansarde in der Rue Martel Nummer 8 wieder. Die Worte meiner Schwester Berta hatten mich aufgewühlt. Als meine Familie 1911 aus Russland vor den Pogromen des Zaren floh, hatte ich das Licht der Welt noch nicht erblickt, Berta und Markus waren noch nicht geboren. Bevor wir zur Welt kamen, hatten meine Eltern drei Kinder verloren. Nach der Unabhängigkeit Polens durch den Vertrag von Versailles erhielt die Familie die polnische Staatsbürgerschaft. Erst nachdem meine Eltern mit Hilfe von Verwandten nach Hannover in die Burgstraße 36 gezogen waren, wurde ich geboren. Meine Mutter sagt, meine Geburt sei am heiligsten aller Tage gewesen, am Shabbat. Meine Kindheit verlief gut. 1929 musste mein Vater seine Schneiderei schließen. Niemand konnte es sich mehr leisten, Anzüge schneidern zu lassen. Die Menschen verarmten. Dann folgten Berufsverbote für Juden, Boykotts jüdischer Geschäfte, Übergriffe auf den Straßen. Eines Nachts weckte mich meine Mutter aus dem tiefsten Schlaf und sagte: »Gleich morgen musst du Deutschland, sogar Europa verlassen.« »Wohin soll ich, Mutter?« fragte ich. »Nach Palästina«, erwiderte sie. »An den Ort, den wir vor zweitausend Jahren verlassen haben.« Ich machte mich auf den Weg nach Palästina. Doch schließlich landete ich in Paris, bei meinem Onkel Abraham. Kurz nach meiner Ankunft dort verloren alle offiziellen Papiere, die mein Dasein, die Grenzen meines Lebens, meine Rechte, Pflichten und Möglichkeiten regelten, ihre Gültigkeit. Ich wurde zu einer Person, die offiziell nicht lebte, die ihre Existenz nicht belegen konnte. Weder durfte ich in Frankreich leben, noch das Land verlassen. Sie wüssten nicht einmal, wohin sie mich abschieben sollten. Das war das Schlimmste. Hätte man mich auf der Straße gefasst, würde ich verhaftet werden, und weil ich offiziell nicht existierte, würde man mich nicht mehr in die Gesellschaft lassen. Mit dem Wagemut eines Siebzehnjährigen fing ich an herumzustrolchen und damit meinen Onkel verrückt zu machen. Mein Onkel war mir gegenüber zwar nicht großzügig, aber er ließ mich auch nicht Mangel leiden.
Dann habe ich ihn kennengelernt. In einem Lokal, in dem Männer wie ich verkehrten, mit einem Namen, der versprach, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauchte: »Tout va Bien«. Er war Deutscher. Elf Jahre älter als ich. Unsere Körpergrößen, Gesichtszüge und Mimik waren sich sehr ähnlich. Auch unsere Krawatten, weißen Hemden, schwarzen Anzüge, sogar die dunkelbraunen Regenmäntel, die wir in dieser regnerischen Nacht beim Verlassen des Lokals an der Garderobe vergessen hatten, glichen sich. Als wir bei ihm zu Hause ankamen, waren wir völlig durchnässt.
Gegen Morgen, nachdem alles schon geschehen war, wussten wir voneinander immer noch nicht, was der andere in Paris machte. Seine erste Frage lautete: »Das erste Mal?« Ich nickte zweimal. »Für mich war es auch fast das erste Mal«, sagte er. »Ich habe Jahre unter einer Dickdarminfektion gelitten. Ich musste mich sogar«, fuhr er fort, »in Berlin von einem jüdischen Arzt, eigentlich einer Ärztin, untersuchen lassen«. Das Wort »musste« gefiel mir nicht und mir wurde etwas mulmig. Auf meine Frage: »Warum bist du nicht zum Hausarzt gegangen?« antwortete er: »Das konnte ich ja nicht. Unser Hausarzt war ein Freund der Familie und meine Eltern taten so, als wüssten sie von nichts.« »Und wenn du zu einem anderen Arzt, einem deutschen Arzt gegangen wärst?« fragte ich, worauf er eine Weile schwieg. Dann sagte er nachdenklich: »Die hätten mich anzeigen können. Dann hätte ich in Deutschland keine Zukunft mehr, meine Chancen auf eine politische Karriere wären vernichtet.« Wie schön wäre es, dachte ich, wenn die Worte sich nicht zwischen uns gestellt hätten, wenn wir uns nur mit den Augen und Empfindungen beschieden und nicht einmal »Auf Wiedersehen!« gesagt hätten, bevor wir wieder auseinandergehen. Aber es war bereits zu spät; ich fragte weiter:
»Was machst du hier?«
»Ich arbeite bei der Botschaft. Ich bin Botschaftssekretär.«
»Du bist also Mitglied der NSDAP.«
»Natürlich. Du nicht?«
»Ich bin Jude.«
Jetzt hatte er ein weiteres Geheimnis, das er hüten musste, und ich hatte mein erstes. Ohne ein Wort zu verlieren, zog ich meine feuchten Kleider an und stürzte hinaus. Noch bevor ich um die Ecke bog, übergab ich mich. Erst kotzte ich den Ekel in mir heraus, dann auch meine inneren Organe, meinen Magen, meinen Dünn-, Dick- und Mastdarm, meine Nieren, meine Gallenblase, meine Lungen und mein Herz. Als ich zu Hause ankam, fühlte ich mich wie ein ausgestopftes Wildtier.
Mein Onkel klopfte Tage später an meiner Tür und erkannte mich nicht. Er hat mich sogar nach mir gefragt. »Vor Ihnen hat hier jemand anderes gewohnt«, hat er gesagt. Als ihm dann klar wurde, dass ich es war, brachte er mich zu sich nach Hause. Er ließ mich baden, gab mir zu essen. Dann gab er mir die Postkarte meiner Schwester Berta … Nach den drei Punkten fuhr Berta mit den Worten fort: »Freitagabend pferchten sie uns in Güterwagen hinein. Umgeben von Schreien, Wehklagen und Gebeten, die Tote hätten aufwecken können, sind wir die ganze Nacht gefahren. Bei Tagesanbruch am Shabbat kamen wir an die Grenze. Jenseits der Grenze luden sie uns ab, als würden sie Sand auskippen, und ihre Leute auf der anderen Seite kommandierten diejenigen, die Geld hatten, in Häuser, die anderen in Baracken. Wir schlafen auf Heu. Sie haben jedem eine Decke gegeben, aber für den polnischen Winter reicht das nicht aus. Lieber Hermann, wir sind ohne Pfennig Geld und wissen nicht, was wir tun sollen.«
Ich sah meinem Onkel, ebenfalls Schneider wie mein Vater, ins Gesicht. »Mach dir keine Sorgen über das Geld«, sagte er, »gleich heute werde ich es schicken«. Ich hatte auch ein wenig Geld. Ich wollte es ihm geben. »Das ist nicht nötig«, meinte mein Onkel, »behalte es als Taschengeld«. Doch als ich ihn am Sonntag fragte, ob er das Geld schon geschickt hätte, antwortete er: »Ich werde es tun, ich warte nur ab, bis sich die Situation geklärt hat.« Ich war verärgert. Nicht über meinen Onkel, sondern über meine Ohnmacht. Ich benutzte kränkende Worte. Dann ging ich. Ich schlenderte ziellos durch die Straßen. In der Rue du Faubourg Saint-Martin betrachtete ich im Schaufenster des Waffengeschäfts »A la fine lame«, Zur Scharfen Klinge, die Gewehre, Pistolen und Dolche.
Ich übernachtete im Hôtel de Suez. Nach dem Frühstück verließ ich um 08:30 Uhr das Hotel. Ich hatte vor, meinen Onkel zu besuchen und um Entschuldigung zu bitten. Als ich wieder an dem Geschäft vorbeiging, blieb ich plötzlich stehen. Ein Trommelrevolver starrte mich an. Ich schaute zurück. Er schien mir zu sagen: »Kauf mich!«
Ich kaufte ihn. Dann kehrte ich in »Tout va Bien« ein, lud die Waffe auf der Toilette und steckte sie in die linke Jackentasche.
Mit der U-Bahn fuhr ich bis Solférino. Meine letzten fünf Francs gab ich unterwegs einem Bettler und lief zur deutschen Botschaft an der Rue de Lille. Seit ich das Hotel verlassen hatte, war ungefähr eine Stunde vergangen. Am Tor vor dem Garten, in dem sich das Botschaftsgebäude befand, hielt mich eine Frau an, wahrscheinlich die Frau des Portiers. Sie fragte mich, was ich wollte. »Ich möchte den Attaché sprechen«, erwiderte ich, »ich muss ihm ein wichtiges Dokument übergeben«. Die Frau des Portiers hegte keinen Verdacht, zeigte auf den Eingang der Botschaft und sagte: »Gehen Sie hier durch.« Ich schlüpfte zur Tür hinein. Das Zimmer von Ernst war am Ende des Flurs und vor der Tür stand ein furchteinflößender Kerl namens Nagorka. Ich wiederholte ihm, was ich zu der Frau des Portiers gesagt hatte. »Geben Sie mir das Dokument, ich leite es weiter«, sagte er. »Nein«, widersprach ich, »ich muss es ihm selbst überreichen. Sagen Sie ihm, Hermann aus Hannover möchte ihn sprechen, er kennt mich«. Nagorka ging hinein, kam wenige Sekunden später wieder heraus und ließ mich eintreten.
Ernst war beunruhigt, mich zu sehen. »Bist du des Wahnsinns?« rief er aus. »Was machst du hier?« Ich erzählte ihm, was geschehen war, und bat ihn um Hilfe. »Sorg dafür, dass entweder meine Familie nach Hannover zurückkehrt, oder ich nach Polen fahren kann«, sagte ich. »Gut, ich finde schon einen Weg«, antwortete er, doch sein Blick machte mir klar, dass er nichts tun würde. Und ihm wurde klar, dass ich ihn durchschaut hatte. Seine Miene veränderte sich. »Du blöder Jude«, fing er an, konnte aber den Satz nicht zu Ende sprechen. Ich feuerte meine Projektile auf seine Brust und seinen Unterleib ab.
Hermann konnte seine Projektile abfeuern, ich meine grünen Worte aber nicht. Ich strich das Wort Paris durch. In dieser Geschichte hatte Paris nichts zu suchen, sie musste harmlos sein, ohne heikle Andeutungen.
Berlin, »Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag«
In jenen Jahren war Marseille die wichtigste unter allen Städten, die für ihre Seifenherstellung berühmt waren. Jedoch könnte mir die Stadt aus vielen Gründen Schwierigkeiten bereiten. Dort gab es eine sehr große armenische Diaspora. Die phonetische Ähnlichkeit zwischen »Marsilya« und »Maria« könnte die auf Presseerzeugnisse spezialisierten Staatsanwälte, die alle meine Texte gründlich durchfilzen, hellhörig machen. Sie könnten mir vorwerfen, eine Verbindung zwischen Armeniern und Marias Schicksal herzustellen und den Aufstand gegen historische Realitäten zu proben, und dann könnte ich sogar am Galgen enden. Wäre Maria Puder in jenem traurigen Herbst tatsächlich nach Marsilya gegangen, würde auch ich in meinem Roman trotz aller Gefahren eine Reise dorthin riskieren. Ich könnte ja zu meiner Verteidigung sagen, dass es das Selbstverständlichste ist, für die Seifenherstellung nach Marsilya zu fahren. Maria Puder hat es aber nie nach Marseille verschlagen.
Dafür verschlug es mich nach Berlin, wo wenige Tage nach ihrem Verschwinden der erste Schnee des Jahres fiel. Den ganzen Tag schaute ich am Fenster den Schneeflocken nach, lauschte ihrem Flüstern untereinander. Sie kamen aus dem Osten, aus einer kälteren, einer sehr kalten Jahreszeit. Noch mehr als Schneeflocken gab es dort, wo sie herkamen, Menschenflocken, die von der Erde in den Himmel flogen.
Ich zählte mir im Geiste die Städte auf, in denen ich mich mit der Herstellung von Duftseifen vertraut machen könnte: Berlin, London, Prag, Wien, Rom … Ich entschied mich für Berlin. Diese Stadt erschien mir geheimnisvoller als die anderen, reizvoller, beschützender, als eine Stadt, die mir und der Menschheit eine bessere Zukunft verspricht. Hinzu kam, dass ich Goethe und Schiller mehr bewunderte als Dickens und Shakespeare. Ich wäre lieber Goethe als Shakespeare gewesen. Und dann gab es noch das Problem, den Ärmelkanal überqueren zu müssen, um nach London zu kommen. Auf dem Wasser wurde ich immer seekrank. Sogar auf Dampferfahrten über den Bosporus wurde mir trotz der herrlichen Brise immer übel. Und das wichtigste Argument war, dass ich tatsächlich nach Berlin gegangen war und mich dort in Maria Puder verliebt hatte.
Innerhalb einer Woche traf ich alle Vorbereitungen und machte mich auf die Reise über Bulgarien nach Berlin. Über die Entwicklungen in Deutschland kannte ich mich in groben Zügen aus, aber dass die ersten Monate des Jahres 1933 sehr turbulent verlaufen waren, hatte ich nicht mitbekommen. Zum Beispiel, dass von Papen, der später Botschafter in Ankara werden sollte, und Hitler sich in Köln in der blauen Villa eines Bankiers getroffen hatten, die heutige Regierung infolge dieses Treffens gegründet wurde, die Bücher von Heinrich Mann, Käthe Kollwitz, Max Liebermann, Albert Einstein, der aus Amerika zurückgekehrt war und sich in Belgien niedergelassen hatte, und dutzenden weiteren Intellektuellen verbrannt und sie selbst gezwungen wurden, ihre Stellen an den Universitäten zu kündigen, wusste ich nicht. Dass der Boykott jüdischer Geschäfte begonnen hatte, Juden in vielen Städten, allen voran in Nürnberg, Schwimmbäder nicht mehr betreten durften, hatte ich nicht gehört. Von der Flucht Bertolt Brechts und Helene Weigels nach Prag wusste ich auch nichts.
In den ersten Monaten von 1933 gab es lediglich zwei Ereignisse, die einen nicht beängstigten: Der schnellste Zug der Welt, der für die Strecke zwischen Hamburg und Berlin nur zwei Stunden und achtzehn Minuten brauchte, wurde in Betrieb genommen. Und Fortuna Düsseldorf siegte gegen FC Schalke 04 drei zu null und wurde Deutscher Meister.
Viel später, nach dem Krieg, als ich erfuhr, dass diese Ignoranz nicht nur Ausländern wie mir zu eigen war, die zum Erlernen der Duftseifenherstellung nach Berlin gekommen waren, war ich – nein, nicht erleichtert, sondern verblüfft. Das war für mich eine schwer überwindbare Enttäuschung. Zum Beispiel hatte keiner ihrer Nachbarn gemerkt, dass Maria Puder plötzlich nicht mehr da war. Sie hatten nicht die leiseste Ahnung, warum man sie seit dem 28. Oktober nicht gesehen hatte. Sogar von der Nacht, in der der jüdische Teil Deutschlands in Brand geriet, war nicht einmal ein Erinnerungskrümel geblieben. Das Gedächtnis war so entleert, dass ich das Gefühl hatte, nicht in Berlin, sondern in einem lateinamerikanischen Roman zu spazieren. Niemand konnte sich daran erinnern, dass eine Kuh eine Kuh und ein Ochse ein Ochse war. In der Nacht vom 9. auf den 10. November waren weder Synagogen in Brand gesteckt worden, noch Geschäfte geplündert. Niemand hatte mitbekommen, dass die Geschädigten für den Schaden aufkommen mussten und Göring gesagt hatte: »Mir wäre lieber gewesen, ihr hättet 200 Juden erschlagen und nicht solche Werte vernichtet.« Dabei hatte selbst ich mit meinem schlechten Deutsch die Schlagzeile des Berliner Lokal-Anzeigers gelesen: »Göring verordnet: Eine Milliarde Sühneleistung der Juden in Deutschland«.
Wenn Maria Puder nicht Jüdin gewesen wäre, hätte ich mir nicht die Mühe gemacht, die Worte dieses Schweins mit Hilfe eines Wörterbuchs zu entziffern. Doch der Mann bekleidete eine so machtvolle Position, dass jedes Wort von ihm sowohl Leben retten, als auch Massaker auslösen konnte. Deswegen ließ mich sein letzter Satz stärker erfrieren als der Berliner Winter: »Ich möchte kein Jude in Deutschland sein.«
Während meiner viertägigen Reise nach Berlin versuchte ich, die Dialoge in meinem Konversationsbuch auswendig zu lernen. Auf den ersten Blick erschien mir Deutsch nicht besonders behaglich, nicht wirklich handlich. Manche Wörter waren sehr lang. Um sie in einem Zug aussprechen zu können, musste man zuerst tief Luft holen. Aber Sätze wie Guten Tag, Wo ist die Haltestelle soundso, Wie komme ich zur nächsten Bäckerei, Auf Wiedersehen, Ich liebe Sie, Ich bin in Sie verliebt, Kann ich bitte ein Brot haben, habe ich gelernt.
An einem sonnigen Dienstagmorgen stieg ich in Berlin aus. Etwas später stand ich auf einer Straße, durch deren Mitte die Straßenbahn fuhr, und schaute verloren um mich. Auf der anderen Straßenseite sah ich eine Grünfläche und in der Ferne bemerkte ich ein Bauwerk, das eine Kirche sein musste. In meiner rechten Hand trug ich meinen Holzkoffer, in meiner linken war der Zettel mit der Adresse der Pension, die ich noch in Istanbul erfragt hatte. Ich bekam das Gefühl, in die falsche Richtung zu gehen, kehrte um und lief zurück auf den Bahnhof Zoologischer Garten zu. Ich stellte fest, dass ich auf der Hardenbergstraße war und las zwanzig oder dreißig Meter weiter vorne einen weiteren Straßennamen: Fasanenstraße. Gerade als ich mir vorgenommen hatte, eine beeindruckende Synagoge mit drei Kuppeln zu betrachten, lief ein Fräulein an mir vorbei, das die gleiche Körpergröße und die gleichen schwarzen Haare wie Fahriye hatte. Ob sie Fahriye auch im Gesicht ähnelte, so schwarze Augen hatte wie sie, ein Kinn, das leicht nach vorn stand und Augenlider, die leicht geschwollen aussahen, ob auch ihre Nase fein und ebenmäßig war und die Unterlippe etwas voller als die obere, konnte ich noch nicht sagen. Ich war drauf und dran, das erste deutsche Wort meines Lebens auszusprechen, und mein Herz klopfte so heftig wie das eines frisch Verliebten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich einen Ton herausbrachte, als ich meinte, ihr »Fräulein« zugerufen zu haben. Wahrscheinlich schon, denn die Frau sagte »Wie bitte?« und blieb stehen. Mir war, als hätte nicht sie gesprochen, sondern die reizende Sängerin Seyyan Hanım hätte ein klagevolles Liebeslied angestimmt: »Diese Liebe in meinem Busen ist ein Schmerz, der nie verebbt.« Mit Mühe gelang es mir, ihr den Zettel zu überreichen. Während sie ihn mir aus der Hand nahm, bewunderte ich ihre zarten Finger und nahm einen sanften Duft von Ölweiden wahr. Sie roch angenehmer als Fahriye. Weil ich mich nicht traute, ihr ins Gesicht zu schauen, hielt ich den Blick gesenkt. »Ihre, wie ich es nicht leugnen kann, wahrlich wohlgeformten Beine, die sich unter dem kurzen Rock zeigten, spannten sich hin und wieder an und erzeugten unter dem Strumpf eine anmutige Welle, die sich bis zu den Knien ausbreitete.« Ihr Rock hatte die gleiche Farbe wie meine Tinte. Währenddessen versuchte sie mir den Weg zu beschreiben, aber mein Deutsch von vier Tagen reichte nicht, um ihre Beschreibung zu verstehen. Schließlich merkte sie, die mir mit ihrer Stimme, ihrem Duft, ihren runden Knien den Kopf schwindlig machte, dass ich Ausländer war und deutete mit einer Geste an: »Kommen Sie mit!«
Wir liefen die Hardenbergstraße gen Orient entlang, wobei sie immer wieder mich anschaute und ich den Bürgersteig. Auf dem ganzen Weg fiel mein Blick ständig auf den Schatten ihrer runden Knie. Ab und an hob ich den Kopf, streifte mit den Augen flüchtig ihr Gesicht und richtete sie dann auf die historischen Bauten um uns herum. Wir liefen an einem imposanten Bauwerk vorbei, das zum Gedenken an Kaiser Wilhelm I. errichtet wurde und viel später nur Gedächtniskirche genannt werden sollte. Dann ging es in einem Bogen Richtung Norden, vorbei an einem großen Platz. Während der ganzen Zeit unternahm sie mehrere Versuche, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich erriet manchmal, was sie gefragt haben könnte und sagte, dass ich aus der Türkei komme und dergleichen. Aber auf die meisten Fragen konnte ich nicht antworten. Als sie nach zehn Minuten Fußmarsch stehenblieb, tat ich es ihr gleich. Sie wies auf eine Straße, die leicht in die südliche Richtung verlief. Nach ein paar Worten, die ich nicht verstand, sagte sie mir schließlich »Tschüs!« (Erst Monate später erfuhr ich, wie man dieses Wort schreibt und war überrascht.) Ich benutzte zur Verabschiedung den Satz, den ich in den vier Tagen fünfzig Mal wiederholt und am Ende auswendig gelernt hatte: »Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.« Ich hörte sie lachen, habe aber nicht verstanden, warum.
Die Lützowstraße und die Pension gefunden zu haben war nicht das Ende aller Anstrengung, sondern erst der Anfang. Um mich mit der Herstellung von Duftseifen vertraut zu machen, musste ich eiligst die Sprache lernen. »Ich begann, bei einem ehemaligen Offizier, der im Weltkrieg in der Türkei war und etwas Türkisch gelernt hatte, Unterricht zu nehmen.« Sobald ich diesen Satz niedergeschrieben hatte, verspürte ich Unbehagen. Ich warf einen vorsichtigen Blick auf den Satz. Er machte mir immer noch Angst. Ich hatte bereits hunderte – nein, das ist übertrieben, aber auf jeden Fall dutzende Texte geschrieben, in denen das Wort Krieg vorkam. Also konnte dieses Wort nicht der einzige Auslöser meiner Angst sein. Ich las den Satz laut, sogar in großen Lettern vor: ICH BEGANN, BEI EINEM EHEMALIGEN OFFIZIER, DER IM WELTKRIEG IN DER TÜRKEI WAR UND ETWAS TÜRKISCH GELERNT HATTE, UNTERRICHT ZU NEHMEN!
Der deutsche Offizier, der im Weltkrieg in der Türkei war
Der Offizier, dem ich meine Deutschkenntnisse verdanke, kannte sich in der türkischen Geschichte gut aus. Er sah die Türkei als eine zweite Heimat an. Dort hatte er sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt. Die Zukunft des Dritten Reichs hing damit zusammen, diese Erfahrungen auf die richtige Art und Weise zu nutzen, meinte er. »Die Türken«, hatte er einmal gesagt, »konnten zwar das Osmanische Reich nicht wiederaufbauen, aber bei der Erledigung der Aufgaben, die für ihr nationales Wiedererwachen unverzichtbar waren, haben sie großes Talent bewiesen.« Für ein Wiedererwachen, ein Wiedererstehen, sei es notwendig, als Erstes die Parasiten, Verschwörer, all diejenigen, deren Blut unrein war, die Wucherer, Gauner, Händler, Schacherer und alle, die die Faulheit als edel ansehen und nicht daran glauben, dass Arbeit frei macht, aus dem Volkskörper zu eliminieren und das Land von Untermenschen zu säubern. »Die Türkei ist in jeder Hinsicht ein bewundernswertes Land«, meinte er, »ein Land, das mit seinen Hamams, staubigen Wegen, tiefen Schluchten, den Wüsten, die jetzt leider außerhalb der nationalen Grenzen liegen, unglaubliche Möglichkeiten bietet«. Die Türken, und ganz besonders die Jungtürken, seien sehr intelligente Menschen. Sie hätten sich sehr gut darauf verstanden, die Möglichkeiten, die ihnen die Natur bot, für ihre Zwecke zu nutzen. Zum Beispiel habe der deutsche Offizier zum ersten Mal dort gesehen, dass Wege ins Nirgendwo führen konnten. Man lief und lief und ging verloren.
Er war einmal im türkischen Hamam, war entzückt von der Architektur – und wurde ohnmächtig. Diese Architektur war perfekt für die Desinfektion. Wenn man die Tür schloss, war es unmöglich, dass Luft nach außen entweicht. Dass er nach kurzer Zeit in Ohnmacht gefallen war, hatte ihn auf die Idee gebracht, die türkischen Bäder könnten auch andere Funktionen als das Schweißtreiben erfüllen, selbst wenn man nicht Zyklon B einsetzte.
Während des Unterrichts mit dem deutschen Offizier fand ich es nicht angebracht zu fragen, was Zyklon B sei. In unserer Konversation benutzte ich nämlich Wörter eines Intellektuellen, und es hätte nicht dazu gepasst, dass ich diese Substanz nicht kannte. Zudem ging es mir darum, so schnell wie möglich die Sprache zu lernen. Dabei konnte ich das meiste, was der deutsche Offizier ausführte, nur mit Mühe verstehen. Mein Wortschatz war eben noch nicht so groß. Trotzdem fiel meinem Deutschlehrer gleich auf, dass ich mit der Seifenherstellung nichts am Hut hatte und war sehr erfreut, von meiner Leidenschaft für die deutsche Literatur zu erfahren. »Die deutsche Sprache ist unser teuerstes Gut«, oder so ähnlich klang sein Kommentar zu dem Thema, was mich neidisch machte und zugleich traurig darüber, dass meine Nation ihre Sprache nicht schätzte und pflegte. Mein Interesse an der deutschen Sprache und Literatur erklärte er damit, dass ich Türke war. Seiner Meinung nach war es denkbar, dass auch die Türken und Japaner Arier waren. Dazu äußerte ich mich nicht. Ich sagte ihm auch nicht, dass unsere Forscher behaupten, alle Nationen würden von Türken abstammen. Nach der Gründung der Republik waren in Schulbüchern rote Pfeile aufgetaucht, die sich vom Ursprungsgebiet der Türken, nämlich von Zentralasien aus, auf sämtliche andere Ursprungsgebiete ausbreiteten. Einer dieser roten Pfeile führte sogar – das konnte auch ein Druckfehler sein – in die Antarktis. Schließlich klang eine Auswanderung in die Antarktis, selbst wenn sie in der Prähistorie stattgefunden haben sollte, nicht besonders vernünftig. Weil für den deutschen Offizier die Frage der Rasse eine besonders wichtige Angelegenheit war, fand ich es nicht nötig, diese Überlegungen mit ihm zu teilen.
Ich kann nicht leugnen, dass der deutsche Offizier ein guter Sprachlehrer war, aber seine Art, einem die Sprache beizubringen, war etwas eigenartig. Ich hätte erwartet, dass jemand, der eine fanatische Zuneigung für die deutsche Sprache und Literatur verspürt, den Unterricht mit Wörtern beginnt, die in der Literatur angebrachter wären, etwa mit dem Wort Liebe. Er aber fand es sinnvoll, sich lange über ein altgriechisches Wort auszulassen, das später ins Hebräische übernommen wurde. Das war ein Wort, das man im Alltag und in der Literatur niemals gebrauchen würde. Es bedeutete vollständig verbranntes Opfer: Holocaust.
Der deutsche Offizier sprach in einem kleinen Café auf dem Kurfürstendamm ausführlich über dieses verstörende Wort, um anschließend eine kleine Stadt namens Oranienburg im Norden Berlins zu erwähnen, wo eines der ersten KZs unter dem Namen Sachsenhausen eingerichtet wurde. Ein weiteres KZ befand sich in Dachau. Der deutsche Offizier sagte ständig KZ, in einem Ton, als wäre es das Selbstverständlichste, dass ich verstehe, was damit gemeint ist. Sachsenhausen war vielleicht nicht in der Welt, aber in Deutschland eines der ersten Exemplare seiner Art, es war ein Ausbildungsplatz, ein Laboratorium. Mit Hilfe der Erfahrungen, die man hier gewinnen würde, würde man KZs mit viel rationelleren Funktionen einrichten und betreiben.





























