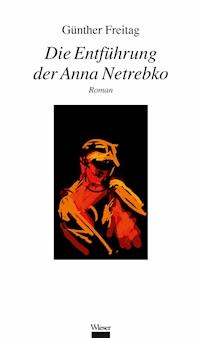Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wieser Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Konrad bricht wegen dieser Anfälle, für die es keine medizinische Erklärung gibt, ein Klavierstudium ab und will die Dirigentenlaufbahn einschlagen. Als schwarzes Schaf der Familie vertieft er sich mit der Besessenheit des Außenseiters in die Sinfonien Gustav Mahlers und scheitert, weil er sich immer stärker aus der Realität in eine Scheinwelt zurückzieht, sowohl in Wien als auch in Berlin. Das können weder seine Tante, vom Vater als Häkelkünstlerin verspottet, noch ein entlassener Hauswart der Musikhochschule verhindern, der ihm jenen Taktstock Gustav Mahlers besorgen will, den Alban Berg aus dem Künstlerzimmer des Dirigenten entwendet hat. Als er wegen seines Niesens alle Klavierschüler verliert, muss er sich nach einer Beschäftigung abseits der Musik umsehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GÜNTHER FREITAG
Mahlers Taktstock
Roman
Die Herausgabe dieses Buches erfolgtemit freundlicher Unterstützung durch das Land Kärnten,das Land Vorarlberg, das Land Steiermark und die Stadt Graz.
A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12
Tel. + 43(0)463 370 36, Fax + 43(0)463 376 35
www.wieser-verlag.com
Copyright © dieser Ausgabe 2019 bei Wieser Verlag GmbH,
Klagenfurt/Celovec
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Gerhard Maierhofer
Umschlagsilhouette: Otto Böhler
ISBN 978-3-99029-357-7
eISBN 978-3-99047-103-6
Inhalt
Mahlers Taktstock
Obwohl niemand in der Familie darunter litt oder gelitten hatte, wie ich am Schluss mühsamer Nachforschungen herausfand, quälten mich Allergien, die überfallsartig Sturzbäche über meine Lider strömen ließen und den Brustkorb in nicht enden wollenden Niesattacken erschütterten.
Von uns hast du das nicht, Konrad, es kommt gewiss daher, dass du dich für etwas Besonderes hältst!, herrschte mich der Vater an, als ich zum ersten Mal über mein Problem sprach, ohne das Wort Allergie zu verwenden.
Natürlich war der Zeitpunkt zwischen Suppe und Hauptgang am Sonntag kein günstiger, aber nur da konnte ich Eltern und Schwestern mit den Tränen und dem Niesen konfrontieren, ohne ein zweites oder drittes Mal über die Symptome reden zu müssen. Die ja tatsächlich ekelhaft waren, ekelhaft und abstoßend, wie meine Schwestern angewidert feststellten und auf die Hauptspeise verzichteten, was das Gesicht des Vaters rot anlaufen ließ und die für Bluthochdruckpatienten typische Atemnot auslöste. Wie ein Weihnachtskarpfen, den der Verkäufer gerade aus dem Becken gefischt hat, schnappte er nach Luft und fiel dann, als er sich einigermaßen gefasst hatte, über die Mutter her.
Das, und dabei zeigte er mit der geballten Faust auf mich, ist das Ergebnis deiner Affenliebe. Katharina und Karin werden ihr Studium bald abschließen, während du dich mit rinnenden Augen und einer tropfenden Nase beschäftigst, wandte er sich wieder mir zu, nachdem die Mutter weinend den Raum verlassen hatte und kurz darauf zu hören war, wie die schwere Suppenschüssel in der Spüle zersplitterte. Nun würde, wie die Mutter wusste und nicht daran dachte, ins Speisezimmer zurückzukehren, für Tage der Haussegen schief hängen. Was meist an mir lag, weil ich wieder einmal zu einem falschen Zeitpunkt ein falsches Thema angesprochen hatte. Gerade gerückt konnte er nur werden, wenn eine der Schwestern bei ihren Prüfungen glänzte oder der Vater einen schwierigen Prozess gewann und ihm das Erfolgshonorar überwiesen wurde. Katharina und Karin würden nach seinem Rückzug die Kanzlei übernehmen, von mir wurde nichts erwartet. Wohl deswegen ließ mich der Vater gewähren, als ich den Wunsch äußerte, im nahen Wien Musik, genauer Dirigieren zu studieren. Er lachte sogar bei der Vorstellung, ich stände vor einem Orchester, würde den Taktstock heben und noch vor dem ersten Ton wie ein Epileptiker von einem Niesanfall durchgeschüttelt werden.
Ein paar Tage später sagte er mir das auch und freute sich auf überraschende Interpretationen, bei denen das Publikum nach dem letzten Ton rätseln würde, welchen Komponisten es denn gerade gehört habe. Aber, fuhr der Vater fort, offensichtlich hatte ihn ein unerwarteter Triumph im Gerichtssaal milde gestimmt, vielleicht sei ich auf eine Nische gestoßen, die einen zumindest vorübergehenden Erfolg garantiere. Schließlich gebe es ja auch Kochshows, bei denen das Publikum nicht ahne, was an ihrem Ende serviert werde, oder Blind Dates, wo die Teilnehmer erst sähen, worauf sie sich eingelassen hätten, wenn es zu spät sei, sich aus dem Staub zu machen. Warum also nicht ein Blind Concert, das eine Schubert-Sinfonie ankündige, die sich nach wenigen Takten über Bartók zu Free-Jazz-Klängen davonstehle? Und als er meinen beleidigten Blick bemerkte: Auf diesen Gedanken hast du mich gebracht! Hier setzte er eine spannungssteigernde Generalpause, in der sich mein Ärger über seinen Zynismus zu Ratlosigkeit milderte und mich endgültig verstummen ließ.
Seit Wochen übst du das Regentropfen-Prélude, fand der Vater zur Musik zurück. Ich ahnte nicht, worauf er hinauswollte, wusste bloß, dass am Ende der Erklärungen eine neue Gemeinheit stehen wird. Dieses Stück sei ja, zumindest in seinem Mittelteil, ideal für einen von Niesreiz durchgeschüttelten Klavierspieler. Das Wort Pianist vermied er, weil mein Spiel für ihn nicht mehr als die Flucht vor jeder ernsthaften Beschäftigung war, womit ich den Eindruck verwischen wollte, ich sei nur an einem Leben ohne Verpflichtungen interessiert. Chopin habe ja ständig gehustet, was sich mit dem Niesen vergleichen lasse, aber das sei auch schon die einzige Gemeinsamkeit zwischen dem romantischen Genie und meinem Dilettantismus. Wie du jedes Mal die lyrischen Teile des Préludes zerniest, ist nicht bloß eine Zumutung für mich, wenn ich im Nebenraum die Zeitung lese, sondern würde dir, gäbe es so etwas, vor einem Musikgericht die Höchststrafe, nämlich lebenslanges Klavierverbot, eintragen.
Mir besorgte die Mutter nach dieser Szene einen Termin beim besten HNO-Arzt. Der werde einen Allergietest durchführen und eine Lösung für meine Misere finden. Die Medizin sei weit fortgeschritten, die Pharmaindustrie stecke Millionen in ihre Forschung, es wäre doch gelacht, gäbe es kein Medikament gegen das Niesen und die rinnenden Augen. Wenigstens die Mutter war auf meiner Seite, auch wenn ich ihr anmerkte, dass sie die Symptome genauso ekelhaft fand wie der Rest der Familie. Sie war die Einzige, die mein Musikstudium ernst nahm, während sich die Schwestern mehr noch als der Vater bei jeder Gelegenheit darüber lustig machten. Für ihn, den Blasmusikliebhaber, stellten meine musikwissenschaftlichen und pianistischen Studien nicht mehr dar als den untauglichen Versuch, meinem Leben als Tagedieb einen seriösen Anstrich zu verleihen. Damit hatte er sich längst abgefunden und seine Enttäuschung mit der Einsicht bewältigt, in jeder Familie gebe es einen Versager. Wichtig sei nur, dass seine Ideen nicht auf die übrigen Mitglieder abfärbten. Gelinge das, könne der, abgesehen von den Kosten, die er verursache, durchaus für Erheiterung und gute Stimmung sorgen. Die Schwestern erreichten nicht einmal das Blasmusikniveau des Vaters. Zwar hatte die Mutter sie schon früh zum Geigenunterricht geschickt, aber nach wenigen Monaten den gut gemeinten Rat des Musiklehrers befolgt und die Musikstunden abgebrochen, weil die Violine in ihren Händen immer ein Fremdkörper bleiben würde. Ihre Entscheidung hatten wohl die gekratzten Dissonanzorgien erleichtert, welche die beiden bei ihren erzwungenen Übungen den malträtierten Instrumenten entlockten.
Nachdem ich mich bei der Sprechstundenhilfe angemeldet hatte und mit dem Satz, das könne dauern, ins Wartezimmer geschickt wurde, wollte ich sofort wieder gehen, wäre da nicht die Mutter gewesen, die so viel Hoffnung in den Allergietest bei der Kapazität setzte. Sie durfte ich nicht enttäuschen, auch nicht belügen, also hockte ich mich auf den einzigen freien Stuhl zwischen eine alte Frau mit Hörgeräten und einen fetten Glatzkopf, aus dessen Nasenlöchern Stäbe ragten, die ihm das Aussehen eines urzeitlichen Insekts verliehen. Als wäre das nicht abstoßend genug, schniefte und grunzte der Mann neben mir in kurzen Abständen, weshalb ich mich ein wenig zur Seite drehte und von der Schwerhörigen angestrahlt wurde.
Und warum sind Sie hier, junger Mann?, brüllte sie. Ich zuckte zusammen und wurde verlegen, weil mich andere Patienten anstarrten. Allergietest, sagte ich, worauf mich die Frau anschrie, ich müsse lauter sprechen, und auf ihre Hörgeräte zeigte. Dabei fiel ihr die Handtasche vom Schoß, über den Boden verstreut lagen Tablettenschachteln, Notizbuch, Kamm, Brillenetui, Geldbörse, Handy, gebrauchte Papiertaschentücher und ein Schlüsselbund. Auf den Knien sammelte ich die Dinge ein und stopfte sie in die Tasche zurück. Der Fettwanst lachte schallend, seine Stäbchen vibrierten, und ich fürchtete, beim nächsten Losprusten würden sie aus den Nasenlöchern schießen und mich treffen. Ist das nicht ein netter junger Mann, brüllte die Frau, nachdem ich ihr die Tasche in die Hand gedrückt hatte. Dass man so einen heute noch trifft! Trotzdem öffnete sie ihre Tasche, nahm die Börse heraus und zählte umständlich Münzen und Geldscheine. Ich fürchtete, die Handtasche würde ein zweites Mal zu Boden fallen. Er ist nicht bloß hilfsbereit, sondern auch ehrlich!, informierte sie das Wartezimmer, worauf mich auch jene anstarrten, die ganz offensichtlich unter starken Schmerzen litten.
Vielleicht adoptiert Sie die Alte ja, nasalierte der Mann mit den Stäbchen, was die Heiterkeit im Wartezimmer weiter steigerte, vor allem weil ein Mädchen mit Wattepfropfen in beiden Ohren den Dicken imitierte und dadurch die Patienten von ihren Ängsten und Schmerzen ablenkte. Der Verspottete herrschte die Mutter des Mädchens an, die Göre zum Schweigen zu bringen, andernfalls würde er ihr die Ohren abreißen und in den vorlauten Mund stopfen. Worauf das halbe Wartezimmer über ihn herfiel und mich nicht mehr beachtete.
Bei dem Lärm hätte ich beinahe überhört, dass ich in den Behandlungsraum gerufen wurde. Nicht die von der Mutter angekündigte Kapazität erwartete mich dort, sondern eine Ordinationshilfe. Sie forderte mich auf, rasch einen Unterarm freizumachen, auf den werde sie ein Allergieextrakt tropfen und dieses anschließend mit einer Lanzette leicht anstechen, der Vorgang verursache keine Schmerzen, nach zwanzig Minuten könne ein Ergebnis abgelesen werden. Das verkündete mir später der Arzt, ich reagierte allergisch auf Tierhaare, Hausstaub und Birkenpollen, meinte er nach einem kurzen Blick auf einen Teststreifen und schien bereits an den nächsten Patienten zu denken. Bei der Sprechstundenhilfe würde ich ein Rezept für Tabletten erhalten, allerdings handle es sich bei mir um einen so leichten Fall, dass er die Einnahme nur bei Bedarf empfehle. Ohne sich zu verabschieden, verschwand die Kapazität in einen Nebenraum und ließ mich ratlos zurück. Womöglich hielt mich der Arzt für einen Simulanten. Als ich später der Mutter enttäuscht das Ergebnis mitteilte, meinte die, ich müsse mich beruhigen und an andere Dinge denken, das würde sich bestimmt positiv auf meine Stimmung auswirken. Danach sollten auch die Symptome abklingen und bald schon verschwinden.
Nach den Anfällen schmerzten meine Rippen und Bauchmuskeln, als hätten mich jugendliche Schläger überfallen und erst von mir abgelassen, nachdem mir sogar zum Stöhnen die Kraft fehlte. In meiner Not befolgte ich den Rat eines angeblichen Hochallergikers aus der Selbsthilfegruppe und trug ein Korsett, weil das die Oberkörpereruptionen dämpfen und die Schmerzen lindern sollte. Der Tipp kam von einem pensionierten Studienrat, einem Schwätzer, der von den meisten in der Gruppe wegen seiner Besserwisserei gehasst wurde. Alle zwei Wochen trafen sich die Allergiker in einem Konferenzraum des Savoy in der Fasanenstraße, um Erfahrungen auszutauschen, in erster Linie aber wohl deshalb, weil ihr Schicksal im Kreis von Leidensgenossen leichter zu ertragen war. Zumindest für die Dauer der Treffen, bei denen das Husten, Niesen, Augentränen und die ekelhaften Ausschläge ihre Peinlichkeit verloren. Erzählte einer von seinen Problemen, wendeten sich die Zuhörer nicht angewidert ab, sondern signalisierten Verständnis und Mitgefühl, indem sie seinen Vortrag mit ihrem Niesen, Augentrocknen oder Kratzen untermalten. Da berichtete die Melodiestimme von Zurückweisung und Ausgrenzung, wenn in der vollen U-Bahn auf der Fahrt von der Uhlandstraße zum Halleschen Tor die Plätze neben ihr leer blieben, und das Allergikerorchester begleitete sie mit einem wehmütigen Schniefen. Selbst die hoffnungslosesten Fälle empfanden in diesem Augenblick ein Gefühl von Geborgenheit, das sie bis zum nächsten Treffen schmerzhaft vermissen würden.
Ich sprach kaum, nicht weil ich nichts hätte berichten können, sondern wegen meines österreichischen Dialekts, der selbst dann durchklang, wenn ich langsam sprach und besonders auf die Vokale und Zwielaute achtete. Einige Zeit versuchte ich, wie ein Berliner zu reden, aber das war noch peinlicher als die Niesattacke in einem Konzertsaal.
Der Studienrat, der aussah wie ein Wiedergänger Walter Ulbrichts, missbrauchte die Treffen im Savoy dazu, die Gruppenmitglieder mit Vorträgen zu quälen, die nichts mit deren Allergien zu tun hatten. Er hatte Geschichte unterrichtet, sein Spezialgebiet waren die Römer. Die bedauernswerten Allergiker mussten seine Schüler ersetzen, die ihm nach der Pensionierung abhandengekommen waren. Am liebsten redete er über Augustus und Caesar, den er immer Käsar aussprach und nach jeder Namensnennung schniefte, aber nicht weil ihn ein Jucken in der Nase plagte, sondern um dadurch eine Verbindung zwischen der historischen Figur und dem Grund der Zusammenkunft herzustellen. Zwischen Käsar und Brutus stimmte die Schemie nicht, von allem Anfang an stand zwischen ihnen, dass Käsar unter einer schweren Pollenallergie litt, während sein Kontrahent unbehelligt über jede blühende Wiese spazieren konnte.
Ich vermutete, die Allergien des Studienrats seien vorgetäuscht, um so auch im Ruhestand seinen Unterricht fortführen zu können. Vielleicht besuchte er an jedem Wochentag eine andere Selbsthilfegruppe, von denen es in Charlottenburg unzählige gab, und quälte deren Mitglieder mit der Schemie zwischen den Hauptfiguren seiner Vorträge. Die Schemie zwischen meinem Brustkorb und dem Korsett stimmte jedenfalls nicht, denn nachdem ich es ein paar Tage getragen hatte, waren die Schmerzen unerträglich. Außerdem behinderte es mich, wenn ich mich in eine Partitur vertiefte und an einem Dirigat arbeitete.
Ich wollte bei Harry Curtis in Berlin studieren, nachdem mich in Wien alle Professoren wegen meiner Behauptung abgewiesen hatten, sie unterdrückten ihre Studenten und möchten nur Kopien von sich selbst produzieren. Dadurch wollten sie wohl über ihren Tod hinaus wirken, wenn sie das schon nicht mit ihrer Arbeit schafften.
Eitle Nichtskönner waren sie, selbstverliebte Taktstockdiktatoren wie der Abteilungsleiter Scharrleitner. Clemens Maria Scharrleitner, der zu jeder Vorlesung im Frack erschien und vor allem über seine Auftritte sprach. Aber nicht über Partituren, Orchester oder besondere akustische Verhältnisse in Konzertsälen und Opernhäusern redete er, sondern darüber, was er bei diesen Anlässen getragen hatte. Auch mit seiner Frisur konnte er sich ausführlich befassen, wobei er stets aus der Hosentasche einen aufklappbaren Taschenspiegel fischte, mit dem er seine Haarpracht prüfte, ins Schwärmen geriet und die Studenten vergaß. Ein Abend sei bereits zum Scheitern verurteilt, wenn der erste Schritt auf die Bühne oder in den Orchestergraben misslinge, war Scharrleitner überzeugt. Da müsse der Dirigent nicht stolpern oder gar stürzen, behauptete er, ein schlecht sitzender Frack oder eine aus der Façon geratene Frisur genüge, um das Desaster noch vor dem ersten Ton zu besiegeln. Worauf immer eine rhetorische Frage folgte: Weshalb, meinen Sie, scheitert Welser-Möst? Wegen seiner unmöglichen Haare, brüllte er, lief rot an und nannte fortan sein Opfer nur noch Franz Most, bevor einer der Kriecher unter seinen Studenten hätte antworten können. Die beschränkten sich auf einen zustimmenden Trommelwirbel mit den Taktstöcken, wonach Scharrleitner lächelnd meinte, Most habe das schließlich eingesehen und sei als Musikdirektor der Staatsoper zurückgetreten. Um seine Theorie zu untermauern, stellte er manchmal eine gerahmte Fotografie auf sein Pult, die den überlebensgroßen Lockenkopf des jungen Levine zeigte. Eine paar Augenblicke wartete Scharrleitner ab und beobachtete die Reaktion der Studenten auf das Fettgesicht, wie er den Dirigenten nannte. Brach beim Anblick des Fotos keine Heiterkeit im Hörsaal aus oder war die seiner Meinung nach zu verhalten, forderte er die Anwesenden auf, ihre Zurückhaltung abzulegen und ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Die machten ihm die Freude und brüllten Verhöhnungen zum Pult, ein Schimpfwörterorkan füllte den Raum, den Scharrleitner mit ausladenden Armbewegungen dirigierte und allegro furioso zu einem Höhepunkt trieb, nach dem die Studenten ermattet in sich zusammensanken und darauf warteten, dass endlich, schließlich war mehr als die Hälfte der Unterrichtszeit verstrichen, über Mahlers Neunte gesprochen wurde.
Für Scharrleitner war Eleganz die wichtigste Eigenschaft eines Dirigenten, und die betraf nicht bloß Kleidung, Haarschnitt oder andere Äußerlichkeiten, sondern vor allem seine Bewegungen. Wenn sich die Tür zum Orchestergraben oder in den Konzertsaal öffne, müsse der erste Schritt vor das Publikum bereits Klarheit schaffen. Ein falscher Rhythmus, ein gehetzter Zwischenschritt vernichte alles Folgende. Was immer auch in den nächsten Stunden zu hören sei, könne man getrost vergessen. Die Leute sollten, noch bevor der Dirigent sein Pult erreicht hätte, aufstehen und an den Garderoben ihre Mäntel abholen. Die Zeit, die sie für die Musik vorgesehen hätten, würden sie sinnvoller in ein exzellentes Abendessen investieren. Und auch den Orchestermusikern wäre damit geholfen, sie hätten einen freien Abend gewonnen, den sie mit ihren Familien oder Geliebten verbringen könnten. Der Musikerberuf sei ja ein ausgesprochen familienfeindlicher und liebestötender, jede Absage würde Beziehungen retten, und wenn schon nicht retten, so doch ihr Zerbrechen hinauszögern.
An diesem Punkt seiner Ausführungen stellte Scharrleitner stets dieselbe Frage: Wer von Ihnen möchte in einer intakten Beziehung sein Leben verbringen? Kein einziger Student meldete sich jemals, nachdem bekannt war, dass Scharrleitner einmal einen hochbegabten Koreaner aus seiner Vorlesung geworfen und sich geweigert hatte, ihn weiter zu unterrichten, weil der gemeint hatte, er halte es sehr wohl für machbar, Musik und Liebe zu verbinden, schon allein deshalb, weil Musik für ihn der höchste Ausdruck von Gefühlen und ohne Liebe unmöglich sei. Da er es nicht gewohnt war, dass ihm widersprochen wurde, und das vor dem Koreaner auch niemand gewagt hatte, verlor Scharrleitner für ein paar Augenblicke die Fassung und jegliche Eleganz, sein Gesicht lief rot an, mit gespreizten Fingern zerfurchte er seine sorgsam gepflegte Mähne. Die von Semester zu Semester weitergegebene Anekdote endete damit, dass er sein Pult verließ, auf den Koreaner zulief, mit dem Taktstock auf den jungen Mann einschlug und ihm nur deshalb nicht die Augen ausstach, weil der geistesgegenwärtig sein Gesicht vor der drohenden Blendung hinter den Handflächen verborgen hatte.
Danach betrieb der Koreaner mit seiner Frau ein Lokal gegenüber der Musikhochschule, an der sie beide gescheitert waren. Er an Scharrleitner und sie nach einem tragischen Unfall. Ihre Eltern besuchten sie, da sie die Tochter jahrelang nicht gesehen hatten, und hörten sich voll Stolz ein Konzert des Hochschulorchesters an, bei dem Kira Cello spielte. Bevor sie in ihre Heimat zurückkehrten, wollten die Eltern mit ihrer Tochter eine Fiakerfahrt unternehmen, weil sie ihre Bekannten nach Europaurlauben davon schwärmen gehört und zahllose Fotos gesehen hatten. Vor der Albertina scheuten die Pferde wegen eines rücksichtslosen Motorradfahrers, Kira wurde aus ihrem Sitz geschleudert und geriet mit dem rechten Arm unter ein Kutschenrad. Nach mehreren Operationen war klar, sie wird nie mehr Cello spielen. In ihrem Lokal waren ausschließlich Cellosuiten von Bach zu hören, die von den meisten Kunden für koreanische Volksmusik gehalten wurden.
Dass der Besitzer seines Lieblingsrestaurants jener Student war, den er vor Jahren in seiner Vorlesung attackiert hatte, ahnte Scharrleitner nicht. Wenigstens einmal in der Woche thronte der mit seinen beiden Assistentinnen beim Koreaner, verdrückte Unmengen Bulgogi mit Reis und Kimchi und quälte die Frauen mit bizarren Aussagen über die Eleganz beim Dirigieren, die zumeist damit endeten, dass er lautstark über die geschmacklose Art der Orchesterleitung von berühmten Dirigenten herzog und nicht bemerkte, wenn er seinen Frack mit Soße bekleckerte oder ihm ein Rindfleischstreifen aus dem Mundwinkel baumelte. Die Assistentinnen wagten es natürlich nicht, ihn darauf hinzuweisen, und so kicherten oft Gäste an den Nebentischen, was Scharrleitner aber nicht auf sich bezog, sondern in seiner Eitelkeit annahm, sie würden sich bei seinen Dirigentenvernichtungen bestens unterhalten. Nur den koreanischen Besitzern verging das Lachen, wenn Maestro Clemens Maria, wie ihn seine Begleiterinnen nannten, das Lokal betrat. Meist eine Verdi-Arie trällernd, als hätte sein Frack nicht genügt, um die Aufmerksamkeit aller Gäste auf sich zu lenken. Hin und wieder ließen sich vor allem asiatische Touristen zu einem schüchternen Applaus hinreißen, weil sie wohl annahmen, er sei ein berühmter Sänger der noch berühmteren Staatsoper, deren Besuch in allen Gruppenarrangements vorgesehen war.
Bevor ich Wien verließ und zu meiner Tante Iris in die Knesebeckstraße zog, recherchierte ich in der Institutsbibliothek Scharrleitners Biografie und fand heraus, dass der nie ein bedeutendes Orchester geleitet hatte. Fünf Jahre war er zweiter Kapellmeister am Linzer Landestheater, trotzdem erzählte er, wie er den Konzertmeister der Slowakischen Philharmonie geohrfeigt oder eine Bratschistin der Berliner Philharmoniker an den Haaren aus dem Saal gezerrt hatte, weil die nicht fähig gewesen waren, seine Ideen umzusetzen. Keiner seiner Studenten hielt ihn, wohl weil die Szenen so unvorstellbar waren, für einen Lügner oder Angeber. Sie starrten ihn fassungslos an, und Scharrleitner genoss ihr Entsetzen.
Hin und wieder ließ er durchblicken, ohne jemals konkret zu werden, dass er selbst komponiere, aber ich entdeckte bloß im Archiv einer Bezirkszeitung den Bericht über ein Opus für Blockflöten und Rhythmusinstrumente. Er werde sich neben seiner Dirigententätigkeit in Zukunft auch intensiv seinen Kompositionen widmen, vor allem deren Verbreitung; bislang seien nur seine Sinfonietta Nr. 1 für gemischten Blockflötenchor und Pauken und das nachfolgende Opus 2, die auf zwei langsame Sätze beschränkte Sinfonietta Nr. 2 für zwölf Altflöten und Becken, aufgeführt worden. Und das im Veranstaltungssaal einer Papierfabrik, mit deren Leiter er das Gymnasium besucht habe, aber er wisse, dass die Zeit reif sei für sein Werk, das bald schon in den größten Häusern bewundert werden könne. Der Reporter schloss seinen Artikel mit dem Wunsch für ein langes Leben in Gesundheit, in dem die Schaffenskraft Clemens Maria Scharrleitners niemals erlahmen möge …
Was niemals erlahmte, waren seine bizarren Ideen, mit denen er einen Teil seiner Studenten zur Verzweiflung trieb, während sich die psychisch stabilen unter ihnen über sie amüsierten. Solange Scharrleitner die in der Hochschule verfolgte, versuchten die Zartbesaiteten, um es musikalisch auszudrücken, die Anordnungen des Professors als Marotte oder Gehorsamsübung abzutun, obwohl sie hätten bemerken müssen, dass sie wie Welpen in der Hundeschule behandelt wurden. Verließen sie aber hinter ihm das Gebäude wegen einer stil- und persönlichkeitsbildenden Exkursion, wobei Scharrleitner darauf bestand, dass alle Teilnehmer wie er im Frack erschienen, schämten sich die Streichergemüter, weil sie vom ersten Schritt ins Freie an begafft und verspottet wurden. Manche von ihnen benötigten nach solchen Auftritten wochenlange Gesprächstherapien, um sich wieder auf ihre Partituren konzentrieren zu können. Den robusten Bläsernaturen unter den Dirigentenanwärtern konnten die Verrücktheiten nichts anhaben, sie versteckten auf den Freigängen Schnapsflaschen unter ihren Frackjacken und verbündeten sich schon nach kurzer Zeit mit den Passanten gegen Scharrleitner und ihre verklemmten Kollegen, die sich willenlos unterwarfen.
Bei einer dieser Exkursionen mussten sie vor der Staatsoper und später vor dem Musikverein Aufstellung nehmen und eine Viertelstunde lang unter Scharrleitners Dirigat das Wort überschätzt den Gebäuden zubrüllen. Danach gestattete er den Zartbesaiteten ein Glas Milch am Naschmarkt, damit sie gestärkt die Szene vor dem Theater an der Wien wiederholen konnten. Einfacher war es für die Sensiblen, wenn Scharrleitner sie in die Natur führte, was öfters der Fall war, denn von der Natur könne ein Dirigent am meisten lernen, behauptete er. Von der Fauna und der Botanik erfahre der aufmerksame Beobachter an einem einzigen Nachmittag mehr als beim jahrelangen Studium von Klugscheißerinterpretationen mit pseudophilosophischem Unterbau. Die würden allesamt von geistesverstümmelten Stubenhockern stammen und dienten ausschließlich dazu, den Blick der angehenden Dirigenten auf die Musik zu vernebeln. An der Musikoberfläche pralle der ab und werde als depressive Rückmeldung in die Köpfe der Studenten zurückgeschossen.
Und aus welchem Grund sollten die Stubenhocker das inszenieren?, fragte ein Bläsergemüt unter seinen Hörern im Wienerwald.
Weil sie, erklärte Scharrleitner mit einem selbstgefälligen Lächeln und bestand darauf, dass die Stubenhocker nur mit dem sie charakterisierenden Adjektiv genannt werden, also nicht bloß Stubenhocker, sondern geistesverstümmelte Stubenhocker, weil sie selbst nicht die geringste Ahnung von Musik hätten und fürchteten, ein anderer würde nicht an der Oberfläche der Kompositionen seine Grenze finden, sondern in sie eindringen. Für einen solchen wäre es ein Leichtes, sie von ihren geistesverstümmelten Stubenhockerpodesten zu stürzen. Die Natur bestehe ja nur vordergründig aus Materie, die von allen gesehen oder ertastet werden könne, fuhr Scharrleitner fort, nicht ohne sich vorher an dem Studenten für seine Zwischenfrage gerächt zu haben, indem er ihn als gehirnamputierten Idioten abkanzelte und von den übrigen Exkursionsteilnehmern verlangte, sie sollten ihn verlachen und mit Tannenzapfen bewerfen.
Die absurden Angriffe auf Opernhäuser, Konzertsäle und erfolgreiche Dirigenten waren, weil ganz offensichtlich seinem Neid geschuldet, für die meisten Exkursionsteilnehmer nachvollziehbar. Eine Grenze überschritt Scharrleitner jedoch, als er eines Tages über die Musik der Stille sprach. Töne seien maßlos überschätzt, begann er und verstörte mit diesem Satz nun auch die zartbesaiteten Streichergemüter, die ihm in ihrer Unterwürfigkeit bis hierher widerspruchslos gefolgt waren. Ratlosigkeit machte sich unter den Dirigentenanwärtern auf der Lichtung breit, die Scharrleitner genoss. Minutenlang gab er sich den Anschein, angestrengt in Büsche hinein- und zu Baumwipfeln hinaufzuhören; die Bläsernaturen warfen sich Blicke zu und verständigten sich so darüber, bei der nächsten Gelegenheit im dichten Unterholz zu verschwinden und in die Stadt zurückzukehren. Der Verrückte, dem es gelungen war, ihnen einen Tag zu rauben, an dem sie Mahlers Sinfonien studieren sollten, würde ihre Abwesenheit nicht bemerken, weil er sich mit seiner Musik der Stille vom Waldboden erhoben hatte und nun über den Bäumen schwebte, von wo aus seine Zuhörer, wenn er sie überhaupt noch wahrnahm, wie Ameisen aussahen. Winzige Krabbler, die seinen Höhenflügen niemals folgen könnten. Die sollten in ihre Provinznester zurückkehren und Blaskapellen dirigieren. Deren Mitgliedern gehe es ja in den seltensten Fällen um die Musik, die meisten bliesen keinen einzigen reinen Ton, sabberten ihre Instrumente voll, fielen ständig aus dem Takt und benützten die Kapellen nur als Ausrede, um sich nach den Proben betrinken zu können. Jeder Installateur oder Elektriker, der auch nur die Hälfte von dem trinke, was ein Blasmusiker in sich hineinschütte, gelte als Säufer und bekomme nach einiger Zeit kaum noch Aufträge. Dass Posaunisten, Trompeter, Klarinettisten oder gar Tubabläser Unmengen an Bier tränken, erscheine allen natürlich, weil ja jeder schon gesehen habe, welche Menge an Flüssigkeit aus den Instrumenten in den Pausen zwischen zwei Märschen zu Boden rinne. Der musikbedingte Verlust müsse ausgeglichen werden, geschähe das nicht, schwebten die Blasmusiker in Lebensgefahr, könnten schon mitten im nächsten Marsch tot zusammenbrechen. Dass es sich dabei bloß um eine billige Ausrede handle, lasse sich auf jedem Landbegräbnis leicht nachweisen. Aber die Bauern- und Handwerkerquerköpfe, die in diesen verödeten Landstrichen hausten, machten sich nicht die Mühe oder seien zu einfältig, um die Blasmusiker aufzudecken. Das liege wahrscheinlich daran, dass sie schon im Kinderwagen, um die Erwachsenen nicht bei der Arbeit zu stören, mit einem in Most getauchten Schnuller, in ihrer verwilderten Sprache Mostzutzl genannt, ruhiggestellt worden seien. So dämmerten sie sich in ihr Leben hinein und verlören ihre Urteilskraft, noch bevor sie gehen könnten. Wäre das nicht der Fall, würden sie bemerken, dass es nach einem Stück an den offenen Gräbern, dem guten Kameraden oder einem verstümmelten Trauermarsch aus der Chopin-Sonate, nicht notwendig sei, beim anschließenden Totenmahl im Dorfwirtshaus literweise Bier in ihre Blasmusikkörper hineinzuschütten, nicht selten die hundertfache Menge von dem, was auf dem Friedhof aus ihren Instrumenten geflossen sei.
Der größte Irrglaube, riss Scharrleitner seine verunsicherten Zuhörer aus ihren Gedanken, besteht ja darin, dass Musik in erster Linie oder ausschließlich eine Angelegenheit der Ohren ist. Das Hören werde maßlos überschätzt, sei wahrscheinlich nach der Bedeutung des Geschlechtsverkehrs für das Zusammenleben der Menschen die am meisten überschätzte Sache. Wieder entfernte er sich von der Musik der Stille in einen Exkurs über die Sexualität, von der Scharrleitner behauptete, sie trenne zwei Menschen mehr, als dass sie diese verbinde. Biologisch betrachtet löse der Geschlechtsakt, wenn er nach den lächerlichsten Verrenkungen zu einem erfolgreichen Ende gelange, zumindest für kurze Zeit die Anspannung in den schwitzenden und dampfenden Körpern der Beteiligten, aber das habe nichts mit dem Denken oder Fühlen der ratlos Nebeneinanderliegenden zu schaffen, sondern lasse sich am ehesten mit dem Vorgang vergleichen, wenn aus einem Hochdruckkessel Dampf abgelassen werde. Außerdem diene er, wenn sich der Puls der Akteure beruhigt habe, ausschließlich dazu, die Herrschaftsverhältnisse zwischen zwei Menschen zu zementieren oder umzustoßen. Nicht anders verhalte es sich mit dem Hören, bei dem die Klangerzeuger ihre Macht über die passiven Bewunderer beweisen und festigen möchten. Aber anders als die am Geschlechtsverkehr Beteiligten müssten die Musikhersteller nicht fürchten, ihre Herrschaft über die Hörer einzubüßen, weil deren Bewunderung, eine Folge jahrhundertelanger Klangeinschüchterung in Konzertsälen und Opernhäusern, das nicht zulasse. Der hässlichste Pianist, der sich mit seinem monströsen Mienenspiel wie ein Epileptiker auf der Klavierbank verrenke, werde bewundert, wegen seiner unfassbaren Fingerfertigkeit und Treffsicherheit, auch wegen der Gefühle, die seine wohlphrasierten Klangkaskaden in den Zuhörern angeblich auslösten. Was für ein Unsinn!, schrie Scharrleitner und forderte den verbliebenen Rest seiner Zuhörer auf, sich von den Ohren weg- und zu den Augen hinzubewegen. Und das allegro vivace!
Um ihnen diesen Weg zu ebnen, stellte Scharrleitner einen Satz zwischen die Bäume auf der Lichtung, den er mehrmals wiederholte und dabei seine Eindringlichkeit steigerte: Meine Freunde (durch diese Anrede wollte er wohl am Beginn seiner Ausführungen eine Komplizenschaft mit seinen Studenten herstellen), meine Freunde, stellen Sie sich vor, dass Brillen für die Augen nichts anderes sind als Hörgeräte für die Ohren!
Die erhoffte Wirkung dieser Einleitung blieb nicht aus, kein Ton, nicht einmal ein leises Füßescharren war nach ihr zu hören, sogar das Vogelgezwitscher schien diminuendo zu verebben, zumindest empfanden das einige seiner Hörer so.
Worauf er denn zu achten habe, weil er die Bildtöne noch nicht sehe, fragte ein Student, nachdem er zuerst den Waldboden, später auch die Bäume bis zu ihren Wipfeln hinauf und schließlich den von den Baumkronen freigegebenen Himmel erfolglos nach Klängen abgesucht hatte. Ein anderer wollte wissen, ob es einen Trick gebe beim Aufspüren der Bildklänge und ob die Klänge Stimme für Stimme vor ihren Augen schwebten oder übereinandergelagert wie in einer Partitur. Solitär oder symphonisch?, fügte er an und zog sich mit seiner Beharrlichkeit den Unmut Scharrleitners zu, der sich jede weitere Frage verbat; seine Hörer, die er von nun an Seher nannte, müssten ihren Augen vertrauen und die Ohren abschalten, dann würde die Augenmusik zu ihnen kommen. Nicht sie sollten sich auf die Suche nach ihr machen und dabei wieder bloß mit ihren Ohren denken, sondern vollkommen ohrenlos auf das Eintreffen der Bildklänge warten. Musik, auch die Ohrenmusik, habe doch immer mit Geduld zu tun, jeder Ungeduldige würde allein wegen dieser Charaktereigenschaft an der Musik oder an seinem Instrument scheitern, was alle einsähen, daran sollten sie denken und dass es keinen vernünftigen Grund gebe, weshalb die Geduld in der Augenmusik keine Rolle spielen sollte.
Selbst die treuesten Studenten befiel an diesem Punkt seiner Ausführungen eine verzweifelte Ratlosigkeit. Verzweifelt deshalb, weil sie es ja gewohnt waren, sich zu unterwerfen und ihrem Lehrer auf den abwegigsten Pfaden zu folgen, aber sosehr sie sich auch anstrengten, sie hörten oder sahen keine Musik. Nicht einen einzigen Ton erspähten sie, obwohl sie sich ihre Ohren zuhielten und die Augen weit aufrissen, als hätten sie Entsetzliches erblickt. Scharrleitner genoss ihre Verstörung und verlangte von den Sehern, sie sollten ihre Augen für eine Minute schließen und, so vorhanden, das Denken abschalten. Danach müssten sie sich ihren Augen anvertrauen, schweigend, schärfte er ihnen ein, und würden in die wunderbarsten Bildklänge eintauchen.
Da hatte sich bereits der größte Teil der Studenten auf den Rückweg in die Stadt gemacht. Diejenigen, die bei Scharrleitner im Wald geblieben waren, gingen den übrigen in den nächsten Tagen aus dem Weg und ließen sich auch Wochen später nicht dazu bewegen, über ihre Erfahrungen mit der Augenmusik zu sprechen. Auch Scharrleitner erwähnte die nicht mehr, sondern verwendete die meiste Zeit in seinen Vorlesungen für seine bekannten Dirigentenvernichtungen; die einzige Abwechslung bestand darin, dass sein bevorzugtes Opfer nicht mehr