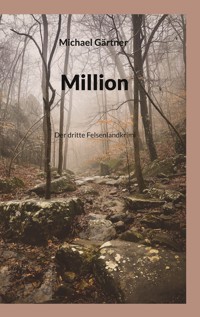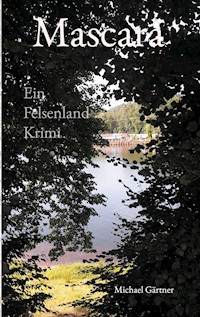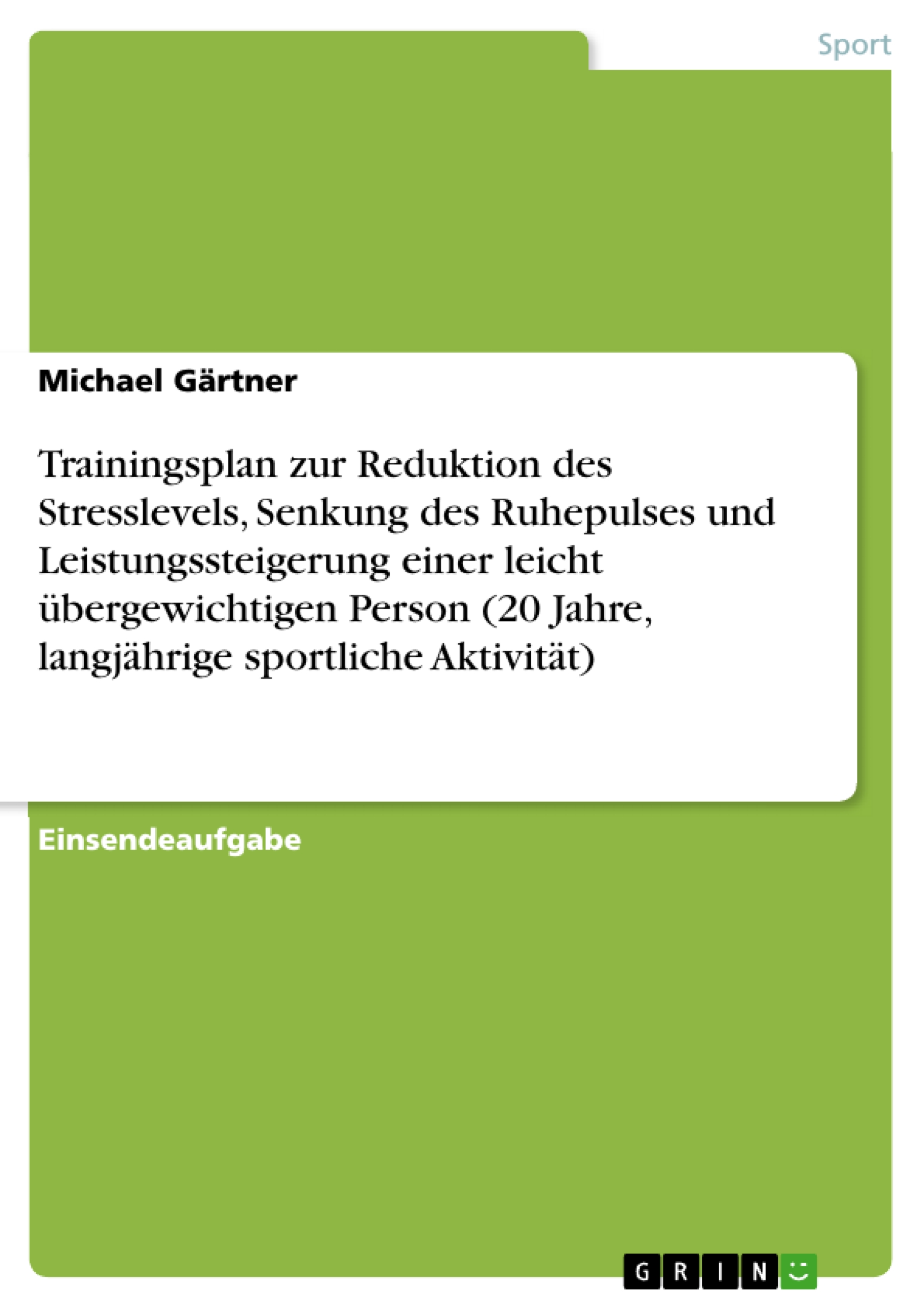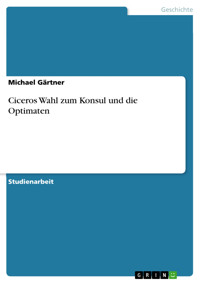Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Was hat es mit dem sogenannten Lotsen auf sich, dem geheimnisvollen Leiter der ominösen Kirche des guten Glaubens? Während das Leben in der malerischen Landschaft des Königsbruchs im Frühling neu erwacht, stört der Tod die Idylle. Zwei Mitglieder einer Seminargruppe, die in der Heilsbach bei Schönau tagt, kommen auf rätselhafte Weise ums Leben. Dann ist da noch die verführerische Tamara, die wie aus dem Nichts auftaucht. Die Pirmasenser Kommissare Peters und Scheller stochern im Mainebel. Ein emeritierter Professor zieht Erkundigungen in den USA ein, eine Bäckerin ermittelt undercover. Nach und nach kommen sie einem verzweigten Netzwerk auf die Spur. Währenddessen zieht im Pfarrhaus in Schönbach die Rushhour des Lebens ein. Der vierte Krimi aus dem Dahner Felsenland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dahner Felsenland
Mai 2011
Alle Figuren der Erzählung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen wären zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Epilog
Prolog
Im späten Frühjahr, wenn der Sommer kommen will, sich jedoch nicht durchsetzen kann, liegen oft am Morgen und am Abend Nebelschwaden über dem Königsbruch. In ihrem Schutz wagen sich die Kaulquappen aus dem Laich, die Libellen schlüpfen aus den Larven, das Gras treibt aus und träumt von einer Ähre, so hoch wie das Schilf. Das Leben explodiert in einer nicht geahnten Vielfalt. Wasserschlauch und Igelkolben erheben sich über die Wasseroberfläche, Sumpfbinse und Wollkraut trauen sich ans Licht. Der Krebs lauert auf seine Beute. Leben bedeutet, anderes Leben zu töten, um leben zu können. Leben lebt, indem es anderes Leben verzehrt. Doch manchmal wird getötet und man weiß nicht warum.
1
Yasmin und Mattes waren bei Oma und Opa Fouquet. Das hatten sie sich schon so lange gewünscht – einmal ein Wochenende bei den Großeltern in Kaiserslautern und ohne die Eltern. Bei Oma und Opa gab es immer Kakao zum Frühstück und ein Ei, wenn man wollte. Honig und Nougatcreme gehörten genauso dazu wie ein Fruchtjoghurt zum Nachtisch. Oma und Opa mussten morgens nicht zur Arbeit, hatten einen riesengroßen Fernseher und wussten, wie man bei You-Tube an die neusten Folgen von Bob, dem Baumeister, kam.
Barbara und Bernd hatten endlich einmal wieder Zeit zum Ausschlafen, ohne die Kinder, ohne nächtliches Getrappel auf dem Flur oder ein »Mama, ich habe schlecht geträumt«. Die Zwillinge waren drei Jahre alt, überaus rege und redeten bereits wie die Alten. Nun waren sie für drei Tage bei den Großeltern, die sich danach vermutlich am liebsten für eine Kur anmelden würden.
Nun, es sollten keine ruhigen drei Tage werden, denn eines dieser unermüdlichen Wandererpärchen war bereits im Morgengrauen aufgebrochen und hatte eine erschreckende Entdeckung gemacht.
Die beiden waren noch nicht lange ein Paar. Vor knapp vier Wochen hatten sie sich auf der Jubiläumsfeier ihrer Firma kennengelernt. »75 Jahre Werkzeugmaschinen aus Dahn« – das war den Chefs ein Fest wert gewesen, wie es das kleine Gewerbegebiet bisher nicht gesehen hatte. Selbstverständlich Bierzelt, Musikband, feinste Vorspeisen, Ochse am Grill und für die Vegetarier alles, was die Veggieindustrie so hergab. Die beiden hatten sich im Arbeitsalltag schon ab und an gesehen, auch gelegentlich einen Gruß zunicken können. Zu einem Gespräch war es bisher nicht gekommen. Das ergab sich jetzt fast von selbst, als beide bei der Essensausgabe anstanden. Später holte er sie vom Tisch mit ihren Kolleginnen ab, lotste sie auf die Tanzfläche und die Dinge nahmen ihren Lauf. Am Abend knutschten sie intensiv in einer Ecke des Zeltes. Zwei Tage später übernachtete er bei ihr.
Nun sagt man den deutschen Männern nach, dass sie mit ihren Neueroberungen gerne wandern gehen – sozusagen als eine unverfängliche gemeinsame Aktivität, die dazu geeignet ist, einander besser kennenzulernen. Dies soll angeblich noch beliebter sein als die Einladung zum Essen. Auf jeden Fall ist es in der Regel billiger. Was die Motivation dieses jungen Mannes aus der Werkzeugmaschinenfabrik gewesen war, muss ungeklärt bleiben. Nicht zu leugnen ist jedoch, dass das Dahner Felsenland eine beliebte Region bei Wanderern und Kletterern ist. Er lud jedenfalls seine Neue zu einer Wanderung ein, und weil es morgens so schön ist und man mit ein wenig Glück den Sonnenaufgang Schulter an Schulter und Arm in Arm, einander wärmend genießen kann, sollte diese Wanderung recht früh beginnen. Sie stellten den Wagen am Bundenthaler Bahnhof ab und gingen hinauf zu den Fladensteinen. Die Betrachtung des Sonnenaufgangs hatten sie bereits absolviert, als sie sich der dem Tal zugewandten Seite des Bundenthaler Brockens näherten. Er erzählte ihr gerade begeistert von seinen Erfolgen in der Jugendfußballmannschaft der TSG Rumbach, was sie nur peripher interessierte, als ihr umherirrender Blick eine unerwartete Entdeckung machte.
»Was ist das?«, rief sie. »Siehst du das?«
Er unterbrach seine Erzählung über den Aufstiegskampf in die Kreisliga und das entscheidende Spiel gegen den FC Hinterweidenthal und schaute in die von ihr gewiesene Richtung.
»Ein Anorak!«
»Mit Haaren?«, fragte sie, und es klang ein wenig empört.
»Ich schaue es mir näher an.«
Dies war eine gute Gelegenheit, neben seinen spielerischen Fähigkeiten auch den in ausreichendem Maße vorhandenen Mannesmut zu beweisen. Also ging er sicheren Schrittes auf das behaarte Etwas zu, schaute näher hin, wandte sich ab und lief zu ihr zurück.
»Eine Frau. Ich glaube, sie ist tot.«
»Dann ruf die Polizei!«, sagte sie aufgeregt.
Damit kam ein Vorgang in Gang, der Bernd Peters Pläne für das Wochenende komplett auf den Kopf stellte.
Was das junge Paar betrifft, das wir an dieser Stelle schon wieder verlassen müssen, können wir auf eine glückliche gemeinsame Zukunft hoffen, hatte der Mann doch bereits verstanden, dass es entsprechend dem bewährten Motto »Happy Wife, happy Life« sinnvoll ist, dem zu folgen, was die Frau sich wünscht.
Die zum Fundort der Leiche beorderte junge Polizistin und ihr Kollege riefen im Pfarrhaus in Schönbach an, und der Samstag begann so ganz anders, als Bernd Peters es sich am Abend zuvor in seiner durch kurzzeitige Kinderlosigkeit überbordenden Fantasie ausgemalt hatte. Er hatte sich schon mit Barbara im Thermalbad in Bad Bergzabern gesehen, mit Saunagang und allem Drum und Dran. Der Nachmittag im Bett, den Abend ganz entspannt vor dem Fernseher. Endlich einmal heraus aus dem Trott von Kindergeschrei, nächtlicher Unruhe und Schlafmangel. Und nun kam dieser Anruf.
Ein Gutes hatte die Angelegenheit: Die Anfahrt war kurz. Der Kriminalkommissar wohnte bei seiner Frau im Pfarrhaus in Schönbach, Luftlinie keine zwei Kilometer von den Fladensteinen entfernt, von denen der Brocken der größte war. Also konnte sein Kollege Scheller erst einmal bei seiner ihm angetrauten Krankenschwester und dem Baby in Pirmasens bleiben. Der hatte seinen freien Samstag genauso verdient wie Bernd Peters, hatte doch eine Serie von Einbrüchen die beiden die letzten Wochen intensiv beschäftigt. Schließlich war es ihnen gelungen, den Kleinbus mit den beiden Erwachsenen und den sechs osteuropäischen Minderjährigen direkt nach einem Einbuch vor einer Villa in Lemberg sicherzustellen. Die Jugendlichen kamen ins Nardinihaus in Pirmasens, die beiden Erwachsenen ins Gefängnis nach Zweibrücken.
Jetzt musste er noch vor dem Frühstück ins Wieslautertal hinunter und dann auf Forstwegen so nahe wie möglich an die Fladensteine heran. Der im Mai allgegenwärtige Frühnebel lag im Tal der Wieslauter. Er musste vorsichtig fahren. Aber kaum hatte er ein paar Meter an Höhe hinauf zu den Felsen gewonnen, war die Sicht wieder klar.
Die einzelnen Felsen haben eigene Namen. Der größte, in Richtung Schönbach gelegene, wird »Bundenthaler Turm« oder »Brocken« genannt. Es folgen der »Namenlose Turm«, der »Ilexturm« und der »Stuhl«, bei dem seine Form der Namensgeber war. Dem »Jüngstturm« und dem »Backofen« schließt sich in Richtung Erlenbach der »Erlenbacher Turm« an.
Um diese Felsformationen rankt sich – wie um so viele im Felsenland – eine Geschichte. Sie erzählt von einer Hochzeit, die einst auf der Burg Berwartstein gefeiert wurde. Unter den Gästen waren sieben Bundenthaler Brüder. Am Ende des rauschenden Festes wankten sie nach Hause. Unterwegs kamen sie jedoch vom Weg ab und beschlossen, auf dem Berg über Bundenthal zu rasten. Während sie sich ausruhten, kam ein alter, gebrechlicher Mann des Wegs und bat die sieben um ein Almosen. Sie beschimpften ihn und nannten ihn einen Faulpelz und Tagedieb. Da sagte der Alte zu ihnen: »Eure Herzen sind aus Stein. Und so sollen auch eure Körper zu Stein werden!« So geschah es. Seitdem waren die sieben Brüder zu Stein geworden und rührten sich nicht mehr vom Fleck.
Der Wald um die Steine herum war jung, und doch hatte er sie schon fast überwuchert. Die Gipfel der Bäume reichten bis an die Spitzen der Sandsteinfelsen. Unten, im Schatten, hatten die Wanderer und Kletterer Wege ausgetreten. Peters kam an einer Bank vorbei, warf einen kurzen Blick auf die Schautafel mit den Erläuterungen, nahm im Vorbeigehen wahr, dass an den Felsen bis zu zehn verschiedene Ablagerungsschichten des Urmeeres zu unterscheiden waren, stolperte über einen grün bemoosten Ausläufer des Ilexturms, strich ein wenig ehrfürchtig mit der Hand über den Sandstein und suchte den Ort des Geschehens.
Übermäßiger Alkoholgenuss und anschließender Verlust der Orientierung wie bei den sieben Brüdern hätten auch die Ursache für den Tod dieser Frau mit den blondierten Haaren und der sportlichen Figur sein können. Sie lag auf dem Rücken, als wäre sie gerade umgefallen, vielleicht im Rausch gestolpert und in der kühlen Mainacht an Unterkühlung gestorben. So etwas hatte Peters immer wieder einmal erlebt. Es musste nicht eine klirrend kalte Winternacht sein, auch diese Frühlingsnächte nahe dem Gefrierpunkt genügten für eine tödliche Unterkühlung, wenn der Alkoholpegel hoch genug war. Gegen die Unterkühlung sprach, dass die Frau ihre Regenjacke anhatte. Menschen, die zu erfrieren drohen, ziehen oft ihre Kleidung aus, weil sie kurz vor dem Kältetod ein unerträgliches Wärmegefühl überfällt. Aber vielleicht war sie auch dazu zu betrunken gewesen.
Er hatte den Weg zum Fundort der Leiche schnell gefunden. Die Kollegen von der Bereitschaft hatten ihren Einsatzwagen in der Nähe des Felsens geparkt und das Blaulicht eingeschaltet gelassen. Fünfzehn Minuten nach ihrem Anruf war er bereits bei ihnen angekommen. Das Wandererpärchen saß ein wenig abseits auf einem Stapel Schichtholz und trank aus einer Thermosflasche heißen Tee oder Ähnliches. Nachdem er die Kollegen mit Handschlag begrüßt hatte, ging Peters zu ihnen.
»Das muss ein ziemlicher Schock für Sie gewesen sein«, begann er vorsichtig.
Beide nickten.
»Haben Sie die Frau so vorgefunden, wie sie jetzt dort liegt?«
»Ja, ich habe sie nur kurz angestupst, um zu schauen, ob sie noch lebt«, antwortete der Mann. »Aber sie war schon ganz steif. Der ganze Körper hat sich bewegt. Schrecklich!«
»Dann haben Sie vermutlich auch niemand anderen in der Nähe gesehen?«, hakte Peters nach.
»Nein, wir waren sehr früh hier«, meinte die Frau, »da ist sonst kaum jemand unterwegs.«
»Dann versuchen Sie sich jetzt von dem Schreck zu erholen.« Peters bemühte sich, verständnisvoll zu wirken. »Geben Sie den Kollegen dort Ihre Kontaktdaten und kommen Sie am Montag nach Pirmasens in die Polizeidirektion, damit wir ein Protokoll schreiben können.«
Jetzt hatte er Zeit für die Kollegen von der Streife. »Auch nicht der Samstagmorgen, wie ihr ihn euch gewünscht habt, oder?«
»Na ja, wer findet schon gerne eine Leiche?«, fragte die Kollegin.
»Andererseits, wenn gar nichts los ist, ist es auch nicht so schön«, meinte der Mann.
»Ist euch etwas aufgefallen?«, fragte Bernd Peters routinemäßig.
»Nein«, antwortete die junge Frau, »die Wanderer saßen da, wo Sie sie angetroffen haben. Wir haben ihnen die gleichen Fragen gestellt und die gleichen Antworten bekommen.«
»Sie könnte vom Felsen gefallen sein. Vielleicht ein nächtlicher Kletterversuch, oder sie ist einfach vom Weg abgekommen. Bis auf die Schürfwunde am Kopf sieht man auf den ersten Blick keine Verletzungen.«
»Wisst ihr, wer sie ist? Habt ihr sie schon einmal hier in eurem Bezirk gesehen?«
»Ich vermute, sie ist ein Feriengast«, sagte der Kollege. »Wir haben tatsächlich die meisten Menschen in der Verbandsgemeinde in den vergangenen Jahren schon einmal gesehen. An sie erinnere ich mich nicht.«
Ein Kastenwagen mühte sich den Waldweg hinauf. Er hielt fünfzig Meter vor dem Fundort der Leiche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Spurensicherung luden ihre Gerätschaften aus und kamen näher.
»Dachte ich es mir doch, der Kommissar Peters. Ihre Stimme ist wirklich unüberhörbar und ebenso unverkennbar, Herr Kollege.«
»Ich vermute, was dieses Alleinstellungsmerkmal betrifft, habe ich einige Neider. Wer würde nicht gerne auf Anhieb erkannt werden?« Peters lächelte den Leiter der Spurensicherung an. Immer wieder wurde er mit seiner tiefen Stimme und dem norddeutschen Akzent aufgezogen.
»Vielleicht der nicht, der dies hier angerichtet hat«, kam es zurück.
»Möglich, aber auf den ersten Blick lässt sich noch nichts sagen. Kaum äußere Verletzungen. Die Frau kann vom Felsen heruntergefallen oder aber hier unten umgekippt oder niedergeschlagen worden sein. Ohne eure Arbeit und die der Gerichtsmedizin werden wir nicht weiterkommen.«
»Ich mache nachher ein möglichst gutes Foto von ihrem Gesicht und schicke es Ihnen aufs Handy«, sagte der Mann von der Spurensicherung.
»Dann schaue ich mich schon einmal ein wenig um«, meinte Peters.
»Sie täten uns einen großen Gefallen – wie Sie wissen -, wenn Sie das unterlassen würden. Wenn wir hier fertig sind, können Sie machen, was Sie wollen. Ich schicke meine Leute auch nach oben auf den Felsen. Sie bekommen einen ausführlichen, illustrierten Bericht und dann können Sie loslegen.« Im Laufe der drei Sätze hatte sich der Tonfall des Chefs der Spurensicherung von bittend in flehend und dann anordnend gewandelt. Bernd Peters zog sich zurück und bat die Kollegen vom Streifendienst, ein Bestattungsinstitut in der Nähe zu benachrichtigen, das die Tote später in die Prosektur der Rechtsmedizin in Mainz bringen sollte.
Er ging zu seinem Wagen und rief Klaus Scheller an. Sie verabredeten sich für den Nachmittag an der Fundstelle. Bis dahin müsste die Spurensicherung fertig sein.
Die Rückfahrt war kurz. Jedoch überfiel Bernd Peters wie jedes Mal, wenn er vor einem toten Menschen gestanden hatte, ein Gefühl der Trauer, vielleicht auch eher der Melancholie. Immer wieder kam ihm dann der Satz von Albert Schweitzer in den Sinn: »Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.« Wir alle wollen leben, ebenso die Tiere. Vielleicht gibt es auch bei den Pflanzen so etwas wie einen Lebenswillen. Wir Menschen können uns nicht ernähren, ohne anderes Leben zu zerstören. Dann sollten wir uns wenigstens nicht auch noch gegenseitig töten.
2
Das war es nun also mit dem kinderfreien Wochenende. Für den Besuch des Thermalbades war es inzwischen zu spät, für alles andere auch, befürchtete er. Bernd musste um fünfzehn Uhr schon wieder am Bundenthaler Brocken sein.
»Ich schlage vor«, meinte Barbara, als er ihr von seinem Einsatz erzählte, »wir machen ein leichtes Mittagessen und dann einen schön gestalteten Mittagsschlaf, zu dem wir mit den Kindern nie gekommen wären. Allein das wäre es doch schon wert, dass wir die Tage auf die Kleinen verzichten müssen.« Bernd zeigte sich sehr erfreut über diesen Vorschlag. Manches kam zu kurz, wenn man kleine Kinder hatte und ständig müde war. Vor allem der Sex, meinte er.
Barbara war Mutter durch und durch. Ein halbes Jahr nachdem Yasmin und Mattes auf die Welt gekommen waren, hatte sie wieder mit der Arbeit begonnen, sich Hilfe im Dorf besorgt, tagsüber ihre Freundin Anna Hoger eingespannt, bei Abendterminen Bernd in die Pflicht genommen. Sie hatte alles gut organisiert und schien mit einer schier unerschöpflichen Energie ausgestattet zu sein. Allerdings hatte sie ein paar Kilo Körpergewicht verloren, und die Ringe unter den Augen sprachen Bände von durchwachten Nächten und dem Stillen zweier hungriger Kinder. Die ersten Monate hatte sie sich eine Nährmutter wie in alten Zeiten gewünscht, mit der sie sich beim Stillen hätte abwechseln können. Zum Fläschchen wollte sie jedoch nicht greifen und musste es auch nicht. Es war immer genügend Milch da – aber es zehrte ganz schön an der Kondition. Kurz bevor die Kinder ihren zweiten Geburtstag feiern konnten, kam er dann, der unvermeidliche Zusammenbruch. Bernd nahm sich Urlaub, Opa und Oma Fouquet nisteten sich für drei Monate im Gästezimmer des Pfarrhauses ein, die Kleinen mussten lernen, dass Mama nicht ständig da sein konnte und es sie trotzdem noch gab. Barbara lernte, ihre Kraft einzuteilen und nicht immer alles allein zu machen. Die Kinder ihrer Freundin Anna Hoger entwickelten ungeahnte Fähigkeiten als Babysitter, Spielplatzbegleiter und Geschichtenvorleser.
Für Bernd war das ein harter Lernprozess. In seiner ersten Ehe hatte er keine Kinder gehabt. Zwar hatte er sich von Barbara immer eine Fußballmannschaft an Kindern gewünscht, kam aber schon bei Zweien schnell an seine Grenzen. Er hatte keineswegs immer die Geduld und die Kraft, die es benötigte, um die anstrengende Kleinkindphase konfliktfrei zu überstehen. Barbara jedoch gelang es, auch in angespannten familiären Situationen deeskalierend auf ihren Mann einzuwirken. Er lernte allmählich, dass das Vatersein viel leichter fiel, wenn man schreiende Kinder nicht als störend, sondern als hilflos ansah.
Von gelegentlichen Überforderungssymptomen abgesehen, hatte er sich zum idealen Vater entwickelt, auch wenn ihn immer wieder der Gedanke überfiel, dass diese beiden Kleinen zwischen ihm und seiner Frau standen, und er sich zurückgesetzt fühlte. Zwar gelang es ihm, dieses Gefühl, sobald es auftauchte, als kindisch einzuordnen, was es nicht daran hinderte, sich immer wieder zu melden. Es war nicht so wie früher, das musste er sich selbst gegenüber zugeben. Manchmal störten die Kinder die Zweisamkeit, gelegentlich auch gerade dann, wenn er die Nähe und Wärme Barbaras am meisten gebraucht hätte. Manchmal fühlte er sich alleingelassen von der Frau, die so viel Energie und Zeit in die Kinder steckte. In die Kinder stecken musste, wie ihm sein Verstand sagte. In die Kinder, die seine Kinder waren. Manchmal fühlte er sich einsam und wusste, dass es kindisch war, unreif, eines Mannes jenseits der Vierzig nicht würdig. Aber er fühlte so – und er gab sich Mühe, diesem Gefühl nicht zu viel Raum zu lassen.
Es war beim Espresso, den Bernd noch kurz trinken wollte, bevor er wieder zum Felsen aufbrechen musste, als sein Handy Pling machte und das Foto der Toten ankam. Barbara schaute ihm nachdenklich über die Schulter und sagte: »Die kenne ich – glaube ich zumindest.«
»Und woher? Wer ist sie?«
»Ich kann mich im Moment nicht genau erinnern. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Lass mich einen Moment nachdenken!«
In Gedanken versunken, begann sie, den Tisch abzuräumen. Bernd stellte das Geschirr zusammen und brachte es zur Spülmaschine. Es war sein Privileg, die Maschine einzuräumen. Was das Ausräumen betraf, war er eine Zeit lang tolerant gewesen und hatte auch andere dies machen lassen. Dann stellte er fest, dass die Tassen nicht dort standen, wo sie hingehörten, und das Besteck nicht parallel in der Schublade lag. Seitdem bemühte er sich, auch dies immer erledigen zu können.
Er schaute seine Frau fragend an. Die hatte sich hingesetzt und ihr Handy mit dem Terminkalender geöffnet.
»Wenn ich mich recht erinnere, muss es vor ein paar Tagen drüben in der Heilsbach gewesen sein. Du weißt schon, in dem Freizeitheim. Da findet zurzeit ein Seminar statt. Etwas Obskures, habe ich den Eindruck. Ich war bei der Leiterin, Schwester Ingeborg, und sah, wie eine Gruppe zum Mittagessen ging.« Barbara dachte nach. »Die Frau fiel mir auf, weil sie sich bei einer anderen untergehakt hatte und ziemlich schrill lachte. Außerdem hatte sie einen fliederfarbenen Kapuzenpullover an. Ungewöhnliche Farbe. Nicht mein Geschmack!«
„Okay“, sagte Bernd. „Wenn ich mit Klaus am Felsen fertig bin, fahren wir zusammen in die Heilsbach.«
Er gab Barbara einen Kuss und sprang aus dem Haus und ins Auto.
Die Spurensicherung hatte das Gelände um den Fundort der Toten abgesperrt und die Untersuchung abgeschlossen. Peters und Scheller konnten sich frei bewegen, es blieb ihnen allerdings nicht viel Zeit, denn im Westen näherten sich die angekündigten Regenwolken. In spätestens einer Stunde würde hier alles nass und rutschig sein. Sie stiegen auf den Felsen. Kein leichtes Unterfangen, jedoch gab es einen Weg, den man auch ohne Haken und Kletterseile begehen konnte.
Als sie oben angekommen waren, schnauften beide ganz tüchtig.
»Als Vater hat man keine Zeit mehr für Sport und verliert an Kondition«, meinte Klaus Scheller, der gerade die erste Babyphase durchmachte.
»Ich hoffe darauf, dass ich in ein paar Jahren mit den Kleinen Fußball spielen kann. Dann kommt die Kondition wieder.«
»Einen Rekord habe ich wahrscheinlich schon gebrochen – den Weltrekord im Schlafdefizit. Zumindest gefühlt.«
»Schlafmangel ist zwar weder für die Gesundheit gut noch für die Konzentration bei der Arbeit«, sagte Bernd, »aber manchmal habe ich den Eindruck, es eröffnen sich mit den sich zwangsläufig einstellenden Tagträumen ganz neue Dimensionen der Wirklichkeit. Ich sehe gelegentlich Dinge, von denen ich sicher bin, dass es sie nicht gibt.«
»Außerdem bewirkt Schlafmangel eine ganz natürliche Form der Empfängnisverhütung: Enthaltsamkeit.« Klaus Scheller hatte sein typisches Grinsen bisher nicht verlernt. »Ich erkenne mich nicht wieder.«
So bestätigten sich die beiden jungen Väter in ihrem Leiden und in der Gewissheit, alles Menschenmögliche – oder besser gesagt Mannesmögliche – zu tun, um ihrer neuen Aufgabe gerecht zu werden.
Bernd Peters ging bis zum Ende des Felsens über der Absturzstelle vor. Hier oben fanden sich Reste von Lagerfeuern. Den zu erwartenden Müll hatte vermutlich die Spurensicherung mitgenommen. Der Bundenthaler Brocken war ein beliebter Kletterfelsen mit anspruchsvollen Gängen. In der Hexennacht zum ersten Mai trafen sich hier oben regelmäßig Jugendliche, die ein Lagerfeuer machten und gegen Morgen, vor Einbruch der Dämmerung, durch die Dörfer zogen, um den Nachbarn Streiche zu spielen: Tore aushängen, Gartenmöbel auf dem Garagendach platzieren, Türklinken beschmieren und noch andere, gelegentlich leider auch geschmacklose Untaten. Das war erst ein paar Tage her. Was den Tod der Frau mit dem Anorak anging, war hier oben jedoch nichts zu entdecken.
Der Abstieg gestaltete sich schwieriger als der Aufstieg und dauerte länger. Die Knie schmerzten die beiden, es war nicht leicht, das Gleichgewicht zu halten. Eine schnelle Flucht war auf diesem Weg jedenfalls nicht möglich. Wer schnell vom Brocken herunterwollte, musste sich abseilen – oder springen, aber das würde tödlich enden.
Der Tatort – wenn es denn einer war – gab wenig her. Man könnte sich lediglich die Frage stellen, was hier passieren konnte, was an anderen Orten nicht möglich war. Man könnte oben auf dem Felsen einen romantischen Abend mit Sonnenuntergang und einem lauschigen Beieinander gestalten. Dazu waren die Nächte aber noch recht kühl. Man konnte ohne viel Aufwand jemanden, den man unter einem Vorwand – etwa dem eines lauschigen Beisammenseins – auf den Felsen gelockt hatte, ohne große Mühe hinabstürzen. Dazu brauchte es nicht viel Kraft. Ein Bein zu stellen oder ein leichtes Tippen an der Schulter sollte genügen. Es bliebe genügend Zeit, um sich aus dem Staub zu machen. Die Tote würde vermutlich erst am nächsten Morgen gefunden. Der Nachteil dieses Ortes war allerdings, dass man das Opfer erst einmal hier musste – und zwar freiwillig. Also musste man die Fähigkeit besitzen, die Romantik des Ortes rhetorisch gekonnt zu vermitteln – oder die Begeisterung zum Klettern. Sie mussten mehr über die Frau erfahren, über ihre Vorlieben, Eigenschaften, Leidenschaften – und sie mussten die Ergebnisse aus der Rechtsmedizin abwarten. Alles sprach dafür, dass sie sich Zeit lassen konnten. Zunächst aber mussten sie in die Heilsbach.
Die Heilsbach lag in einem Seitental des Königsbruchs. Es waren die Gemeine Keiljungfer und die Langflügelige Schwertschrecke gewesen, die in den Sechzigerjahren verhinderten, dass der Königsbruch geflutet und der Wasgausee gebildet wurde. Einiges sprach jedoch dafür, dass die zu erwartenden Kosten in Höhe von über einhundert Millionen Deutsche Mark eine mindestens ebenso große Rolle spielten. Statt eines Sees, der den Tourismus ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen sollte, wurde aus dem Königsbruch zwischen Fischbach, Schönau und Rumbach ein Naturschutzgebiet. Für die Touristen wurde das Biosphärenhaus errichtet, ein naturkundlicher Lernort mit Baumwipfelpfad und Restauration, und auf dem Bruch verlegte man viele hundert Meter holzbeplankte Wege über Sumpf und Bäche, sodass die Natur fortan ungestört von oben betrachtet werden konnte. Diese zu jener Zeit einzigartige Einrichtung sollte Geld in die Gegend bringen, eine Hoffnung, die sich auf Dauer nicht erfüllte.
Schwester Ingeborg war die Leiterin der Freizeitstätte Heilsbach. Sie war keine Ordensschwester im eigentlichen Sinn, war es nie gewesen. Sie wurde so genannt, weil katholische Häuser traditionell von Ordensschwestern geführt wurden. Das hatte sich durch den Rückgang der in Orden organisierten Menschen geändert, in der Heilsbach jedoch hatte man diese Anrede einfach beibehalten. Ingeborg Schweitzer wehrte sich lange dagegen und gab es eines Tages auf. Vielleicht lag es auch an ihrem Auftreten, das von Strenge und Fürsorglichkeit geprägt war, dass die Mitarbeiter sie weiterhin mit »Schwester Ingeborg« anredeten – wenn auch gelegentlich mit einem ironischen Unterton.
Schwester Ingeborg war fast sechzig Jahre alt, drahtig, die grauen Haare zu einem Dutt zusammengesteckt, stets in grauem Kleid mit weißer Schürze. Sie war ausgebildete Hauswirtschafterin und hatte Fortbildungen in Betriebswirtschaft besucht, was der Freizeitstätte sehr zugutekam.
Scheller und Peters wurden zu ihr geführt, als sie an der Pforte nach der Hausleitung fragten. Auf dem Weg durch das Haus, über den Hof ins nächste Haus und dort ins Büro von Schwester Ingeborg schauten die beiden sich um. Peters musste vor sich selbst zugeben, dass er sich ein katholisches Freizeitheim etwas verstaubter vorgestellt hatte als die freundlichen Flure und Außenanlagen, die er zu sehen bekam. Klar, ein Freizeitheim ist selten ein architektonisches Highlight, und die Häuser sahen von außen hauptsächlich bieder und bodenständig aus. Bei der Einrichtung hatte man viel helles Holz eingesetzt, denn das erwartete der Gast im Pfälzer Wald. Alles in allem machte die Freizeitstätte einen modernen Eindruck.
»Unterhalb des Bundenthaler Brockens wurde heute Morgen eine Frau tot aufgefunden, von der uns jemand sagte, er habe sie hier bei Ihnen im Haus gesehen«, begann Bernd Peters, nachdem man sich einander vorgestellt hatte. »Ich habe hier ein Foto der Toten. Wären Sie bereit, es sich anzuschauen?«
Schwester Ingeborg zögerte keinen Moment, griff zu ihrer Brille und dem hingehaltenen Handy, schaute auf das Display, seufzte und nickte. »Ja, sie gehört zu einer der Gruppen hier im Haus. Ich meine, sie heißt Kristina, bin mir aber nicht ganz sicher.«
»Wen könnten wir fragen?«, setzte Scheller nach.
»Herrn Nonnenmacher, Thilo Nonnenmacher. Er ist der Leiter der Gruppe. Er hält oft Seminare bei uns ab. Ein Stammgast sozusagen. Sie finden ihn im Tagungsraum vom Haus Walburga – wenn Sie hier herausgehen, dann nach links, am Ende des Hofes. Ich weiß aber nicht genau, ob die Gruppe heute Nachmittag da ist. Sie wollten eine Wanderung machen.« Schwester Ingeborg griff zu ihrem imposanten Schlüsselbund. »Ich komme mit Ihnen!«
Die Heilsbach begann in den Fünfzigerjahren mit einem Zeltplatz für die Jugend aus Pirmasens und Zweibrücken. Nach und nach kamen erste Gebäude wie Waschhäuser, Küchenhaus, ein Freibad und später Gruppenhäuser hinzu. Die Lage im Sauertal, die Ruhe und die gute Luft waren ideal für ein Naherholungsheim der Westpfälzer. Näher und schöner konnte man nicht Ferien machen. Man sparte nicht mit Renovierungen, Umbauten und Erweiterungen, und so blieb die Heilsbach beliebt und konkurrenzfähig.
Die Gruppe war tatsächlich ausgeflogen. Schwester Ingeborg zeigte den beiden Beamten den Gruppenraum. Die Wände waren voller großer Papierplakate mit Überschriften wie: »Wer bin ich?«, »Wer will ich sein?«, »Was hemmt mich?«, »Der Weg des guten Glaubens«.
»Was ist das für eine Gruppe?«, wollte Peters wissen. Was er da an der Wand sah, gehörte für ihn entweder zu einem Seminar für Leitungskräfte, zu einer Veranstaltung zur Stärkung des Selbstbewusstseins oder zu einer esoterischen Religionsgemeinschaft.
»Der Leiter, Herr Nonnenmacher, ist ein sehr sympathischer Mensch. Charmant, höflich, zuvorkommend, rücksichtsvoll, einfühlsam. Er möchte anderen Menschen dabei helfen, ihren Weg im Leben zu finden. Deshalb hält er hier Seminare ab. Mehrere im Jahr.« Schwester Ingeborg klang begeistert, sofern man das von einer strengen Hausleitung sagen konnte. »Die Leute wirken immer so zufrieden, wenn sie gehen. Ich glaube, er macht eine gute Arbeit.«
»Was hat es mit dem ‚guten Glauben‘ auf sich?«, fragte Scheller. »Den Ausdruck habe ich noch nie gehört.«
»Ja, Sie haben recht«, meinte Schwester Ingeborg, »das ist seine spezielle Formulierung. Er möchte die Menschen zu einem guten Glauben führen, das meint er, glaube ich. Ein Glaube, der ihnen guttut. So verstehe ich das. Er ist nun mal evangelisch. Denke ich jedenfalls. Aber wir dürfen auch Evangelische aufnehmen, obwohl wir eine katholische Einrichtung sind.«
»Und Sie wissen nicht, wann die Gruppe zurückkommt?«, fragte Klaus Scheller.
»Spätestens zum Abendessen, denn sie haben sich nicht abgemeldet«, sagte Schwester Ingeborg. »Vielleicht auch früher. Es soll bald wieder regnen.«
»Dann warten wir auf die Gruppe«, beschloss Bernd Peters. Sein Kollege schaute ihn wenig begeistert an. »Ich denke, sie sollten durch uns von dem Tod ihres Gruppenmitglieds erfahren, und nicht durch jemand anderen. Außerdem möchte ich ihre Reaktionen sehen.«
Die waren ein wenig überraschend. Peters war davon ausgegangen, dass sich in einem Seminar, in dem solche Themen, wie sie auf den Wandplakaten angesprochen wurden, behandelt wurden, eine gewisse Nähe unter den Teilnehmern entwickelte. Das Entsetzen über den plötzlichen Tod des Gruppenmitglieds Kristina hielt sich jedoch sehr in Grenzen.