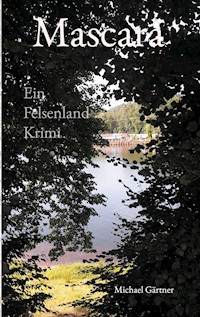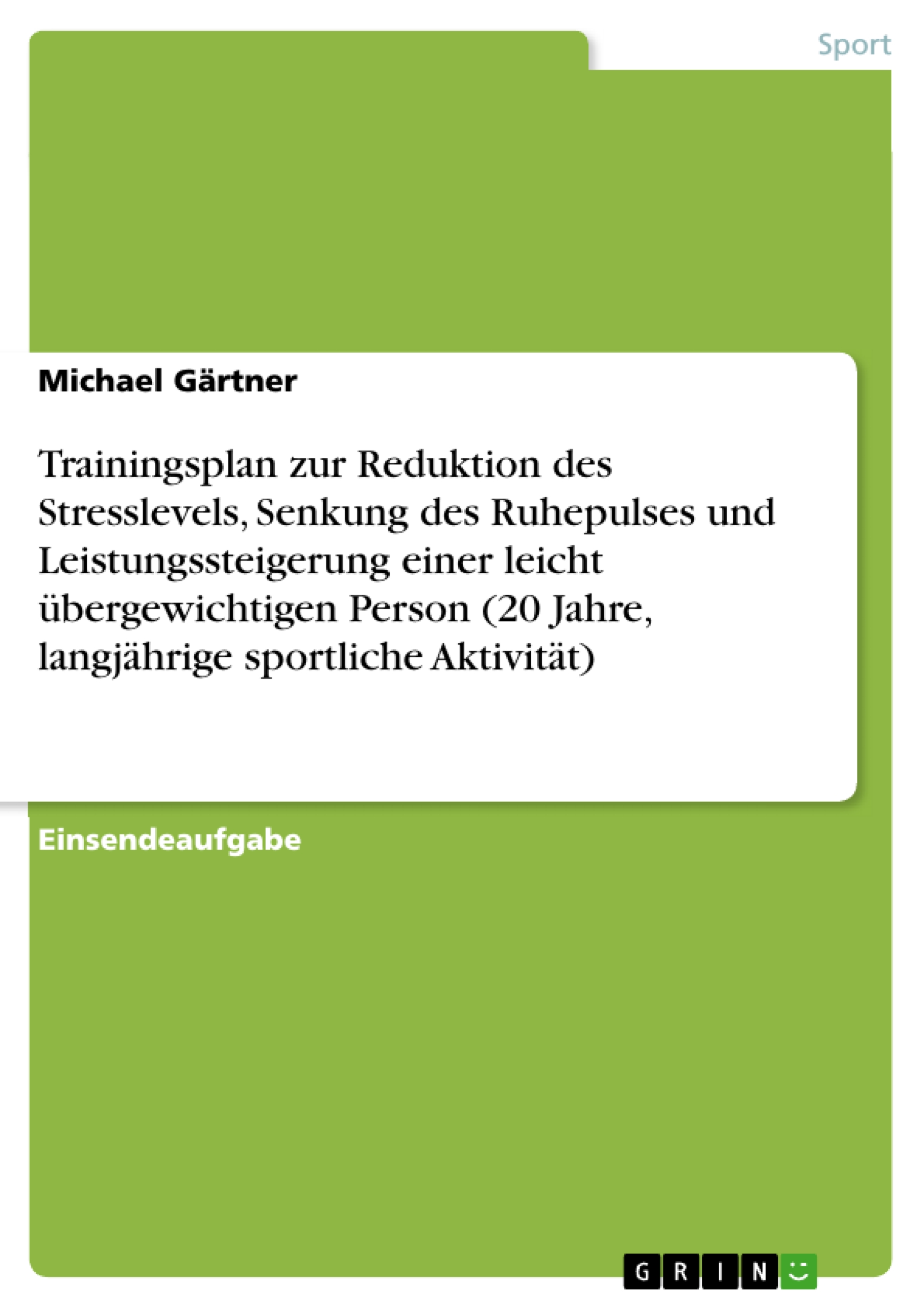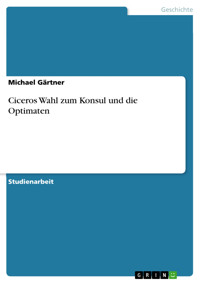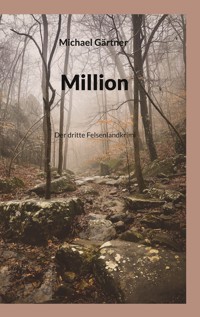
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Immer wieder tauchen neue Fragen auf. Der Tote im Wald bei Gebüg ist auf eine noch nie dagewesene Weise umgekommen. Warum wurde er umgebracht, warum gerade dort und warum so? Wo sind seine Frau und die Kinder geblieben? Und was hat es mit der einen Million Euro auf sich, die er ein paar Tage vor seinem Tod ins Ausland überwiesen hat? Die Pirmasenser Kriminalkommissare, Pfarrerin Barbara Fouquet und der emeritierte Professor Alfred von Boyen machen sich auf die Suche, die sie bis nach Paris und in die Karibik führt. Der dritte Felsenland-Krimi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Million zu haben oder nicht zu haben, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.
Dahner Felsenland September 2007
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Personen
In zwei Tagen ist es so weit. Morgen werde ich dort sein. Ich werde nur einen kleinen Koffer benötigen. Ich möchte noch einmal einen alten Schulfreund besuchen, habe ich euch gesagt. Das Taxi wird mich zum Flughafen bringen, dann in den Zug, am Bahnhof werde ich abgeholt. Alles Weitere ist geregelt. Vielleicht wird es schon in der nächsten Nacht sein. Anderenfalls werde ich noch 24 Stunden warten müssen. Ich tue es für dich, meine Liebe, und die Kinder. Ich hoffe, du wirst es verstehen.
1
In dem ehemaligen Köhlerdorf Gebüg begann jener Tag wie jeder andere. Die Berufstätigen verließen am frühen Morgen den Ort mit dem Auto, manche bildeten Fahrgemeinschaften, die Schulkinder wurden vom Bus abgeholt, die Kindergartenkinder von den Eltern nach Fischbach gebracht. Die Älteren schliefen länger und ließen den Jungen den Vortritt auf den Straßen. Es war schon sehr lange her, dass an dieser Stelle im Wald nur ein paar Hütten standen, in denen die Köhler mit ihren Familien hausten. Die Holzkohle wurde zur Verhüttung des Eisenerzes gebraucht, das man an einigen Stellen der Gegend mithilfe mühsam in die Berge getriebener Stollen schürfte. Dort oben am Fuße des Maimont befand sich ein Buchenwald, den man ausbeutete, solange das Eisenerz geborgen und die Holzkohle benötigt wurde. Von »Buche« soll auch der Name stammen: das Gebüg.
Alfred von Boyen hatte diesen Tag wie jeden Tag begonnen – er war den Weg des Bogens gegangen. Die alte Kunst des Kyu-Do hatte er bei einem Meister in New York gelernt und sie hatte ihn fortan begleitet. Seit er sich vor einigen Jahren in die Stille des Gebüg zurückgezogen hatte, konnte er dieser Übung des meditativen Bogenschießens ungestört jeden Morgen nachgehen. Das hatte ihm sehr dabei geholfen, über die Brüche in seinem Leben, die ungewollten und die selbst gewählten, hinwegzukommen. Das ehemalige Köhlerdorf bestand aus nur wenigen Häusern. Was an einem Ende gerufen wurde, konnte man am anderen hören, oft sogar verstehen.
Kaum hatte er den Bogen und die Pfeile wieder an ihren angestammten Platz zurückgestellt, wurde es laut im Dorf. Immer mehr Stimmen waren zu hören, sie fielen übereinander her und vermischten sich zu einem undeutbaren Rufen und Schreien. Von Boyen hatte sich für diesen Tag – wie immer – ein festes Pensum an Arbeit vorgenommen. Sein jüngstes Projekt war ein populärwissenschaftliches Buch zur Geschichte der Religionen Europas und deren Miteinander, das nicht selten auch ein Gegeneinander gewesen war. Er wollte endlich aufklären, mit alten Vorurteilen aufräumen und damit zu einem guten Zusammenleben der Menschen in der multikulturellen Gesellschaft Europas beitragen. Er war getrieben von dem Wunsch, seinen Teil zu mehr Frieden in Europa und rund um das Mittelmeer zu leisten.
Die Rufe am anderen Ende des Dorfes wurden lauter. Von Boyen ließ sich nicht gerne bei der Arbeit stören. In diesem Moment kam seine Nachbarin angelaufen. Sie klingelte ununterbrochen an der Haustür, ungewöhnlich für die sonst so zurückhaltende Frau.
»Kommen Sie!«, rief sie ihm zu, als er ihr die Tür geöffnet hatte. »Ich denke, das müssen Sie sich anschauen!«
Die Nachbarin konnte sich für manches begeistern und über vieles aufregen, von dem Alfred von Boyen nicht aus der Ruhe zu bringen war. Er hatte schon so viel Schreckliches und Schönes gesehen, dass ihm die kleinen Aufregungen des bundesdeutschen Alltags meist wie Hohn vorkamen gegenüber dem, was andere Menschen auf dieser Erde durchmachen mussten. Er wusste jedoch auch, dass die menschliche Natur täglich ihren Teil an Aufregung und Neuigkeiten brauchte, damit sie in einem wohlgeordneten Leben nicht an Langeweile krank wurde.
Er zog sich schnell eine Jacke an, lief über den Hof auf die lediglich mit Schotter bedeckte Straße vor seinem Haus und suchte nach seiner Nachbarin. Sie stand unten an der Gabelung der beiden Straßen im Gebüg und winkte ihm zu.
Es war noch früh am Vormittag. Die im Ort Zurückgebliebenen, die wenigen Hausfrauen und die Alten, waren aber nun alle auf der Straße und liefen auf den Wald zu. Am Ende des Dorfes, beim letzten Haus in der Maimontstraße, hörte die geteerte Straße auf und ging in einen unbefestigten Wirtschaftsweg über. Da war ein Parkplatz für einige wenige Wagen, begrenzt von dem kleinen Bach auf der einen Seite und dem ansteigenden Hang des Berges auf der anderen. An den Wochenenden konnte man dort gelegentlich die Autos von Wanderern mit Kennzeichen aus den Städten und Landkreisen entlang des Rheines finden. Heute Morgen parkte hier niemand.
Die Nachbarin hatte gewartet. Von Boyen ging mit ihr zum Wald hinauf. Die Menschen vor ihnen blieben bei den ersten Bäumen auf der Straße stehen und schienen heftig miteinander zu diskutieren. Der Anblick erinnerte an eine Herde der kleinen Hochlandrinder auf den umliegenden Wiesen, die mit Empörung ihr Futter einforderten. Der sich anschließende Waldweg war ausgefahren und von den Regenfällen der letzten Tage an einigen Stellen tief zerfurcht. Der Bach, der zur Rechten durch ein kleines Tal hinunter zum Ort floss, war hoch gefüllt. Normalerweise war an dieser Stelle, wenn man die letzten Häuser hinter sich gelassen hatte, nur das Rauschen des Windes in den Bäumen und das Gluckern des kleinen Baches zu hören. Ansonsten umfing den Spaziergänger bereits die wohltuende Stille des Waldes. Heute jedoch gellten die Rufe der Dorfbewohner durch das Unterholz.
»Weshalb haben Sie mich gerufen?«, fragte von Boyen, als er seine Nachbarin erreichte. »Was ist dort los?«
»Dort oben soll ein Mensch liegen. Ein Toter. Mehr weiß ich auch nicht.«
Die alte Frau König aus dem Eckhaus an der Kreisstraße hatte die Leiche entdeckt. Sie war an diesem Tag – wie jeden Morgen – mit ihrem Hund in den Wald gegangen. Sie wartete – auch wie immer - , bis alle Autos den Ort verlassen hatten und ging dann los. So musste sie ihren Hund nicht anleinen und konnte ihm von der Haustür an freien Lauf lassen. Der Hund war eine hübsche Promenadenmischung mit der nachteiligen Begabung, in mehreren Hundesprachen bellen zu können, und dies so laut, dass bei Frau Königs morgendlichem Spaziergang regelmäßig auch die letzten Schläfer des Dorfes geweckt wurden.
Der Vierbeiner stürmte auf die Straße vor dem kleinen Haus von Frau König und markierte mit lautem Kläffen sein Revier. Dabei drehte er sich um sich selbst, als gelte es, eine ganze Herde Wölfe zu verscheuchen. Er war jedoch völlig allein, lediglich zwei alte Spatzen betrachteten ihn mit wohlwollender Gleichgültigkeit. Er wartete, bis Frauchen die Haustür abgeschlossen hatte, und stürmte dem Ende der Straße zu. Dort, an dem kleinen Parkplatz, blieb er stehen. Er ging nie ohne die alte Frau in den Wald hinein. Vermutlich hatte er Respekt vor den vielen fremden Gerüchen, die dort auf ihn eindrangen. Die machten ihn andererseits neugierig, und als Frau König ihn erreicht hatte, wagte er sich in ihrem Schutz in den Wald hinein.
An diesem Morgen kamen sie nicht sehr weit. Sie waren vielleicht fünfzig Meter gegangen – wobei der Hund diesen Weg mehrmals hin- und zurückgelaufen war – als er plötzlich stehen blieb und sein Kläffen einstellte. Frau König rätselte eine Weile herum, was ihren Hund so plötzlich zum Schweigen gebracht hatte. Dann entdeckte sie einen Hut und eine Hand und wagte sich nur noch langsam an das Etwas heran, vor dem der Hund still Haltung angenommen hatte.
Das seltsame Geräusch, das sie nun wahrnahm, kam aus der Richtung des Menschen, der dort lag. Es waren Hunderte Fliegen, die um den Körper herum schwirrten, sich auf ihm niederließen und wieder davonflogen. Frau König bekam Angst und auch der Hund blieb respektvoll auf Distanz. Allein wollten sie nicht näher an die Leiche herangehen – denn, dass es sich um eine solche handelte, war Frau König vom ersten Moment an klar. Also machten beide auf dem Absatz kehrt und gingen so schnell wie möglich ins Dorf zurück.
Dort angekommen, klingelte sie an der Tür des ersten Hauses. Jedoch, wie schon befürchtet, war niemand da. Verzweifelt lief sie auf die Straße zurück und begann zu rufen: »Hilfe!«
Es rührte sich nichts. Sie musste zu einer wenig geschätzten Nachbarin gehen und dort läuten. Als diese die Tür öffnete und Frau König etwas von einer Leiche im Wald sagte, war sich die Frau in der Kittelschürze nicht sicher, ob es die komische Alte aus dem Haus unten an der Kreisstraße nun endgültig erwischt hatte, oder ob das wieder eine von deren gelegentlich skurrilen Geschichten war. Bei ihr siegte jedoch die Neugierde, sie ging zusammen mit Frau König ein Haus weiter und klingelte den jungen Rentner aus seiner Wohnung.
Noch im vergangenen Jahr war er zum ‚Briefträger des Jahres‘ von den Anwohnern seines Zustellbezirks in Pirmasens gewählt worden. Sechzig bis achtzig Kilo Briefe und Broschüren hatte er jeden Tag ausgefahren, zwölf bis fünfzehn Kilometer legte er täglich zurück. Dann hatte eines Tages der alte Französischlehrer aus der Reihenhaussiedlung den Rückwärtsgang seines Wagens mit dem Vorwärtsgang verwechselt und den ‚Briefträger des Jahres‘ überfahren. Monate im Krankenhaus, dienstunfähig. Nun war er den ganzen Tag in seinem kleinen Haus und wusste nicht so recht, was er mit dem Leben anfangen sollte. Er hielt noch die Kaffeetasse in der Hand, als er an die Tür trat, und war dann sofort bereit, die beiden alten Damen zu begleiten. So gingen sie zu dritt, einer stark humpelnd, eskortiert von einem ungewöhnlich schweigsamen Hund, in den Wald hinein. Die Frauen blieben zurück, der Mann wurde, immer noch die Kaffeetasse in der Hand, nach vorn geschickt.
Er kam zurück, kreidebleich wie Frau König fand, nahm einen Schluck aus seiner Kaffeetasse und sagte: »Dort liegt ein toter Mann.«
»Sind Sie sicher, dass der Mann tot ist?«, fragte die Nachbarin.
»Der Kopf ist völlig kaputt und die Brust ist ganz blutig.«
»Wir sollten die Polizei holen«, meinte Frau König.
»Das ist sicher richtig«, sagte der Mann mit der Kaffeetasse.
»Dann machen Sie das«, wies ihn die Nachbarin an.
Der Mann ging in sein Haus, Frau König und die Nachbarin zurück ins Dorf.
Die Nachricht von dem Toten im Wald rollte wie eine ständig größer werdende Lawine die Straße hinunter und hatte sich an der einzigen Kreuzung des Gebüg verzweigt.
Als von Boyen am Waldrand ankam, war bereits das halbe Dorf versammelt. Die meisten blieben in einem respektvollen Abstand vor dem Tod, der glücklicherweise nicht der ihre war, stehen. Einige hatten sich jenseits der Grenze des Waldes zu dem leblosen Etwas vorgewagt. Von Boyen warf einen kurzen Blick auf den schrecklich zugerichteten Leichnam und sagte dann in ruhigem, fast pietätvollen Ton zu den Umstehenden: »Es wird das Beste sein, wenn wir jetzt alle zurück zur Straße gehen. Die Polizei muss bald eintreffen und wir haben, so befürchte ich, schon viele Spuren verwischt.«
Die Menschen hörten auf den als Einsiedler bekannten Mann aus dem einstöckigen Haus am oberen Ende des Ortes. Alfred von Boyen hatte sich in den vergangenen Jahren viel Anerkennung und auch Zuneigung bei den Menschen erworben. Nicht nur, weil er den ungeliebten Job eines Kirchdieners übernommen hatte, und das auch noch unentgeltlich, sondern er galt zudem als ein Mensch von großer Bildung, Zuverlässigkeit und Menschenfreundlichkeit zu sein.
Es dauerte wirklich nur noch wenige Minuten, dann war die Polizeistreife aus Dahn am Ende der Maimontstraße angekommen. Das Blaulicht spiegelte sich in den Fenstern der letzten Häuser. Die beiden Männer in Uniform ließen sich den Weg zeigen, gingen in den Wald hinein und kamen mit der Bitte zurück, von nun an den Waldweg nicht mehr zu betreten und nichts zu berühren. Sie platzierten ihr Fahrzeug wie eine Sperre an das Ende der Straße und baten die Menschen, in ihre Häuser zu gehen. In absehbarer Zeit würde die Kriminalpolizei aus Pirmasens eingetroffen sein und sich um alles kümmern.
Die Gebüger zerstreuten sich widerwillig. Von Boyen ging zurück in sein Haus und setzte sich an seine selbst gewählte Arbeit. Er hatte seine Professur niedergelegt und sich aus dem Berufsleben zurückgezogen. Als Politikberater war er auch nicht mehr tätig. Man kannte seinen Namen allerdings nach wie vor. Immer wieder einmal wurde er als Experte in Fernsehsendungen eingeladen. Er hoffte, dass seine Popularität der Verbreitung des neuen Buches helfen würde, so könnte er immer noch etwas bewegen.
Das Arbeitszimmer war unter dem niedrigen Satteldach des Hauses eingerichtet. Es bestand aus einem Schreibtisch, einigen Ablagemöglichkeiten und vielen Bücherregalen. Wenn er von seinem Schreibtisch den Blick nach links wandte, sah er einen kleinen Dachaustritt, von dem aus man einen überwältigenden Blick auf das Tal und die in der Ferne bläulich schimmernden Hügel des Pfälzer Waldes hatte. Der Blick ging in die Weite, verlor sich jedoch nicht ins Unendliche.
Nach jeder Unterbrechung dauerte es eine Weile, bis er ins Schreiben kam. Nach dieser grausigen Entdeckung im Wald war es besonders schwer, sich zu konzentrieren. Das hatte es im Gebüg wohl seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Ein Toter. Ein Mensch war gewaltsam zu Tode gekommen und im Wald am Ortsrand abgelegt worden. Vielleicht war es auch der Tatort. Die Untersuchungen der Polizei würden bald erste Erkenntnisse ergeben. Er wollte jetzt nicht darüber nachdenken.
Doch der Anblick holte ihn wieder ein. Alfred von Boyen klappte den Deckel seines Laptops zu und schaute über den Dachaustritt in die Ferne. Keiner der Umstehenden hatte den Toten gekannt. Das hieß noch nicht viel. Trotzdem konnte sich die Tat im Gebüg ereignet haben. Trotzdem konnte der Mörder oder die Mörderin aus dem Ort stammen. Er stellte sich vor, was in den Köpfen der Menschen vor sich ging. Angst und Misstrauen würden um sich greifen. Am Mittag würden die Kinder nach Hause kommen, am Abend die Berufstätigen. Die Vermutungen und Gerüchte würden überquellen wie ein Topf kochender Milch und die Atmosphäre im Ort verpesten.
Alfred von Boyen war noch in Gedanken versunken, als es wieder an seiner Haustür klingelte. Er ging die Wendeltreppe ins Erdgeschoss hinunter und öffnete. Vor ihm stand Klaus Scheller. Er musste lächeln, als er ihn sah. Mit Klaus Scheller verband er einige Erlebnisse im Zusammenhang mit zwei Fällen in den vergangenen Jahren, die das ganze Dahner Felsenland erschüttert hatten. Der Polizeikommissar aus Pirmasens war ein guter Ermittler. Er hatte jedoch auch über Jahre hinweg den Ruf eines Frauenhelden gehabt. Angeblich ermittelte er – wie er es gelegentlich selbst ausgedrückt hatte – in seiner Freizeit weiter, um einen Überblick über die Vielfalt des weiblichen Geschlechtes zu bekommen. Das führte leider oft dazu, dass er unausgeschlafen zum Dienst erschien. Dieses unstete Leben hatte er seit einiger Zeit aufgegeben. Die Ursache war leicht zu finden: Eine attraktive und energische Krankenschwester, mit der Scheller nun schon seit fast zwei Jahren liiert war. Noch eines hatte Klaus Scheller ausgezeichnet – eine gewisse Respektlosigkeit, vor allem gegenüber dem ihm weltfremd erscheinenden von Boyen. Inzwischen hatten die beiden sich miteinander arrangiert und die jeweils guten Seiten des anderen entdeckt.
»Schön, Sie zu sehen, Herr Scheller.« Die Begrüßung fiel ausgesprochen freundlich aus.
»Ganz meinerseits, Herr von Boyen«, erwiderte Klaus Scheller und lächelte sympathisch. »Leider bin ich, wie Sie sich denken können, aus dienstlichen Gründen hier. Mein Chef bittet Sie, zum Fundort der Leiche zu kommen, wenn es Ihnen zeitlich möglich sein sollte.« So gewählt drückte er sich selten aus.
Schellers Chef war Bernd Peters, ein groß gewachsener, blonder Mann mit einer tiefen Stimme und dem unüberhörbaren Slang seiner norddeutschen Heimat. Er hatte sich im Anschluss an eine persönliche Krise nach Pirmasens versetzen lassen – was aus seiner ehemals Kieler Perspektive das Ende der Welt war. Das verband ihn mit Alfred von Boyen, der wie Bernd Peters im Südwesten der Republik einen Neuanfang gesucht hatte.
»Mache ich gerne«, sagte Alfred von Boyen. »Bitte warten Sie doch einen Moment.«
Als Alfred von Boyen vor die Tür trat, zeigte Klaus Scheller auf die Garage und fragte: »Na, läuft er noch?«
»Wen meinen Sie?«, fragte von Boyen.
»Na, den alten Rover.«
»Kein Problem. Er läuft und läuft und läuft. Und er säuft und säuft und säuft. Das Problem mit dem Benzinverbrauch ist nicht zu lösen. Für heutige Verhältnisse genehmigt er sich einfach zu viel. Deshalb benutze ich ihn auch so selten wie möglich. Aber hier oben kommt man ohne Auto leider nicht aus.«
»Also«, sagte Klaus Scheller, »wenn Sie mal wieder eine Spritztour machen: Ich wäre dabei!«
»Ich habe schon einmal überlegt, mir einen Zweitwagen zuzulegen. Einen kleinen Diesel oder Ähnliches. Aber es macht leider entschieden zu viel Spaß, mit dem Rover zu fahren.«
Die beiden unterhielten sich noch eine Weile über Autos. Ein Thema, das sie verband. Als sie die Straße zum Wald hochgingen, wurden sie aus den Fenstern und von den Balkonen neugierig beäugt. Von Boyen kannte inzwischen alle Einwohner des Gebüg und nickte freundlich nach rechts und links – und man grüßte zurück.
Die Szenerie am Waldrand hatte sich in der letzten Stunde völlig verändert. Der Weg in den Wald war mit einem rot-weißen Flatterband abgesperrt, der Parkplatz mit Dienstwagen der Polizei belegt. Auf der Straße stand der Leichenwagen eines lokalen Bestattungsinstitutes. Die beiden Mitarbeiter lehnten in dezentes Schwarz gekleidet an ihrem Wagen. Wenn keine Angehörigen eines Toten in der Nähe waren, scheuten sie sich nicht, eine gewisse Langeweile angesichts des Todes durchblicken zu lassen. Weiter oben durchforschten Männer und Frauen in weißer Schutzkleidung den Wald, sammelten hier und da einen Gegenstand auf, machten Fotos und nahmen Abdrücke vom Boden. Es war ein geschäftiges Treiben in Schwarz und Weiß vor dem Hintergrund des braun grünen Waldes.
Als Scheller und von Boyen herantraten, löste sich ein Mann aus einer Gruppe und kam auf sie zu.
»Schön, dass du Zeit hast, Alfred«, sagte er. »Ich hätte gerne deinen Rat in diesem Fall.«
»Ich freue mich, dich zu sehen«, gab Alfred von Boyen zurück. »Ich befürchte, dass dieser Mord noch viel Unruhe in unseren kleinen Ort bringen wird.«
»Das denke ich auch. Deshalb möchte ich so schnell wie möglich weiterkommen.« Bernd Peters war der Leiter der Kriminalinspektion in Pirmasens. Er kannte Alfred nun schon bald fünf Jahre und die beiden trafen sich immer wieder einmal privat, zumeist im Pfarrhaus in Schönbach bei Barbara Fouquet, Peters’ Lebensgefährtin.
»Ist dir heute Morgen, als du das erste Mal hier warst, bei den Reaktionen der Menschen aus Gebüg etwas aufgefallen?«, fragte Bernd Peters.
Sie traten zur Seite, weil die Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens sich in Bewegung gesetzt hatten und den Leichnam abtransportieren wollten.
»Nein, sie waren verständlicherweise alle entsetzt. Niemand kannte den Toten. Zugegebenermaßen ist von seinem Gesicht auch nicht viel zu erkennen.«
Er schaute in den Waldweg hinein. Gerade wurde der Deckel auf den Metallsarg gehoben. In einer Stunde würde der Leichnam bei der Gerichtsmedizin sein. »Die Leute fragen sich vor allem, wie das passieren konnte, ohne dass jemand im Dorf etwas bemerkt hat«, fuhr er fort.
»Die Identität des Toten ist geklärt«, sagte Bernd Peters. »Er hatte Papiere bei sich, unter anderem Personalausweis und Führerschein. Danach handelt es sich um einen gewissen Sebastian Mahler aus Pirmasens.«
Der Sarg wurde an ihnen vorbeigetragen und in den Leichenwagen geschoben. Die Klappe des Laderaums schloss mit einem dezenten Klacken, die Männer bestiegen die Vordersitze.
»Die Personenabfrage hat ergeben«, setzte Peters neu an, »dass er Inhaber einer Firma für Computersoftware ist, die nicht weit von hier auf dem Gelände des ehemaligen amerikanischen Depots hinter Petersbächel ihren Sitz hat. Scheller wird gleich hinfahren und ein Kollege aus Pirmasens ist zur Privatadresse unterwegs.«
Der Leichenwagen wendete und fuhr die Maimontstraße hinab.
»Eigentümlich finde ich die Kleidung des Toten«, sagte Alfred von Boyen. »Der Mantel und die Schuhe sind von außergewöhnlicher Qualität. Zwei hochwertige Marken. Die Firma scheint gut zu laufen.«
»Das ist uns auch aufgefallen. Der Hut muss kostspielig gewesen sein. Allerdings ist die restliche Kleidung eher einfach.«
»Das ist eine ungewöhnliche Kombination. Und dann dieses zerstörte Gesicht. Da muss Hass im Spiel gewesen sein, eine ungeheure Aggression. Das ist kein einfacher Mord.«
Alfred von Boyen schaute nachdenklich auf die beiden Polizisten. »Ich bin gespannt, was ihr herausbekommen werdet.«
Er verabschiedete sich und winkte Klaus Scheller zu, als der auf dem Weg zu Mahlers Firma an ihm vorbeifuhr.
Am Nachmittag kamen die Kinder aus der Schule. Wenn es auch die eine oder andere Mutter schaffte, ihrem Kind nicht sofort die Neuigkeit zu erzählen, so gelang es nicht allen, und zehn Minuten nach Ankunft des Schulbusses trafen sich die Kinder auf der Straße.
Ihr erster Weg führte sie an den Waldrand. Die Enttäuschung war groß, denn außer den Absperrbändern war nicht mehr viel zu sehen. Die meisten Polizeiwagen waren abgerückt, lediglich drei Mitarbeiter der Spurensicherung machten noch die letzten Abdrücke und nahmen einige Fotos auf. Die angespannte Geschäftigkeit des Vormittags war einer gewissen Ruhe gewichen und die Kinder konnten den drei Fachleuten ihre Fragen stellen. Endlich war der Krimi aus dem Fernsehen in das wirkliche Leben herübergekommen.
Das Ganze wurde noch viel aufregender, als ein Fernsehteam des Südwestrundfunks anrückte und die Kameras auspackte. An diesem Abend wäre Gebüg im Fernsehen. Die Kinder drängten sich an die Absperrbänder in der Hoffnung, sich selbst am Abend dort sehen zu können. Endlich kam einmal Leben in dieses sonst so langweilige Dorf. Am nächsten Tag würde man in der Schule viel zu erzählen haben. Vielleicht sollten sie gleich ein paar andere aus der Klasse anrufen. Aber noch war das Fernsehteam da. Die durften sogar hinter die Absperrbänder und den Fundort filmen.
Die meisten Kinder hatten auf das Mittagessen verzichtet und waren direkt an den Waldrand gelaufen. Nun meldete sich langsam der Hunger. Aber es war alles viel zu interessant. Als die Männer von der Spurensicherung abrückten und das Fernsehteam seine Sachen packte, wurde es schon langsam dunkel. Das älteste der Gebüger Schulkinder war Michael mit seinen 14 Jahren. Er hatte den ganzen Nachmittag ausgeharrt und die meisten Fragen gestellt. Nun wollte er selbst sehen, wo die Leiche gelegen hatte. Aber eigentlich durfte man den Tatort nicht betreten. Ein Schild wies ausdrücklich darauf hin. Andererseits war niemand da, der ihn daran hätte hindern können.
Michael ging los und Svenja, die Zweitälteste, trottete hinter ihm her. Die drei anderen Kinder, die noch auf der Straße warteten, blieben ängstlich zurück. Michael machte manchmal Sachen, die sie sich selbst nicht trauten, und von denen ihre Eltern sagten, sie sollten sie auch nicht tun. Michael war groß und stark und für die drei Kleinen ein Vorbild. Er war ihnen aber oft auch unheimlich. Immer wieder machte er eben solche Sachen, die man nicht machen sollte. Sie hätten jetzt nach Hause gehen können, aber sie waren viel zu gespannt, was Michael und Svenja erzählen würden.
Die beiden bückten sich unter dem Absperrband hindurch und gingen mit vorsichtigen Schritten in den Wald hinein. Überall sah man noch Reste der Arbeit der Spurensicherung – kleine Markierungen, Gipskleckse auf dem Boden, Löcher, in denen die Stative der Kameras gesteckt hatten. Die Abenddämmerung hatte eingesetzt, es war im Wald deutlich dunkler als tagsüber. Nun begann die Stunde, in der sich im Wald alles veränderte. Es war spürbar kühler geworden. Der Weg war nicht gut zu erkennen, Licht und Schatten verwandelten sich in eine diffuse Dunkelheit, die Bäume und Büsche formierten sich zu neuen Gestalten. Manches, was da gewesen war, verschwand, anderes wurde neu sichtbar.
Michael und Svenja tasteten sich langsam vor. Mit jedem Schritt wurden sie weniger mutig. Der kurze Weg erschien ihnen recht lang. Svenja ergriff Michaels Hand. Das hatte sie noch nie getan. Der Wind schlug um. Nun rollte er langsam vom Maimont hinunter ins Dorf. Die Blätter und kleinen Zweige gerieten in Bewegung, es zog ein leichter Hauch über den Boden. Je weiter sie gingen, umso weniger konnten sie sehen. Michael wurde mulmig zumute, wollte es wegen Svenja jedoch nicht zugeben. Er war der mutige Anführer der Gebüger Kinder, der Held der Kleinen. Das wollte er auch bleiben.
Endlich kamen sie an die Stelle, wo der Tote gelegen haben musste. In der Dämmerung konnten sie das Blut nicht von der Erde unterscheiden. Michael war das auch gar nicht mehr wichtig. Er wollte nur noch zurück.
»Man kann ja gar nichts mehr erkennen«, sagte er enttäuscht.
»Komm, wir gehen zurück«, sagte Svenja. Sie zog an seiner Hand.
Michael wollte sich gerade umwenden, als hinter ihnen etwas den kleinen Hang herunterrutschte. Die beiden erschraken. Svenja stieß einen leisen Schrei aus. Das Etwas rappelte sich auf und stellte sich vor sie. Michael nahm allen Mut zusammen und sah genau hin. Vor ihm stand eine Frau, die wirklich komisch gekleidet war, wie er fand. Er zuckte zusammen. Svenja versteckte sich hinter ihm.
Die Frau stellte sich direkt vor Michael hin. »Verschwindet von hier und lasst euch nie wieder sehen!«
Die beiden liefen los, blieben hinter der nächsten Wegbiegung stehen.
»War das ein Geist?«, fragte Svenja.
Sie war zwölf Jahre alt und ein liebes, hübsches Mädchen, aber manchmal doch noch wie ein kleines Kind.
»Wie kommst du auf die Idee, dass das ein Geist gewesen sein soll?«
»Sie war so plötzlich da.«
»Das war eine komische Frau und sie war sehr unangenehm«, sagte Michael.
»Sie hat mich entsetzlich erschreckt«, sagte Svenja.
»Mich auch«, gab Michael zu.
»Was erzählen wir den anderen?«
»Am besten gar nichts«, sagte Michael. »Diese Frau bleibt unser Geheimnis – aber ich wüsste gerne, was sie dort gemacht hat.«
2
Im Spätsommer fielen die Kletterer ins Dahner Felsenland ein. Die Tage waren noch lang genug, es war jedoch nicht mehr so heiß wie im Juli und August, die Sonnenuntergänge gestalteten sich um ein Vielfaches schöner, die Luft hatte schon ein herbstliches Aroma, die Bäume begannen sich zu verfärben, der Indian Summer bot von den Burgen und Felsen einen überwältigenden Anblick. Wenn dann die Maronen von den Bäumen fielen und der gärende Most des Neuen Weines die wenigen Kilometer aus der Rheinebene in großen Tanks herangefahren wurde, dann gab es nichts, was dem Leib fehlte, und die Seele fühlte sich wohl.
Anna Hoger, die Bäckersfrau aus Schönbach, hatte in der Kombination aus gerösteten Esskastanien und Neuem Wein seit einigen Jahren eine gute Geschäftsidee für den farbenprächtigen Herbst entwickelt. Die »Käschte«, wie die Esskastanien kurz genannt wurden, ließ sie von den Kindern des Dorfes in den umliegenden Wäldern sammeln und kaufte sie ihnen ab. Den Neuen Wein bezog sie von einem Winzer aus Nussdorf. Sie hatte die Genehmigung bekommen, vor ihrer Bäckerei eine Bierzeltgarnitur aufzustellen, falls durchziehende Wanderer sich dort ausruhen und Neuen Wein und geröstete Maronen gleich vor Ort essen wollten. Mehr als diesen einen Tisch hatte sie nicht gewollt, sonst hätten der Wirt des Hirschen, der letzten verbliebenen Gaststätte des Ortes, und der der Pizzeria in ihr eine Konkurrenz gesehen. Gegenüber dem Hirschen hatte sie den Vorteil, dass sich die Maronen im Ofen der Bäckerei wunderbar rösten ließen. Der aus Kroatien stammende Wirt der Pizzeria hatte zwar auch einen gut geeigneten Ofen, aber ihm war wichtig, dass in seinen Steinofen nichts anderes als Pizza hineinkam. Selbst zu Flammkuchen war er nicht zu überreden gewesen. So hatte Anna Hoger ihre Geschäftsidee umsetzen können.
Das Dahner Felsenland hatte viele wandernde und kletternde Stammgäste, die im Jahr einmal vorbeikamen. Dass der ‚Neue‘ bei der Bäckerei Hoger in Schönbach besonders gut und die Maronen perfekt geröstet waren, sprach sich innerhalb dieser Kreise schnell als Geheimtipp herum. So hatte Anna Hoger im Herbst alle Hände voll zu tun, um die Nachfrage zu befriedigen. Es war für sie und ihren Mann eine wichtige Einnahmequelle, denn es war nicht leicht, sich als kleine Bäckerei gegenüber den Backautomaten der Supermärkte zu behaupten.
Anna hatte Überlegungen angestellt, ob sie nicht ein gut ausgewähltes Sortiment an regionalen Produkten aufbauen sollte – hauptsächlich für die Wanderer, aber vielleicht hätten auch Einheimische daran Interesse. Ein paar Tage zuvor hatte sie Kontakt mit einem Arztehepaar aus Kröppen aufgenommen, die sich mit der Produktion von Ziegenkäse aus biologischer Haltung der Tiere versuchten. Die Qualität sollte hervorragend sein.
Die Bäckerei Hoger war neben den Gaststätten eines der wichtigsten Kommunikationszentren des Ortes und der Gegend. Anna Hoger förderte dies dadurch, dass sie eine gute Zuhörerin war, keine Ratschläge gab, aber – einer guten Therapeutin vergleichbar – die richtigen Fragen stellte. Damit hatte sie schon so manchen über eine Krise hinweg geholfen und Auswege finden lassen. Das bewunderte ihre beste Freundin, die Ortspfarrerin Barbara Fouquet, an ihr. »Man könnte meinen, du hättest einen Seelsorgekurs oder eine Ausbildung als Psychotherapeutin hinter dir«, sagte sie so manches Mal, wenn Anna von ihren Gesprächen in der Bäckerei erzählte oder auch einmal an Barbara eine solche weiterführende Frage gerichtet hatte.
Im Jahr zuvor war eine geraume Zeit lang ein immer wiederkehrendes Thema ihrer gelegentlichen nachmittäglichen Gespräche bei einer Tasse Kaffee die Frage gewesen, ob Barbara ihrem Bernd anbieten sollte, zu ihr ins Pfarrhaus zu ziehen. Das war zwischen den beiden ein ständiges Diskussionsthema. Bernd Peters hatte ein kleines Appartement in Pirmasens, wo auch der Dienstsitz der Polizeidirektion war, bei der er als Kriminalkommissar arbeitete. Sein Pflichtbewusstsein sagte ihm, er müsse dort wohnen, damit er, wenn es notwendig wäre, schnell auf der Dienststelle sein könnte. Von Schönbach aus benötigte er fast eine Stunde. Das würde sich erst reduzieren, wenn die B 10 weiter ausgebaut worden wäre. Auch das war ein jahrelang wiederkehrendes Thema. Barbara konnte nicht nach Pirmasens ziehen, denn sie musste im Pfarrhaus wohnen. Das sah das Pfarrerdienstgesetz so vor. Die Situation erschien ausweglos.
»Ich möchte ihn nicht in Gewissensnöte bringen«, hatte Barbara immer wieder gesagt. »Aber ich kann nicht hier weg. Obwohl – es wäre schon schön, zusammenzuwohnen.«
»Höre ich da Hochzeitsglocken läuten?«, fragte Anna. Sie erzählte nicht jede Neuigkeit weiter, aber wissen wollte sie sie schon.
»Alles hat seine Zeit«, meinte Barbara daraufhin nur und lächelte ein geheimnisvolles Lächeln.
»Habt ihr eine Alternative zum gemeinsamen Wohnen hier in Schönbach?«, fragte Anna nach einer Weile.
Barbara schwieg. Sie dachte nach. Anna hatte recht mit ihrer Frage. Es gab keine Alternative. Sie könnten weiterhin in getrennten Wohnungen leben, Bernd könnte manchmal eine Nacht bei ihr verbringen, sie seltener eine Nacht bei ihm. Aber es wäre nicht das, was sie wollte. Was sie beide wollten. Nein, es gab keine wirklich wünschenswerte, akzeptable Alternative. Also musste sie ihn darauf ansprechen und ihm diese Lösung vorschlagen.
An jenem Abend war Bernd ziemlich erschöpft erst spät am Abend aus Pirmasens zurückgekommen. Erst suchte er im Kühlschrank nach etwas Essbarem, dann griff er zu einer Flasche Bier und schließlich setzte er sich unter Stöhnen auf die Couch. Barbara sah ihn mitfühlend und fragend an. Es dauerte eine Weile, bis er das erste Wort herausbekam.
»Ich schätze ihn ja sehr und in der Regel ist er auch ein guter Chef, aber was ihn geritten hat, für morgen früh um acht Uhr diesen nicht gerade wichtigen Termin anzusetzen, verstehe ich nicht. Er weiß doch, wie spät es oft bei uns wird.«
Barbara lächelte möglichst verständnisvoll und fragte: »Ein nicht gerade wichtiger Termin am frühen Morgen?«
»Es geht um eine Vereinfachung bei der Zuteilung der Dienstwagen. Inhaltlich ändert sich gar nichts, nur das Verfahren soll verändert werden.«
»Aha.«
»Das macht bei uns ohnehin meistens Jenny. Eigentlich müsste ich da gar nicht hin.«
»Du hast doch einen kompetenten Kollegen.«
»Wen meinst du?«
»Scheller natürlich.«
Schweigen.
»Du, mit deiner norddeutschen Gründlichkeit meinst, was du nicht selbst machst, wird nicht ordentlich gemacht.«
Wieder Schweigen.
»Ich habe morgen meinen ersten Termin um zehn Uhr. Dann geht es allerdings durch bis in den späten Abend. Wenn du also Scheller anrufst und ihn bittest, dich bei dieser so wichtigen Besprechung zu vertreten, schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe.«
Verdutztes Schweigen.
»Du signalisierst Scheller, dass du ihn ernst nimmst, und du hättest die Möglichkeit für ein Frühstück im Bett – oder anderes.«
Aufmerksames Schweigen.
»Und außerdem bin ich der Meinung, dass wir da jetzt endlich einen Schnitt machen sollten und du endgültig zu mir ziehst – und Klaus Scheller erlaubst zu beweisen, dass er ein ernst zu nehmender Kollege ist.“
Skeptisches Schweigen. Eine sich aufhellende Miene. Ein entschiedener Kuss.
Als er seine Entscheidung am Tag darauf seinem Vorgesetzten mitteilte, meinte der: »Das war aber überfällig, lieber Kollege. Und zur Hochzeit kommen meine Frau und ich auch gerne.«
Das war nun schon eine Zeit lang her. Bernd wohnte seit einigen Monaten im Pfarrhaus. Die morgendlichen Einkäufe der Frühstücksbrötchen hatten damit eine größere Dimension angenommen, liefen aber immer noch nach dem gleichen Schema ab. So auch an diesem Tag. Nachdem »the same procedure as every day« absolviert war, fragte Anna: »Hast du schon etwas über den Toten gehört, den sie im Gebüg gefunden haben? Es soll ein Unternehmer aus Pirmasens gewesen sein.«
»Ja, das stimmt. Die Mitarbeiter seiner Firma haben erzählt, dass der Chef tags zuvor noch in der Firma gewesen sei und man gestern den ganzen Tag versucht habe, ihn oder seine Familie zu erreichen, jedoch ohne Erfolg.«