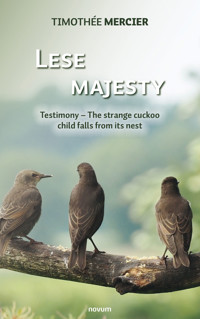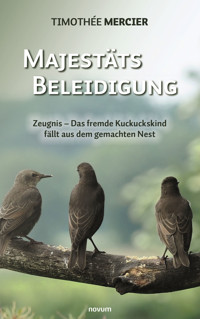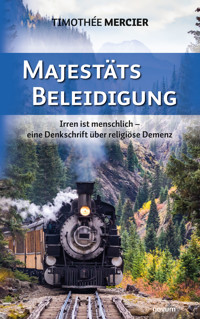
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicht erst seit den Missbrauchsskandalen steht die Kirche als Institution am Pranger. Doch sollte man sich bei aller berechtigten Kritik dann auch vom Glauben abwenden? Nein, meint Timothée Mercier in seinem Buch "Majestätsbeleidigung". Dabei spart er nicht an deutlicher Kritik insbesondere an der katholischen Kirche, zeigt aber auch, wie die antichristliche Politik der Nazis den Leuten, trotz deren Niederlage, den Glauben ausgetrieben hat. So finden wir eine orientierungslose Gesellschaft vor, was durch den Neoliberalismus zusätzlich angeheizt wird. Aber wie kommen wir aus dem Dilemma aus korrumpierter Kirche und Glaubensferne wieder raus? Indem die Priesterschaft sich aus der erstarrten Liturgie löst und Menschen so wieder Orientierung geben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2023 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-758-6
ISBN e-book: 978-3-99131-759-3
Lektorat: Tobias Keil
Umschlagfotos: Gary Gray, Tomas Marek | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Einleitung
Glauben& dessen Regeln spielend leicht gemacht!
***
Jedoch irrt der Mensch, der an GOTT zweifelt.
***
Nur wer vertraut, findet IHN
Zitat
„Die Weisheit des Menschen
besteht darin,
dass er imstande ist,
sein Unrecht einzusehen,
die Weisheit der Seele
besteht in der Liebe zum wahren GOTT
und Seiner Wahrheit.“
aus „Gottmensch“ von Maria Valtorta
Vorwort
Das etwas andere Religionsbuch
***
über die Unwägbarkeiten
einer Kirche im Manko
von
Sinn und Unsinn
einer „wahren“ Religion
verfasst
im Alltag eines Laiengläubigen
von
Timothée Mercier
Hinweis: In kursiv gehaltene Absätze sind original übernommen aus dem 12-bändigen Werk Gottmensch von Maria Valtorta, wie Jesus Christus ihr es in einem langen Leben im Krankenbett unter Visionen eingegeben hat. Gottmensch ist erschienen beim Parvis Verlag in der Schweiz und wird von vereinzelten Persönlichkeiten in der kath. Kirche empfohlen.
Sonstige Quellenangaben finden sich im fließenden Text bzw. explizit angeführt auf der letzten Seite. Ich verzichte auf ein präzises Datum bei etlichen Quellenangaben, es ist dem besseren Lesefluss geschuldet.
Prolog
Glaube und das, was der Volksmund darunter versteht, sind kein intellektuelles Verdienst. Er rührt aus einer ganz einfachen persönlichen Initiative, Gott einbeziehen zu wollen. Wer das verschweigt, hat nicht den wahren Glauben. Im globalen Vergleich des Meinungsforschungsinstituts der Gallup International zeigt sich, dass die am wenigsten gebildeten Menschen zugleich am religiösesten sind. Am höchsten sei daher der Anteil der aktiven Kirchgänger mit 87 Prozent in Westafrika, während Schweden das Land mit den meisten Ungläubigen sei. Dennoch, die Theologen wissen, dass man Gläubige zum Altare, nicht wie Lämmer zur Schlachtbank führen soll, sondern bei der Liturgie immer etwas „denken“ und „empfinden“ muss. Der Glaube an Gott ist immer auch ein wohlwollender Gedanke an Ihn, wie man an einen Freund oder an einen Bruder denkt, mit Freude und Liebe und in Freiheit.
Warum aber gibt sich der Mensch bei den Nächsten immer mehr Mühe als bei Gott, der als unser aller Schöpfer vor seinen Geschöpfen geliebt und geachtet werden möchte? Weil das Gedenken selbst, um als solches ohne Einschränkung Gehör finden zu wollen, zunächst von jeder Absurdität und Banalität reingewaschen werden müsste. Zum Beispiel wäre da das kollektive Unschuldsbewusstsein, das wie selbstverständlich gleichsam bei Säkularen wie auch bei Gläubigen unaufhaltsam um sich greift (Erich Kästnerim Nachkriegsdeutschland: „Die Unschuld grassiert wie die Pest!“). Im Laufe dieses Textes geht es darum, die Aufmerksamkeit auf die vielen Verbindungen und Zusammenhänge zu lenken, die im großen Aufschrei und Gebrüll der Menge untergehen. Letzteres führt zu nichts anderes, als dass Gott noch mehr beleidigt wird und die Menschen unvermindert leiden.
Was ist der Glaube? Gleich dem harten Samenkorn der Palme, oft klein, stützt er sich auf das kurze Sätzlein:„Es gibt einen Gott“, und wird von der einen Behauptung genährt: „Ich habe ihn gesehen.“ … So war der Glaube unseres Volkes, der von den frühesten Patriarchen auf die späteren übergegangen war, von Adam auf seine Nachkommen, von Adam, dem Sünder, dem man aber glaubte, als er sprach: „Es gibt einen Gott, und wir sind hier, weil er uns erschaffen hat, und ich habe ihn gekannt!“ Dann wurde der Glaube immer vollkommener, da er immer mehr enthüllt wurde und er unser Vermächtnis ist, erhellt durch göttliche Offenbarungen, Erscheinungen von Engeln und das Licht des Heiligen Geistes.Immer sind es kleine Samenkörner im Vergleich zum Unendlichen.Aber sie haben Wurzel gefasst, haben die harte Scholle der Menschlichkeit mit ihren Zweifeln und Neigungen durchbrochen und über das Unkraut der Leidenschaften, der Sünden, über den Schimmel der Niedergeschlagenheit, über die Motten der Lasterhaftigkeit, über alles triumphiert. Die Seelen haben sich erhoben, sich zur Sonne gewandt und schwingen sich immer höher zum Himmel empor, bis sie sich aus der Beschränkung des Fleisches befreit und sich mit Gott vereinigt haben, mit seiner vollkommenen Erkenntnis, seinem vollkommenen Besitz jenseits des Lebens und des Todes, mit dem wahren Leben.
Was bewegt denn den Katholiken heute ideologisch noch in seinem Umfeld, geschweige denn die große Masse? Mitunter scheitert sogar die Bereitschaft zur Ökumene, weniger an der Liturgieordnung selbst, denn es waren tatsächlich 6 protestantische Gelehrte, die bei der Ausgestaltung der „Neuen Messe“ mit ihrem Beitrag zum II. Vatikanischem Konzil zugegen sein durften. Die Ökumene scheitert vielmehr auch an der Frage, ob Christus lebendig Fleisch und Blut annimmt beim Opfermahl. Interessant wäre an dieser Stelle eine Erhebung, wieviel Katholiken in Wirklichkeit daran glauben. Und wollte man sie dann auch alle vom Empfang der Hostie ausschließen, die in der Eucharistie nur einen symbolischen Akt für den Empfang der Liebe Christi sehen? Ein Dogma verrichtet nicht automatisch die nötige Überzeugungsarbeit beim Gläubigen beziehungsweise solchen, die im Begriff sind welche zu werden. Da ist jeder einzelne Katholik angehalten, sich die Tatsachen stetig ins Bewusstsein zu rufen, ebenso den Nutzen, der daraus durch uns auch für andere Menschen entsteht.
Neben der Form der Liturgieordnung, die den Gläubigen durch den Gottesdienst führt, bedarf es dringend auch jener geistigen Führung. Das steht doch völlig außer Frage, jenes Geschick, das auf das erhabene innere und äußere Wirken Gottes, das die Liebe ist, hinweist. Ein Wirken, das nach innen und außen in höchstem Maße fruchtbar wird, denn nicht in erster Linie eine vom Menschen vorgegebene Liturgieordnung, sonderndie Liebe Gottes festigt die Bande und macht daraus eine einzige Vollendung, dasheißtder Hl. Geist, der erste Ursprung jeder erschaffenen Vollkommenheitund daher jedes menschlichen Gedankens.Die künstlerische Ordnung der katholischen Liturgieform lässt da durchaus noch ungenutzten Spielraum zur Gestaltung offen.
Tatsächlich aber tritt der Zelebrant in ermangelnder Wirkung notwendigerweise vor allem als Moderator in Erscheinung, als Herr der liturgischen Ordnung, welcher in der Zelebrationsweise „versus populus“ vollends zum Zirkusdirektor ausreift. Ein Dienst, bei dem dreißig Minuten füllend in Wort, Mimik und Gestik alles vorgegeben wird, um ein ständig sich wiederholendes Programm darzubieten, das nur zum Nachsprechen animieren kann, ist milde gesagt kein Gottesdienst, sondern ein Dienst an der Liturgie und am Showmaster selbst. Deshalb dreht sich bei der Masse der Katholiken und insbesondere in den reichen Ländern vieles um sie selbst. Die katholische Kirche hat sich zu einem Paralleluniversum aufgebläht, mit vielen kleinen Planeten – ihren Gemeinden, in denen jede für sich ein eigener Geist weht, nämlich der des Moderators. Der Schöpfergeist indes weht woanders. Das ist der Hintergrund für den oft zu beobachtenden und bei Außenstehenden abstoßend wirkenden Personenkult in der katholischen Kirche, was dem nationalen Patriotismus nicht unverwandt ist.
Wenn jemand das Reich Gottes sehen und an seinen König glauben will,muss er auf geistige Weise wiedergeboren werden.
Das Himmelreich wird nur von solchen bewohnt, die das vollkommene geistige Alter erreicht haben. Jeder hat seine Methode, um den Hafen zu erreichen. Jeder Wind ist gut, wenn man das Segel zu handhaben versteht. Ihr spürt den Wind wehen und müsst das Boot manövrieren und darauf achten, in welche Richtung er bläst. Doch könnt ihr nicht sagen, woher er kommt, noch herbeirufen, den ihr nötig habt.Auch der Heilige Geist ruft, kommt rufend und geht vorüber. Doch nur, wer aufmerksam ist, kann ihm folgen. Das Kind kennt die Stimme des Vaters, der Geist kennt die Stimme des Geistes, von dem er erschaffen wurde.
Das Wasser der Taufe ist ohne den Geist nichts als ein Symbol. Wer mit Wasser gereinigt ist, muss sich dannmit dem Heiligen Geist reinigen und durch ihn sich entzünden und leuchten, wenn er auf Erden hier und im Ewigen Reich im Schoße Gottes leben will.Der Ältere legt die Axt der Meditation an die Wurzeln seines alten Denkens, entwurzelt den Baum und behält nur den Kern des guten Willens zurück. Während ein junger Mensch, wie wir ihn in der Person des Apostels und Evangelisten Johannes kennen, sein Fleisch abzutöten sucht und den Geist wiedergeboren lässt.
Es gibt nur ein ewiges Leben im Jenseits, nicht zu verwechseln mit dem einen Dasein von Fleisch und Blut auf der Erde, sondern die Rede ist vomunsterblichen Geist, der durch das Zusammenwirken von Taufe und Heiligem Geist zum wahren Leben wiedergeboren wird.Ihr müsst aufs neue geboren werden. Der heilige Johannes und viele seiner Ebenbilder, dieChristus bis in unsere heutige Zeit in aufrechter Weise suchen und nachfolgen, legen ihr Ich auf den Scheiterhaufen der Liebe.Aus der Asche geht ihre neue geistige Blume hervor, eine wunderbare Sonnenblume, die sich unablässig der ewigen Sonne zuwendet. Denn was vom Fleisch gezeugt wird, ist und bleibt Fleisch und stirbt, nachdem es ihm in seinen Begierden und Sünden gedient hat. Doch was vom Geist gezeugt wird, ist Geist und kehrt zum Schöpfer-Geist zurück, nachdem es bis zum vollkommenen Alter den eigenen Geist empor geführt hat.
Die postreligiöse Erscheinung greift überwiegend nur zu Kult und Ritus. Sie verspricht den Verstand zu befrieden, in einem Denkgebäude, in dem auch unsere Kultur der Individuen mit einer Vielzahl zermürbender Erscheinungsformen zu Hause ist. Mittels hässlicher Alltagsgewänder des sich anbiedernden Egoismus macht der Zweifelnde sich fest, von denen er sich im Verlauf dunkler Stunden vergebens loszureißen sucht, weil sie ihn verfolgen wie ein zweites Ich. Das Umfeld, meist ignorant für das Innenleben, bemerkt nichts. So sieht der Zweifler allmählich und im Fortschreiten seines Alters einen Verzweifelten im Spiegelbild und will vor Gott fliehen, weil er das wachsende Bedürfnis in sich verspürt, von sich selbst loszukommen, sich selbst fremd ist und obendrein verdrängt, sich wiederfinden zu können, aber den Mühen dafür ausweicht. Man bringt eine Vielzahl an Widersprüchen in sich nicht dadurch zum Erlahmen, indem man Gott in sich tötet, sondern indem man mit ihnen Haushalten lernt, so wie mit allen zutiefst eigenen Bedürfnissen.
Was man mit Strenge oft nicht erreicht, erreicht man mit Freundlichkeit. Es gibt Menschen, die nie von selbst zum Meister kommen würden, daher muss der Meister zu ihnen gehen. Andere würden wohl zum Meister kommen, aber sie schämen sich vor den Mitmenschen und auch sie muss der Meister aufsuchen.Die neuen Zeiten werden neue Methoden mit sich bringen. Bis gestern, bis zur Zeit des Täufers, war es die Asche der Buße. Heute jedoch, in Seiner Zeit, gibt es das süße Manna der Erlösung, der Barmherzigkeit und Liebe. Jede Zeit hat die für sie nützlichen Dinge.Niemand näht ein Stück neuen Tuches auf ein altes Gewand, denn beim Waschen geht der neue Stoff ein und der Riss im alten wird noch größer. Ebenso füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche, denn die alten Schläuche würden durch die Gärung des Weines bersten, und der Wein würde auslaufen. Der alte Wein, der schon alle seine Umwandlungen durchgemacht hat, gehört in alte Behälter und der neue Wein in neue.Daher soll eine Kraft einer anderen, ebenso starken gegenübergestellt werden. Dies geschieht jetzt. Die Kraft der neuen Lehre erfordert neue Methoden ihrer Verbreitung, und Christus, der dies weiß, bedient sich ihrer.
Augenfällig allemal ist, Er, Christus, lässt sich keineswegs von althergebrachten Traditionen oder vorgefertigten, theatralischen Modellen in Gefangenschaft nehmen. Er selbst bildet das Grundelement für Treue und damit den Eckstein für rationale Gebundenheit, um schließlich der Willkür vorzubeugen und Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Es geht darum, dass wir allzu oft dem traditionellen Denken und den Institutionen des Pharisäertums verhaftet und geistige Kinder dieser Epoche geblieben sind – emotional wie rational. Den wenigsten Traditionalisten steht nämlich vor Augen, welche Tradition sie zu Ehren bringen wollen. Jenes psychologische Gebilde, in das man sich bereits seit Jahrzehnten und womöglich von Kindheit an mit seinem rationellen Denken häuslich eingerichtet hat, ist in der Tat vom inneren Wachstum mit der Religion oder der Reifeprüfung des geistigen Alters säuberlich zu trennen, weil sie in Opposition dazu stehen.
Etwas einfältig erscheint das Aufblähen des täglichen Gottesdienstes mittels Anreihung gleichlautender liturgischer „Komponenten“. Wenn nämlich mehrere Elemente in Folge immer wieder dasselbe sagen wollen und noch dazu an der falschen Stelle, droht die vielgelobte sich steigernde Ordnung einer Messfeier, das Ergebnis am Ende zu sprengen, und ein Chaos im menschlichen Geist anzurichten. Bei regelmäßigen Besuchen mancher Gottesdienstfeiern etwa entsteht dann im Kopf eine Art Endlosschleife. Letztere gereicht dem Gläubigen noch nicht einmal dahingegen, sich ein geistiges Zuhause zu errichten, sondern wird im Überfluss des Gesagten und Gestauten mühevoller Stein des Anstoßes. Die Masse einer derlei gearteter Ansammlung von Ungesagtem erscheint monströs, verkommen zu Worthülsen, die unverkennbar die Routine in den Vordergrund rücken. Routine aber ist die Basis jeder Konformität und in unserem Fall die Grundlage für geistige Entfremdung beziehungsweise religiöse Demenz. Routine lässt der Seele eines Gläubigen nicht den geringsten pragmatischen Spielraum zur Einheit mit Gott und seinem Erlöser, geschweige denn ist von Qualität beim Lob des Herrn zu sprechen.
Im Widerstreit seiner Gefühle findet der Christ im liturgischen Gebäude des Gottesdienstes indes langfristig nur vordergründig Halt und Trost, vielmehr bringt der regelmäßig begangene Ritus im Gegenteil sein selbsttätiges Denken wirkungsvoll zum Erliegen, ähnlich der geistigen Rückbildung in einer Demenz. Zu oft driftet der Gläubige bei der Eucharistiefeier zwischen Schuldbekenntnis und „Vater unser“, dem Gebet aller Gebete, geradewegs in die Gedankenlosigkeit ab; zu langatmig wirkt der Monolog des Zelebranten auf den Gottesdienstbesucher, der schon zu lange auf die Folter gespannt wurde und endlich angekommen bei der Eucharistie nun durch das viele Vorbeten des Zelebranten auf sich selbst zurückgeworfen wird. Gloria und Sanctus könnten ähnlicher nicht sein in ihrer Eigenschaft, Gott zu preisen. Jene Bestandteile, welche in wörtlicher oder dem Sinn nach bereits in anderer Form vorher schon mal gesagt wurden, könnten vereinfacht werden, um aus dem großen Drehbuch des Gottesdienstes eine vielversprechende geistige Einladung zu machen.
Wenn einer allein unter Heiden, ohne Kirche und ohne Bücher wäre, hätte er alles, was zur Betrachtung erforderlich ist, im „Vater unser“, und eine offene Kirche in seinem Herzen durch dieses Gebet. Er hätte eine Regel und ein sicheres Mittel, sich zu heiligen.
Weil sich die katholische Kirche, mehr noch: weil sich die gesamte westliche Ratio vom leidvergessenen griechischen Denken habe anstecken lassen, sei sie taub geworden gegenüber dem „Aufschrei der Unschuldigen“, der „Autorität der Leidenden“. In diesem Sinn habe der TheologeJohann Baptist Metz, der vor Jahrzehnten die katholische Kirche aus ihrem eschatologischen Schlummer gerissen und heilsam in Unruhe versetzt habe, keinen Zweifel daran gelassen, rezitiert dieZeit:„Die Geschichte des Abendlandes wäre weniger grausam gewesen, wenn das jüdische Gottesgedächtnis, die Revolte gegen die ‚Normalität’ von Herrschaft und Gewalt, nicht unterdrückt worden wäre – wenn nicht nur Athen und Rom, sondern auch Jerusalem die ‚geistige Landschaft‘ Europas bestimmt hätten. Indem die Kirche das Christentum als Synthese zwischen dem ‚Glauben’ Israels und dem ‚Geist‘ Athens begreift, reduziert sie den jüdischen Anteil auf den bloßen ‚Glauben‘. Sie schlägt das ‚Denkangebot‘ aus, das Israel dem Christentum mit auf den Weg gab: diememoria passionis, das Eingedenken von geschichtlichem Leid, von Unrecht und Gewalt. Die Kirche hat das Christentum halbiert. Sie hat ihre jüdischen Wurzeln verleugnet und will nicht wahrhaben, dass Christus selbst der gefolterte und gekreuzigte Jude ist.“
Der Übergang vom Beugen der Knie nach dem Kyrie zum Himmelhochjauchzen im Gloria ist allenfalls rasant und für ein menschliches Herz nicht nachvollziehbar, weshalb viele ihre Knie gar nicht mehr beugen. Selbst wenn diese Aneinanderreihung in der Logik die Erlösung zum Ausdruck bringen will, sprengt sie jede Andacht im Sinne des Nachspürens der eigenen unausweichlichen menschlichen Sündhaftigkeit im Laufe des Gottesdienstes und bietet damit ausreichend Nährboden für die Unbußfertigkeit unter Katholiken. Der krasse Übergang zum Gloria ist eine totale Verfehlung der Intonation und macht das Schuldbekenntnis zu einer bloßen Farce, das in einem theatralischen Schauspiel der lauthalsen Herzen endet. Im selben Atemzug, mit dem das Gloria angestimmt wird, ist alles so, als ob nichts gewesen wäre und der Gläubige findet sich spätestens im Alltag wieder im elenden Kreislauf der eignen Sündhaftigkeit, zurückgeworfen auf ein außer Rand und Band geratenes Unschuldsbewusstsein. Er wird damit mit jeder heiligen Messe aufs Neue ins eiskalte Wasser geworfen. Wer tut sich das freiwillig an? Euphorische Selbstüberschätzung mit all ihren tragischen Folgen, wie sie der Verlauf dieses Buches noch ernüchternd zu erkennen gibt.
Die Liturgieordnung der „neuen Messe“ als solches wäre an sich ein herrliches Konstrukt und eine echte Errungenschaft der katholischen Kirche für die ganze Menschheit, bei der in der Wahrnehmung des Menschen tatsächlich die Herrlichkeit des Schöpfers zum Ausdruck gebracht werden könnte. Nur diese teilweise seltsame Anordnung der liturgischen Elemente als Wohlfühlprogramm ist spektakulär misslungen. Es bedarf an der Stelle des kollektiven Schuldbekenntnisses eines einleitenden Tiefganges im Wort, um dem Evangelium schwerpunktmäßig mehr Raum der Entfaltung zu geben und das Gedenken an Christus als das zu feiern, was es ist, nämlich als Aufruf sich retten zu lassen und als die Erlösung des wahrhaft Gläubigen von seiner bußfertigen Schuldhaftigkeit hin zum ewigen Heil. Das muss sich von Anfang bis Ende wie ein roter Faden durch den Gottesdienst ziehen, wenn er als solches seinen Namen verdienen will. Was nun in der katholischen Liturgie als solches gehandelt wird, ist mit der künstlichen äußeren Trennung der Eucharistie vom einleitenden Schuldbekenntnis genau das Gegenteil und mitunter ein haarsträubender Widerspruch, denn ein aufrichtiges Schuldbekenntnis ist bereits Eucharistie durch und durch.
Wer schon einmal mit Demenzkranken zu tun hatte, der kennt deren totale Verweigerung, persönliche Fehler einzugestehen. Es fällt ihnen deshalb so schwer, weil das ganze Leben zu einem Verlust geworden ist. Das ist psychologisch begründet und nachvollziehbar. Wie viel Liebe brauchen diese Menschen von ihren pflegenden Angehörigen oder Personal, um sie halbwegs in der Spur zu halten? Man kann diese Mühe gar nicht hoch genug würdigen und schätzen. Aber Menschen, die sich ihrer geistigen Fähigkeiten rühmen, indem sie sich Gläubige nennen, sich jedoch im Gottesdienst von einer Minute auf die andere nicht mehr daran erinnern wollen, dass ihnen vor ein paar Sekunden und bereits viele Male zuvor schon vergeben wurde, weil sie durch einen unglücklichen ästhetischen Kunstgriff in der Liturgie dazu verleitet werden, können der Gnade Gottes nur bedingt anteilig werden, denn Sünder sind wir allemal und bleiben es auch. Es ist nur statthaft, sich stets unserer Bußfertigkeit zu erinnern, auch in einem festlich gekleideten Gottesdienst. Nur weil wir uns berechtigt sehen, den Leib Christi zu wandeln und zu kommunizieren, und ein bisschen Lärm und Euphorie darum inszenieren, sind wir noch lange nicht vollkommen oder gute Menschen.
Den Beweis führen die Geschichte und ganz besonders die Geschichte Deutschlands selbst an, die trotzdem, dass sie Generationen von Geistesgrößen hervorbrachte, eine andere Generation von Mördern folgen ließ. DieZeitberichtet, dass dort, wo 110 Jahre später ein Konzentrationslager entstand,Goethe1827 gesagt habe: „Ich war sehr oft an dieser Stelle. Hier fühlt man sich groß und frei.“ Der Ettersberg sei als Hausberg Weimars eng mit der deutschen Klassik verbunden. Bis heute sei das 190 Hektar umfassende ehemalige Lagergelände ein Stadtteil von Weimar.
Dein Meister, dein wirklicher und größter Meister, der dich deinen Meister verstehen lässt, ist die Liebe.
Da fehlt es doch schon an der Basis, was in protestantischen Freikirchen schon lange Alltag geworden ist und viele Menschen heilt. Die Ökumene scheitert ganz offensichtlich insbesondere mitunter an der religiösen Demenz unter Christen. Sie gehen konform im Wellness-Rhythmus der Liturgie, ohne auch nur im Geringsten eine geistige Entwicklung in Betracht ziehen zu wollen. Es kann einfach nicht oft genug gesagt werden einleitend zum Schuldbekenntnis, was Erlösung bedeutet, damit die Herzen der Menschen auch angerührt werden. Das Opfer, das Christus begangen hat, war nicht ausschließlich der abschreckende Kreuzestod, auch wenn es dort sehr deutlich für alle zu sehen ist. Erst wenn wir uns mit der gleichen Intensität vor Augen halten würden, dass Sein ganzes Leben ein einziges Opfer war, um die frohe Kunde von der Barmherzigkeit Gottes in aller Munde zu legen, würden wir mehr und mehr begreifen, dass Er es auch für jeden Einzelnen im Hier und Jetzt getan hat.
Warum also hören wir selbst auf damit, Opfer zu bringen und die Nachricht weiterzureichen? Weil wir Opfer und Mühen scheuen? Das allein ist es nicht. Wir müssen das Opfer Christi als Ganzes begreifen lernen, um es als persönliche Einladung zur Erlösung verinnerlichen zu wollen, freiwillig und so gerne, dass wir es sogar täglich und womöglich mehrmals am Tag vergegenwärtigen. Das ist Heilung. Nur so konnte die Nachricht des „Neuen Bundes“ uns auch noch im dritten Jahrtausend erreichen. Das Kreuzist grausam, aber es verliert seine abstoßende Wirkung auf das Auge des Betrachters, wenn es als Finale eines großen Siegeszuges an Sinn hinzugewinnt. Wenn man sein ganzes Leben lang unsagbare Mühen und Pein auf sich geladen hat, zusammen mit den Aposteln und auch für sie, damit Er sie in Seinen Fußstapfen sehe, und uns in Seinen, kann Christus am Ende zu Seinen Richtern, und es waren in der Tat viele, die Ihn lieber tot als lebendig sehen wollten, kaum sagen: „So, nun ist es genug, den Kreuzestod nehme ich nun nicht auch noch auf mich. Ich mach mich jetzt aus dem Staub, aus dem ihr alle gemacht seid. Seht ihr mal zu, wie ihr jetzt damit zurechtkommt.“ Vielmehr hat Er uns aber im Opfer ein Gedenken Seiner Liebe für uns hinterlassen. Mehr noch, der Sühnetod am Kreuz war der Preis für unser aller Erlösung, damit wir die Verzeihung vom himmlischen Vater empfangen dürfen. Deshalb spricht Jesus von einer wahrhaften Speise und wahrhaftem Trank, die im Brot und Wein, Sein Fleisch und Blut vermehren als Sühneopfer und Versöhnungsgabe vor Gott.
Christus hätte es auch dabei belassen können, einfach nur seine frohe Botschaft zu verkünden, und Seine Gegner und Feinde, die Ihm dabei im Weg standen, mit einem Fingerzeig sichtbar unmittelbar abzustrafen oder zu vernichten. Er hätte dazu noch nicht mal eine Waffe benötigt, wie die republikanische Politikerin Lauren Boebert aus Colorado über social Media Jesus im Juni 2022 zugeraten hatte. Er habe offenbar nicht genug dieser halbautomatischen Angriffswaffen besessen, um seine Regierung davon abzuhalten, ihn zu kreuzigen, sagte die Abgeordnete im Repräsentantenhaus laut US-Medienberichten bei einer Veranstaltung in Colorado Springs zum Gelächter des Publikums. Sonst hätte er die Männer von Statthalter Pontius Pilatus im Garten von Gethsemane abwehren können. Das AR-15 wird in den USA immer wieder von Amokläufern zur Ermordung unschuldiger Zivilisten verwandt.
Warum hat Jesus es wohl nicht getan? Diese Frage muss jeder ernsthaft für sich beantworten können, wenn er die Saat der Erlösung im Herzen aufgehen sehen will. Dennoch, mit einem kurzen Satz ist es gesagt: weil wir es auch nicht können. Er hat die gleichen Mühen auf sich genommen, die wir auch haben mit unseren Mitmenschen oder sie mit uns, wenn wir das Gute nicht erkennen, das sie uns tun wollen, oder rechtes in falscher Weise tun, weil unser Ego noch nicht abgenommen hat in unserem falschen Stolz und mangelnder Erkenntnis als unvollkommene Wesen. Wem nützen fromme Verbeugungen und strikte Befolgungen des liturgischen Albtraums, wenn das Herz nicht berührt wird vom Gedenken an Christus, jedes Mal wieder, wenn wir von Ihm sprechen und Gottesdienst halten. Was allem Anschein nach über einen sehr langen Zeitraum und im radikalen Sinn durchaus nützlich erschien, entpuppt sich einmal mehr als unbefriedigende und irregeleitete Abhängigkeit vom Marionettentheater. Der Gottesdienst seinerseits will als einheitliches Ganzes aus freien Stücken begangenen werden, wenn er vor Gott Wohlwollen finden soll. Schließlich wird auch niemand gezwungen werden, das Jenseits zu betreten. Regelmäßig von der Routine zusammengeketteter Fragmente getragen zu werden, ist noch kein freier Entschluss, seinen Geist zu erheben. Er wird sich dadurch schlicht und ergreifend nicht erheben, sondern brachliegen und sich in einer Art religiöser Demenz unter Umständen sogar rückbilden.
Anderes braucht es nicht, meine Freunde. In den Worten des „Vater unser“ ist alles, was der Mensch für die Seele, den Leib und das Blut benötigt wie in einem goldenen Ring eingeschlossen.Mit diesem Gebet bittet um das, was dem einen und den anderen nützlich ist; wenn ihr darum bittet, werdet ihr das ewige Leben erlangen.Es ist ein so vollkommenes Gebet, dass die Wellen der Häretiker und der Lauf der Jahrhunderte es nicht zu ändern imstande sind. Das Christentum wird vom Biss Satans zerstückelt werden, und viele Teile meines mystischen Leibes werden zerrissen und abgetrennt, eigene Zellen bilden, im vergeblichen Verlangen,einen vollkommenen Leib zu gestalten, wie es der mystische Leib Christi ist, in welchem alle Gläubigen in der apostolischen Kirche vereint sind und in der alleinigen wahren Kirche, die bestehen wird, so lange die Erde besteht!Aber die abgetrennten Teilchen, denen die Gaben nicht zukommen, die ich der Mutterkirche schenke, um meine Kinder zu nähren, werden sich immer christlich nennen und sich dessen erinnern, dass sie auf Christus zurückzuführen sind.Auch sie werden dieses universelle Gebet beten. Vergesst es nie und denkt stets darüber nach. Wendet es auf euer Wirken an. Es braucht nichts anderes für die Heiligung. Wenn einer allein unter Heiden, ohne Kirche und ohne Bücher wäre, hätte er alles, was zur Betrachtung erforderlich ist, in diesem Gebet, und eine offene Kirche in seinem Herzen durch dieses Gebet. Er hätte eine Regel und ein sicheres Mittel, sich zu heiligen.
Liturgie darf nicht mal im Ansatz zur Bildung von Parallelgesellschaften oder gar als Ersatzreligion dienen. Der emeritierte PapstBenedikt XVI.nimmt dazu mehrere Jahrzehnte nach seiner Amtszeit in einem Aufsatz an die Versammlung der Bischofskonferenzen zum Missbrauch-Gipfel im Februar 2019 Stellung, welchen das bayerische Klerusblatt veröffentlicht hat. Er schreibt, dass in den 20 Jahren von 1960 bis 1980 „die bisher geltenden Maßstäbe in Fragen der Sexualität vollkommen weggebrochen“ seien. Aus dieser Entwicklung heraus sei dann eine „Normlosigkeit entstanden“, die man nun in der Gegenwart abzufangen versuche. Wie nebenbei erwähnt der emeritierte PapstBenedikt XVI., dass es in mehreren deutschen Priesterseminaren „homosexuelle Klubs“ gegeben habe, „die mehr oder weniger offen agierten und das Klima in den Seminaren deutlich verändert“ hätten. Jedoch macht der ehemalige Oberhirte diesen ausgeprägten Hang zum gleichen Geschlecht konkret die sexuelle Revolution der 68er-Bewegung verantwortlich, auch für die vielen Missbrauchsfälle in Deutschland. Das ist vielleicht gar nicht mal von so weit her geholt, aber zu sagen, dass andere Schuld seien, war noch nie ein denkwürdiger Beitrag. Mutmaßlich strukturelle Daseinsmängel in der Kirche, zu denen an vorderster Stelle der Vatikan mit seinem fragwürdigen Status als Kirchenstaat steht, und die in Beton gegossenen hohen Nebengebäude der Liturgiebeschaffenheit befeuern jedenfalls die Bildung von Paralleluniversen weitaus deutlicher. Letzteres ist aber noch kein Bündnis der Liebe.
Was auf dem Spiel steht, ist die Wirklichkeit Gottes. Nicht weniger rechthaberisch wirken deshalb auch die Schuldzuweisungen jener, die entweder nichts mit der Kirche zu tun haben oder aber als unverständige Gläubige, den Klerus auf sein menschliches Wesen zu reduzieren suchen. Derlei Verlautbarungen können nur dem fiktiven Unschuldsbewusstsein gerecht werden, in der selbstgewählten Unfähigkeit, die eigene Triebhaftigkeit richtig einzuordnen. Konsequenterweise werden die zahlreichen Wortmeldungen als erlesene Großzügigkeit der Gesellschaft dem Priester gegenüber angepriesen, wenn sie diesen das Recht auf häuslichen Sex einräumen. Die Triebhaftigkeit, die vom Manne allzu oft mit all seiner Manneskraft gleichgesetzt wird bzw. von Frauen bereits in sehr jungen Jahren gern als Maßstab für ihre zur Schau gestellte Reizbarkeit gegenüber dem Manne gilt, wird jedoch allgemein überschätzt. Genauso wie die Liturgie überbewertet wird. Das Scheitern setzt sich fort und das Menschliche will beständig dem Göttlichen überhöht werden.
Töricht ist, wer sagt: „Herr, verzeih“ und dann die Gelegenheit zur Sünde doch nicht meidet.
Wie das verspätete Bekenntnis des emeritierten Papstes deutlich macht, geht dieses Gebaren nun schon seit vielen Generationen so und wird stock und steif in die nächste übertragen. So ist es nicht nur in der Kirche, so ist es auch mit den Herausforderungen in der Gesellschaft. Bedenke man nur als Beispiele die nunmehr jahrzehntealte Pflegemisere in Seniorenheimen oder Krankenanstalten, den Umweltschutz oder das nationale und internationale Gefälle zwischen Arm und Reich. Warum stellen sich hier nur unbedeutende Minderheiten ernsthaft den essentiellen Fragen? Warum wollen nur wenige ernsthaft Probleme auch lösen? Warum bitten wir Gott, Monster zum Schweigen zu bringen, die der Mensch selbst in sich erschaffen hat? Warum gebieten wir dem Schöpfer, Hunger, Krieg und Krankheiten nicht zulassen zu dürfen, wenn sie doch eine direkte Folge kurzsichtiger und egozentrischen Handelns der Menschen selbst sind? Sie sind von Menschen Hand gemacht, also können sie nur durch den menscheneigenen Willen gelöst werden.
Schließlich mutiert auch die Liturgie bereits seit Jahrzehnten unter dem Einfluss des Menschen zu einem undefinierbaren Etwas. Was erreichen Menschen oder auch Gläubige noch wirklich in ihrem Leben? Bei genauerem Hinsehen gibt sich jene Nachlässigkeit als die Wurzel einer übelriechenden Pflanze zu erkennen. Sie heißt Gleichgültigkeit und scheint auf den ersten Blick harmlos, wendet aber in Sekundenschnelle ihr Blatt, wenn einer zu zündeln beginnt. Ihre Früchte wandeln sich in Schadenfreude oder gar emotionaler Mordlust. Selbst hinter jener zwielichtigen Maske, die seit Jahrhunderten mittels des Katholizismus zum Tragen kommt, verbirgt sich etwas undefinierbar Verbotenes.
Hält sich der wahre Kern verborgen, fragt man sich? Hinter dem Schein guter Werke hüllt sich die Gemeinde mitsamt ihren Hirten und Oberhirten in schöne Gewändern, gekleidet augenfällig in das traditionell liturgische Gebäude, das mittlerweile auf Sand gebetet ist. Dort verweilen sie in Resignation, nicht in Einmütigkeit, um mit den Worten des Apostels Paulus nach dem ersten Korinther zu sprechen, sondern gespalten und geteilt in Links, Rechts und Mitte. Die Kirche steht vielerorts mit ihren Aufgaben nicht nur mehr vor der ungelösten Herausforderung eines verkrusteten und überflüssigen Kirchenstaates, sondern sie muss auch ihre Hausaufgaben machen und endlich die Herzensrevolution angehen, gleichermaßen bei ihren Hirten und Gläubigen, damit sie zu Christus aufschaut, an ihn glaubt als Kern der Wahrheit. Es ist der Weg, um sich Ihm auch im Sakralraum wieder authentisch zuwenden zu wollen.
Konkret heißt das, dass Liturgie nicht länger der Hort für irgendeinen Ersatzmechanismus von Stillstand und Resignation des Klerus oder einer kleinen Minderheit beschreiben darf. Sie muss vielmehr das reine Gedenken beim Priester und Gläubigen gleichermaßen unterstreichen können und folglich auch die Sehnsucht nach Gott, damit die VersammlungIHN mehr liebt als die Welt, die mit all ihren Gefühlen nicht ein einziges Lächeln Gottes wert ist. Es ist von existentieller Bedeutung, dass die Schar der Gläubigendarüber nachdenkt, was die Welt ist und was Gott ist, damit sie nach dem Besseren strebt.Nichts Geringeres steht hinter dem Auftrag Jesu, der die Liebe des Vaters und die Liebe zum Vater ist:„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“
Bereits vor den beiden großen Weltkriegen hatte die Eucharistie einen freundlichen Verfechter, den Zeitgenossen PapstPius X.. Sich einzumauern im Schein eines liturgischen Baus, hatte noch nicht mal im Mittelalter seine Bewährung, umgebend von den schlimmsten Verwerfungen, weshalb dieser Papst die Eucharistie herausführte aus ihrem tiefen Schlummer. Er formulierte das Prinzip der „lebendigen Teilnahme“ (Participatio actuosa) des Volkes, das vomZweiten Vatikanischen Konzil(1963) übernommen wurde, indem PapstJohannes Paul II.sich um geistiges Wachstum bemühte. Die Tradition der Liturgie ist bis heute wahrlich unverrückbar mit dogmatischem Charakter aus dem Kirchenboden gestampft. Sowohl PapstPius X.als auchJohannes Paul II.suchten jedoch die Öffnung blind gerecht fertigender Traditionen, um den Kern freizugeben und liturgische Strukturen in ihrem Zentrum zu erreichen. Die Spaltung der Menschheit in Kirchgänger und Gottesdienstmuffel, in Protestanten oder Katholiken bringt indes zwei Strömungen für alle Welt offen zu Tage. Natürlich gab es immer auch Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht an einen Gott glauben wollen oder können, meistens ist es eine Mischung von beidem. Dass wiederum Menschen der Zugang zum Kern aller Wahrheit verwehrt bleiben muss, weil individuelle Fehlinterpretationen über die Bedeutung von Liturgiebeschaffenheit den Weg dahin verhindern, ist nicht hinnehmbar.
Verkannt wurde einstweilen die Reform in seinem inneren Antrieb als direkte Folge mythischer Überhöhung von liturgischen Gestaltungsformen beziehungsweise deren Überfrachtung um ihrer selbst willen. Dass darüber hinaus die Zelebrationsweise mit dem Rücken zum Altarsakrament Gefahren bergen kann, die zu Lasten der Authentizität der gesamten Liturgie geht und bei den Erneuerern dennoch als Kompromiss besagter zweier Strömungen gefeiert wird, wurde fortan mit Allerwelts-Rhetorik im Altarraum als Emanzipationsprinzip für die Gläubigen vergolten. Resultierend aus der ersten Unachtsamkeit, tritt also folgenreicher die zweite Nachlässigkeit in den Vordergrund und raubt der Gottesdienstfeier vollends ihre Eindeutigkeit als Gedenken. Die Gedenkfeier ist keine solche mehr, sondern fortan als „Neue Messe“ in aller Munde und Katholiken sind keine Wächter des aufgehenden Morgens mehr, sind nicht mehr wachsam, sondern trunken und träge von der nimmersatt werdenden Gabe GOTTES im ewigen Opfermahl der Eucharistie. Letztere ist allerdings als solche nicht mehr auszumachen und ihrem ursächlichen Charakter zur Stärkung des Unrechtsbewusstsein entfremdet. Selbst wenn Gott auch weiterhin inmitten unter uns sein sollte, ist das Nehmen der Menschenherzen einseitiger geworden und hat sich unersättlich ausgeweitet, weil das Geben sich nicht mehr am Gedenken an das vielseitige Opfer Christi orientiert, sondern im Erstarken von einvernehmender Gefühlsduselei und pharisäischer Selbstverliebtheit.
Dass Menschen nicht glauben, davon berichtet auch das Alte Testament; aber Verirrungen, die durch abstrakte und theokratische Liturgiebesessenheit maßgeblich ins Leben gerufen wurden, das gibt es erst seit der Erschaffung der Liturgie selbst, durch den Klerus, der damit nichts Geringeres erreicht hat, als sich selbst abzuschaffen. Das II. Vatikanische Konzil erlag nun seinerseits geschichtsbedeutend in einem unaufhaltsamen Tatendrang einer zeitgenössischen Interpretation hinsichtlich der Ansichten über den Volksaltar beziehungsweise der damit im Zusammenhang stehenden folgenreichen Zelebrationsweise des Zelebranten mit dem Rücken zum Altarsakrament. Sowohl Ursachen als auch Wirkung der seinerzeit so populären Verbreitung des Volksaltares wurden verhängnisvollerweise zu nachlässig recherchiert oder erst gar nicht interpretiert, wiewohl sie nur als das gedeutet wurden oder werden, was sie vordergründig darstellen: den natürlichen Ausdruck einer Gemeinschaft, die mit dem Zelebranten zusammenrückt. Das war allenfalls die Richtschnur im Verhalten der vergangenen Kriegsepochen. Was jedoch Menschen allein aus einer naturalistisch-entfremdeten Einstellung befreien und zum Personsein in Gemeinschaft erlösen könne, das sei die Begegnung mit der Personalität Gottes, unterstreichtJohn Rawlsin seinem WerkÜber Sünde, Glaube und Religion.
Im Glauben, den Maria bei der Verkündigung als „Magd des Herrn“ bekannte und mit dem sie dem Gottesvolk auf seinem Pilgerweg ständig „vorangeht“, strebt die Kirche „unablässig danach, die ganze Menschheit … unter dem einen Haupt Christus zusammenzufassen in der Einheit Seines Geistes“.
aus der Enzyklika „Die Mutter des Erlösers“ (Nr.28) von Papst Johannes Paul II.
Teil I – Irren ist menschlich
Eine Denkschrift über religiöse Demenz
Kapitel I – Beschreibungen einer Gesellschaft
Nachkriegsparodien
Auf dem Weg, auf dem die Menschheit geht, schuftet sie, um Felsen der Zweifel, Enttäuschung und Entwürdigung, des Hasses und der Unzufriedenheit beiseitezuschaffen. Viele sind dabei in weltlichen Irrtümern gefangen und bauen unaufhörlich an der Ungerechtigkeit der Welt und ihrer eigenen Dunkelheit weiter, verfangen sich bei der Anhäufung irdischer Werte und Lehren. Sie kommen nicht weiter, sehen nicht nach vorn. Jesus geht diesen Weg mit uns. Seine Gegenwart ist diskret und leicht zerstörbar. Seine Nahrung soll uns stärken, Halt und Richtung geben, damit wir nicht abrutschen.
Dazu müssen wir glauben, dass Seine Liebe nach dem Wunder der Verwandlung sich in uns entfachen kann, um selbst ansteckend zu werden für die Liebe im Nächsten. Das kann sie hingegen nicht, wenn unser Herz voll von Schuld ist und wir sie nicht hinauskehren auch jene, welche wir „nur“ geerbt haben. Beim eucharistischen Weltkongress in Rom im Heiligen Jahr 2000 wird auf die Beichte hingewiesen als Mittel, um dem Wunder der Eucharistie näher zu kommen und bewusster zu werden.
Kann keiner sagen, es ist keiner unter ihnen, der müde von der Müdigkeit der Sünde, das Gefühl hat, weniger Mut zu haben und vom Feind bezwungen zu werden, da nichts so sehr schwächt wie ein schlechtes Gewissen? Heilig ist, wer sich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich heilig bewahrt. Dann ist Gott in ihm. Weder die Taufe noch der Ritus helfen, wenn nicht die Reue und der feste Wille vorhanden sind, der Sünde zu widersagen.Man kann Gott in seiner Güte nicht unbestraft versuchen. Das ist nicht erlaubt. Er verzeiht, verzeiht, verzeiht … Doch er verlangt den festen Willen, die Sünde aufzugeben, um weiterhin verzeihen zu können.Töricht ist, wer sagt: „Herr, verzeih“ und dann die Gelegenheit zur Sünde doch nicht meidet.
Es ist bezeichnend, dass das zweite Eucharistische Hochgebet mit der Epiklese nach der Konsekration die Bitte um die Einheit der Kirche in folgenden Worten verbindet: „Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lasse uns eins werden durch den Heiligen Geist.“ Diese Formulierung lässt deutlich werden, dass das Wesen des eucharistischen Sakramentes die Einheit der Gläubigen in der kirchlichen Gemeinschaft ist, gibt PapstBenedikt in Kapitel fünfzehn Eucharistie und kirchliche Communio derSacramentum caritatisan. So zeigt sich die Eucharistie an der Wurzel der Kirche als Geheimnis der Communio.
Der Baum des Lebens, von dem der Mensch sich infolge der Sünde entfernt hat, zeigt sich im Leib Christi den Menschen von Neuem. Obwohl unser Planet fortwährend mit Gräbern übersät wird, obwohl der Friedhof, worin der aus dem Staub hervorgegangene Mensch wieder zu Staub zurückkehrt (vgl. Gen 3,19), ständig wächst, leben doch alle Menschen, die am Grab Jesu Christi wachen, d. h. seine Lebensgeschichte wider allen Anfechtungen im Herzen tragen, in der Hoffnung auf ihre eigene Auferstehung. Das Evangelium und die Eucharistie, die wir in Reinheit empfangen, das sind unsere Wegzeichen.
Weder die Taufe noch der Ritus helfen, wenn nicht die Reue und der feste Wille vorhanden sind, der Sünde zu widersagen.
Die Natur sei nicht alle Wirklichkeit, und Gott in seiner Transzendenz für die Immanenz unerreichbar, das zumindest behauptet in derTagespostim März 2004Dieter Hattrup,Professor für Dogmatik an der Theologischen Fakultät Paderborn. Er fügt an, Natur sei diejenige Wirklichkeit, die in meine Reichweite falle, Gott diejenige Wirklichkeit, in deren Reichweite ich falle. Die Anerkennung dieser Wirklichkeit heiße Bekehrung.Joachim Gauck,der als ehemaliger Pastor den Vorsitz des Vereins „Wider das Vergessen – für Demokratie“ inne hatte, präzisiert: „Wenn wir Gott, das summum bonum, das Gute an sich nicht mehr haben – dann haben wir wenigstens die Sicherheit, das Böse an sich, das tiefste Übel zu kennen. Und dieses böte, so paradox es klinge, einen Fixpunkt, von dem aus man sich ein Koordinatensystem in die wertneutrale Moderne hinein bauen könne.“ Bei einem Interview mit derFASäußert er bereits lange vor seiner Zeit als Bundespräsident den Verdacht, dass die zentrale Rolle des Holocausts in unserem Bewusstsein damit zu tun habe, dass wir in einem für die meisten nachreligiösen Zeitalter leben würden.
Wenn man dem AutorRodney ClarkGlauben schenken darf, würde es das positive Wissen, das nicht aus Versenkung und Meditation, sondern aus dem mühsamen Geschäft des Erforschens (vor Ort), Abwägens, Vergleichens hervorgeht, Schritt um Schritt mehr geben. Da sei kein Platz für Fatalismus. Es gäbe Zukunft, Fortschritt und man könne die Welt verbessern. Dann würde auch der Einzelne zählen, du und ich und er und sie, ob Privatperson oder Politiker, Bischöfe oder Journalisten, Wirtschaftsbosse oder Intellektuelle. Sie alle hätten eines gemeinsam, sie könnten Fragen stellen, um sich auf die Suche nach der Wahrheit zu machen.
Wer aber keine Fragen mehr stellen mag, der ist noch schlimmer dran als der, welcher öffentlich (ver)zweifelt, weil nichts Jesus Christus mehr beleidigt als die Zweifel über seine Vergebung, die dem Fortschritt der Liebe und Brüderlichkeit alle Türen und Tore öffnet. PapstJohannes PaulII. beschrieb diese Kluft zwischen dem wahrhaft Suchendem und dem gleichgültig Gesättigtem in seiner Enzyklika „Fides et Ratio“, übersetzt „Glaube und Vernunft“: „(…)Der Glaubende gibt sich jedoch trotz der Beschwerlichkeit nie geschlagen. Die Kraft, um seinen Weg zur Wahrheit fortzusetzen, erhält er aus der Gewissheit, dass Gott ihn als ‚Forscher‘ erschaffen hat (vgl. Koh 1, 13), der den Auftrag hat, trotz der ständigen Bedrohungen durch den Zweifel nichts unversucht zu lassen (…) (S.26 zu ‚Erwirb dir Weisheit, erwirb dir Einsicht. ‘ [Spr 4, 5])“
Es wird mithin vielfach aus der Mitte der Gesellschaft geforscht, wie es glücklicherweise nicht wenige „säkulare“ Soziologen, Psychologen, Philosophen und Journalisten oder christliche Laienorganisationen wieSt. Egidiound katholische Ordensgemeinschaften wie die derMutter Theresaoder die internationale JugendorganisationCenacolonoch verstehen. Sie sind dort wo Nöte und Sorgen der Menschheit am größten sind, sich verzahnen und verhärten. Ihre in Bürgernähe veranlassten Erhebungen und Recherchen zeichnen in der Öffentlichkeit ein sehr realistisches Bild von der Gesellschaft. PapstBenedikt XVI.kreidet im Herbst 2006 vor den versammelten und Bericht erstattenden deutschen Bischöfen gewissermaßen den atheistischen Geist an, mit dem Intellektuelle die Gesellschaft filtrierten, wenn „hinter deren zur Schau gestellter intellektueller Überlegenheit sich doch Ratlosigkeit angesichts der letzten existentiellen Fragen verbirgt“.
Theorie und Praxis, die aus seinen verschiedenen Verlautbarungen hervorgehen, geraten aber auch bei diesem Papst unter Spannung. Im November 2011 unterzeichnet er in dem afrikanischen Benin „Africae munus“, ein Schlussdokument, welches als Ergebnis der zweiten afrikanischen Synode im Oktober 2009 deren 57 Thesen behandelt. Der bis 2009 in der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Kapstadt tätige PfarrerStefan Hipplerbemängelt in einem Artikel in derSüddeutschen Zeitungzum Ende des Pontifikats vonBenedikt XVI., dass der Papst zwar Probleme wie Armut, Flüchtlingsströme, Korruption benannte, aber im Prinzip es dabei geblieben sei. Das geistliche Philosophieren über den gerechten Menschen sei anerkennenswert, zeige aber eine mangelnde Bereitschaft, die harschen Lebensbedingungen der meisten Afrikaner mit Empathie zur Kenntnis zu nehmen. Der Mensch lebe zwar nicht von Brot allein, wie schon die Heilige Schrift sage, aber ohne Brot würden viele andere Überlegungen zum Luxus. Konkrete Lösungen, die den Menschen helfen würden, suchte man bei diesem Papst vergebens, schließt der Seelsorger.
Ebenso füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche, denn die alten Schläuche würden durch die Gärung des Weines bersten, und der Wein würde auslaufen …Die Kraft der neuen Lehre erfordert neue Methoden ihrer Verbreitung, und Christus, der dies weiß, bedient sich ihrer.
„Im Licht der grundlegenden Wahrheit des Glaubens und zugleich der Vernunft ist es im dritten Jahrtausend wieder möglich, Glaube und Wissenschaft miteinander zu verbinden“,so der Papst an anderer Stelle bei seinem Besuch der Katholischen Universität vom heiligen Herzen in Rom im November 2005. Auf dieser Grundlage, so zitiertL’Osservatore RomanoPapstBenedikt, finde die tägliche Arbeit einer Katholischen Universität statt. Und wenn der grundlegende Auftrag jeder Universität „das ständige Suchen nach Wahrheit durch Erforschen, Bewahren und Verbreiten von Wissen zum Wohl der Gesellschaft“ sei, zeichne sich eine katholische Universitätsgemeinschaft aus durch die christliche Inspiration der Einzelnen und der Gemeinschaft, durch das Licht des Glaubens, welches das Nachdenken erleuchte, durch die Treue zur christlichen Botschaft, wie sie von der Kirche vorgelegt würde, und durch die institutionalisierte Verpflichtung im Dienst des Volkes Gottes, so der Papst.
Es wäre gleicherweise lohnend nachzuspüren, welche geistigen Strömungen die Abwendung vom Altarsakrament ausgelöst bzw. zugelassen haben könnte.Die Aufmerksamkeit des Volkes wurde vom Sakrament auf den Zelebranten hin verschoben. Selbiges mit einer ausgemachten und vor dem ehrfurchtgebietenden Altarsakrament allzu ungeschickter Gestik, um nicht zuletzt auch die Person des Priesters mit samt seiner Persönlichkeit in die Schar der Gläubigen einzureihen. Eigentlich sollte der Priester am Altar überhaupt keine Persönlichkeit vorgaukeln müssen, sondern ganz den vertreten, von dem er vorgibt, berufen worden zu sein. Um gewiss alles richtig zu machen, müsste man die Platzierung des Tabernakels am Hochaltar im Rücken des Priesters während der Messfeier „versus populus“ in Zweifel ziehen, worüber sich allerdings fast keine Menschenseele mehr wundert.
Diese liturgische Umwälzung, der auch die geistige in nichts nachstand, fand wohl vorwiegend während der Kriegswirren ihren Anfang und konnte weder die Kontrolle des damaligen PapstPius XII. noch des nachfolgenden Konzils der Nachkriegsepoche in seiner Unbotmäßigkeit erreichen. Der Wille zur „Demokratisierung der Liturgie“ während und nach dem Ende des „Dritten Reiches“ in der Weise der Hinwendung zum Volk, trotz aller Einbußen für die Aufmerksamkeit auf das Zentrum, dem Allerheiligsten, speist seine moralische Deutungskraft mit dem euphorischen Ziel, sowohl geographischer als auch zeitlicher Expansion, aus einer im Gedächtnis der Gläubigen nie zuvor dagewesenen Zeit. Eine von Krieg und Ideologien durchsetzte Zeitspanne. Die Nazi-Rhetorik spukte in den Köpfen der Menschen bis hinein in die fünfziger Jahre. Dort aber, wo das Denken systematisch ausgehöhlt wird, wie sollte da das G-e-d-e-n-k-e-n an den einen höchsten Herrn ewige Früchte zeitigen können?
Es war gleichwohl eine Zeit, in der GOTT und Seine Gebote zur Nebensache degradiert wurden, in der sich der Mensch zu einer mit der vom Führer in der Rassenlehre verliehenen Größe erhob. Es musste im „Ringen der Völker und Rassen der Stärkere, der zugleich der Bessere ist, seine Überlegenheit erweisen“, so zitiert es derDozent für Neuere Geschichte an der TU-Berlin,Manfred Gailus,für dieZeit. „Rasse“, „Reich“ und „Führer“ seien aufgelockert worden durch martialische Sinnsprüche von Himmler, Rosenberg, Hess, Schirach und Göring. Ohne Kampf und Opfer würde es keine Leistung geben, soGailus, und ohne ständiges Neugebaren aus Werden und Vergehen würde das Leben nicht lebenstüchtig bleiben. Gerade dies sei das große Geheimnis und Wunder des Lebens, dass es nur durch Selbstaufopferung weitergereicht werden würde. Dies seien die „göttlichen Gesetze des Lebens“, wer sie kenne und nach ihnen leben würde, der wisse, dass die „Blutgemeinschaft des Volkes“ von ihm auch die Hingabe seines Lebens für die „Brüder“ fordern dürfe, dokumentiertGailus.
So wurde beispielsweise nicht nur das Gesetz Gottes „Du sollst nicht töten“ von Staatswegen ausgehebelt und mit Füßen getreten, sondern der „Führer“ selbst setzte sich unverhohlen als universeller Gesetzgeber gewissermaßen an die Stelle Gottes, „denn wer ein Gebot bricht, verstößt gleichermaßen gegen alle, weil er gegen den einen Herren verstößt, der das Gesetz gemacht hat“, so lesen wir in den apostolischen Briefen der Heiligen Schrift.Gailusberichtet weiter, dass die NSDAP zudem an einer „Endlösung der religiösen Frage“ gearbeitet habe, mit der Matthäus Ziegler, der später wieder in den kirchlichen Dienst der evangelischen Kirche integriert worden sei, beauftragt worden sei. Nach Zieglers eigenen Angaben sei ein Manuskript von 1200 Seiten überDie Vatikanpolitik von Bismarck bis Hitlerentstanden, welche sich mit den Grundlinien der zukünftigen nationalsozialistischen Vatikan- und Kirchenpolitik vertraut haben machen wollen. Die Vernichtung der Juden und des Judentums als die Wurzel des Christentums könnte somit erst der Anfang einer Reihe von tiefgreifend vernichtenden Maßnahmen gegen den christlichen Glauben gewesen sein. Die beiden großen christlichen Konfessionen jedenfalls waren im Auftrag Hitlers ebendies bereits im Fadenkreuz seiner Chefideologen. Die eine wurde dabei als Geisel genommen, während die Katholische Kirche systematisch in die Zange genommen wurde.
Die Politisierung des Sakralraums war ein ultimatives Begehren des Dritten Reichs und die Parodien der Demokratisierungsbewegung der Liturgie im Nachkriegsdeutschland innerhalb der katholischen Kirche ist diesem Anspruch auf europäischem Boden wohl mehr unbewusst als bewusst gerecht geworden. Hitlers Experiment, mit der Vereinnahmung der Kirchen die geistliche Hegemonie für die Zeit nach dem Krieg vorauszuplanen, ist trotz verlorenen Krieges aufgegangen und zeigt seine Früchte Jahrzehnte nach dem Kriegsende nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt in Form einer vom Hirten losgelösten Kirche. Davon kann ein Reichsführer nur träumen und der Nächste kommt bestimmt, angesichts des gewaltsam aufgebrochenen Vakuums im Sakralraum, welches einem schwarzen Loch aus dem Universum gleicht, das alles Heilige verschlingt.
Den Erfolg, welchen also die Kriegswirren der „Demokratisierungsbewegung“ in der Nachkriegsperiode der katholischen Kirche bescherte, verdankt sie mithin in der Hauptsache den geistigen Umwälzungen während des Dritten Reiches. Ihre hemmungslose Ausbreitung konnte sie fernerhin auf noch viel älteren Wurzeln der Geschichte der Kirche selbst austragen. An einem ihr symbolträchtigen Ort, nämlich dem Petersdom zu Rom, verkörpert sie das Exempel der Zelebration am Volksaltar, zu welcher der Priester gehobenen Standes nunmehr seit gut vier Jahrhunderten bei feierlichen Anlässen dem Altarsakrament den Rücken kehrt, wie zu einem Ausgeschlossenen. Kein irdischer König würde sich diese Behandlung bieten lassen, sondern er bestünde auf eine zentrale Rolle während und ergo von Anfang der Zeremonie zu seinen Füßen. Demzufolge würde der König seinem Volk es auch unmissverständlich an Integrität und Wohlwollen missen lassen, wenn es Ihm geteilten Herzens dient.
Unanfechtbar soll der Kristall eurer Seele sein! Unanfechtbar!
Wir könnten Seiner räumlichen Gegenwart ohnedies bewusster werden, wenn wir das Gedenken selbst ungeteilten Herzens begehen und gestalten würden. Indes werden von Kriegsende an ausgehend von Deutschland flächendeckend in ganz Europa, durch Restaurierungen zerstörter oder beschädigter Kirchen mehr oder minder am Vorbildcharakter des Petersdoms, Volksaltäre errichtet. Das Bauwerk der Peterskirche zu Rom und sein Volksaltar entstand bereits zwischen 1506 und 1626, zu einer Zeit in der es noch keine „Tabernakelfrömmigkeit“ gab. Denn nur für die Kommunion auf dem Sterbebett wurden konsekrierte Hostien aufbewahrt. Die bei der Messe jeweils übrig gebliebenen Hostien hatten die Geistlichen und Messdiener zu konsumieren. Das Austeilen von in einer zuvor gehaltenen Messe konsekrierten Hostien, das heute landauf, landab geschieht, war offiziell verboten. Das Messzelebrieren vor einer in der Monstranz zur Verehrung ausgestellten konsekrierten Hostie war gleichfalls verboten.
In jener Zeit ließ Julius II. Alt-Sankt-Peter von dem Baumeister des Neubaus des Petersdoms Bramante (1444–1514) ungerührt abreißen. Der sehr politische Papst war während seines Pontifikats in sämtliche Kriegswirren des christlichen Abendlandes verwickelt und zettelte selbst solche an, wenn es darum ging, die Vorherrschaft des Kirchenstaates mit dem Ziel einer Großmachtstellung auf italienischen Halbinsel auszubauen. Nur das Eintreffen von Schweizer Söldnern (heute die Schweizer Garde) unter einem seiner Kardinäle konnte den Papst zuletzt im Kampf gegen die Franzosen retten, die erst 1512 aus Italien abziehen wollten.
Julius II. forcierte auf sehr umstrittenem Wege zur Finanzierung der gigantischen Basilika den Ablasshandel derart, dass er Luthers Protest und dessen zahlreicher Anhängerschaft an sich gezogen hat. Mit dem Grundstein des neuen Petersdoms am 18. April 1506 war also nicht nur die Axt an die Wurzel der Einheit der Kirche gelegt, sondern man erkennt klar die Angleichung der Sakralraumgestaltung zugunsten eines pompösen Zeitgeistes, bei dem die Verherrlichung des verweltlichten Priesters an dem nun initiierten Volksaltar die zentrale Bedeutung eingenommen hat.
Die darauffolgende Gegenreformation der Katholiken tut sich bis heute schwer mit dem Protestantismus und umgekehrt (ver)zweifeln Protestanten an der Geschichte der Dynastie der Päpste. Die Ironie der Geschichte wollte es, dass der Erbauer des Petersdoms seine Ruhestätte nicht in seinem neu errichteten Bauwerk findet, das er hatte eigens für sein Grab errichten lassen, sondern seine Gebeine liegen heute in einer kleinen, abseits gelegenen Kirche in San Pietro in Vincoli, einem Stadtteil in Rom.
Wehe, siebenmal wehe den Toten im Geiste unter meinen Priestern, die in ihrer Lauheit, in ihrer weichlichen, jeder Tatkraft entbehrenden Trägheit des Fleisches, in ihrer Schläfrigkeit trügerischen Traumbildern nachhängen, aber ihre Gedanken nicht auf den dreieinigen Gott richten; die voller Berechnung sind, sich aber nicht bemühen, dem höheren Ziel, nämlich den Reichtum der Herzen und den Schatz Gottes zu vermehren, gerecht zu werden.Erdgebunden, engherzig und abgestumpft leben sie dahin und ziehen auch jene in ihr totes Gewässer, die ihnen nachfolgen in der Meinung, dass sie das Leben besäßen.Der Fluch Gottes komme über die Verführer meiner kleinen, geliebten Herde! Nicht jene, die durch eure Trägheit verlorengehen, ihr pflichtvergessenen Diener des Herrn, werde ich bestrafen, sondern von euch werde ich Rechenschaft fordern über jede Stunde, jeden Augenblick, jede eurer Nachlässigkeiten und ihre Folgen.
Vielmehr aus der Laune der einen Halbherzigkeit am Altar sind im Mittelalter grob begangene Nachlässigkeiten gegenüber GOTT und Seinen Belangen in Folge unverrückbar auch für die Nachwelt installiert worden, deren Züge und Ähnlichkeit ausgerechnet mit jenen im Dritten Reich eine exponentielle Entwicklung in Europa erhielten. Die Nachkriegsperiode kann die Ausuferung des fatalen Irrtums nicht aufhalten. Der Stolz des radikal Absurden, im Nichts Halt zu finden, gebärdet das Unabhängigkeitsstreben und den daraus resultierenden Gottesmord hinein bis ins Nachkriegseuropa. Er beschreibt die Basis der vielen Gründe für schwindende Gottesdienstbesucher heute und insbesondere der Jugend in ganz Europa.
Jugend lässt sich in der Konkurrenz weltlicher Angebote nur mehr für ganzheitliche Wahrnehmung heranziehen. Deren Initiative scheint dann aber grenzenlos. Mit ihren Protesten, angefangen im Jahre 2018, die nach dem Vorbild der schwedischen KlimaschutzaktivistinGreta Thunbergjeden Freitag stattfanden, würden Jugendliche zum Beispiel eine konsequentere Klimapolitik fordern, berichtet dieSZim März 2019. An einem regnerischen Freitag demonstrierten in München über 10.000 Schüler und Studenten und nach Angaben von Fridays for Future gingen in ganz Deutschland in mehr als 220 Städten junge Menschen auf die Straße, so dieSZ. Das ist beeindruckend.
Das Licht Gottes erstrahlt dort, wo man willig und eifrig darum bemüht ist, es von den Schlacken zu reinigen, die sich aus dem Wirken des Menschen ergeben: aus seinen Kontakten, Reaktionen und Enttäuschungen.Das Licht Gottes erstrahlt dort, wo der Docht in reichlich Öl des Gebetslebens und der Nächstenliebe getaucht ist.Das Licht Gottes leuchtet mit so unendlich vielen Strahlen, wie es Vollkommenheiten Gottes gibt, von denen jede einzelne im heiligmäßigen Menschen eine heldenhaft ausgeübte Tugend erweckt, wenn der Diener Gottes den Kristall seiner Seele rein bewahrt und dem qualmenden Rauch der bösen Leidenschaften zu widerstehen vermag.Unanfechtbar soll der Kristall eurer Seele sein! Unanfechtbar!Nur Gott allein hat das Recht und die Macht, diesen Kristall zu ritzen und mit dem Diamanten seins Willens seinen heiligsten Namen darin einzugraben. Dann wird dieser Name zur Zierde und lässt ein Feuer übernatürlicher Schönheiten von unendlicher Vielfalt auf diesem reinsten Quarz erstrahlen.
Aber, wenn der törichte Diener des Herrn die Selbstkontrolle und den Überblick über seine Aufgabe, die einzig und allein übernatürlicher Art ist, verliert und falsche Figuren einritzen lässt, Kratzer, die keine Gravierungen, sondern geheimnisvolle, dämonische Namenszüge von den feurigen Krallen Satans sind, dann scheint die wundersame Lampe nicht mehr schön und ungetrübt. Der Kristall zerspringt, und die Flamme erlischt unter den Scherben. Oder, wenn die Lampe nicht zerspringt, entsteht ein Gewirr unverständlicher Zeichen eindeutigen Ursprungs, in denen sich der Ruß festsetzt und sie vollends unkenntlich macht.
Der Volksaltar muss kein Nachteil für Gottes Anliegen sein, sondern kann durchaus einen Vorschuss an Teilnahmecharakter für die versammelten Gläubigen vermitteln, wie es ansatzweise seine ursprünglichen Errichter bezweckten. Denn wer am Volksaltar auf Geheimniskrämerei des Zelebranten hofft, der hofft vergebens. Jedoch sprengt ein ehrlos gehaltener Tabernakel im Sakralraum unweigerlich die Authentizität der gesamten Versammlung. Insofern läuft der Priester Gefahr, in seiner Abgewandtheit vom Tabernakel mitunter selbst zu einer illusorischen Größe heranzuwachsen. Unwillkürlich (und manchmal auch zu offensichtlich) präsentiert er sich als die Person, die das Wunder der Wandlung wirkt. Eine fatale Irreführung des Gläubigen, der noch zu wenig darüber weiß, dass Gott es ist, der alle Wunder wirkt. Hingegen würde der gezeigte Rücken des Zelebranten während der Wandlung unmissverständlich die Hinwendung zu Gott beschreiben, selbst wenn der Zelebrant nicht gewillt ist, die Einheit mit Gott zum Nonplusultra seines Berufsstandes zu erheben. Am Volksaltar hingegen spielt mit dem sichtbaren Angesicht des Zelebranten immer auch seine Persönlichkeit mit rein und eine zentrale Rolle, um folglich zur Richtschnur für eine in Szene gesetzte oder gelungene Liturgie zu werden. Das liegt nicht zwangsläufig am rhetorischen Gutdünken des Zelebranten, sondern an der Subjektivität im Auge des Betrachters. Ein Drahtseilakt, denn der eine Gläubige will die Gestik so verstehen, während der andere sie ganz anders zu deuten gewillt ist.
Die ursächliche Liturgieordnung als solche will jedoch ideale Verhältnisse schaffen und nicht in Abhängigkeit fragwürdiger Zelebrationsweisen stehen, beziehungsweise dazu das Risiko der Versuchung für persönlichen Stolz gegen 0 zu halten. Denn Stolz ist weder die angebrachte Demutsbezeugung vor Gott, der Er selbst aus seiner Gnade heraus jedes einzelne Wunder dieser Erde wirkt, noch fühlt sich die Versammlung angemessen angesprochen, dem Sendungsauftrag, mit „all seinen Kräften“ zu „Seinem Gedächtnis“ beizuwohnen. Der Herzogenrather PfarrerGuido Rodheudtmeint, dass die Wunden heilen könnten: „Der Bezug zum Heiligen ist vollkommen zerstört worden durch die Zeitumstände, und die Kirche hat den Fehler gemacht, diese Zeitumstände völlig aufzusaugen bis hin zu Kirchenbau und Liturgiereform.“ Nur langsam wachse eine Generation nach, die Kult und Kultur, Seelsorge und Gottesdienst nicht mehr als Gegensätze begreife, rezitiert ihnAlexander Kisslerim September 2008 in derFAS.
Geschichte & Gegenwart
„Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme“
Thomas Morus
Deutschland ging es materiell wieder gut und musste sich bis zum Überfall der Russen auf die Ukraine auch nicht mehr vor kriegerischen Agitatoren innerhalb oder vor den Toren seiner Grenzen fürchten. Wie könnte es da verwundern, wenn sich zur Jahrtausendwende der Widerstand gegen den Bau von Moscheen in Berlin, Frankfurt und München regt, wo doch das Bürgertum religiöses Verständnis und den Umstand leerer Gotteshäuser vorzugsweise aus seinem Bewusstsein verdrängt hat. Es ist wohl kaum noch jemand erpicht darauf, der strengen Auslegung von Religion ins Auge zu blicken, vielmehr ist es die neurotische Natur der Menschen oder der Mensch ist allzeit bereit, verderbt genug zu sein, um es darauf anzulegen, die allzeit greifbare Erlösung mit allen Mitteln vor sich her zu schieben. Selbst unter Gläubigen herrscht die eingefahrene Mentalität vor, Erlösung und Heil ohne Anstrengung oder persönliche Einbußen beschreiten zu können.
Überall würde also der Protest von Anwohnern laut. Die Grenze zwischen Bürgerbegehren und rechtspopulistischen oder radikalen Bewegungen sei fließend, meintArmin Laschet. Das Problem sei ja nicht, dass die Muslime uns überrennen und die Christen massenhaft konvertieren, hält der Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration in Nordrhein-Westfalen,Laschet, im September 2008 in derFASdagegen, sondern dass wir unsere eigene Überzeugung nicht mehr vortragen würden. Natürlich sei es auch nicht schön, wenn die Bistümer Kirchen verkauften und gleichzeitig Moscheen gebaut würden. Das sei aber keine Frage an Muslime, sondern an uns selbst, untermauert der Minister.
Der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, KardinalKaspar, attestiert im Dezember 2006 in einem Gespräch mit derFAS, dass es nach einer neueren Aufklärungswelle, die nach 1968 eingesetzt habe, auch in dieser heutigen Zeit immer noch den Trend gäbe an einer Spiritualität, die freilich sehr emotional sei, die kein klares Gottesbild habe, sondern mehr der Selbsterfüllung und der eigenen Identitätssuche diene. Das sei die Form einer gewissen Bürgerlichkeit. Religion habe aber nur einen Sinn, so der Kardinal, wenn sie ein Gegenüber habe. Nur der lebendige Gott könne wirklich helfen. Und das stelle vor die Frage, welche heute vielen unbequem erscheine: die Frage nach der Wahrheit. Es fehle heute oft an der Entschiedenheit für die Wahrheit.
Für den abendländischen Glauben ist Christus die einzige Leitfigur, welcher der Menschheit vorausging, um im liebenden Gehorsam vor Seinem himmlischen Vater als erster Mensch mit der Auferstehung den eigenen Tod zu bezwingen. Christus hat all jenen das ewige Leben verhießen, die an ihn glauben würden und die Gesetze des Schöpfers halten wollten, welche dem Menschen durch Moses vermittelt wurden. Christus sprach von nichts anderem als von der Art und Weise, das Leben zu erlangen und zu bewahren.
Das unveränderliche Gesetz muss in die Tat umgesetzt werden, die Sünden beweint, Buße muss getan und die Seelen geöffnet werden für das Wort,um zum wahren Leben zu kommen, zu Gott. Der Tod wird dann nicht das „Ende“, sondern der Anfang sein.
Fürderhin fragt sich an anderer Stelle der ehemalige Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, wie man als Theologe – das heißt als Wissenschaftler, der verantwortet von Gott reden soll – von der gegenwärtigen Situation und ihren Nöten sprechen kann, ohne das zu nennen, wasJohann Baptist Metzschon vor Jahrzehnten die Gotteskrise genannt habe. Als Antwort auf das Memorandum deutscher Theologen appelliert KardinalKasperam 11. Februar 2011 in derFAZeindringlich an die Unterzeichner, die deutschsprachigen katholischen Theologinnen und Theologen, sich ernsthaft zu fragen, ob die Kirchenverfassung heute eine existenzielle Frage der Menschen sei. Er kommt auf das theologische Grundproblem zu sprechen, das er im Memorandum mit dem Titel „Ein notwendiger Aufbruch“ selbst vermisst, und hält ein, dass wenn seit 1950 der Anteil der regelmäßigen Kirchgänger im Schnitt um mehr als zwei Drittel zurückgegangen sei, das dann ein Vorgang sei, der längst aufrütteln hätte müssen und den wirklichen Grund aufzeige, was man den Priestermangel nenne.Kaspersetzt sich diesbezüglich für die radikale Erneuerung des Glaubens ein, die an dieser „radix“, an dieser Wurzel ansetze, statt oberflächlich an der Stellschraube Zölibat zu drehen. Das Beispiel anderer christlicher Konfessionen, die die in Erwartung gestellten Veränderungen bereits umgesetzt hätten, zeige, dass sie damit nicht besser fahren würden und sogar in einer noch viel tieferen Krise stecken beziehungsweise teilweise sogar auf deren Spaltung zuliefen.
PapstBenediktinSacramentum caritatisim KapitelIV.„Eucharistie und Priesterweihe“ – Eucharistie und priesterlicher Zölibat 24. […] In dieser Wahl des Priesters kommen nämlich in ganz eigener Weise seine Hingabe, die ihn Christus gleichgestaltet, und seine Selbstaufopferung ausschließlich für das Reich Gottes zum Ausdruck. (75) Die Tatsache, dass Christus, der ewige Hohepriester, selber seine Sendung bis zum Kreuzesopfer im Stand der Jungfräulichkeit gelebt hat, bietet einen sicheren Anhaltspunkt, um den Sinn der Tradition der lateinischen Kirche in dieser Sache zu erfassen.[…]