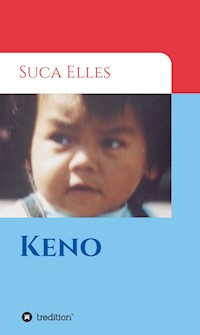6,80 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau, die sich Makuahine nennt, setzt ihre drei kleinen Kinder aus und verschwindet. An anderer Stelle taucht sie erneut auf, mit anderem Namen, einer neuen Vita. Ihre Ziele sind Freiheit, Glück, Wohlstand. Dafür nimmt sie in Kauf, sich in Kneipen und Bars zu verdingen, sich zu prostituieren. Ganz langsam scheint sich das Blatt zu wenden, als sie Bertram trifft. Aber diese Phase endet mit seinem Tod. In einem Amateurtheater trifft sie zwei Männer, die ihren Lebensweg bis nach Indien begleiten. Sie schenkt einem Jungen das Leben und landet schließlich in Berlin. Dort findet sie zufällig Hinweise auf eine ihrer Töchter, aber erst spät, zu spät, macht sie von diesem Wissen Gebrauch. Die Leser von "Makuahines Töchter" finden in dem vorliegenden Buch Antworten auf die Fragen: Wer ist Makuahine und was geschieht mit ihr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
www.tredition.de
Toda gran falta es un acto de egoísmo.
Concepción Areal (1820-1893)
(Jeder große Fehler ist ein Akt des Egoismus)
Suca Elles
Makuahine
www.tredition.de
© 2013 Suca Elles
Umschlaggestaltung, Illustration: Suca Elles
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-6864-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Prolog
(1951)
Die junge Frau hatte die drei kleinen Mädchen auf die Bank gesetzt und war gegangen. Jedoch nur bis zum Waldrand. Dort stand sie hinter einem Baum und beobachtete, wie die Kinder einschliefen. Sie nahm den mit einem Schlafmittel versetzten Zucker aus ihrem Beutel und schüttete ihn auf den Waldweg. Die leere Flasche, in der sie die Milch transportiert hatte, behielt sie. Dann wandte sie sich um und ging mit schnellen Schritten tiefer in den Wald hinein.
Kapitel 1
Der Pfarrer, ein wohlbeleibter älterer Mann, trat neben die junge Frau, die am Grab stand und fragte:
„Kennen Sie die Verstorbene?“
Die junge Frau antwortete ohne aufzusehen: „Sie war meine Tante.“
Der Pfarrer blickte erstaunt: „Ach, ich wusste gar nicht, dass sie noch Verwandte hatte. Mir sagte sie, sie sei ganz allein auf der Welt.“ Dann besann er sich und sagte: „Es tut mir leid.“
Die junge Frau nickte: „Schon gut. Sie war meine letzte Hoffnung. Nun weiß ich nicht mehr, wohin ich gehen soll.“ Sie sagte dies mit tonloser Stimme, die zu müde schien, um noch verzweifelt zu klingen.
Der Pfarrer musterte die junge Frau. Sie war sehr dünn, hatte blonde Haare und trug ein zerknittertes Kleid, auf dem sich ein paar Flecken befanden. Strümpfe hatte sie nicht an. Ihre Schuhe waren alt und abgetragen. In der Hand trug sie ein Bündel und eine Baumwolltasche. Ihr Gesicht war blass, jedoch nicht von jener krankhaften Blässe, die von Blutarmut oder chronischer Unterernährung herrührte. Es war eine mehr oberflächliche Blässe, wie nach Strapazen oder Schlafmangel.
„Wie heißen Sie, mein Kind?“
Sie deutete auf den Grabstein, auf dem „Berta Grote, geb. Speiermann“ stand. „Speiermann“ sagte sie, „Rosemarie Speiermann. Tante Berta war die Schwester meines Vaters. Die beiden waren zerstritten. Mein Vater fand ihren Ehemann unpassend.“
„Ja“ sagte der Pfarrer „Alfons Grote war ein Metzger, grob und ungeschlacht. Berta hatte es zu seinen Lebzeiten nicht leicht. Und danach“ fügte er hinzu „auch nicht.“
Die junge Frau, die sich Rosemarie Speiermann nannte, nickte nur.
„Woher kommen Sie?“ fragte der Pfarrer weiter.
„Aus Franken. Meine Eltern sind bei einem Bombenangriff in Nürnberg im Jahr 44 ums Leben gekommen. Danach habe ich bei einer Schwester meiner Mutter in Weierhof bei Fürth gewohnt. Die ist vor ein paar Wochen ganz plötzlich gestorben. Blutvergiftung hat der Arzt gesagt. Ich musste aus dem Häuschen, das zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehört, ausziehen. Die Besitzer benötigen es für das neue Schaffnerehepaar.“
„Schaffner?“ fragte der Pfarrer.
„Das ist ein Ausdruck für Knechte oder Mägde, die auf einem Hof arbeiten.“
„Ach so“ sagte der Pfarrer nur. „Und was geschah dann?“
„Ich bin hierhergekommen, um meine Tante Berta zu suchen, in der Hoffnung, ich könne bei ihr unterkommen.“ Ein Schulterzucken. „Aber die ist ja auch verstorben.“
„Was werden Sie jetzt tun?“ fragte der Pfarrer. Wieder ein Schulterzucken.
„Kommen Sie mit“ sagte er bestimmt. „Wir werden einmal sehen, ob wir für Ihr Problem eine Lösung finden.“
Als sie an der kleinen Kirche ankamen sagte der Pfarrer: „Treten Sie ein und warten Sie hier auf mich, es dauert nicht lange.“
Damit verschwand er aus ihrem Gesichtsfeld.
Sie ließ sich müde auf eine der Bänke sinken. „Gar nicht schlecht“, dachte sie. „Vielleicht gibt es etwas zu essen und ein Bad.“ Sie fühlte sich schmutzig und dachte an die große gusseiserne Badewanne in ihrem Elternhaus, in der sie als Kind gebadet wurde. Sie hatte in einem Raum mit schwarz-weißem Boden gestanden und die Füße der Wanne waren Löwenköpfe gewesen. Mein Gott, wie lange war das her? Ihre Kinderfrau, Frieda, hatte immer gesungen, während sie sie gewaschen und anschließend trocken gerubbelt hatte. Und dann rieb Frieda immer etwas in ihre Haare, damit das Auskämmen nicht ziepte. Das hatte nach frischem Gras gerochen.
Als eine Hand sie an der Schulter berührte, zuckte sie zusammen. Sie war eingenickt. Der Pfarrer stand vor ihr und sagte: „Kommen Sie mit mir, mein Kind, jetzt gibt es erst einmal eine heiße Suppe und dann ein Bad. Danach sehen wir weiter.“
In der Küche werkelte eine dickliche ältere Frau.
„Haben wir noch Suppe von heute Mittag“ fragte der Pfarrer. Widerwillig nickte sie und beäugte Rosemarie mit Misstrauen. Dann schob sie einen Topf in die Mitte des Herdes, rührte ein paar Mal darin herum und füllte zwei große Kellen in einen Teller. Sie stellte den Teller mit Suppe nicht eben freundlich auf den Tisch. Rosemarie war das egal. Die Suppe war voller Gemüse und auch einige Speckstücke schwammen darin herum. Dazu gab es ein kräftiges Brot. Rosemarie aß beides heißhungrig und schob, als sie fertig war, den Teller mit einem wohligen Seufzen zurück.
Die Haushälterin, vom Pfarrer Lina genannt, sah Rosemarie auffordernd an. So stand sie auf und nahm den Teller und den Löffel und stellte beides auf das Brett neben einem Steinbecken. Sie suchte nach einem Lappen aber Lina ergriff ihren Arm und sagte:
„Es wird Zeit, dass Sie sich ordentlich waschen. Im Keller ist ein Zuber, auf dem Herd ist der Wasserkessel. Wasser gibt’s draußen an der Pumpe.“ Mit diesen Worten ging sie voraus in den Keller, der offenbar auch als Waschkeller diente. Sie zeigte Rosemarie die Gerätschaften, steckte das Holz im Ofen in Brand, legte ein paar Kohlen nach und warf Rosemarie wieder einen misstrauischen Blick zu.
„Sie sind also die Nichte von Berta?“ Es war mehr eine Feststellung denn eine Frage.
Rosemarie nickte.
„Ich habe Sie hier aber noch nie gesehen“ fuhr Lina fort und Rosemarie beeilte sich zu erklären, dass sie auch noch nie hier gewesen sei, ja ihre Tante zu Lebzeiten nicht gekannt habe.
Lina verließ den Raum und kam kurze Zeit später mit einem fadenscheinigen Handtuch und einem Stück Seife zurück. Sie legte beides neben den Zuber und verschwand wortlos.
Nachdem Makuahine, die sich jetzt Rosemarie nannte, sich und ihre Kleidung gewaschen hatte, Letztere zum Trocknen über den Herd gehängt und die Kleider, die sie in ihrem Bündel getragen hatte, angezogen hatte, reinigte sie die Wanne, hängte das Handtuch ebenfalls zum Trocknen über den Herd und ging zurück zur Küche, wo der Pfarrer vor einer Tasse Malzkaffee saß. Er schenkte auch ihre eine Tasse ein und fragte: „Was werden Sie jetzt tun, nachdem sie hier keine Angehörigen mehr haben?“
„Ich werde versuchen, eine Arbeit zu finden.“ Der Pfarrer nickte. „An welche Art Arbeit haben Sie denn gedacht?“ fragte er, und Rosemarie sagte:
„Ich nehme alles, was ich bekommen kann.“
„Haben Sie denn in irgendeinem Beruf praktische Erfahrung sammeln können?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Ich mache Ihnen Ungelegenheiten, das tut mir leid, aber wäre es vielleicht möglich, dass ich heute Nacht hier bleibe. Morgen früh mache ich mich dann auf den Weg.“
Der Pfarrer nickte, was ihm einen missbilligenden Blick von Lina eintrug. „Es gibt hier einen Verschlag, in dem steht ein Bett mit einem Strohsack. Wenn Sie damit vorlieb nehmen, können Sie über Nacht bleiben.“ Rosemarie nickte stumm.
Später lag Rosemarie auf ihrem Strohsack, angetan mit ihrer alten Hose und einem Kittel. Sie war so müde, dass sie sofort einschlief.
Als sie erwachte, war es noch stockdunkel. Sie versuchte noch einmal einzuschlafen, aber es gelang ihr nicht. Die Gedanken in ihrem Kopf jagten einander, und so lag sie wach, starrte in die Dunkelheit und überlegte, welches ihre nächsten Schritte sein würden.
Das mit der „Tante“ hatte Gott sei Dank geklappt. Sie hatte gezielt nach einer Kirche Ausschau gehalten und war dabei auf den Friedhof gestoßen. Auf dem einfachen Holzkreuz hatte sie die Angaben gefunden, die sie brauchte, und das Grab selbst war unscheinbar und ungepflegt, was vermuten ließ, dass hier keine Angehörigen der Verstorbenen wohnen. Also hatte sie sich ihre kleine Geschichte zurecht gelegt. In ein paar Stunden wäre sie wieder unterwegs und dann konnte es ihr gleich sein, ob man hinter ihren Schwindel kam oder nicht.
Aber wohin sollte sie von hier aus gehen? Wie sollte sie an Geld kommen? Und sie brauchte Papiere. Vielleicht wäre der Pfarrer auch hier behilflich. Versuchen konnte sie es immerhin. Hatte sie erst einmal Papiere, konnte sie sich eine Arbeit suchen. Irgendeine. Sie war nicht wählerisch. Und sie brauchte ein Dach über dem Kopf. Und dazu brauchte sie Geld. Sie seufzte. Wenn alle Stricke reißen, dachte sie, kann ich immer noch nach Hause gehen. Aber der Gedanke war nicht verlockend. Nein, das würde sie wirklich nur als allerletzte Möglichkeit in Erwägung ziehen. Sie wollte frei sein, ein neues Leben beginnen. Jetzt war sie schon so weit gegangen, ein Zurück durfte es jetzt nicht mehr geben.
Ihre Gedanken schweiften ab. Sie sah sich als kleines Mädchen mit anderen Kindern, die alle braune Haut, schwarze Haare und schräge Augen hatten, auf dem Dorfplatz spielen oder im flachen Wasser, das warm und salzig war, plantschen. Sie sah sich mit ihrem Vater und den Trägern durch den Wald, den man hier Dschungel nannte, gehen und nach bestimmten Pflanzen Ausschau halten. Das war eine glückliche Zeit gewesen.
Ihr Vater arbeitete als Botaniker für eine holländische Firma. Nur ein paar Jahre nach Abschluss seines Studiums war er nach Sumatra geschickt worden. Mit anderen Forschern arbeitete er zunächst an einer Ertragssteigerung für Kautschuk in der Hauptstadt, später ging er dann in den Süden, um dort eine eigene Versuchsreihe aufzubauen. Er war schon fast ein Jahr auf der Insel, als er zum ersten Mal Magdalena erblickte. Sie war die einzige Tochter der Missionarsfamilie, die am Rande von Palembang in einer Missionsstation lebte und versuchte, den Eingeborenen den christlichen Glauben nahe zu bringen. Er war von ihrem Anblick entzückt, was nicht verwundert, denn die Auswahl an jungen heiratsfähigen Europäerinnen war eher beschränkt. Ein gutes Jahr später heirateten sie, und fast auf den Tag genau neun Monate später kam Rosemarie, die auf den Namen Heidrun von Lemberg getauft wurde, zur Welt.
Bevor sie zur Schule gehen musste, kehrte die Familie nach Deutschland zurück und siedelte sich im Geburtsort ihres Vaters, in Augsburg, an. Und von da an war alles anders. Sie musste jetzt immer darauf achten, schicklich angezogen zu sein. Das Wetter war ihr verhasst, ebenso die ungewohnten Strümpfe, Schuhe, Jacken, Mäntel und Handschuhe. Außerdem spielte sich das Leben mehr im Haus als draußen ab. Ihr Vater arbeitete wieder in einer Firma, ging morgens aus dem Haus und kam abends manchmal sehr spät nach Hause. Die Mutter, auf Sumatra von getauften Mädchen, die sich um Haus, Küche und Wäsche kümmerten, verwöhnt, musste nun diese Arbeit selbst verrichten. Lediglich eine Kinderfrau, die sie, die kleine Wilde im Zaum halten musste, konnten sich die Eltern leisten. Die kleine Heidrun bekam oft Schelte. Alles, was sie bisher geliebt hatte, war ihr verboten. Sie reagierte auf diese Verbote mit Verstocktheit. Auch die Eltern, die sich bisher gut verstanden hatten, zankten sich jetzt des Öfteren. Gründe gab es genug. Vom nicht ausreichenden Gehalt des Vaters bis zu den vielen Stunden, die er von zu Hause abwesend war. Heidrun sehnte sich nach Sumatra zurück. Sie hasste alles und jeden mit Ausnahme ihres Vaters und Friedas, die ihr näher stand als ihre Mutter.
Rosemarie stellte fest, dass die Nacht der Morgendämmerung zu weichen begann und begab sich in die Waschküche, um ihre Kleider zu holen. Schnell zog sie sich an, schüttelte den Strohsack auf, packte ihre Sachen wieder zu einem Bündel zusammen und trat in die Küche. Lina stand am Herd und setzte einen Kessel mit Wasser für den Morgenkaffee auf.
„Ich gehe jetzt“ sagte Rosemarie. „Haben Sie vielen Dank dafür, dass ich hier bleiben durfte. Gott segne Sie“ setzte sie noch hinzu und wandte sich zur Tür.
„Nun bleiben sie halt, in Gottes Namen, und nehmen das Morgenmahl mit uns. So viel Zeit werden Sie doch sicher haben“ entgegnete Lina ein wenig mürrisch.
„Wenn es nicht zu viele Umstände macht“ sagte Rosemarie leise und begann Teller und Tassen auf den Tisch zu stellen.
Der Pfarrer begrüßte sie mit einem warmen Lächeln, als er die Küche betrat, und erkundigte sich, ob sie gut geschlafen habe. Sie nickte und biss herzhaft in die dicke Scheibe Brot, die mit Schweineschmalz bestrichen war.
„In der Stadt gibt es ein paar Fabriken“ sagte der Pfarrer und riss sie aus ihren Gedanken, „und dann haben wir noch die Zechen, aber die beschäftigen keine Frauen“ schloss er. „Fahren sie einfach in die Nordstadt und fragen sie dort nach“ schloss er lahm.
Sie bedankte sich noch einmal, verabschiedete sich und wandte sich zum Gehen. Er trat mit ihr hinaus auf den Kirchplatz und drückte ihr zum Abschied eine Münze in die Hand. „Für den Fahrschein“ sagte er, bevor er sich umwandte und zurück ins Haus ging.
Kapitel 2
Der Bus hielt zum wiederholten Male. Sie hatte aufgehört, die Haltestellen zu zählen. Direkt neben der Haltestelle befand sich ein großes Werkstor und auf der anderen Seite der Straße sah sie das Schild einer Gaststätte. „Pütt-Eck“ stand in verblichenen Buchstaben darauf. Spontan stand sie auf und verließ den Omnibus. Sie sah sich nach allen Seiten um. Ansprechend war die Gegend nicht, soviel stand fest. Das Tor war der Eingang zum Zechengelände, wie sie jetzt feststellte, und die langen Mauern auf beiden Seiten grenzten das Gelände ein. Am hinteren Ende der Mauer erkannte sie einen Kiosk, sonst war diese Seite der Straße kahl.
Gegenüber, neben der Gaststätte, befanden sich ein Tante-Emma-Laden, eine Wäscherei, ein Schuster und eine Reparaturwerkstatt für Kleinkrafträder, Fahrräder, Radios und anderes. Sie überquerte die Straße und betrat die Gaststätte. Es waren kaum Gäste da, und hinter der Theke stand ein kräftiger Mann in mittleren Jahren und trocknete Gläser mit einem nicht ganz sauberen Handtuch.
Der Raum war verraucht aber warm, und aus der Küche drang Essensgeruch, der ihr das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ.
Beherzt trat sie zur Theke und sagte:
„Ich suche Arbeit.“
Der Wirt musterte sie und fragte zurück:
„Wat für Arbeit suchse denn?“
Sie zuckte mit den Schultern. „Alles, was nicht gegen das Gesetz verstößt.“
Einer der Gäste, die am Tisch nahe der Theke saßen, hob den Kopf und sagte:
„Sei man bloß vorsichtig, watte sachs. Der Kuno is ein schlimmer Finger.“ Das gutmütige Lachen, das er hinterherschickte, nahm seinen Worten die Bedrohung.
Kuno ging nicht auf das Geplänkel ein. Er zog die Stirn in Falten und sagte:
„Setz dich hin und warte, ich bin gleich wieder da.“ Dann verschwand er durch die Tür seitlich der Theke, die, den Geräuschen und Gerüchen nach zu urteilen, in die Küche führte.
Während sie wartete, entspann sich in der Küche ein kurzer Wortwechsel zwischen Kuno und seiner Frau Berta. Schließlich einigten sie sich darauf, dass man eine Hilfe für die Wäsche, zum Putzen der Kneipe und zum Bedienen gut gebrauchen könnte. Berta wollte weiterhin ihre Kinder selbst versorgen und das Kochen wie bisher übernehmen. Wenn sie die zusätzlichen Arbeiten künftig nicht mehr würde verrichten müssen, könnte sie außer Buletten auch noch Mettbrötchen, Suppe oder einen strammen Max anbieten. Das würde das Geschäft beleben.
Als Kuno wieder den Gastraum betrat nickte er.
„Hab Arbeit für dich“ sagte er, „wie heißte und wo wohnste denn?“
Sie schüttelte den Kopf: „Bisher noch nirgendwo. Bin gerade erst angekommen, und ich heiße“….Sie zögerte kurz bevor sie sagte „Angelika.“
„Angelika und wie weiter?“
„Ostrowski“.
Kuno verkniff sich die Frage nach dem Woher, dazu war später noch Zeit.
„Auf dem Söller gibt’s nen Raum, da kannste schlafen. Musst nur auf dem Dachboden bißken Ordnung schaffen und neue Leinen für die Wäsche aufhängen, weil eigentlich ist das, wo de schlafen kannst, unser Trockenraum gewesen.“
Die Küchentür öffnete sich und Berta sah durch die Tür. Sie stellte eine Platte mit Buletten auf die Anrichte und winkte Makuahine, die jetzt Angelika hieß zu, ihr zu folgen. In der Küche wies sie auf eine Bank, stellte einen Teller mit 2 Buletten und einem Kanten Brot auf den Tisch, dazu eine Tasse mit Malzkaffee und sagte:
„Iss und trink erst einmal, du siehst aus, als könntest du es brauchen.“
Angelika nahm das Angebot dankbar an, während Berta sie nach ihrer Herkunft ausfragte. Angelika hatte lange nachgedacht, welche Geschichte sie zu der ihren machen sollte, und so erzählte sie jetzt, dass sie ein Flüchtlingskind aus dem Osten sei, bei einer alten Verwandten in Bayern bis zu deren Tod untergekommen war und hier im Ruhrgebiet vergeblich nach weiteren Verwandten gesucht habe. Nun sei sie heimatlos und allein und müsse dringend eine Arbeit und eine Unterkunft haben.
Ein wenig misstrauisch fragte Berta: „Du wirst doch nicht etwa gesucht?“
Angelika sah sie verständnislos an.
„Vonne Polizei mein ich“ ergänzte Berta und Angelika beeilte sich zu verneinen.
Berta deutete auf das Bündel an ihrer Seite: „Is dat allet, watte has?“ Ein Nicken war die Antwort.
Sie räumte das Geschirr vom Tisch ab und begann es abzuspülen, aber Berta wehrte ab. „Du mach man oben fertig und wennse dat has, kannse mitte Wäsche anfangen.“
Damit waren die Mittagspause und die Fragestunde zu Ende.
Später am Nachmittag kam ein kleiner dicker Mann und nagelte an dem alten Bett so lange herum, bis es die Drahtlauflage und den Strohsack trug und ging dann wortlos wieder. Berta brachte Bettzeug, das schon bessere Tage gesehen hatte, aber Angelika war das egal. Sie hatte erst einmal einen Platz, wo sie unterkommen und eine Arbeitsstelle, wo sie Geld verdienen konnte.
Zwei Tage später, sie wusch gerade wie jeden Tag die Wäsche, brachte Berta ihr ein paar Kleidungsstücke. „Die sin vonne Johanna“ sagte sie „hier direkt ausse Nachbarschaft. Is im Wochenbett zusammen mit dat Kind gestorben. Musse verleich wat abnähen, aber sin noch gut, die Brocken.“
Spät am Abend, wenn Angelika die Kneipe geputzt hatte, suchte sie ihre Dachkammer auf und überlegte, wie sie an gültige Papiere kommen konnte. So lange sie hier war, fragte niemand mehr. Aber sie war sich sicher, dass sie hier nicht ewig bleiben wollte. Vielleicht bis zum Frühjahr. Man würde sehen.
Nachdem Angelika etwa 4 Wochen bei Kuno und Berta gewaschen und geputzt hatte, zeigte ihr Kuno, wie man Bier zapfte und erklärte ihr, was die einzelnen Bestellungen bedeuteten. Die Kunden waren ausschließlich Männer, die „auffe Zeche am malochen sind“, wie er ihr erklärte, und die Wünsche waren einfach: Bier, Schnaps, Mettbrötchen oder eines der 5 Gerichte, die auf der neuerdings vorhandenen Speisekarte standen. Manchmal kamen die Kumpels auch bevor sie einfuhren und frühstückten mit Malzkaffee und Spiegeleiern auf Brot.
Kuno vergewisserte sich, dass Angelika alles richtig machte und sagte ihr, sie solle sich ihre Arbeit so einteilen, dass sie nach Schichtende um 2 Uhr nachmittags und um 10 Uhr abends jeweils in der Kneipe mithelfen könne. Es wurde angeschrieben und die Rechnung an den Zahltagen beglichen.
Angelika mochte diese Arbeit. Die Männer waren rau aber ehrlich. Sie verschwendeten keine Zeit mit falschen Komplimenten und hatten für ein gut gezapftes Bier höchstens ein anerkennendes Nicken. Manche sprachen von ihren Familien und andere erzählten ihr von der Arbeit vor Kohle, wenn mal nicht allzu viel zu tun war. Sie hörte zu, nickte, lächelte, aber enthielt sich jeden Kommentars. Für die Männer war die Arbeit ihr Leben, und die Kneipe war für viele der Unverheirateten ein Zuhause. Die Atmosphäre war fast familiär zu nennen, und Angelika bemerkte nach einiger Zeit, dass auch sie dazu gehörte. Fehlte sie zu den üblichen Zeiten im Schankraum, wurde nach ihr gefragt. So verging der Winter. Die Tage wurden länger, die Temperaturen nicht mehr ganz so eisig wie in den letzten Wochen. Sie hatte abends immer mehrere Steine, die sie auf der Herdplatte oder im Backofen angewärmt hatte, in ein altes Handtuch gewickelt und mit in ihr Bett genommen. Bald würde dies nicht mehr nötig sein, so hoffte sie. Wegen ihrer schadhaften Schuhe war sie schon seit Wochen nicht mehr nach draußen gegangen, vom Gang zum Abfallhaufen einmal abgesehen. Kuno hatte gefragt, ob sie ihre freie Zeit nicht zu Besuchen oder Besorgungen verwenden wolle, aber sie hatte mit Hinweis auf ihr Schuhwerk abgelehnt. Außerdem benötigte sie nichts. Sie bekam ihr Essen im Haus, am Waschzuber lag Seife und zu Weihnachten hatte sie von Berta Shampoo und ein paar gebrauchte Lockenwickler bekommen, so dass sie ihre Haare pflegen konnte. Außerdem hatte Berta ihr Nähzeug besorgt, mit dem sie nach und nach Johannas Garderobe für sich geändert hatte. Leider war kein warmer Mantel dabei gewesen, ein weiterer Grund für Angelika, das Haus nicht zu verlassen.
An den Zahltagen standen häufig die Ehefrauen mit oder ohne Kinder am Werkstor und erwarteten ihre Männer. Sie nahmen die Lohntüten in Empfang und kamen auf ein Bier mit in die Kneipe. Dann gingen sie mit dem Großteil des Lohns nach Hause und überließen die Männer ihrem Skat- oder Doppelkopfspiel. Es gab darunter auch einige, die ihre Frauen beschimpften, wenn sie am Tor standen, die nicht willens waren, ihren Lohn abzugeben. Auch seien einige von den Männern ihren Frauen gegenüber schon handgreiflich geworden, erfuhr Angelika von Berta. Bei den anderen Kumpeln waren diese Männer aber nicht gut gelitten. Ein paar Runden Skat zu spielen, ein paar Bier zu trinken, dazu den einen oder anderen Schnaps, war eine Sache, die Familie nicht ausreichend zu versorgen, Frau und Kinder zu schlagen, eine andere. Einmal, als sich zwei verschwägerte Kumpel an der Theke trafen, von denen der eine zur Gewalttätigkeit neigte, und nachdem ein verbaler Austausch von Unfreundlichkeiten stattgefunden hatte, gingen die beiden vor die Tür und prügelten aufeinander ein. Der Schläger hatte schon ein paar Schnäpse auf, was seine Gewaltbereitschaft zwar erhöhte, seiner Reaktion aber nicht zuträglich war. Schließlich landete sein Kontrahent einen Treffer auf den Punkt. Der Schläger ging zu Boden. Als er wieder aufstehen konnte, sagte sein Schwager: „Wenn meine Schwester noch einmal mit blauen Augen rumläuft, schlag ich dich tot, merk dir das.“ Danach gingen beide wieder in die Kneipe, setzten sich so weit wie möglich auseinander und tranken noch ein Bier, bevor sie nach Hause gingen.
Kapitel 3
Es war kurz nach Ostern im Jahr 1953. Die Tage waren jetzt schon wärmer und wilde Krokusse blühten in den Vorgärten der Siedlung. Lex, ein junger Mann, der über Tage auf der Zeche arbeitete, hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, jeden Freitag ins “Pütt-Eck“ zu kommen. An diesem Freitag stellte er sich nicht wie sonst an die Theke, sondern setzte sich an einen Tisch. Als Angelika ihm sein Bier und die übliche Bulette brachte sagte er: „Wenn du mal einen Augenblick Zeit hast, würde ich gern mit dir reden.“ Sie nickte und wies zur Theke.
„Wird aber noch eine Stunde dauern, bis die ersten Kumpels gehen.“
Lex nickte und vertiefte sich in die Zeitung, die er mitgebracht hatte.
Es dauerte fast zwei Stunden, bis ein wenig Ruhe einkehrte. Angelika nahm eine Zigarette und ein kleines Glas Bier und setzte sich zu Lex.
„Also, was willst du mir sagen?“ fragte sie. Er sah sie an und sagte dann ein wenig unbeholfen:
„Ja weißt du, ich arbeite manchmal auch in einer Kneipe – eigentlich keine Kneipe, mehr eine Bar. Dort ist es gemütlicher als hier, und die Gäste sind auch aus einer anderen Schicht. Keine Arbeiter, mehr die Sorte, die im weißen Hemd arbeiten geht. Und ich habe gehört, dass die eine Thekenbedienung suchen. Vielleicht solltest du mal vorbeischauen. Ich finde, der Laden dort würde besser zu dir passen als die Malocher-Kneipe hier. Und der Verdienst ist allemal besser. Kommst du?“