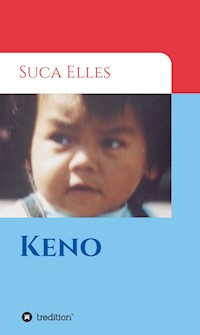6,80 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei kleine Mädchen werden auf einer Parkbank ausgesetzt. Die blonde Renate wird von einer Frau geraubt, die ihr eigenes Kind verloren hat. Leonie, das älteste Mädchen, kommt in ein Waisenhaus und danach in eine Pflegefamilie, Elena, das Baby, kommt zu Adoptiv-Eltern in die Schweiz. Auf ihrem Lebensweg, haben die Mädchen Abenteuer zu bestehen, erleben Liebe, Enttäuschungen und Trauer. Auf der Suche nach ihren Wurzeln taucht immer wieder das Wort "Makuahine" auf. Wird es ihnen helfen, einander zu finden und etwas über ihre Herkunft zu erfahren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Suca Elles
Makuahines Töchter
www.tredition.de
© 2012 Suca Elles
Umschlaggestaltung, Illustration: Suca Elles
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Printed in Germany
ISBN: 978-3-8472-3515-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alles fließt.
Du steigst nicht zweimal in denselben Fluss
Heraklit
Prolog
(1951)
Sie stand am nahen Brunnen, befeuchtete einen Lappen und ging zurück zur Bank, auf der drei Kinder saßen. Sie reinigte deren Gesichter und Finger, gab den beiden größeren Mädchen Brötchen in die nunmehr sauberen Hände, setzte sich das kleinste Kind auf den Schoß und tunkte kleine Brötchenstücke in eine Schale mit Milch. Nachdem sie so ein halbes Brötchen verfüttert hatte, gab sie noch etwas Zucker in die Milch und ließ die beiden anderen Kinder die Schale leer trinken. Dann legte sie das kleinste Kind, das etwa ein halbes Jahr alt war, dem ältesten Mädchen in die Arme und befahl ihmr, es gut fest zu halten. Sie packte die Schale und die Tüte mit Zucker in einen Baumwollbeutel, ebenso das feuchte Tuch, ging um den Brunnen herum und war den Blicken der Kinder entzogen. Nicht lange danach, schliefen die drei Kleinen, die beiden größeren Mädchen mit angezogenen Beinen auf der Bank sitzend, das kleinste Kind quer über dem Schoß.
Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als sich der Bank eine junge Frau näherte. Verstohlen sah sie sich nach allen Seiten um und schien zufrieden, mit dem was sie sah. Auf der nahen Straße hörte man dann und wann ein Auto vorbeifahren, sehen konnte man es von hier aus nicht, und Menschen waren ebenfalls nirgendwo zu sehen. Schnell trat sie zur Bank, schob das kleinste Kind ein wenig zur Seite und hob das blonde Mädchen hoch. Das Kind reagierte nicht, und besorgt legte sie eine Hand auf den Oberkörper des Mädchens. Als sie unter ihrer Handfläche das kleine Herz schwach aber regelmäßig schlagen spürte, legte sie den Kopf des Kindes an ihre Schulter und ging davon.
Zwei Stunden später begann das Baby zu schreien, erst leise, dann immer lauter werdend, bis schließlich das größere Mädchen die Augen öffnete und verschlafen um sich blickte. Sie griff nach dem Baby, legte es anders hin und rieb sich die Augen. Dann sah sie neben sich und schien sich an etwas erinnern zu wollen, aber immer wieder fielen ihr die Augen zu. Das Baby schrie weiter, und gerade, als sie die Augen wieder öffnen wollte, fiel ein Schatten über die Bank. Verschwommen sah sie die blaue Uniform eines Schutzmannes. Ihren Augen tasteten sich an seinem Körper hoch bis zu seinem Gesicht, und sie erschrak. Er hatte eine große Narbe auf der Wange. Mechanisch zog sie das schreiende Baby näher zu sich, aber der Mann machte keine Anstalten, es ihr wegzunehmen.
Mit tiefer Stimme frage er „Na, Kleene, wo ist denn deine Mama“.
Das Kind sah ihn schüchtern an und zuckte mit den Schultern.
„Kannste auch sprechen“? fragte er sie und sie antwortete mit leiser Stimme „Ja“.
Er setzte sich auf das freie Ende der Bank und fragte weiter „Wie heeste denn?“
„Leonie“.
„So, Leonie, und wie weiter?“
„Weiß nicht“.
„Wer ist denn der kleene Schreihals?“
„Meine Schwester Elena“.
„Wird ja immer schöner! Und ihr Beeden seid hier ganz alleene?“
„Renate ist auch noch da“.
„So, wo isse denn?“
Leonie blickte sich hilflos um. „Vorhin war sie noch da“.
Der Mann fragte weiter „Is Renate eene Verwandte?“
Leonie blickte ihn verwirrt an.
„Na jut, frag ich mal anders: Wer ist Renate?“
„Meine Schwester“.
Wat, noch eene. Wie alt biste eigentlich?“
„Vier Jahre“.
„Hm, und wie alt is Renate?“
„Weiß nicht“
„Iss se größer als du?“
„Ne, kleiner“.
„Ach du liebes Jottchen, dat ist ja ne schöne Bescherung. Weeste wat, ick bin gleich wieder da, rühr dich nich von der Banke!“
Er ging ein Stück davon und rief laut mit volltönender Stimme Renates Namen. Nach etwa einer halben Stunde kam er zurück, Schweiß lief ihm übers Gesicht.
„So, Kleene, jetzt kommt ihr erst einmal mit mir“.
Er nahm das Baby auf den Arm und Leonie an der Hand und ging mit ihnen Richtung Stadt.
Renate wird Sylvia
(1951)
Nachdem Ingrid das kleine Mädchen auf den Arm genommen hatte, lief sie schnell durch das anschließende Wäldchen, bis sie zu einer Straßenbahnhaltestelle kam. Sie nahm die nächste Bahn Richtung Innenstadt, stieg dort um, nahm einen Bus und eine weitere Straßenbahn in einen Außenbezirk und erreichte die kleine Siedlung am frühen Nachmittag, durchschwitzt und nervös. Noch immer schlief das Mädchen in ihren Armen. Als sie durch den Garten das kleine Häuschen ihrer Mutter betrat, war sie körperlich und nervlich am Ende. Sie setzte sich schweratmend in der Küche auf einen Stuhl und legte das Kind neben sich auf einen abgeschabten Sessel. Dann, nachdem ihr Puls wieder ruhiger schlug, versuchte sie die Kleine zu wecken. Es dauerte eine Weile, bis das Kind die Augen aufschlug und sie verständnislos ansah. Sein kleines Gesichtchen verzog sich weinerlich.
„Mama“ war das erste Wort, das sie sprach und als Ingrid sagte „Ruhig meine Kleine, ich bin ja da“, begann das Mädchen zu weinen.
Ingrid nahm das Kind wieder auf den Arm und wiegte es, aber das gefiel ihm ganz und gar nicht. Immer lauter schluchzte es:
„Mama“ und nach einer Weile „Leonie komm“.
Ingrid erschrak. Das Kind musste schon älter sein, als sie angenommen hatte. Es sprach schon viel zu viel für ihren Geschmack.
Ingrid setzte das Mädchen auf ihren Schoss und goss ihr aus einer Kanne Milch in eine Tasse. Die Kleine trank durstig. Ingrid suchte in den Töpfen, die auf dem Herd standen, und fand in einem ein paar gekochte Kartoffeln, gemischt mit Rüben. Sie holte einen Löffel und fütterte das Mädchen. Dabei sagte sie ihr immer wieder leise ins Ohr. „Du bis Sylvia und ich bin deine Mama“.
Als das Kind den Teller leer gegessen hatte, groß Ingrid Wasser in eine große Schüssel. Sie wusch das Kind und legte es in das Bett, das in einem mit einem Vorhang abgetrennten Nebenraum stand. Dann setzte sie sich auf den Rand des Bettes und summte leise, bis das Kind wieder eingeschlafen war.
Kaum war sie wieder in der Küche, trat ihre Mutter ein. Ingrid ging zu ihr, nahm sie in den Arm und sagte „Wir haben unsere kleine Sylvia wieder“.
Die Mutter bedachte ihre Tochter mit einem vorwurfsvollen Blick. „Sag mal, spinnst du, oder ist das ein geschmackloser Scherz?“.
Ingrid strahlte „Es ist die reine Wahrheit, komm!“ und sie führte ihre Mutter ins Schlafzimmer, wo unter der leichten Decke ein blonder Lockenkopf sichtbar war.
Ingrids Mutter erschrak bis ins Mark. „Um Gottes Willen, was hast du getan, was ist das für ein Kind und wie kommt es hierher? Bis du denn von allen guten Geistern verlassen?“
Als sich Renate-Sylvia unruhig bewegte, drängte Ingrid ihre Mutter zurück in die Küche und erzählte, was sich an diesem Morgen zugetragen hatte.
Sie hatte wieder einmal nicht schlafen können und war schon sehr früh erwacht. Seit Sylvia nicht mehr lebte und Kurt in Hannover war, kam dies oft vor. Also beschloss sie, nach Heisingen zu fahren, dort ein wenig spazieren zu gehen um die Zeit, da sie noch nicht mit Kurt verheiratet war, in ihre Gedanken wieder aufleben zu lassen.
Durch die gelben und roten Blätter des Herbstwaldes sah sie die Frau mit den 3 Kindern. Die blonden Haare des kleinen Mädchens erinnerten sie an ihr Kind, und sie folgte den vieren unauffällig. Als diese die Bank erreicht hatten und die Mutter die Lebensmittel auspackte, sah sie noch etwas, nämlich, dass die Frau etwas unter den Zucker mischte. Sie hatte dafür keine Erklärung und wartete. Nachdem die Frau sich aber zielstrebig entfernte und kurz danach die Kinder einschliefen, schloss sie daraus, dass das Essen der Kinder mit einem Schlafmittel präpariert gewesen sein musste. Sie wartete mindestens eine halbe Stunde, und erst als sie sicher war, dass die Frau nicht zurückkam und sie von niemand gesehen wurde, stahl sie das blonde Kind und brachte es auf Umwegen nach Hause.
Ihre Mutter sah sie immer noch mit einem Blick an, dem man einem Kalb mit zwei Köpfen zukommen lässt.
„Kannst du mir sagen, wie es weitergehen soll? Wir haben Nachbarn, die es sicher interessiert, wieso du plötzlich wieder ein Kind hast, und du hast einen Mann, der dazu mit Sicherheit auch einige Fragen stellen wird“.
„Hab ich mir alles schon überlegt“, sagte Ingrid. „Den Nachbarn sagen wir, dass ich die Kleine solange betreue, bis ihre Mutter wieder aus dem Krankenhaus kommt. Und ich fahre gleich morgen nach Hannover. Kurt hat ja ab nächsten Monat eine Wohnung angemietet. Bis wir einziehen können, bleibe ich in einer Pension. Ich werde ihm sagen, das Kind sei aus einem Waisenhaus. Nach ein paar Tagen sage ich ihm dann die Wahrheit. Dann kann er uns nicht mehr wegschicken, ohne dass es einen Skandal gibt. Und der wäre für seine Karriere nicht sehr förderlich“.
„Du bist krank“, sagte ihre Mutter. „Ich sollte die Polizei verständigen“.
„Tu, was du nicht lassen kannst“, antwortete Ingrid. „Macht sich bestimmt gut, deine Tochter in der Irrenanstalt oder im Gefängnis. Und an die Kleine denkst du wohl gar nicht, was? Ich weiß verdammt genau, was ich getan habe. Aber ich will dieses Kind. In Hannover können wir völlig neu beginnen. Niemand kennt uns. Wir sind ein Ehepaar mit einem Kind und damit basta“.
„Kannst du mir verraten, wie Kurt erklären will, dass er so plötzlich ein Kind hat?“
„Das ist das kleinste Problem“, sagte Ingrid. „Als er sich nach Hannover bewarb, lebte unsere Sylvia noch. Während der Schulung interessiert sich niemand für die Familienverhältnisse. Und in der Hannoveraner Bank fängt er ja erst nächsten Monat an. Alle Urkunden und Unterlagen von Sylvia habe ich ja noch. Sie ist ganz einfach nie gestorben“.
Ingrids Mutter schüttelte den Kopf und sagte:
„Pack deine Sachen! Fahr so schnell wie möglich! Ich möchte mit dieser Angelegenheit nichts zu tun haben. Und noch etwas: komm nicht wieder, solange du ein gestohlenes Kind bei dir hast“.
Sylvia begegnet ihrer Oma
(1954-1960)
Renate, die jetzt Sylvia hieß, war vier Jahre alt, als ihr Bruder geboren wurde. Sie lebte mit ihren Eltern in Hannover und ging in einen evangelischen Kindergarten. Als ihre Mutter ihr erzählte, dass sie ein Baby bekommen würden, fand sie das großartig. Fast alle ihre Freundinnen im Kindergarten hatten noch Geschwister, mit denen sie nachmittags spielen konnten, nur sie war meistens allein zu Hause oder auf dem Grundstück, weil Mama nicht wollte, dass sie mit den anderen auf der Straße spielte. Als dann aber Markus auf die Welt kam, stellte sie fest, dass sie noch lange nicht würde mit ihm spielen können, er schlief meistens oder er schrie, wenn er Hunger hatte oder die Windeln voll waren. Und noch etwas hatte sich geändert. Papa kam jetzt immer sehr zeitig nach Hause und lief mit Markus auf dem Arm durch die Wohnung. Sie beachtete er kaum noch. Mama hatte auch weniger Zeit für sie, weil sie sich um das Baby kümmern musste, und so fühlte sich Sylvia oft einsam. Wenn sie doch wenigstens eine Oma gehabt hätte, aber Mama hat ihr mehr als einmal gesagt:
„Wir haben keine Oma und damit basta“
.So verging die Zeit, und Sylvia kam in die Schule. Dort gefiel es ihr ausgesprochen gut, die Lehrerin war nett und ihre Kindergartenfreundinnen waren mit ihr in der gleichen Klasse. Auch durfte sie jetzt öfter diese Freundinnen besuchen, um mit ihnen zu spielen, und manchmal spielten sie auch Einfangen oder Verstecken auf der Straße, aber das schien ihre Eltern jetzt nicht mehr zu stören. Allerdings gab es auch einen Wermutstropfen. Sie hatte ihr Zimmer räumen müssen. Papa meinte, sie würde Markus wecken, wenn sie abends zu Bett ginge, und er würde sie morgens zu früh stören, und außerdem könne es auf lange Sicht nicht angehen, dass ein Junge und ein Mädchen im gleichen Zimmer schliefen.
Also wurde kurzerhand auf dem Dachboden eine Wand eingezogen und ihre Sachen dort hinaufgestellt. Im Winter war es bitterkalt, an dem kleinen Fenster bildeten sich Eisblumen, doch Mama hatte ihr ein extra dickes Deckbett gegeben, so dass sie nachts nicht frieren musste. Freilich konnte sie im Winter dort keine Hausaufgaben machen, die machte sie dann am Küchentisch. Im Sommer war es allerdings manchmal so heiß, dass sie nicht schlafen konnte, und mehr als einmal war sie heimlich auf die Terrasse geschlichen und hatte in der Hollywoodschaukel geschlafen.
Kurz nach ihrem 10. Geburtstag waren sie dann in ein anderes Haus gezogen. Das neue Haus war größer und sie hatte wieder ein eigenes Zimmer, mit Heizung und sogar mit einem kleinen Balkon. Markus besuchte die Grundschule im ersten Jahr und war ein richtiger Racker, der mit seinen Streichen die ganze Familie in Atem hielt. Doch Papa, der immer strenger als Mama gewesen war, lachte nur darüber, und selbst als Herr Behrmann abends klingelte und mitteilte, dass Markus eine Scheibe seines Gewächshauses mit dem Fußball eingeschlagen habe, sagte Papa nur:
„Lassen Sie den Glaser kommen, und schicken Sie mir die Rechnung“.
Und zu Markus sagte er: Das wird hoffentlich nicht zur Gewohnheit“.
Und dann geschah etwas Seltsames. Eines Tages, als Sylvia früher als sonst nach Hause kam, weil die Geographie-Doppelstunde wegen Erkrankung der Lehrerin ausfiel, hört sie schon im Garten laute Stimmen aus dem Haus. Ihre Mutter sprach mit irgendeiner Frau und gerade sagte sie:
„Höre Mutter, ich möchte nicht, dass die Kinder dich sehen, ich habe immer wieder betont, dass wir keine Oma haben, also geh jetzt bitte. Ich besuche dich, sobald ich kann, und dann können wir alles Weitere klären, aber nicht jetzt und hier!“
Und die andere Frau sagte: „Ich bin aber gerade hier, um meinen Enkel zu sehen und es interessiert mich auch, was aus Sylvia zwei geworden ist, verstehst du das nicht? Kein Mensch weiß, wie lange ich noch lebe, und es gibt noch ein paar Dinge, die ich vorher für mich klären will“.
„Gut“, sagte Mama, „aber lass mir ein wenig Zeit. Ich muss auch mit Kurt darüber sprechen. Ich schreibe dir und ich besuche dich sobald es geht. Versprochen. Aber jetzt geh bitte!“
Sylvia hatte den Rückzug angetreten und sich an der Straße neben dem Wartehäuschen versteckt. Kurze Zeit später sah sie eine alte Frau, die auf einen Stock gestützt die Straße in ihre Richtung herunterkam. Sie überlegte. Mama hatte diese Frau Mutter genannt, und die Frau hatte von Markus als ihrem Enkel gesprochen. Also musste das ihre Oma sein. Kurz entschlossen trat sie der alten Frau in den Weg. Sie lächelte verlegen und sagte:
„Ich bin Sylvia. Bist du meine Oma?“
Die alte Frau wurde ganz blass um die Nase und setzte sich schnell auf die Bank im Wartehäuschen. Sie wischte sich mit einem Taschentuch über die Stirn. Dann sagte sie:
„Du hast gelauscht, stimmt’s?“
Sylvia nickte stumm.
„Tja“, sagte die alte Frau, „das ist dann wohl Schicksal. Ich bin Ingrids Mutter und heiße Thea. Wieviel hast du denn erlauscht?“
„Alles“, sagte Sylvia mutig, und es wurde ihr mulmig bei dieser Lüge.
„Nun“, fuhr Oma Thea fort, „wenn du alles weißt, dann ist dir vermutlich klar, dass du unser Treffen hier nicht erwähnen solltest, verstehst du?“
Wieder nickte Sylvia.
„Ich muss jetzt los, sonst verpasse ich den Zug“, sagte Oma Thea.
Und Sylvia sagte: „Ich bringe dich zum Bahnhof“ und leise fügte sie hinzu. „Ich habe mir von klein auf eine Oma gewünscht“.
Thea sah sie an, sagte aber nichts. Dann gingen beide nebeneinander in Richtung Bahnhof.
Elenas Herkunft
(1958)
Als Elena zum ersten Mal etwas über ihre Herkunft erfuhr, war sie gerade 7 Jahre und im 1. Schuljahr. Sie hatte einen bösen Schnupfen und konnte nicht schlafen, weil die Nase verstopft und ihr Mund ganz trocken war. Eben wollte sie nach Mama rufen, als sie hörte, wie ihre Eltern sich lauter als sonst unterhielten. Die Tür zum Wohnzimmer war einen Spalt breit offen, so dass ein wenig Licht in ihre kleine Kammer fiel, und so hörte sie das Gespräch, von dem sie aufgrund ihrer Jugend nicht allzu viel verstand. Eben hörte sie ihren Vater sagen:
„Denk doch mal vernünftig, Sophie, du kannst nicht beides haben. Es wird für Elena schon schwierig werden, sich ständig an neue Orte und Menschen zu gewöhnen, aber wenn wir noch ein Kind adoptieren, wird es nahezu unmöglich, dass du mich zu meinen Engagements begleitest. Ich verstehe ja, dass dir dein berufliches Weiterkommen am Herzen liegt, das ist ganz in Ordnung, aber wie willst du mit 2 Kindern noch Zeit zum Fotografieren finden?“
Eine Weile war es still, dann sagte Mama mit einem hörbaren Seufzen
„Ich weiß, du hast Recht. Aber ich muss noch einmal darüber schlafen. Auf der einen Seite hätte ich gern noch ein Kind – auf der anderen Seite möchte ich endlich mal etwas Großes machen, nicht immer nur Ehrungen und Vereinsfeste“.
Elena überlegte. Was meinte Papa, dass sie sich ständig an neue Orte und Menschen gewöhnen müsste, und was bedeutete adoptieren. Kinder wuchsen doch im Bauch der Mutter, und Raimund, ihr Banknachbar in der Schule, hatte ihr sogar erzählt, wie sie da hineinkamen, aber das glaubte sie nicht so recht. Dass Mama mehr fotografieren wollte, verstand sie – aber wie hieß das Wort, wohin wollte Mama Papa begleiten? Sie hatte es vergessen, aber sie konnte ja morgen danach fragen. Darüber schlief sie endlich ein.
Nachdem Leonie und Elena von dem Schutzmann gefunden worden waren, brachte dieser sie zu seiner Schwägerin.
Hanne, so hieß seine Schwägerin, war eine resolute Frau, die während des Krieges vier Kinder großgezogen hatte. Sie sah viel älter aus als sie war, hatte schwielige rissige Hände, hoffte immer noch, dass ihr Mann, der als verschollen galt, eines Tage wieder vor der Tür stehen würde und war überaus praktisch veranlagt.
Schon einige Wochen, nachdem Elena bei ihr abgeliefert worden war, hatte sie ein Ehepaar gefunden, mit dem sie beim zuständigen Amt vorstellig wurde. Die Frau hatte ein ärztliches Attest, dass sie gesund war, aber keine Kinder bekommen konnte. Hanne erzählte dem Beamten, dass es sich bei der jungen Frau um eine Cousine 2. Grades handle, die z.Z. in der Schweiz wohne und die gerne die kleine Elena aufnehmen würde. Als der Beamte ihr versuchte zu erklären, dass das formal nicht möglich sei, ein deutsches Kind ins Ausland zu vermitteln, sagte sie knapp „Red doch keinen Stuss, Mann, du weißt doch genau, dass wir den Stropp nirgendswo unterkriegen. Und schließlich is meine Cousine ja nich ausse Welt, ich brauch bloß zu schreiben, dann kommtse mit dat Kind wieder her. Und wer sagt denn, dat dat Kind deutsch is? Dat andere Mädchen, dat im Waisenhaus is, hat gesacht se heißt Elena. Klingt mehr italienisch wie deutsch, findste nich? Also wat is?”
Und so wurde Elena als Pflegekind an Sophie und David weitergereicht, die ihr Glück kaum fassen konnten. Zwei Jahre später wurde die Ersatz-Geburtsurkunde – Eltern unbekannt - eine halbe Din-A-4-Seite mit vielen Stempeln aber wenig Inhalt – in die Schweiz geschickt ,und ein weiteres Jahr später war die Adoption rechtskräftig.
Für Elena waren Sophie und David immer Mama und Papa gewesen. Mama hatte schon von jeher gerne und oft Fotos von ihr gemacht, und Papa konnte wunderschön Geige spielen. Das zu wissen, war für sie genug. Lustig war, dass Mama deutsch mit ihr sprach, Papa aber französisch, und sie, um ihre Eltern zu necken, die Sprachen genau umgekehrt benutzte. In der Schule sprachen die Lehrer französisch mit ihr und den anderen Kindern, was für sie kein Problem darstellte, aber Gino, ihr bester Freund und Karen ihre besten Freundin, hatten da mehr Schwierigkeiten. Papa hatte ihr erklärt, dass in der Schweiz Menschen aus vielen Ländern lebten, weil die Schweiz ein neutrales Land war und immer noch sei, und dass während des Krieges Menschen aus Ländern, die von den Nazis besetzt worden waren, in die Schweiz ins Exil gegangen seien. Besonders für Juden war die Schweiz eine kleine Enklave inmitten des Horrors.
„Sind wir auch Juden?“ hatte sie gefragt. Und Papa sagte: „Mama und ich sind Juden, aber keine praktizierenden, und was du einmal sein willst, überlassen wir dir, wenn es soweit ist“.
Während der ersten beiden Schuljahre kam es immer wieder vor, dass ihr Vater für einige Zeit von zu Haus weg musste. Ihre Eltern hatten ihr erklärt, dass man das Tournee nennt, wenn ein künstlerisch tätiges Elternteil in andere Städte oder Länder reist, um dort zu arbeiten. Sophie blieb zu Hause bei Elena und verbrachte die Zeit damit, Sprachen zu lernen, zu fotografieren und den häuslichen Verpflichtungen nachzukommen. Eines Tages, während sie ihre Schulhefte in die Tasche packte fragte sie Sophie:
„Mama, warum streitest du mit Papa?“
Sophie hob erstaunt den Kopf. „Wie kommst du denn darauf, dass wir streiten“, fragte sie zurück.
„Ich habe das gestern gehört, als ich im Bett war“.
„Nein, meine Kleine, wir haben nicht gestritten. Wir haben nur unterschiedliche Vorstellungen, was die Rollenverteilung in unserer Familie betrifft“.
Und als sie den verständnislosen Blick von Elena sah fuhr sie fort: „Kleines, das verstehst du noch gar nicht. Wir beide haben dich sehr lieb, und das ist das Wichtigste, meinst du nicht?“
Elena sah die plötzliche Traurigkeit in den Augen ihrer Mutter.
„An diesem Abend sagte David: „Hört mal zu, ihr Beiden, ich habe eine Überraschung für euch. Wir werden die Weihnachtstage in Florida verbringen. Ich habe zwei Konzerttermine in Miami und anschließend werden wir noch ein paar Tage in der Sonne bleiben. Außerdem möchte ich meinen Onkel Joshua wieder einmal sehen, “ fügte er hinzu.
„Fahren wir mit dem Schiff?“ fragte Elena. David verneinte. „Das wäre zwar sicher sehr interessant und erholsam, aber es dauert einfach zu lange. Wir werden von Zürich aus mit dem Flugzeug fliegen, zuerst bis London. Dort übernachten wir. Am nächsten Tag fliegen wir nach New York. Dort übernachten wir wieder, und dann geht es weiter nach Florida“.
Sylvia
(1961)
Seit Sylvia ihre Oma gesehen hatte, wartete sie täglich, in der Hoffnung, dass ihr die alte Dame noch einmal über den Wege laufen würde. Aber nichts geschah. Auch ihre Eltern schwiegen über den Besuch und Sylvia fragte sich, ob ihre Mutter es nur so dahin gesagt hatte, dass sie Oma Thea besuchen wolle. Oder es geschah dies, während sie in der Schule war. Verdammt, was sollte sie nur tun?
Ihre beste Freundin, Mona, wusste vielleicht eine Lösung. Mona wusste immer auf alles eine Antwort. Sie wohnte in einem Stadtteil, der noch hübscher aussah, als der in dem Sylvia wohnte. Die Häuser dort waren groß und die Gärten noch größer und die Mutter von Mona sah aus, wie eine der Damen aus den Modekatalogen ihrer Mutter. Sie trug immer Schuhe mit hohen Absätzen, auch zu Hause und ihre Haare waren zu einem blonden Turm aufgesteckt. Mona hatte schwarze Haare und auch ihre Haut war sehr dunkel. Sylvia erinnerte sich noch sehr gut an den ersten Tag auf der Mittelschule – die einzig mögliche Schulform, die sie besuchen durfte, obwohl ihre Noten überdurchschnittlich gut waren. Ihr Vater jedoch verwies auf die Tatsache, dass sie ein Mädchen sei und doch heiraten würde. Da wäre das Gymnasium verlorene Zeit. Und wenn sie nach der Realschule noch irgendetwas machen wolle, könne sie ja auf die Handelsschule oder auf die Frauenfachschule gehen. Gute Stenotypistinnen oder Kinderpflegerinnen wurden immer gebraucht, sagte er. Als sie ihren neuen Klassenraum in der Mittelschule betrat, fiel ihr Mona sofort auf, sie war ihr irgendwie vertraut, obwohl sie sicher war, dass sie einander noch nie begegnet waren. Mona schien es ähnlich zu gehen, denn schon nach einer Woche waren sie beste Freundinnen.
Nach dem Unterricht ging sie mit zu Mona nach Hause. Bereits auf dem Weg erklärte sie ihr, mit welcher Neuigkeit sie vor ein paar Wochen konfrontiert worden war. Mona war erst ein bisschen beleidigt, weil sie nicht sofort mit ihr gesprochen hatte, aber dann sagte sie
„Das ist ein Fall für einen Detektiv. Und weißt du, wer der beste Detektiv der Welt ist: meine Mutter.“
Das letzte Stück rannten sie und kaum hatte das Hausmädchen die Tür geöffnet, rannten beide schon durch die Diele – wo sie nur kurz ihre Schultaschen abstellten – in den Salon.
Monas Mutter saß auf der Couch und telefonierte, beendete aber das Gespräch, als sie die beiden unruhig von einem Fuß auf den anderen hüpfen sah.
„Was ist denn mit euch los, seid ihr in einen Ameisenhaufen getreten?“ fragte sie.
„Nein, aber Sylvia muss dir was ganz Wichtiges erzählen und du musst uns dann helfen.“
„Nun mal langsam“, sagte Monas Mutter, „solltet ihr nicht erst in die Küche gehen und etwas essen oder wenigstens ein Glas Kakao trinken?“
„Später“, sagte Mona, schubste Sylvia auf die Couch, setzte sich selbst auf den Boden und sah erwartungsvoll in die Runde.
Erst zögernd, aber dann zunehmend flüssiger, berichtete Sylvia von dem belauschten Gespräch und davon, dass sie ihre Oma so gern wiedersehen würde, aber sich nicht getraute zuzugeben, dass sie von dem Besuch und dem Gespräch wusste.
Monas Mutter schwieg einen Augenblick nachdenklich, dann rief sie nach dem Mädchen und bat darum, zwei Gläser Kakao und ein paar Brote zu bringen. Für sich selbst bestellte sie Kaffee.
Dann sagte sie zu Sylvia: „Weißt du, wo deine Mutter geboren ist, bzw. wo sie gewohnt hat, bevor sie deinen Vater geheiratet hat?“
„Ja in Essen.“
„Gut, und wie ist der Mädchenname deiner Mutter?“
„Schütte“, sagte Sylvia. „Sie heißt Ingrid Kuhlmann, geborene Schütte. Das steht auf ihrem Ausweis“.
„Na wunderbar“, sagte Monas Mutter und strahlte. „Ihr beide esst jetzt in Ruhe euer Mittagessen und wenn ihr fertig seid, weiß ich vielleicht schon mehr. Aber“, fügte sie ernst hinzu, „es wäre mir wirklich lieb, wenn Sylvias Eltern nicht davon erfahren würden, was wir hier besprechen. Ich weiß, das ist pädagogisch völlig falsch, was ich hier tue, man sollte Kinder nie mit Heimlichkeiten belasten, aber ich glaube, diese Geschichte ist eine Ausnahme. Was meint ihr, könnt ihr das für euch behalten, oder muss ich damit rechnen, dass Sylvias Eltern hier vor der Tür stehen und einen Heidenzirkus veranstalten? Natürlich dürftet ihr dann auch nicht mehr miteinander Umgang pflegen“, ergänzte sie mit einem listigen Lächeln. Die beiden Mädchen verstanden sofort. Sie benetzten die Finger der rechten Hand mit Spucke, legten sie auf ihre Herzen und gelobten nach alter Indianerart Stillschweigen. Dann griffen sie wacker zu und Monas Mutter verließ den Raum.
Nach dem Essen gingen beide in Monas Zimmer und begannen mit den Hausaufgaben. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Monas Mutter ins Zimmer kam und Sylvia einen Zettel in die Hand drückte. Darauf stand eine Adresse: Thea Schütte, Auf der Burg 18, Essen. „Merke es dir gut“, sagte Monas Mutter, „der Zettel bleibt hier, verstehst du?“ Sylvia nickte. „Die Straße liegt im Westen der Stadt, nicht weit von der Stadtgrenze Mülheim entfernt“, fuhr Monas Mutter fort. „Aber vielleicht solltest du einfach mal eine Karte an deine Oma schreiben oder besser einen Brief“.
„Und wenn sie antwortet, sehen meine Eltern das doch“, sagte Sylvia ein wenig mutlos.
„Dann musst du die Situation eben deiner Oma erklären und sie bitten, nicht zu dir nach Hause zu schreiben“.
„Kann sie nicht hierhin schreiben?“ fragte Sylvia hoffnungsvoll. Nach kurzem Zögern sagte Monas Mutter
„Ja, meinetwegen, jetzt bin ich schon so weit gegangen, jetzt kommt es auch nicht mehr darauf an“ und damit verließ sie das Zimmer in dem die beiden Mädchen sofort mit einem Brief an Oma Thea begannen.
Jeden Morgen wartete Sylvia gespannt auf Monas Eintreffen, in der Hoffnung, sie halte einen Brief in der Hand. Es vergingen zwei Wochen, da sagte Mona in der großen Pause: „Bleibt es dabei, dass du heute wieder mit zu uns kommst“ und Sylvia nickte.
Als sie bei Mona in der Diele standen, kam die Mutter die Treppe herunter, nahm Sylvia an der Hand und führte sie in den Salon. Dort gab sie ihr ein verschlossenes Couvert - die langersehnte Antwort ihrer Oma.
„Lies den Brief in Ruhe“, sagte sie, „und wenn du fertig bist, komm zu uns in die Küche“. Dann ließ sie Sylvia allein und schloss leise die Tür. Sylvia riss den Briefumschlag auf und begann zu lesen:
Mein liebes Kind, ich habe mich über deinen Brief sehr gefreut. Allerdings gefallen mir die Heimlichkeiten ganz und gar nicht. Deine Mutter will mich am kommenden Wochenende besuchen und ich werde ihr sagen, dass ich gerne mit meinen Enkeln korrespondieren möchte. Ich werde ihr für euch beide Briefchen mitgeben und dann können wir uns ganz ohne Heimlichkeiten schreiben.
Gerne würde ich euch auch ganz bald wiedersehen. Vielleicht klappt das ja in den Schulferien. Auch das werde ich mit deiner Mutter besprechen. Ich vermisse euch sehr.
Herzliche GrüßeOma Thea
Da wäre ja zu schön, wenn sie in Zukunft ihrer Oma schreiben und sie besuchen könnte. Sie durfte sich jetzt nur nicht verraten und musste warten, bis ihre Mutter wieder zurückkam. Komisch, sie hatte noch gar nicht gesagt, dass sie am Sonntag nicht da sein würde.
Sie ging in die Küche und zeigte den Brief Monas Mutter, die ihn kurz überflog, faltete und ihn in den Küchenschrank, ganz oben, unter die Dose mit dem Kamillentee legte.
Als Ingrid am Sonntagabend wieder nach Hause kam, sah sie müde und erschöpft aus. Kurt fragte mehr mit Blicken als mit Worten
„Und?“
„Später“ formten ihre Lippen tonlos und dann ging sie ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen. Kurt hatte den Kindern als Abendbrot eine Tüte Pommes frites spendiert und so gab es für die beiden keinen vernünftigen Grund mehr, sich in der Nähe ihrer Eltern herumzudrücken. Markus wollte seine Fußballkärtchen noch einmal sortieren und Sylvia wollte eine Möglichkeit finden, zu lauschen, was ihre Mutter zu berichten hatte. Bevor sie das Wohnzimmer verlies, öffnete sie die Terrassentür einen kleinen Spalt, der hinter dem Vorhang gar nicht zu sehen war. Sie hoffte, dass sie von ihrem Balkon aus hören konnte, was hier besprochen wurde. Dann verschwand sie mit einem „gute Nacht allerseits“ im Obergeschoss.
Schnell schloss sie ihre Tür und klemmte ihren kleinen Sessel unter die Klinke. Man konnte ja nie wissen, ob Markus nicht noch einmal zu ihr hereinschauen würde. Sie öffnete die Balkontür leise, legte sich auf den Boden und schob sich bis zum Gitter nach vorn. Von unten hörte sie Schritte und die Stimme ihrer Mutter
„Ich brauche jetzt einen Likör. Du auch?“
„Ich hab heute Bier getrunken, ich bleibe dabei“ brummte Kurt und Sylvia hörte, wie ein Bierverschluss geöffnet wurde. Danach war die Stimme ihres Vaters, etwas undeutlich, weil er eine Zigarette zwischen den Lippen hielt, zu hören
„Und, was war, erzähl schon!“
„Sie will die Kinder sehen“, sagte Ingrid, „ihnen schreiben, sie in den Ferien mal ein paar Tage bei sich haben, so was halt“.
„Ach, jetzt auf einmal“, sagte er, „früher, als die Kinder klein waren und wir mal ein wenig Entlastung hätten brauchen können, hat sie sich ja auch nicht darum gekümmert“.
„Du weißt weswegen“ sagte Ingrid.
„Mein Gott“, sagte Kurt, „das ist doch wirklich Schnee von vorgestern und interessiert heute niemanden mehr. Damals, als du mit der Kleinen zu mir kamst, weil sie dich rausgeschmissen hat, da war die Sache noch brandheiß. Und da waren ihr die eigene Sicherheit und der gute Ruf wichtiger als du und das Kind. Wenn sie dich damals geschnappt hätten, wäre unsere ganze Existenz im Eimer gewesen. Ich versteh bis heute nicht, was du dir dabei gedacht hast. Aber egal. Das Thema ist vom Tisch. Sylvias Papiere sind längst in Ordnung und wir sind eine stinknormale Familie.
Was aber deine Mutter betrifft, ich weiß nicht, ob ich sie hier sehen will. Meinetwegen kann sie den Kindern schreiben und ebenso kann Sylvia sie besuchen, aber meinen Sohn kriegt sie nicht. Jetzt jedenfalls noch nicht. Wenn mein Sohn größer ist, kann er selbst entscheiden ob er will oder nicht. Schick ihr ein Bild von ihm, “ fügte er noch hinzu, „damit sie Ruhe gibt.“
Dann hörte Sylvia wie der Fernseher eingeschaltet wurde. Sie schob sich vorsichtig zurück in ihr Zimmer, schloss leise das Fenster und verkroch sich in ihrem Bett. Es war doch recht kalt auf den Steinen gewesen. Sie kuschelte sich tief in die Kissen und dachte über das Gehörte nach. Irgendwas stimmte nicht. Es war mehr ein Gefühl denn etwas Greifbares. Etwas, was ihr in der Formulierung aufgefallen war. Sie dachte angestrengt darüber nach und plötzlich wusste sie es: Ihr Vater hatte von ihr gesprochen dabei ihren Vornamen oder „das Kind“ gebraucht, Markus jedoch nannte er stets „meinen Sohn“. Und dann hatte er noch gesagt…als du mit der Kleinen zu mir kamst und Sylvias Papiere sind längst in Ordnung….. War sie vielleicht gar nicht sein Kind? Sie musste unbedingt mit irgendeinem Menschen darüber sprechen. Gleich morgen. Und mit diesem Gedanken schlief sie ein.
Als sie am nächsten Tag aus der Schule nach Hause kam, gab ihr Ingrid einen Brief von Thea. Sylvia ging sofort in ihr Zimmer um Hausaufgaben zu machen, in Wirklichkeit schrieb sie jedoch, versteckt in der Algebra-Mappe einen Brief an ihre Oma. Als sie den Brief beendet hatte und ihre Hausaufgaben fertig waren, ging sie hinunter und sagte, sie wolle sich am Kiosk eine Jugendzeitschrift kaufen. Geschwind lief sie zur Post, kaufte eine Briefmarke und warf den Brief ein, dann schlenderte sie zum Kiosk und kaufte eine Bravo. Eine neue Phase des Wartens hatte begonnen.
Sylvia besucht ihre Oma
(1962)
In den Osterferien war es endlich soweit. Sylvia durfte eine Woche bei ihrer Oma verbringen. Voller Ungeduld saß sie nun im Zug von Hannover nach Essen. Ihr Vater hatte angemerkt, dass sie natürlich nicht in allen Ferien nach Essen fahren könnte, das käme zu teuer. Darauf hatte sie gesagt
„Dafür spart ihr das Geld für mich im Urlaub“.
„Glaubst du denn, wir müssten nicht auch etwas bezahlen, wenn du in Essen bist?“ hatte er zurückgefragt und sie hatte darauf keine Antwort gewusst. Geld war in der Familie stets ein Thema, obwohl Papa nicht schlecht verdiente. Mama bekam ausreichend Haushaltsgeld und wenn alle anderen Kosten gedeckt waren, wurde der Rest gespart. Papa sprach immer von Einlagen, festverzinslichen Anlagen und dergleichen mehr. Einmal hatte sie gefragt, warum er denn so viel spare und er hatte gesagt
„Man weiß nie, was kommt, und außerdem wird Markus sicher studieren und das kostet eine Menge. Zudem brauchen wir auch hin und wieder ein neues Auto und ich kann weder ein Fahrzeug noch einen Urlaub auf Kredit akzeptieren. Wenn man etwas möchte, muss man vorher die Bedingungen dafür schaffen. Das entspricht zwar nicht unbedingt dem Zeitgeist, ist aber meine ureigene und unumstößliche Ansicht“.
Damit war das Thema erledigt.
„Klar“, dachte sie „mal wieder Markus“ und obwohl sie sich sehr gut mit ihm verstand, war eine gewisse Eifersucht auf die Vorrechte, die er als Sohn genoss, latent vorhanden.
Und da war ja auch noch immer das Gespräch zwischen ihren Eltern, das sie belauscht hatte, nachdem Mama das erste Mal von Oma wieder nach Hause gekommen war. Die Worte „das Kind“, wenn es um sie ging und „mein Sohn“, wenn Papa von Markus sprach. Sie musste unbedingt ihre Oma fragen, was das zu bedeuten hatte.
Die Stimme des Schaffners riss sie aus ihren Gedanken.
„Nächste Station ist Essen Hauptbahnhof“ sagte er. „Wirst du abgeholt?“.
„Ja“ antwortete Sylvia „von meiner Oma“.
„Na dann, schönen Aufenthalt“ und damit ging er weiter zum nächsten Abteil.
Wenige Minuten später reichte er ihr das Gepäck hinaus, nachdem sie auf den Bahnsteig gesprungen war. Ein Rucksack, ein kleiner Koffer, eine Tasche. Sie bedankte sich, nahm alle Gepäckstücke an sich und ging Richtung Ausgang. Da sah sie ihre Oma. Sie war in Begleitung eines jungen Mannes, den sie als Bruno vorstellte. Bruno nahm ihr Koffer und Tasche ab, ging vor ihnen durch die Sperre und fragte über die Schulter: „Biste dat erste Mal hier?“
Sie nickte.
„Na dann wirste wat zu sehen kriegen“ sagte er, während er einen VW-Käfer aufschloss und den Beifahrersitz nach vorne zog, damit sie hinten einsteigen konnte. Dann machte er die vordere Haube auf und verstaute ihr Gepäck. Ihre Oma nahm auf dem Beifahrersitz Platz und schon ging es los, vorbei an Gleisanlagen eines Güterbahnhofs, an einer großen Fabrikhalle, an alten Bürogebäuden bis sie eine Wohngegend erreichten, die allerdings längst nicht so hübsch aussah, wie der Stadtteil in dem Sylvia wohnte. Aber das war ihr egal. Alles war neu und sie genoss es, an unbekannten Häusern und Straßen vorbei zu fahren, einen Blick in kleine Gärten oder Hinterhöfe zu erhaschen und war ungeheuer gespannt, wie und wo ihre Oma wohnte. „Auf der Burg“ hörte sich großartig an. Ihre Mutter hatte ihr aber gleich die Illusion genommen, dass es sich um eine richtige Burg handeln könnte. Es sei absolute Grünlage, hatte sie gesagt und der Straßenname verwiese lediglich darauf, dass vor langer Zeit dort einmal eine Burg gestanden haben könnte.
Jetzt wurde die Gegend ländlich.
Bruno brummte: „Sin gleich da“, zog den VW verwegen am höchsten Punkt einer Steigung um die Kurve und machte den Motor nach weiteren ca. 50 Metern ganz aus. Sylvia blickte auf ein kleines Häuschen, das mehr einem großen Gartenhaus denn einem Wohnhaus glich, umgeben von einem Garten in dem ein paar Blumen blühten.
„Kommt herein“ sagte Oma Thea und schloss die Tür auf. Sylvia folgte ihr mit dem Rucksack in der Hand und Bruno lud die Tasche und den Koffer aus dem Auto und brachte alles in den winzigen Flur.
„Dein Oma war heute Morgen schon am Backen, gezz bin ich mal gespannt, watse gemacht hat“ sagte er und nahm am Küchentisch Platz. Thea holte ein Blech mit Nusshörnchen aus dem Ofen und wartete darauf, dass das Wasser, mit dem sie den Kaffee brühen wollte, kochen würde. Sie wies auf den zweiten Stuhl, der neben dem Küchentisch stand.
„Setz dich doch“ sagte sie zu Sylvia.
„Und wo sitzt du?“ fragte diese zurück.
„Hier“ antwortete Oma Thea und griff unter den Tisch. Sie zog einen Hocker hervor, der keine Lehne, dafür aber ein dickes Kissen auf der Sitzfläche hatte.
Wenig später kauten alle drei mit vollen Backen und schlürften dazu den brühendheißen Kaffee. Danach verabschiedete Bruno sich und ging davon. Thea sagte:
„Er ist der Sohn meiner Nachbarin, ein Nachzügler, aber ein netter Junge und sehr hilfsbereit. Und“ fügte sie hinzu „jetzt erzähl mir, wie geht es zu Hause. Was machen die anderen und wie ist es dir seit unserem letzten Treffen ergangen?“
Sylvia druckste ein wenig herum, dann ging sie zu ihrem Rucksack, öffnete ihn, holte ein Notizbüchlein heraus und sagte:
„Ich hab mir alles aufgeschrieben, was ich dich fragen wollte, damit ich nichts vergesse. Und ich hab dir was mitgebracht. Damit nahm sie aus ihrem Rucksack ein kleines Päckchen und reichte es ihrer Oma. „Das ist von mir“ sagte sie „und das“, wieder griff sie in den Rucksack, „ist von Mama“. Und damit zog sie ein größeres Päckchen hervor.
Oma Thea öffnete zuerst das kleine. Darin fand sie einen Bilderrahmen aus rotem Kunstleder und darin ein Bild von Markus, am Gartenzaun stehend, mit zerzausten Haaren und einem entwaffnenden Lächeln. Sie betrachtete es eine Weile.
„Das ist aber lieb von dir“ sagte sie zu Sylvia. „Darüber freue ich mich sehr, hab vielen Dank“.
Sie strich dem Mädchen über die Haare. Dann öffnete sie das andere Päckchen. Sie fand darin ein Paket Kaffee, eine Nylonstrumpfhose, Sandalen mit Korksohle und 20 Mark. Keine Karte, kein Brief. Ihre Züge verfinsterten sich und nur die Anwesenheit von Sylvia hielt sie davor zurück, das gesamte Päckchen in den Ofen zu werfen. Welche eine Unverschämtheit, dachte sie, behandelt zu werden, wie die „armen Verwandten“ und das von der eigenen Tochter. Als ob sie nicht in der Lage wäre, für Sylvias Ernährung eine Woche lang aufzukommen! Schweigend packte sie alles wieder in das Papier und legte es auf die Anrichte. Und nach einem kurzen Schütteln sagte sie fröhlich:
„Jetzt zeige ich dir mein Schloss und meinen Park. Komm mit“.
Sie nahm Sylvia an der Hand und gemeinsam verließen sie die Küche.
Das Häuschen war klein, bestand aus der Wohnküche, in der sie gegessen hatten, einer Schlafkammer, einem kleinen Wohnzimmer mit einer durch einen Vorhang abgetrennten ische und einem Miniflur. Im Anbau befanden sich eine Toilette und ein Waschbecken. Sylvia fragte sich, ob und wie ihre Oma badete, wagte es aber nicht, diese Frage zu stellen. Danach gingen sie in den Garten, der sich an drei Seiten um das Haus zog. Vorne, im Eingangsbereich, hatte er rein dekorativen Charakter. Dort waren Blumen und Stauden zu Hause. Seitlich gab es einen großen Gemüsebereich, der sich bis hinter das Haus zog, wo Beerensträucher und Obstbäume den Rahmen für eine gemütliche Gartenlaube bildeten. Sylvia stellte sich das Areal bei strahlendem Sonnenschein im Hochsommer vor und fand es wunderschön.
„Im Sommer ist die Laube mein Lieblingsplatz“ sagte Thea gerade so, als hätte sie Sylvias Gedanken erraten. „Siehst du den grünen Schleier über den Bäumen und Sträuchern? Bald ist hier alles voller Blätter und Blüten. Dann spielt sich das Leben mehr draußen als drinnen ab. Und du kämest nie auf die Idee, dass du in einer Großstadt wohnst. Hier ist alles sehr ruhig und ländlich“ schloss sie.
Jetzt nahm Sylvia ihren Mut zusammen und fragte:
„Wo badest du denn?“
Thea antwortete – zu Sylvias Erleichterung ohne Groll oder Staunen – „wenn ich baden will, gehe ich ins Schwimmbad, da gibt es eine Abteilung mit Wannenbädern, im Sommer dusche ich beim Anbau. Ich fülle einen Gummisack mit Wasser aus der Pumpe und hänge ihn an das Dach. Wenn die Sonne eine Zeit lang darauf scheint, ist das Wasser warm. Damit lässt es sich herrlich duschen. Ansonsten wasche ich mich am großen Becken in der Küche“.
Sylvia nickte. Obwohl es für sie ungewohnt sein würde, fand sie es lustig. Es hatte etwas von einem Abenteuer. Sie musste unbedingt im Sommer wiederkommen!
„Wo ist dein Mann?“ fragte Sylvia weiter „ich meine, Mamas Vater“ fügte sie schnell hinzu, damit Oma Thea nicht ein Eindruck bekam, sie wisse nicht, dass man auch ohne Trauschein Kinder in die Welt setzen konnte.
„Das ist eine lange Geschichte“ sagte Thea. Vielleicht erzähle ich sie dir einmal“.
„Hat meine Mutter auch hier gewohnt?“ fragte sie.
„Ja“ sagte Thea „bis sie Kurt kennen lernte. Da zog sie dann aus und zu Verwandten von Kurt in den Essener Süden. Dort haben sie auch geheiratet. Und ein paar Jahre später zogen sie nach Hannover.
Sylvia überlief es heiß und kalt. Thea hatte nicht gesagt „seid ihr nach Hannover gezogen“ sondern „zogen sie“. Wo war sie zu dieser Zeit? Sie war doch 1950 geboren, so stand es in ihrem Ausweis.
„Und ich“ fragte sie ihren ganzen Mut zusammen nehmend „wo war ich? Bin ich auch hier geboren?“
Thea stutzte kurz, sagte dann aber schnell:„Klar, bist du in Essen geboren, das steht doch in deinen Papieren - oder etwa nicht?“
Sylvia beeilte sich zu nicken. Ihr fiel jedoch auf, dass Thea den ersten Teil ihrer Frage nicht beantwortet hatte.
Elena im Internat
(1965)
Elena saß in dem kleinen aber nett eingerichteten Zimmer im Internat, dass sie sich mit Pilar-Kaino, einem Mädchen mit spanischem Vater und finnischer Mutter teilte. Sie schaute versonnen über die hochsommerliche Landschaft und schrieb ab und zu eine Zeile nieder. Sie arbeitete gerade an einem Gedicht, dessen erste beide Strophen sie schon fertig gestellt hatte.
Pilar stürmte ins Zimmer. „Hast du Mathe fertig? Kann ich abschreiben, ich bin spät dran!“
Elena grinste. „Warst du wieder heimlich draußen am See?“ fragte sie. Pilar nickte.
„Das Wasser ist unglaublich schön. Es gefällt mir dort besser als auf dem Land. Ich glaube, ich hätte eigentlich Meerjungfrau werden sollen“.
Elena lachte verschmitzt. „Wenn du so begeistert vom Wasser bist, verstehe ich deine Abneigung gegen Schnee nicht. Ist doch auch nur Wasser“.
Pilar zog ihr ein Gesicht. „Aber kalt, viel zu kalt“ sagte sie.
Das Mädchen, das in dieser Woche für Aufsicht auf ihrem Flur zuständig war, kam herein.
„Elena, du sollst zur Direktorin kommen“
Elena blickte verdutzt auf.
„Wieso ich? Ich habe doch gar nichts gemacht.“
„Keine Ahnung. Du sollst jedenfalls sofort ins Büro kommen“ und damit verschwand sie.
„Soll ich mitgehen?“ fragte Pilar. „Wenn es wegen der Sache am See ist, stehe ich auch dafür grade“.
„Ne, lass mal“, sagte Elena „ich komm schon klar,“ und damit verließ sie das Zimmer und begab sich zum Büro der Direktorin.
Als sie eintrat, spürte sie sofort, dass sie keine Strafpredigt erwarten würde. Frau Dr. Höges stand am Schreibtisch und empfing Elena mit einem warmen Lächeln.
„Setz dich“, sagte sie „und schau nicht so besorgt. Es handelt sich um nichts Schlimmes“ fuhr sie fort. „Du weißt ja, dass in wenigen Tagen das Schuljahr zu Ende geht und wir unser Haus für 3 Monate schließen. Heute Morgen hat deine Mutter angerufen und mich gebeten, eine Unterkunft für dich zu finden, da sie in die USA fliegen muss, um über Opfer des Rassismus zu berichten. Sie wird erst ein paar Tage nach Ferienbeginn nach Hause kommen können. Dein Vater, so sagt sie, sei noch in Toronto bis zum Ende des Monats“.
Elena nickte.
„Fällt dir denn etwas ein, wo du diese Zeit verbringen möchtest“ fragte die Direktorin.
Elena schüttelte den Kopf
„Momentan nicht, aber ich denke darüber nach“.
„Gut, wir sprechen morgen nach der 4. Stunde noch einmal, Komm dann bitte unaufgefordert in mein Büro“. Und damit war Elena entlassen.
Pilar wartete schon voller Ungeduld.
„Und, was war?“ fragte sie.
Elena erzählte, dass sie die erste Ferienwoche untergebracht werden musste, weil ihre Eltern berufsbedingt beide nicht rechtzeitig zurück sein konnten.
Pilar strahlte.
„Mensch, Eli“, sagte sie „ich habe eine wunderbare Idee. Du fährst mit mir nach Barcelona zu meinen Eltern und zu meinem kleinen Bruder. Und dann besuchen wir alle meine Verwandten und baden im Meer und sitzen auf den Ramblas und fahren auf dem Tibidabo mit dem Karussell….“
„Ich kann doch nicht so einfach zu dir und deiner Familie mitkommen“ wandte Elena ein, obwohl ihr der Gedanke nicht schlecht gefiel.
„Wieso denn nicht?“ gab Pilar zurück. „Wir sind eine gastfreundliche Familie und solange ich denken kann, haben wir immer Leute zu Besuch gehabt.“
Sie ging zur Tür.
„Ich gehe jetzt zur Direktorin und bitte, meine Eltern anrufen zu dürfen. Dann sehen wir ja, wie gut mein Plan ist“ und weg war sie.
10 Minuten später kam sie strahlend ins Zimmer. Jubelnd fiel sie Elena um den Hals.
„ Es klappt, es klappt“ rief sie. „Meine Mutter ist nicht nur einverstanden sondern sogar begeistert, und die Dr. Höges versucht jetzt, deine Mutter zu erreichen. Und wenn die auch nichts dagegen hat, fahren wir in 3 Tagen nach Hause, nach Barcelona“.
An diesem Abend lag Elena noch lange wach im Bett. Auf der einen Seite freute sie sich auf ein paar Ferientage mit Pilar in einer Stadt, die sie noch nie besucht hatte, auf der anderen Seite überlegte sie, wie lange das nun schon so ging, dass sie weitergereicht wurde und immer das Gefühl hatte, ihren Eltern im Wege zu sein. Beide liebten sie sehr, zeigten ihr dies auch ständig, überhäuften sie mit Zärtlichkeit, wenn sie da waren. Meistens waren sie aber in der Weltgeschichte unterwegs und schienen zufrieden, sie in der Sicherheit und Geborgenheit des Internats zu wissen. Obwohl sie schon im vierten Jahr hier lebte, dachte sie manchmal noch mit Sehnsucht an die Zeit zurück, da Mama nur gelegentlich als freie Fotografin gearbeitet hatte.
Während ihrer Zeit in der internationalen Grundschule hatte Mama sie fast immer abgeholt. Und wenn sie einen Auftrag hatte, war Papa dagewesen.
In den Ferien waren sie auch manchmal alle drei dorthin gefahren, wo Papa ein Engagement hatte. Das war immer toll gewesen. Wenn Papa Proben hatte, durfte sie sich in den Zuschauerraum setzen und zuhören. Sie liebte Musik, besonders klassische, über alles.
Als sie im 2. Schuljahr war, hatte Mama beschlossen, auch wieder zur Schule zu gehen. Genauer: zur Uni. Sie belegte den Studiengang Journalismus. Sophie machte ihren Abschluss zur gleichen Zeit, da Elena die Grundschule absolviert hatte, und ihr erster Auftrag führte sie nach Berlin, wo gerade die Mauer gebaut wurde. Von da an überschnitten sich die Termine ihrer Eltern so oft, dass die beiden beschlossen, für Elena ein Internat zu suchen.
Elena gewöhnte sich schnell ein, lernte gerne und fand auch zu den anderen Mädchen schnell Kontakt. Zu Hause war sie nur noch in den Sommer- und Weihnachtsferien. 1963 war sie im Sommer mit ihrer Mutter in die USA gereist. Sophie hatte Aufnahmen von Martin Luther King gemacht, und in diesem Jahr würde sie die Ferien in Barcelona beginnen. Vergessen war die kleinen Reibereien und Eifersüchteleien zwischen ihr und Pilar. Die beiden waren in einen kindlichen Konkurrenzkampf getreten, sowohl was die Leistungen in der Schule, als auch die Beliebtheit bei den Mitschülerinnen und vor allen Dingen bei den Mitschülern betraf. Ernste Auseinandersetzungen hatte es jedoch nie gegeben. Wenn es darauf ankam, waren die beiden Mädchen ein unzertrennliches Duo. Sicher würde es ihr in Barcelona gefallen. Pilar war schließlich ihre beste Freundin. Mit diesem Gedanken schlief sie schließlich ein.
Drei Tage später war es dann soweit. Die gepackten Koffer standen im Lieferanteneingang, die Zimmer waren aufgeräumt, die Mädchen in allerbester Laune. Roman, der Fahrer, Hausbursche und Mädchen für alles war, sollte die Internatszöglinge, die nicht abgeholt wurden, entweder zur Bahn oder zum Flugplatz bringen. Elena und Pilar hatte noch reichlich Zeit. Ihr Zug fuhr erst am Abend, so dass sie am nächsten Tag früh morgens an der spanischen Grenze sein würden. Dort wollte Pilars Vater sie in Empfang nehmen. Den Rest des Weges würden sie entlang der Küste mit dem Auto fahren. Sie summte leise La Paloma vor sich hin, während Pilar noch ein paar von den Keksen, die für die Abreisenden bereitstanden, einsteckte. Man konnte ja nie wissen.
Elena in Barcelona
Es begann gerade zu dämmern, als Elena von ihrem Liegesitz hoch schreckte. Der Zug bremste und die Räder auf den Gleisen machten ein unangenehm schrilles Geräusch. Sie sah aus dem Fenster und dann auf die noch schlafende Zugbegleiterin. Auch Pilar schlief noch, eingerollt wie eine Katze.
Jetzt kam langsam Bewegung in die beiden Schlafenden, der Zug hatte vollends angehalten. Die junge Zugbegleiterin, die Französin war und Viviane hieß, schlug die Augen vollends auf, sah aus dem Fenster und sagte zu Pilar und Elena
„In einer halben Stunde müsst ihr aussteigen. Macht euch fertig.“
Sie ging davon und kam kurze Zeit später mit zwei Bechern Kakao wieder. Pilar kramte aus ihrer Tasche die kleinen Törtchen, die sie gestern vor der Abreise noch eingesteckt hatten und beide Mädchen frühstückten auf die Schnelle. Sie waren bereits fertig, als der Zug sich wieder in Bewegung setzte und zwischen einem Gewirr von Schienen sich den Weg zum Bahnhof suchte. Reisende, die nach Spanien wollten, mussten in Port Bou den Zug wechseln, da die Spurweiten der spanischen und französischen Eisenbahn nicht identisch waren.
Der Zug erreicht den Bahnsteig und Pilar stieß einen Freudenschrei aus. Sie hatte ihren Vater erblickt. Pilars Vater kam ihnen mit großen Schritten entgegen. Er umarmte Pilar und schwang sie herum, dann gab er Elena die Hand und schließlich winkte er einen Gepäckträger heran und gab ihm den Auftrag, die Koffer und Taschen zu seinem Auto zu bringen.
Die Küstenstraße war zu dieser frühen Stunde noch einigermaßen leer, und so kamen sie zügig voran. Es gab auf der Strecke wundervolle Ausblicke auf das Meer und Elena konnte sich gar nicht satt sehen an der Landschaft, während Pilar in unglaublich schnellem Spanisch mit ihrem Vater sprach. Beide lachten zwischendurch immer wieder und schienen sich ausgezeichnet zu verstehen. Bei Cadaques fuhren sie ab und machten vor einem kleinen Cafe halt. Der Vater bestellte für alle drei spanisches Frühstück, bestehend aus Tortillas, Fladenbrot und Kaffee und danach fuhren sie gestärkt weiter, bis sie Barcelona erreichten. Elena war ein wenig enttäuscht. Weit und breit war kein Meer mehr zu sehen. Sie war davon ausgegangen, dass eine Hafenstadt am Meer liegen müsse und sie das Meer von jedem Punkt aus würde sehen können. Als Pilar und ihr Vater eine kurze Gesprächspause einlegten, zupfte sie Pilar am Ärmel und fragte:
„Wo ist das Meer?“
Pilar zeigte mit dem linken Arm von ihrem Körper weg und sagte: „Da! Allerdings musst du durch die gesamte Stadt, um zum Meer zu kommen und es ist hier ziemlich schmutzig. Wir fahren immer nach Castelldefels oder Sitges zum Baden“.
Der Wagen befand sich jetzt in einem Stadtteil, in dem alte ehrwürdige Häuser in großen Gärten standen. Elena fand, das Wort „vornehm“ wäre hier angebracht. Da hielt der Wagen auch schon vor einem dieser großen Eisentore, die mit Blumenranken verziert waren. Ein großer, schlaksiger und von der Sonne gebräunter Junge sprang von innen herbei und öffnete die beiden Flüge des Tores, so dass die Limousine hineinfahren konnte. Hinter dem Auto schloss er das Tor wieder. Noch bevor der Wagen ganz angehalten hatte, riss Pilar die Tür auf und sprang hinaus, sie rannte die große Freitreppe hinauf und fiel erst ihrer Mutter um den Hals, um sofort danach einen kleinen, vielleicht 4jährigen Jungen an sich zu drücken.
Dabei plapperte sie unentwegt ohne Atem zu holen, wie es schien. Elena stieg langsam aus. Pilars Vater hielt ihr charmant die Tür auf und gab Anweisungen bezüglich des Gepäcks. Der aufgeschossene Junge, der das Tor geöffnete hatte, nahm alle Gepäckstücke gleichzeitig und lief die Treppe hinauf ins Haus. Er hatte Pilars Vater „Don Diego“ genannt.
Pilars Mutter - Dona Maini – empfing Elena mit einem warmen Lächeln und einer Umarmung.
„Ich freue mich sehr, dass du Pilar die Ferien verschönen willst“ sagte sie in einem leicht fremd klingenden Spanisch „und Leon freut sich auch.“
Damit zeigte sie auf den kleinen Jungen, der sich an ihre Seite geschmiegt hatte und mit schelmischen Augen zu Elena aufsah.
Elena bedankte sich in holprigem Spanisch für den freundlichen Empfang und Dona Maini sagte:
„Höflicher wäre es, wenn wir Französisch mit dir sprechen würden. Aber ich denke, es ist auch für dich von Vorteil, wenn du hier vor Ort die spanische Sprache lernst. Also sprechen wir Spanisch mit dir und wenn du etwas nicht verstehst, frag einfach“.
Elena nickte und wollte etwas erwidern, da aber zog Pilar sie ins Haus und die Treppe hinauf, durch einen Flur und in den nächsten Flur hinein. Dann öffnete sie zwei nebeneinander liegende Türen.
„Das ist mein Zimmer“ sagte sie und deutete auf die erste Tür ,„und das ist das Gästezimmer im Mädchentrakt“. Mit diesen Worten schob sie Elena in einen großen Raum, in dem bereits ihr Gepäck stand. Sie führte sie zu den Türfenstern, die mit dunklen Jalousien ausgestattet waren, damit die Sonne den Raum nicht zu sehr erwärme, drückte sie ein wenig auf und sagte: „Das ist unser Garten mit dem Schwimmbecken. Da können wir jetzt den ganzen Tag vertrödeln“.
Elena verbrachte wundervolle Tage mit Pilar und deren Familie. Am Sonntag fuhren alle zusammen schon früh morgens nach Barcelona und gingen zum Gottesdienst in die Kirche Sta. Maria del Mar. Danach fuhren sie zum Castillo am Montjuic, spazierten später durch Gassen des Barri Gotic, aßen zu Mittag im Els 4 Gats und flanierten am späten Nachmittag mit anderen Familien auf den Ramblas. Pilars Vater erklärte und wies auf Sehenswürdigkeiten hin, sprach über die Historie der Stadt und der Provinz und als sie schließlich wieder alle im Auto saßen und die Rückfahrt antraten, war Elena erschöpft aber auch begeistert von den neuen Eindrücken. Deshalb verabschiedete sie sich auch sofort, nachdem sie in Petralbes angekommen waren, und ging schlafen.
Am nächsten Morgen berichtete Dona Maini, dass ihre Mutter am vergangenen Abend noch angerufen und sich nach ihr erkundigt hatte.
„Deine Mutter ist noch in den USA“ sagte Dona Maini „und wenn sie zurückkommt, hat sie nur einen Tag Zeit, bevor sie nach Algerien muss. Ich habe deshalb vorgeschlagen, dass du noch ein Weilchen bei uns bleibst. Auf dem Rückweg von Nordafrika kann deine Mutter hier Station machen, und dann könnt ihr zusammen weiter in die Schweiz fahren. Was sagst du dazu?“
Elena strahlte: „Ich bleibe gerne noch, wenn es nicht zu viele Umstände macht“ fügte sie hinzu.
Dona Maini nahm sie in den Arm.„Ganz und gar nicht“ sagte sie, „wir alle sind sehr glücklich, dass du bei uns bist und dass es dir gefällt“.
Die Zeit verging wie im Flug. Viel zu früh kam der Tag, an dem Don Diego sagte:
„Willst du mit mir zum Flughafen fahren? Deine Mutter kommt heute an“.
Elena nickte.
„Wir müssen nach Reus fahren“, sagte Don Diego, „Barcelona hat nämlich zwei Flughäfen“.
Pilar meldete sich:
„Ich fahre auch mit“ verkündete sie „sonst langweilt sich Elena bestimmt, und Papa macht aus der Fahrt eine Geschichtsstunde“.
„Frechdachs“ lachte ihr Vater gutmütig „also los, dann kommt, wir wollen nicht zu spät sein“.
Leon zog ein Gesicht
„Ich will auch mit“ sagte er. Seine Mutter hob ihn auf den Arm.
„Wir beide machen etwas viel besseres“ tröstete sie ihn „wir beide essen ein Eis“.
Die Caravelle sah sehr elegant aus und war beinahe pünktlich. Sie standen alle hinter einer Sperre und blickten gespannt auf das Rollfeld, als die Treppe herangefahren wurde. Elenas Mutter war unter den ersten, die das Flugzeug verließen und sah sich suchend um. Ihre Haare waren länger, als Elena sie in Erinnerung hatte, ihre Haut war gebräunt und sie trug Leinenhosen, Stiefel und ein Buschhemd. Dazu eine Männersonnenbrille und eine Pilotenarmbanduhr, die an ihren zartgliedrigen Armen merkwürdig aussah.
Dann entdeckte sie die winkende und rufende Elena und lief geradewegs auf sie zu. Einer der Bediensteten des Flughafens wollte sie zum Haupteingang manövrieren, aber sie schüttelte seine Hand ab und eilte zur Sperre, um ihre Tochter zu umarmen. Sie hatte sogar noch Zeit, Pilar und deren Vater zu begrüßten, ehe jetzt 3 uniformierte Flugplatzangestellte sie nachdrücklich aufforderten, zuerst durch die Passkontrolle am Haupteingang zu gehen.
Hinter dem Kontrollpult trafen sich alle wieder und schmunzelnd sah Don Diego zu, wie die drei weiblichen Wesen Neuigkeiten und Eindrücke austauschten. Es dauerte eine ganze Weile, bis das Gepäck eingesammelt war und Sophie und die beiden Mädchen im Auto saßen.
Auf dem Rückweg nach Petralbes fuhren sie am Flugplatz El Prat vorbei, und Sophie buchte Flüge für sich und ihre Tochter für den nächsten Tag.
„Du kannst bei mir im Zimmer schlafen“, sagte Elena, „das geht doch, oder?“ fragte sie Don Diego. Der nickte. „Natürlich, aber deine Mutter kann auch gern eins von den anderen Gästezimmern haben“ sagte er charmant.
„Bloß keine Umstände“ lachte Sophie „ich bin es gewohnt, sogar im Busch oder am Strand zu schlafen. Und da ist es sicher ungleich bequemer, das Bett mit meiner Tochter zu teilen“.
Elenas Ferien in Vietnam
Elena war mit ihrer Mutter vor drei Tagen nach Hause zurückgekehrt, wo ihr Vater schon auf sie wartete. Nun freute sie sich darauf, mit ihren Eltern zwei Wochen in den Staaten zu verbringen. Ihr Vater machte eine Tournee durch Boston, Philadelphia, Baltimore und Washington D.C und wollte die Freizeit jeweils mit seiner Frau und Tochter verbringen. Bisher war sie in Florida und in Kalifornien gewesen, wo sie das Klima angenehm empfunden hatte. Den Osten der USA würde sie jetzt kennenlernen. Ob sie da wohl im Meer baden konnte?
Auf dem Gang vor ihrem Zimmer waren plötzlich laute Stimmen zu vernehmen. Ihre Mutter hatte telefoniert und nun sprach, nein stritt sie mit ihrem Vater.
Elena wollte nicht lauschen, konnte aber nicht umhin, der sehr laut geführten Unterhaltung zu folgen. Gerade sagte ihr Vater:
„Wie stellst du dir das vor? Ich kann doch Elena nicht allein im Hotel zurücklassen. Ebenso wenig kann ich von dem Kind verlangen, dass es sich fünf und mehr Stunden in Konzertsälen herumdrückt und nach den Konzerten noch bei den Empfängen dabei ist. Wir waren uns darüber einig, dass ihr beide lediglich beim letzten Konzert im Zuschauerraum sitzt, ansonsten wolltest du mit Elena etwas unternehmen, während ich arbeite. So war das vereinbart, wen du dich freundlicherweise erinnern möchtest“.
„Da wusste ich ja auch noch nicht, dass sich in Vietnam etwas zusammenbraut, was durchaus zu einem Weltkrieg führen könnte.“ Das war die Stimme ihrer Mutter.
„Und du musst da hinunter und die Welt retten, wie?“ fragt jetzt ihr Vater in erregtem Ton.
„Rede doch keinen Unsinn“ sagte Sophie „aber ich werde mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, vor allen anderen zu recherchieren, was sich da tut. Und wenn du nicht in der Lage bist, unsere Tochter in deine Obhut zu nehmen, fliegt sie eben mit mir. Ich sehe darin kein so großes Problem.“