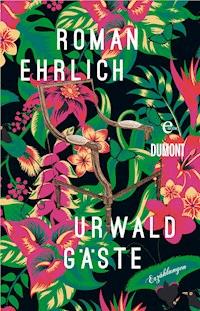14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Longlist - nominiert für den Deutschen Buchpreis 2020 Alle Versuche, die Malediven vor dem steigenden Meeresspiegel zu retten, sind gescheitert, Pauschaltouristen haben sich neue Ziele gesucht, und der Großteil der Bevölkerung musste die Inseln verlassen. Gleichzeitig ist die heruntergekommene Hauptstadt Malé zum Ziel all jener geworden, die nach einer Alternative zum Leben in den gentrifizierten Städten des Westens suchen. Und so wird die Insel für die kurze Zeit bis zu ihrem Untergang zur Projektionsfläche für Aussteigerinnen, Abenteurer und Utopistinnen, zu einem Ort zwischen Euphorie und Albtraum, in dem neue Formen der Solidarität erprobt werden und Menschen unauffindbar verschwinden. Mit »Malé« fängt Roman Ehrlich die komplexe Stimmungslage unserer Zeit ein und verwebt die Geschichten rund um die Sehnsüchte und das Scheitern seiner Figuren zu einem Abbild all der Widersprüche, die das Leben zu Beginn des 21. Jahrhunderts ausmachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Roman Ehrlich
Malé
Roman
Roman
Über dieses Buch
Alle Versuche, die Malediven vor dem steigenden Meeresspiegel zu retten, sind gescheitert, Pauschaltouristen haben sich neue Ziele gesucht, und der Großteil der Bevölkerung musste die Inseln verlassen. Gleichzeitig ist die heruntergekommene Hauptstadt Malé zum Ziel all jener geworden, die nach einer Alternative zum Leben in den gentrifizierten Städten des Westens suchen. Und so wird die Insel für die kurze Zeit bis zu ihrem Untergang zur Projektionsfläche für Aussteigerinnen, Abenteurer und Utopistinnen, zu einem Ort zwischen Euphorie und Albtraum, in dem neue Formen der Solidarität erprobt werden und Menschen unauffindbar verschwinden.
Mit »Malé« fängt Roman Ehrlich die komplexe Stimmungslage unserer Zeit ein und verwebt die Geschichten rund um die Sehnsüchte und das Scheitern seiner Figuren zu einem Abbild all der Widersprüche, die das Leben zu Beginn des 21. Jahrhunderts ausmachen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Roman Ehrlich, geboren 1983 in Aichach, aufgewachsen in Neuburg an der Donau, studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und an der Freien Universität Berlin. Bislang sind von ihm die Bücher ›Das kalte Jahr‹ (2013), ›Urwaldgäste‹ (2014), ›Das Theater des Krieges‹ (2017, mit Michael Disqué) und ›Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens‹ (2017) erschienen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2020 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Büro Ziegler
Coverabbildung: PeterHermesFurian/iStock und Nasa
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490200-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
»Die Werke des Herrn sind große,zum Staunen für alle.«
Psalm
»we are the bubbles in the champagne poured off of the roof
rising always as we fall«
Final Party
Dem Gefesselten erscheint es seltsam, dass man ihn in einen Kellerraum gebracht hat. Er ist immer davon ausgegangen, dass es auf der Insel keine Kellergeschosse gibt oder dass sie längst geflutet sein müssten.
Der Gefesselte wurde auf einen Holzstuhl gesetzt und dort festgebunden. Davor hatte man ihm einen Baumwollsack über den Kopf gestülpt und mit einem harten Gegenstand gegen das Gesicht geschlagen. Der Gefesselte hat eine Wunde unter dem linken Auge. Er spürt, wie sie im Rhythmus seines Herzschlags pulsiert. Die linke Gesichtshälfte ist angeschwollen, die Haut spannt. Der Gefesselte würde seine Wunde gern desinfizieren. Wer weiß, denkt er sich, wer diesen Sack vor mir schon über dem Kopf gehabt hat.
Seine Entführer haben ihn auf den Stuhl gebunden, er hörte ein spitzes Hämmern, einige Schläge und dann ein kontinuierliches Rauschen und Plätschern, als würde ein Schwimmbad eingelassen. Der Baumwollsack wurde ihm vom Kopf gezogen, der Gefesselte hörte, wie in seinem Rücken eine schwere Stahltür zugeschlagen wurde. Er schaute sich um und begriff, dass man ihn in einen Kellerraum gebracht hatte, was ihm seltsam vorkam, eben weil er auf der Insel noch nie in einem Kellerraum gewesen war und geglaubt hatte, dass sie nicht existieren oder längst geflutet sein müssten.
Der Kellerraum wird von einer Leuchtstoffröhre beleuchtet, die an der niedrigen Decke befestigt ist. Ein schmales Kellerfenster aus dicken Glasbausteinen befindet sich unterhalb der Zimmerdecke, dem Gefesselten gegenüber. In einen dieser Glasbausteine ist von den Entführern – das war das spitze Hämmern, das ich gehört habe, denkt der Gefesselte – ein Loch geschlagen worden, durch das jetzt mit großem Druck ein modrig brauner Wasserstrahl in den Kellerraum hereingeschossen kommt. Ich habe keinen Prozess bekommen, denkt der Gefesselte, fast belustigt von der einfachen Klarheit des Satzes. Überhaupt fühlt er sich nicht panisch, sondern sehr ruhig – auf eine unbeschreibliche Art überlegen. Es gab keine Anklage, man hat mir keine Gelegenheit gegeben, mich zu verteidigen. Ich weiß nicht, was mir vorgeworfen wird, wofür ich bestraft werden soll.
Der Gefesselte sieht keinen Sinn darin zu schreien. Das laute Hereinströmen des Wassers füllt den Raum, es ist um seinen Kopf herum und in den Ohren das einzige Geräusch, und der Gefesselte hat den Eindruck, als krieche das Rauschen des hereinströmenden Wassers auch unter die geschwollene Gesichtshälfte, als wäre die Wunde unter seinem Auge eine Öffnung, durch die das Rauschen in seinen Kopf gelangt, wie feine Finger oder Rauch, vielleicht ist auch der Schädel verletzt, denkt der Gefesselte.
Der gesamte Fußboden ist bald von einem gleichmäßigen, dunklen Wasserspiegel bedeckt. Kleine Galaxien aus Öl und Staub rotieren auf der Oberfläche um sich selbst, dazwischen aschene Papierfetzen und grobe Farbschuppen, die von den Wänden abgefallen sind. Aus der Wasseroberfläche heraus, wie die Gebäude der Insel aus dem Ozean, ragen Kabelrollen, Kisten, Papierstapel, Haufen aus Kram. Die Schuhe des Gefesselten stehen bis zum oberen Rand ihrer Sohlen im Wasser. Der Gefesselte spürt die Feuchtigkeit an seinen Füßen. Von dort, wo der Wasserstrahl auftrifft, treiben kleine Schaumberge zitternd davon und verteilen sich im Raum.
Dem Gefesselten wird klar, dass er sich vorsichtig bewegen muss. Dass ein Umfallen des Stuhls die Lebenserwartung in seiner speziellen Lage nochmal drastisch verkürzen würde.
An der Stelle, an der Frances Ford vor einer fast blinden Fensterfront steht, im Licht der schmutzigen Scheiben, die von den grell zwischen den Wolken hervorbrechenden Strahlen der Nachmittagssonne angeschienen werden, der ganze Staub, das Salz und der Dreck auf dem Glas golden aufleuchtend, ist der dunkelblaue Teppichboden über die Jahre ganz bleich geworden. Selbst in den Augenblicken, in denen die Sonne hinter den schwer dahintreibenden Wolken verschwindet, das Leuchten der schmutzigen Scheiben weggedimmt wird, steht Frances Ford in einem lichten, hellblauen Rechteck, im verwaisten Frühstücksraum des Royal Ramaan Residence Hotels, in der sogenannten Daisy Street, in einem Viertel, das die neuen Bewohner der Stadt als Stearson Patch bezeichnen, benannt wahrscheinlich im Andenken an einen der frühen Pioniere, die sich hier nach dem völligen Zusammenbruch der Inselrepublik als Erste angesiedelt haben und denen die bereits bestehenden Namen der Orte nichts bedeuteten oder einfach zum ständigen Aussprechen zu kompliziert waren.
Über die Möbel hat sich eine dichte Staubschicht ausgebreitet. Auch auf der Luft, die sich seit Jahren nicht bewegt hat, liegt der Staub, alt und tot, denkt Frances Ford, und jeder Atemzug dieser staubigen Luft beißt in der Nase und füllt die Lunge mit einem schweren, das Herz ganz düster verschattenden Gefühl. Nirgendwo in dem weiten Raum, der tiefer im Innern des Gebäudes in permanente Dunkelheit getaucht ist, wollten sich die beiden gerne hinsetzen.
Seit ein paar Tagen steht das Wasser fast knietief in den Straßen. Durch den Dreck auf den Scheiben kann Frances Ford die Umrisse eines Fahrzeugs ausmachen, das sich vom Gebäude des Hotels entfernt und in eine schmalere Seitenstraße einbiegt. Ein Amphibienfahrzeug, mit hohen Reifen und einem Schiffsrumpf, davon hat sie schon einige in der Stadt gesehen. Vielleicht ist es auch nur jedes Mal dasselbe, das ihr ständig wiederbegegnet, weil der Raum, auf dem man sich hier bewegt, so begrenzt ist. Es ist durch die schmutzigen Scheiben nicht wirklich zu erkennen, für Frances Ford aber bereits aus der Erinnerung an den Anblick einfach zu ergänzen, wie das Fahrzeug seine Spur durch das dunkle, ölige Wasser zieht, wie kleine Wellen sich keilförmig am Heck des Fahrzeugs bilden und an die Ränder der Straße hinrollen, gegen die Hauswände schwappen, wo sie einen Tumult verursachen unter den Plastikflaschen und dem anderen Müll, der sich dort angesammelt hat.
Frances Ford hat sich mit dem Vater der verstorbenen Schauspielerin Mona Bauch im Frühstücksraum des Royal Ramaan Residence Hotels verabredet, weil dieses Hotel – wie auch die Schauspielerin Mona Bauch – sehr häufig in den Aufzeichnungen des Lyrikers Judy Frank erwähnt wird, dem sie selbst in vergeblicher Mission hinterhergereist ist und dessen Tagebücher, Briefe und Gedichte ihr unter die Haut und in die Seele gefahren sind wie die Feuchtigkeit in die Mauern dieser verlorenen Stadt.
Frances Ford ist etwa anderthalb Wochen vor dem Vater der Schauspielerin Mona Bauch in Malé angekommen. Sie empfindet dem verzweifelten Mann gegenüber einen Vorsprung an Wissen über die Verhältnisse. Gleichzeitig hat sie das Gefühl, dass ihr weniger Zeit übrig bleibt, bevor die umfassende Trägheit, das schwer über den Köpfen hängende schwüle Wetter, der Regen, die nagenden Wellen und die von einem bleichen Mond über die Insel hinweggezerrten Springfluten ihren Antrieb, ihre Kraft und ihren Willen vollständig aufgezehrt haben werden.
Der verzweifelte Vater hat seine Suche gerade erst begonnen. Für ihn gibt es außerdem einen Anhaltspunkt, der Frances Ford fehlt: Die Schauspielerin Mona Bauch hat sich vor zwei Monaten irgendwo hier in der ehemaligen Hauptstadt der Republik das Leben wahrscheinlich selbst genommen, ihr toter Körper wurde gefunden, es gibt Zeugen, die davon ausführlich berichtet haben, und zwei unterschiedliche, sehr unappetitliche Fotografien einer übel verunstalteten Wasserleiche, die für eine Weile im Internet kursierten. Vermutlich wurde sie auf einem der umliegenden Atolle verbrannt oder in einem Sammelgrab bestattet. Der Lyriker Judy Frank ist dagegen ohne Spur verschwunden. Über seinen vielleicht sogar zeitgleichen Selbstmord wird nur spekuliert. Man nimmt an, dass sie gemeinsam gegangen sind.
Der Vater der Schauspielerin Mona Bauch wird zuhause in Deutschland von seinen Angestellten beim Nachnamen genannt und von seinen Freunden, in Ableitung dieses Nachnamens, schon seit der Schulzeit eigentlich, im milden Spott der Zuneigung: Belly. In der Kneipe, in der man ihn gestern nach seinem Namen gefragt hat, wusste er nicht, wie er sich vorstellen sollte. Bauch war ihm zu förmlich, Belly zu privat und sein eigentlicher Vorname so fremd, als gehöre er einem anderen. Dabei war Elmar Bauch aufgefallen, dass er schon sehr lange niemanden mehr kennengelernt hat oder sich außerhalb der Arbeit einer fremden Person vorstellen musste. Er entschied sich zur Vorstellung in seiner Funktion, die ihn auf die Insel gebracht hat, als Vater der verstorbenen Schauspielerin Mona Bauch, um gleich auch klarzustellen, welche Art von Information er sich von den Leuten hier erhoffte: Klärung, einen Hintergrund, vor dem so etwas wie Trauer überhaupt erst möglich wäre, die dann hoffentlich die dumpfe Betäubung ablösen könnte, die ihn umfängt, seit er über sein Endgerät, von einer Push-Nachricht aus der Kategorie Celebrity Check, über den Tod der eigenen Tochter in Kenntnis gesetzt wurde.
In der Kneipe, die der verzweifelte Vater gestern zur ersten Orientierung auf der Insel aufgesucht hat, erzählte man ihm, es existiere eine Art Abschiedsbrief seiner Tochter. Man sei unter Umständen auch bereit, ihm diesen Brief zugänglich zu machen, es ließe sich da etwas einfädeln, ein Treffen arrangieren, zum gegenseitigen Nutzen. Frances Ford überhörte das Gespräch zwischen dem neu Angekommenen und der sehr muskulösen, strikt und kompromisslos auftretenden Niederländerin Hedi Peck am Tresen der Kneipe. Sie bot dem unbeholfen auftretenden Vater an, sich mit ihm am nächsten Tag im Royal Ramaan Residence Hotel in der Daisy Street zu treffen, sie habe ihm keinen Deal vorzuschlagen und sie könne ihm vielleicht auch nicht wirklich weiterhelfen, aber es gebe da eine Überschneidung von ihrer eigenen Suche und seiner, die ihn interessieren könnte.
Frances Ford erklärt dem Vater, der im Raum ein Stück weit hinter ihr steht, nicht im hellen Rechteck auf dem Teppichboden, aber noch im Licht der Fensterfront:
»Ich komme aus einer schönen Gegend in den Vereinigten Staaten, wo es im Winter noch richtig kalt wird und im Frühling sehr grün und lebendig ist, und ich habe an der Universität in meiner Heimatstadt Deutsche Sprache und Literatur studiert und auch einen Ph.D. in dem Fach gemacht, über deutsche Lyrik der Gegenwart. Mich haben vor allem die Lyrikerinnen und die Lyriker interessiert, die nach der Jahrtausendwende geboren wurden, in die Umbrüche nach 9/11, die großen Finanzkrisen und die ganzen Widersprüche der Zeit hinein, und wie sie das in ihren Gedichten versucht haben zu fassen, ganz grob formuliert, von ihrem Standpunkt in Europa aus, mit der speziellen Geschichte von Deutschland, wobei ich alles über das Motiv von der blauen Blume angeschaut habe, die ja für die Romantiker ein wichtiges Symbol gewesen ist, was auch in der DDR eine Rolle gespielt hat und dann später oft ein Chiffre geworden ist für die Politik von den Rechten im Land. Ich weiß nicht, ob Sie sich für zeitgenössische deutsche Lyrik interessieren. Das Symbol von der blauen Blume ist dort sehr präsent. Die ganze Symbolsprache der Romantik hat in der deutschen Lyrik der letzten Jahrzehnte eine Renaissance gehabt. Mein Doktorvater, für den ich an der Uni gearbeitet habe, wollte, dass ich meine akademische Karriere voranbringe und Aufsätze veröffentliche und er hat immer versucht, mir neue Themen zuzuspielen. Ich wollte aber meine Karriere nicht voranbringen. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr an der Uni arbeiten. Vor ein paar Monaten hat mir mein Doktorvater von einer Konferenz in Deutschland den gesamten Nachlass von dem deutschen Lyriker Judy Frank mitgebracht, von dem wir damals noch nicht gewusst haben, dass es ein Nachlass ist, aber inzwischen glaube ich eben, dass Judy Frank gar nicht mehr am Leben ist, was auch mit ihrer Tochter zu tun hat.«
Der Vater der Schauspielerin Mona Bauch hört der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Frances Ford mit einer ihm selbst unbekannten Geduld bei ihren Ausführungen zu. Er erfasst jede Einzelheit überdeutlich und in völliger Klarheit und hat endlich das Gefühl, hier setzt jemand dazu an, ihm all das zu erklären, was bislang so unbegreiflich, unwirklich und albtraumhaft verschlossen gewesen ist. Der Vater der Schauspielerin Mona Bauch hat sich nie für zeitgenössische deutsche Lyrik interessiert.
»Der Lyriker Judy Frank«, fährt Frances Ford fort und hält dabei ihre zählenden Finger zwischen sich und den sehr aufmerksam zuhörenden Vater, »hat bei seinem Verlag in Deutschland neun Gedichtbände veröffentlicht – Verweilen unter schwebender Last, Motorisierte Mädchen, Welt ohne Ende, Die Lümmel aus dem Dritten Reich, Mein Leben als Kind, Ein Zweig und ein Zweiter, Eklipsen, Der Vibe von Wittenberg und Lachs, mein Hase –, bevor er seinem Verleger angekündigt hat, dass er nach Malé gehen will, weil es ihm auf dem Festland nicht mehr gefällt. Frank hat gehofft, dass er hier in Malé unter den Ausgewanderten eine Situation vorfinden könnte, die so wäre, wie er sich immer das Westberlin aus den achtziger Jahren vorgestellt hat, das ja auch eine Insel gewesen ist, die ein bisschen verloren war und wo auch nur hingewollt hat, wer schon etwas gesponnen hat und mit der ordentlichen Gesellschaft nicht richtig zurechtgekommen ist.«
Der Vater der verstorbenen Schauspielerin erzählt Frances Ford, während er noch auf ihre Finger schaut, die sich nach dem Aufzählen der Gedichtbände Judy Franks zu einer Form verschränkt haben, die ihn das Wort Indianertipi denken lässt, dass auch Mona von der Geschichte der geteilten Stadt Berlin fasziniert gewesen sei und dass er sich erinnern könne, wie sie einmal gesagt habe, das wäre das einzige Berlin, in dem sie gerne leben würde, dieses Westberlin von früher. »Ich glaube, mit dem richtigen Berlin von heute ist sie einfach nicht warm geworden. Und dann ist sie ja auch bald nach Frankreich gegangen und danach dann nach Kalifornien. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie in Kalifornien geblieben wäre oder nach Deutschland zurückgekommen, aber ich wurde natürlich nicht gefragt, sie war ja längst erwachsen. Ich konnte mir das alles hier gar nicht vorstellen, aber ich dachte, es ist vielleicht gefährlich.«
Frances Ford nickt, ohne dem Gegenüber dabei ins Gesicht zu schauen. Sie will versuchen, so viel Abstand wie möglich zur Trauer des verzweifelten Vaters einzuhalten. Sie spürt, dass dieser Mann sie als jemanden oder etwas wahrzunehmen beginnt, der oder das in der Lage dazu sein könnte, ihm eine sehr schmerzliche, sehr frustrierende Puzzlearbeit abzunehmen und die bislang noch schlechtsortierten Teile zu einem verstehbaren Gesamtbild zusammenzubringen.
»Frank ist vor drei Jahren hierhergekommen. Und er hat von hier aus seinem Verleger in Deutschland immer wieder E-Mails und Manuskripte und Tagebücher geschickt. Er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass der Verleger in Deutschland alles sortieren und veröffentlichen würde und ihm ein bisschen Geld überweisen, aber der Verleger ist sehr krank geworden und schließlich gestorben, und die Frau vom Verleger hatte kein Interesse, den Verlag weiterzuführen. Sie hat die ganze Korrespondenz und die Archive sortiert, verschiedene Festplatten angelegt, E-Mails ausgedruckt, Konten aufgelöst und dann alles verteilt und verschenkt an die Erstbesten, die sich dafür interessiert haben. So sind die Sachen dann über meinen Doktorvater zu mir gekommen. Ich habe die Gedichtbände von Judy Frank schon gekannt. Seine Inseltagebücher, Gedichte, Skizzen und Briefe aus Malé haben mich aber noch so viel mehr fasziniert als die publizierten Bücher. Erst habe ich versucht, über die Witwe von seinem Verleger einen Kontakt aufzubauen, dann ihm selbst direkt zu schreiben, und weil das alles nicht funktioniert hat, habe ich bei meinem Doktorvater Urlaub beantragt und bin hierhergekommen, um nach diesem deutschen Lyriker zu suchen, was ziemlich verrückt ist, weil er wahrscheinlich eh schon nicht mehr lebt und weil ich auch gar nicht sagen könnte, was passieren würde, wenn ich ihn finde. Also was ich mir vorstelle, was passieren soll. Vielleicht wäre ich gar nicht hierhergekommen, wenn ich nicht schon gewusst hätte, dass es keine Hoffnung gibt.«
»Ich fürchte, ich kann Ihnen da gar nicht weiterhelfen. Ich habe von meiner Tochter nur ein paar E-Mails bekommen, während sie hier gelebt hat. Die können wir uns aber gern nochmal gemeinsam anschauen, wenn Sie meinen, dass Ihnen das etwas bringen könnte.«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihre Tochter und Judy Frank ein Paar gewesen sind oder zumindest romantisch verbunden waren. Meine Vermutung ist, dass Frank für Ihre Tochter einen Kosenamen gehabt hat. Wenn das stimmt, dann hat er sie Luna genannt und dann kommt sie in seinen Texten wirklich sehr oft vor.«
»Luna.« Elmar Bauch spricht den Kosenamen seiner Tochter ein paarmal laut aus und es gefällt ihm überhaupt nicht, wie das Wort sich unaufhaltsam ausbreitet, über sein Gehirn und die Erinnerung an das eigene Kind. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie schrecklich das ist. Luna.«
»Es ist schwer zu sagen, wie man die Sache mit dem Abschiedsbrief Ihrer Tochter bewerten soll. Ich würde Ihnen aber raten, vorsichtig zu sein, dass man Sie nicht ausnutzt.«
In Gedanken fügt Frances Ford für sich noch die Worte im Moment Ihrer größten Schwäche hinzu.
Im Royal Ramaan Residence Hotel ist es nach seiner Aufgabe nie zu einer dauerhaften Hausbesetzung oder Weitervermietung der Räume gekommen. Vereinzelt liegen noch verschimmelte Matratzen in den Betten, mehrheitlich sind die Zimmer aber leergeräumt, alles von Wert abgeschraubt und herausgebrochen, es gibt keinen Strom und die Wasserleitungen sind längst tot und verrostet. Judy Frank hat das Hotel häufig zu beschreiben versucht. Er hatte sich gewünscht, eine Sprache zu finden, die über den üblichen Verfallstourismus und die Faszination für Ruinen hinaus darstellen könnte, was das für ein Ort ist, den die Menschen den Pilzen und Milben zum Aufbau ihrer mikroskopischen Gesellschaften überlassen haben.
Frances Ford und Elmar Bauch steigen durch die Stockwerke des verlassenen Hotelgebäudes bis ganz hoch auf die Dachterrasse, von der Ford erzählt, dass sie für die beiden Vermissten ein romantischer Treffpunkt gewesen sei. Aus den dunklen Fluren, in die man vom Treppenhaus nur ein paar Meter weit hineinschauen kann, drängt eine Lautlosigkeit hervor, der die beiden bei ihrem Aufstieg mit übermäßigem Schnaufen und Seufzen begegnen, um nicht von ihr verschlungen zu werden. Elmar Bauch erinnert sich, dass seine Tochter in einer E-Mail aus Malé geschrieben hat, die Stadt sei voller Orte, die einem das Schweigen nahelegen. Am Absatz des letzten Stockwerks ist aus dem geöffneten Ausgang zur Dachterrasse bereits das Brechen der Wellen zu hören, die ewige Unruhe des Indischen Ozeans, der kaum mehr friedlich, flach und türkisfarben daliegt wie auf den Prospekten von früher, sondern wild und schaumig und tosend, düster aufgewühlt und völlig verseucht vom Abfall der Menschen in ständiger Bewegung ist. Schon vor dem Heraustreten auf die Dachterrasse dringt das Meer den beiden auch in die Nasen. Jeder Atemzug ist satt vom salzigen Geschmack alles Organischen, das in diesem Salzwasser je verendet ist und sich dann langsam aufgelöst hat. Tranig und scharf rinnt dieser Geschmack den Atmenden aus der Nase in den Rachen hinab, füllt den Mundraum aus und legt sich als öliger Film auf die Zunge.
Die Dachterrasse des Royal Ramaan Residence Hotels ist mit verwitterten Holzplanken ausgelegt, aus denen sich rings um einen großen Swimmingpool herum flache Podeste erheben, die früher sicher mit Liegestühlen und Sonnenschirmen bestückt waren. Jemand hat die rechteckigen Blumenkästen am Rand der Podeste zu Hochbeeten umfunktioniert und darin ein paar Pflanzen aufgezogen – Marihuana, Möhren, Salbei, Petersilie –, dann aber offensichtlich vor einiger Zeit schon das Interesse verloren und die Gewächse sich selbst überlassen. In dem großen, weiß gekachelten Loch des Swimmingpools hat sich in den Jahren der Verlassenheit ein sumpfiges Biotop von selbst gebildet: grüne Halme, die der Wind bewegt, dazwischen Grütze und Farne und fauliges Laub.
Das Hotel ist nicht das höchste Gebäude auf der Insel. Trotzdem sind die bis auf den letzten Meter mit Häusern und Straßen zugebauten Ränder in allen Richtungen zu erkennen. Am Ende einer jeden Straßenschlucht dasselbe Bild von anrollenden Wellenbergen, von weißen Adern aus Gischt und Schaum durchzogen, ihr krachendes Zusammensinken und Zurückgesaugtwerden in den nächsten Brecher. Die Flutmauern, die gegen die beständige Arbeit des Meeres auf den Saum des Korallenriffs gesetzt wurden, sind an den meisten Stellen schon zerbrochen und eingestürzt. Das seichte Wasser in den Straßen, das seit den letzten Regenfällen nicht mehr vollständig abgeflossen ist, wird von einer ruhigen, gleichmäßigen Dünung durchzogen. Kein Erdgeschoss der Stadt wird noch bewohnt oder gewerblich genutzt. Alles Leben findet in den oberen Etagen statt. Frances Ford sieht ein paar Schweine auf einem Dach gegenüber eng gegeneinander gedrängt aus einem Holztrog fressen. Sie denkt, dass alles, was hier an diesem Ort passiert, das Vergehen von Zeit ist. Das Meer und seine unermüdliche Vertilgungsarbeit sind die wahrhaftige Entsprechung der vergehenden Zeit. Schon lange ist in dieser Stadt nichts anderes mehr passiert. Es scheint, als hätten die Leute vergessen, dass sie einmal eine Zukunft gehabt haben. Frances Ford schaut sich auf der Dachterrasse des Royal Ramaan Residence Hotels um, versucht, den vom Wind zerzausten Vater der Schauspielerin Mona Bauch dabei auszublenden und sich zu erinnern, wie sehnsuchtsvoll ihr der Ort in der Beschreibung des Lyrikers Judy Frank vorgekommen ist. Sie denkt, dass die Schönheit der Beschreibung nicht in den Dingen liegen kann, die beschrieben werden, sondern ein Abglanz sein muss von der Sehnsucht, die ein anderer empfindet und stellvertretend beschreibt. Sie denkt, dass es eine traurige Sache ist, wenn in den Behausungen der Menschen kein menschliches Leben mehr stattfindet. Und dann hört sie, in ihrem Kopf, klar und deutlich wie in einem geschlossenen Raum, ihre eigene Stimme eine Folge von Wörtern sagen, die ihr zugleich vertraut und urzeitlich fremd vorkommen, wie die ersten Wesen, die einmal aus dem Wasser an Land gestiegen sind, um unsere Vorfahren zu werden – eli, eli, lama sabachthani, sagt die Stimme. Frances Ford muss sehr kurz auflachen und wendet sich dann dem verzweifelten Vater zu, der sie fragend ansieht.
In der mit Abstand bestbesuchten Kneipe der Inselstadt, die offiziell, wie außen angeschrieben, Der Blaue Heinrich heißt, von ihren deutschen Gästen liebevoll Das Leberblümchen genannt wird und von der anderssprachigen Stammkundschaft auch Blue Henry, Nighthowler, Bar Aciano, Sala de Bombas, Goruboi oder Milliways (wobei nicht ganz klar ist, von wem die Ableitungen stammen und worauf sie sich eigentlich beziehen), wird im Sinne der Nachfrage ausgeschenkt und abgefüllt. Es geht, wie immer im Spiel mit den Substanzen, um Auslöschung. Aber natürlich auch um die Geselligkeit, das Soziale, das Gespräch mit dem räumlich nächsten Menschen, Einlassung und Exposition. Wer neu ankommt auf der Insel und sich in die Strukturen fügt, die unter den Ausgestiegenen entstanden sind, der geht zunächst in den Blauen Heinrich, um sich einen Schlafplatz zuweisen zu lassen und außerdem einen Termin beim Professor zu bekommen, der der Gesellschaft der Glücksuchenden als Führer- und Vaterfigur vorsteht. Als letzter Angehöriger der Ältestengeneration und weiser Entscheider, als der der Professor unwidersprochen gilt, wird er von den Milizen, die ihrerseits den Zusammenbruch der Inselrepublik befördert haben und seither die versinkenden Atolle kontrollieren, als Geschäftspartner akzeptiert. Die gesamte Versorgung der Aussteigergesellschaft basiert auf dem guten Verhältnis des Professors zu den Milizen. Ein bürgerlicher Name des Professors ist nicht überliefert. Niemand weiß, ob er je wirklich einen akademischen Titel erworben hat. Man sagt, er spreche die verschiedensten Sprachen ohne Fehler oder Akzent und wisse meistens mehr über die Kunst und Kultur der Herkunftsländer der Leute, die bei ihm vorstellig werden, als diese Leute selbst. Das Büro des Professors befindet sich zwei Stockwerke oberhalb des Blauen Heinrich. Ein Telefon hinter der Bar verfügt über eine direkte Verbindung nach oben. Der Professor ist nie unter den Gästen anzutreffen, vor die Fenster seines Stockwerks sind zu jeder Tageszeit weinrote Vorhänge gezogen, durch die nachts ein künstliches Licht hindurchleuchtet. Es ist nicht möglich, für den Professor im Sinne einer Anstellung zu arbeiten. Es handelt sich vielmehr um ein verantwortungsvoll gepflegtes Verhältnis von Güte, Dankbarkeit, Schuld und Sühne.
In der Regel herrscht im Blauen Heinrich eine ausgelassene Kneipenfröhlichkeit, die all den wirklichen und wahnhaften Stürmen zum Trotz festhält am Leben unter Menschen, das schließlich schon immer kompliziert gewesen ist, widersprüchlich und anstrengend. Immer schon, lautet der Subtext und Konsens der Gespräche im Blauen Heinrich, waren doch die anderen Menschen und das Bier, das man mit ihnen trinkt, der Ausweg aus dem Trübsinn. Ein Gemälde, von einem auf der Insel ausgestiegenen Kunstmaler angefertigt, füllt die komplette Wand im hinteren Gastraum. Das Cover des 1991 erschienenen Albums Nevermind der amerikanischen Grungeband Nirvana ist darauf abgebildet, allerdings ohne deren Schriftzug. Anstatt des Geldscheins, dem der nackte Säugling entgegentaucht, ist auf den Angelhaken eine blauviolette Blüte aufgespießt.
Im großen Raum vorne verläuft eine lange Bar, an der die meisten Gäste aufgereiht stehen, ihre Getränke bestellen und entgegennehmen und mit den verschiedenen Bargeldsorten bezahlen, die auf der Insel akzeptiert werden (die Preise werden dem aktuellen Kurs entsprechend auf den nächsten Schein, das nächste Hundert oder Tausend aufgerundet), oder direkt per Endgerät eine Überweisung tätigen in der vom Blauen Heinrich präferierten Kryptowährung. Die Gespräche an der Bar und in den Gasträumen finden in allen erdenklichen Sprachen statt, wobei häufig der Versuch unternommen wird, einem in der eigenen Sprache ohnmächtigen Gegenüber die relevanten Vokabeln einzeln und sehr deutlich direkt ins Gesicht zu brüllen, aus didaktischen Gründen oder um so vielleicht die Rezeptoren eines tieferliegenden Sprachzentrums, das die Bedeutung aller Worte der Welt ohnehin schon kennt, erreichen zu können.
Manchmal läuft Musik im Blauen Heinrich und manchmal, in den seltenen ruhigen Momenten, bevor es richtig losgeht und die besondere Nachdrücklichkeit erreicht wird, die dem nüchternen Menschen am Anfang eines Abends oft noch fehlt, hört man von draußen das Meer oder den Regen, der hinter den zugeschraubten Kneipenfenstern in die Straßen rauscht und dabei oft so klingt, als bestünde die restliche, den Blauen Heinrich umgebende Stadt ausschließlich aus gigantischen Murmelbahnen, die unablässig neu befüllt werden. Verschiedene Rauchwaren werden geraucht, die Beleuchtung ist diffus, der Qualm, die Unberechenbarkeit betrunkener Bewegung, ein fettiger, menschlicher Dunst, legen sich als Schleier auf die Sicht, penetrated only by odd and misdirecting lights, neu Dazugekommene fühlen sich, als würden ihnen Feinstrumpfhosen über die Köpfe gezogen.
Nachts sind die Straßen der Stadt einzig vom Mondlicht und dem schwachen Schein der Lampen aus den Fenstern der Häuser beleuchtet. Bei klarem Wetter spiegelt sich der Nachthimmel im Flutwasser. Wenn kein Wind geht und kein Mensch oder Fahrzeug die ruhige Oberfläche stört, kann eine einzeln an einer Kreuzung stehende Person den Eindruck bekommen, die Häuser der Stadt Malé schwebten frei im All, das sich über und unter ihr im millionenfach leuchtenden Verglühen der Sterne ausbreitet. Auf den Stufen vom Erdgeschoss zum Eingang des Blauen Heinrich verlaufen feuchte Fußspuren, die meisten Leute auf der Insel tragen Anglerhosen, Gummistiefel oder Schwimmschuhe, da niemand gern länger als nötig die eigene Haut dem Wasser in den Straßen aussetzt. Vor der Eingangstür stehen Surfbretter, improvisierte Flöße und Stechpaddel an die Wand gelehnt. Wer von der Straße kommend, aus der Dunkelheit der Nacht oder dem hellen Mondlicht heraus, den Blauen Heinrich betritt, kommt dabei immer auch nach Hause, nicht selten zum ersten Mal. Gläser werden erhoben, ein Stuhl herangezogen oder eine Lücke am Tresen frei gemacht. Die einzeln in die neue Gemeinschaft hinein Ausgewanderten verhalten sich solidarisch, jeder einzelne Aussteiger und jede Aussteigerin, im eigenen Individualismus kompromisslos, ist am Ende doch vereint im Gruppenbild einer auf Grund gelaufenen Besatzung, die ihrem Schiff die Treue hält. Jeder träumt für sich allein den Traum vom unbekannten, unverbrauchten Ort und teilt dadurch mit den anderen dieselbe Vision von Ankunft, Erforschung und Entdeckung und dabei auch die tägliche Realität aus Warten und Spähen, dem Lesenlernen der Phänomene des Wetters und der Gezeiten und dem tiefen Bedürfnis nach ausführlichen Gesprächen, über den Stand der Dinge und das innen, in einem, herrschende Gefühl. Unendliche Freizeit, Langeweile und eine fundamentale Heimatlosigkeit legen den im versinkenden Inselstaat abgestiegenen Aussteigern das regelmäßige Trinken und Reden so nahe ans Herz wie sonst nur noch die Selbstbefriedigung und den künstlerischen Ausdruck.
An einem ruhigen Abend nach tagelangem Regen tritt der vor einigen Monaten gemeinsam mit seinem Bruder Fabrizio auf die Insel ausgewanderte Flavio Gentili einzeln an jede Gruppe und an jeden Gast im Blauen Heinrich heran. Die beiden Brüder sind vor zwei Wochen im Streit auseinandergegangen, haben sich seither nicht mehr beieinander gemeldet und sich auch nicht zufällig irgendwo getroffen. Flavio Gentili wurde am Morgen von einem entsetzlichen Gefühl der Trennung befallen. Seither geht er auf der Insel herum und fragt jeden, den er trifft: »Hast du meinen Bruder gesehen?«
Gentili ist an diesem Abend nicht empfänglich für den witzigen Spruch, für Nachfragen oder Kommentare. Sobald er bemerkt, dass von der gefragten Person keine relevante Information zu bekommen ist, wendet er sich ab und fragt die nächste. Die sehr muskulöse, strikt und kompromisslos auftretende, breit an der Bar lehnende Niederländerin Hedi Peck, die sich im Gespräch mit einem nervös und unsicher wirkenden Menschen befindet, den sie angriffslustig anfunkelt, eine verbale Demontage in Vorbereitung oder schon im Gange, lässt er bewusst aus, weil er sich denkt, die kann mir eigentlich nur schaden, selbst wenn sie etwas weiß. Als niemand mehr zu fragen übrig ist, steht Flavio Gentili eine Weile im Blauen Heinrich herum und überlegt, eher aus Gewohnheit, ob er ein Getränk bestellen soll. Die nicht an ihn gerichteten, durcheinandergeredeten Fetzen der Gespräche hört er heute mit anderen Ohren.
Die Bartenderinnen Alex und Mariza haben unmittelbar vor ihrer Schicht auf einer Bühne in der Nähe die Hauptrollen in einem Theaterstück von Aphra Behn gespielt. Ein Zuschauer von eben steht an der Bar und redet aufgebracht auf sie ein – »Kann doch nicht sein, dass ihr da gar nicht mehr drüber reden wollt. Wollt ihr jetzt nur noch so schön und souverän hinter der Bar stehen?« Von irgendwo links hört Flavio Gentili die Sätze: »Ich kann mich nur noch an diesen Dicken erinnern, der immer den Polizisten gespielt hat.« Und: »Ich würde schon auch gerne mal gefickt werden, aber halt nicht von dir.« Sowie: »Man kann halt nicht Peter Pan und Peter Szondi gleichzeitig sein.«
Er beschließt, ohne Bier noch weiter nach seinem Bruder zu suchen, woanders als im Blauen Heinrich. Auf dem Weg nach draußen wird er von einem Schwerstbetrunkenen aufgehalten, der ihm einen Zeigefinger gegen die Brust stößt und sagt: »Ein jeder Mensch hat mindestens zwei sehr aktive Ringmuskeln an seinem Körper, die er jeweils unterschiedlich gut kontrollieren kann. Die meisten kontrollieren den einen ein bisschen besser als den anderen.« Flavio Gentili versteht kein Wort, weil er die Sprache des Schwerstbetrunkenen nicht spricht. Er wartet ab, bis der Schwerstbetrunkene das Interesse verliert und die Tür freigibt. »Ich sehe ja, dass du mich anschaust«, sagt der Betrunkene, »aber ob du mir zuhörst, das sehe ich nicht.«
Eine einzelne Person geht auf der Brücke der Freundschaft aus der Stadt hinaus aufs Meer. Ohne den Schutz der Gebäude wird sie mehrfach von starken Windböen erfasst und aus dem Gleichgewicht gebracht. Die Haare der Person werden vom Wind aufgestellt und so bewegt, dass man von außen meinen könnte, sie befänden sich schon unter Wasser, im Einklang mit dem Tanz der Algen. Die Person läuft die ganze Strecke bis an die Stelle, an der die Fahrbahn an einer schroffen Kante nach unten weggebrochen und ins Meer gestürzt ist. Dort bleibt sie stehen und schaut über das fehlende Stück hinweg auf die andere Seite. In unregelmäßigen Abständen zerspritzt eine Welle in weißer Gischt an einem der Pfeiler, die sinnlos zwischen den Bruchkanten der Brücke der Freundschaft aus dem Meer herausragen. Auf der gegenüberliegenden Seite hängen lose Fahrbahnbrocken an rostigen Stahlstreben an der Abbruchstelle herunter, dahinter ist die Brücke etwa zwanzig Meter weit in starker Schieflage einseitig abgesackt und von Rissen durchzogen. Die Person kann von der Kante aus bis auf die Inseln Hulhulé und Hulhumalé blicken, mit denen die Stadt Malé einmal durch die Brücke der Freundschaft verbunden war. Der ehemalige Velana International Airport befindet sich dort, aufgelassene Wohnsiedlungen, die zum Teil von den Milizen verwendet werden, und ein stillgelegter Fährhafen, in dem, vom Standpunkt der Person aus nur als silbergraue Silhouette zu erkennen, das große Kreuzfahrtschiff vertäut liegt, das nicht mehr fährt und von verschiedensten Gerüchten umrankt wird.
Die Person sieht zwei Milizionäre in Neoprenanzügen in einem Schnellboot an der Brücke vorbei in Richtung des Kreuzfahrtschiffes fahren. Das Schnellboot klatscht vom Kamm der einen Welle auf den Rücken der nächsten, den Milizionären hängen Sturmgewehre über den Schultern, die Läufe zeigen in den Himmel. Sie müssen sich sehr gut festhalten, denkt die Person.
Die Person ist in der letzten Zeit häufig frühmorgens aufgewacht, weil sie keine Luft mehr bekommen hat. Sie war jedes Mal heftig aufgeschreckt, die Lunge bis zum Hals hinauf komplett blockiert, und erst nach ein paar Sekunden war ihr das Atmen wieder möglich. Bei diesem Aufwachen ist die Person von einer Panik befallen worden und hatte sich hinterher gedacht: Wenn jemand mit mir im Bett gelegen hätte, dieser jemand wäre sicher sehr erschrocken und hätte sich Sorgen gemacht.
An diesem Morgen hatte sich das Aufwachen aber grundsätzlich von den vorherigen Malen unterschieden. Die Person könnte mit niemandem darüber sprechen, ohne dass es ihr peinlich wäre, aber sie war an diesem Morgen beim Aufwachen überhaupt nicht panisch, obwohl sie wieder nicht einatmen konnte und keine Luft bekam. Alles war unheimlich verlangsamt, ihre Bewegungen, ihr Denken, schwebend und ohne Gewicht. Die Person hörte – und das wäre ihr wohl peinlich gewesen, wenn sie jemandem davon erzählt hätte – einen langgezogenen, wunderschönen Laut, einen Ruf, wie einen Walgesang. Und unter diesen Walgesang mischte sich ein redinischer Chor, ein uralter und ebenso wunderschöner Chant, der weiter in die Vergangenheit zurückreichte, als die Person mit ihrem Geist erfassen konnte. Als die Person schließlich einatmete, tat sie es ohne eigene Anstrengung. Die Luft strömte ihr ganz von selbst in die Lunge und verdrängte dabei etwas anderes, von dem die Person sich erfüllt gefühlt hatte. Der Walgesang und der vorzeitliche Chant verstummten und die Person sah ein fahles Licht vor ihrem Fenster, das den Sonnenaufgang ankündigte.
In ihren Träumen der letzten Zeit hatte die Person sehr häufig den Kopf in den Nacken gelegt und über sich düstere Sturmgewitterwolken aufwallen sehen. Die Wolken rollten unheimlich nah über sie hinweg in großer Geschwindigkeit. Die Person dachte sich jedes Mal im Traum, sie könnte ihre Hand ausstrecken und die Wolken berühren und dass sie schon ganz genau wüsste, wie sie sich anfühlen würden. Wenn sie ihren Blick senkte, sah die Person neben und unter sich weite Kelpwälder, deren Stiele und Blätter synchron im Rhythmus eines von sehr weit herkommenden Rauschens sich bewegten, das lauter wurde und verschwand mit jeder neuen düsteren Wolke, die über die Person hinwegging. Zwischendurch fuhren einzelne Lichtspeere in den dunklen Grund der Wälder hinab, beleuchteten eine sich umstülpende Qualle oder einen Schwarm winziger Fische.
Die Person tritt einen Schritt näher an die Bruchkante der Fahrbahn heran und schaut vor sich nach unten auf die unruhige Oberfläche des Wassers. Eine dunkelblaue Plastiktonne, aus der ein kleiner weißer Plastikzapfhahn herausragt, schunkelt lustig über die Wellen zu ihren Füßen. Die Person erinnert sich daran, wie der Lyriker Judy Frank vor seinem Verschwinden einmal einen Satz aus seinem Inseltagebuch für sie übersetzt hat.
»Wie Obelix in den Zaubertrank bin ich als kleiner Junge in den Lethestrom gefallen«, hatte der Satz gelautet, »und muss seither immerfort alles, was ich weiß, vergessen«.
Der Professor empfängt den Vater der verstorbenen Schauspielerin Mona Bauch drei Tage nach dessen Ankunft auf der Insel in seinem Büro über dem Blauen Heinrich.
Dem Vater wurde der Aufgang gezeigt, der aus der Kneipe in ein dunkles Treppenhaus führt. Er stieg die Stufen hoch bis zu einer Wohnungstür, über der ein schwach funzelnder Baustrahler angebracht war. Auf dem Weg nach oben kam es ihm mehrfach so vor, als würde er von lauernden Gestalten aus dem Dunkel des Treppenhauses heraus beobachtet. Elmar Bauch klopfte an die Tür, wie man ihn angewiesen hatte, wartete eine knappe Minute, bevor er nochmal klopfte und schließlich von einer Stimme hinter der Tür hereingebeten wurde, ohne dass er hätte sagen können, ob die Person, der die Stimme gehörte, schon die ganze Zeit über da gewesen war und ihn ausschließlich aus strategischen, also aus machtpolitischen Gründen vor der Tür hatte warten lassen. Elmar Bauch dachte tatsächlich die Worte machtpolitische Gründe, als er die Tür in den warm beleuchteten Raum hinein öffnete, in dem er als Erstes einen scharfen Buttersäuregeruch wahrnahm, wie er ihn sonst nur aus den Wohnungen verwahrlosender Tierfreunde kannte.
Der Empfangsraum des Professors ist mit Teppichboden ausgelegt, der Tür gegenüber steht ein großer Schreibtisch, an dem der Professor sitzt, eine kleingewachsene, altersschlaffe Gestalt, der die Zeit einen ewigen Zweifel ins Gesicht gegraben hat. Vor dem Schreibtisch befindet sich kein Stuhl. Eintretende müssen ihre Anliegen stehend vorbringen und sich dabei beobachten lassen, wie sie so ausgestellt mit ihren Gliedmaßen umgehen, welche Haltung sie beim Sprechen einnehmen und wie sie die aus dieser Konstellation erwachsende Herausforderung bewältigen, dass die kleine Gestalt des Professors mit dem größten Respekt von oben herab adressiert werden muss.
Der Vater der toten Schauspielerin tritt vorsichtig an den Schreibtisch heran, wobei es ihm so vorkommt, als müsste er sehr viel mehr Schritte machen, als für die kurze Distanz nötig wären. Die Wand rechts vom Professor ist vollständig mit übervollen Bücherregalen bedeckt. Zwischen die Bücher sind einzelne Blätter und Zettel so gestopft, dass wirklich nirgends mehr eine Lücke frei ist und das ganze Gebilde, denkt der Vater, in sich zusammenfallen muss, wenn einer einmal ein einzelnes Buch dort herauszieht. An der Wand hinter dem Professor, über seiner sitzenden Gestalt, hängt ein großformatiges Gemälde, eine abstrakte Kunst, die zugleich sehr konkret und gegenständlich auf den Vater wirkt: rote und gelbe Farben, kleine blaue Flecke, einige kohlenschwarze, aggressiv hineingeworfene Striche, schon im Zerfließen angedeutete Formen, als hätte jemand das Bild im Innern eines Feuers gemalt, denkt der Vater, ohne dabei selbst zu verbrennen.
Der Professor begrüßt den Vater der toten Schauspielerin Mona Bauch und der Vater der toten Schauspielerin Mona Bauch begrüßt seinerseits den Professor und ihm fällt auf, dass die kleine Person hinter dem Schreibtisch tatsächlich völlig akzentfrei die Muttersprache des Vaters spricht, als wäre es die eigene.
Durch die Wand links vom Schreibtisch des Professors führt ein Durchgang in ein Nebenzimmer mit drei Fenstern nach draußen, vor die sämtlich weinrote Vorhänge gezogen sind. Der Vater sieht, durch den Durchgang hindurch, mittig im Raum wie eine Installation, eine Katze auf einem versifften Samtpolster liegen. Und obwohl Elmar Bauch nur sehr kurz durch den Durchgang ins Nebenzimmer schaut, sieht er dort einige Details an der Katze auf dem Samtpolster sehr genau. Wie ein grelles Licht, das sich auf die Netzhaut schreibt und dann als Negativ durchs Gesichtsfeld geistert, sieht der Vater diese Details noch vor sich, als er den Blick schon wieder auf den Professor hinter seinem Schreibtisch gerichtet hat. Er sieht die von einem schleimigen Sekret verklebten Augen der Katze, in groben Büscheln starr festgetrocknetes Fell und eine rasierte Stelle am Bauch des Tiers, wo ein langer Schnitt sehr unsauber vernäht wurde. Der Vater sieht noch im Hinabschauen auf das abwartende Gesicht des Professors glänzende Hautwülste zwischen schwarzgrindigen Fäden und am unteren Ende des Schnitts im Bauch der Katze eine wundgekratzte, eitrige Stelle. Du bist das also, die hier so stinkt, denkt der Vater, ohne aber seinen Blick von dem des Professors, dessen gütigen Augen, wie der Vater findet, nochmal abwenden zu können, um das Tier anzuschauen, dem der Satz ja eigentlich gilt.
Der Professor ist es schließlich, der als Erster etwas sagt, in die träge Stille des Raumes, in dem nur das Summen von elektrischem Licht zu hören ist.
»Haben Sie sich inzwischen schon ein wenig eingelebt bei uns?«
»Ich würde gerne etwas über meine Tochter erfahren, von der man behauptet, dass sie hier gestorben ist. Ich möchte sie gerne sehen oder zumindest wissen, wo sie geblieben ist. Ich habe gar nicht vor, mich hier einzuleben.«