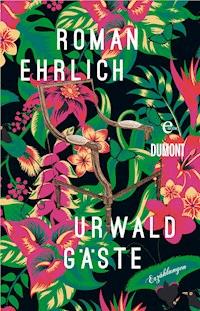8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Traumhaft, klug und voller Poesie: das Debüt von Roman Ehrlich Das Land ist eingeschneit. Ein junger Mann wandert an einer Autobahn entlang. Einsame Felder, Jauchegruben, Rasthöfe und fensterlose Möbelhäuser sind die Stationen seines Weges. Das Ziel ist ein Dorf am Meer, am Rande eines ehemaligen Militärgebietes, wo sein Elternhaus steht. Müde und erschöpft muss er bei seiner Ankunft jedoch feststellen, dass die Eltern verschwunden sind. Ein geheimnisvoller Junge öffnet ihm die Tür. Schweigsam und störrisch zieht sich dieser in der darauffolgenden Zeit meist in das Kinderzimmer zurück, wo er an einem mysteriösen Projekt arbeitet. Nach und nach finden die beiden Zugang zueinander. Was sie verbindet, sind Geschichten. Historische Geschichten von Auswanderern und Naturkatastrophen. Aber auch nacherzählte Geschichten aus dem Fernsehen, die den Jungen begeistern. – Am Ende steht mitten in der Eislandschaft ein Haus in Flammen, und in den Augen der Dorfbewohner spiegelt sich weit mehr als die Farbe des Feuers. Roman Ehrlich hat einen Roman geschrieben über die Einsamkeit der Menschen. Mit enigmatischer Brutalität verwebt er Historie und Gegenwart zu einem poetischen Meisterwerk. Ein Debüt, das niemanden kaltlässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
R O M A N E H R L I C H
eBook 2013
© 2013 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nurten Zeren/zerendesign.com
Umschlagabbildung: © Tetra Images
eBook-Konvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8752-1
www.dumont-buchverlag.de
Für Ima, Jochen und Anselm
In den Leuchtstoffröhren, die über unseren Köpfen zu jeder Tageszeit für künstliche Beleuchtung sorgen, ist kurz ein klirrendes Geräusch zu hören.
Ich schaue hoch, sehe aber nichts. Kein Flackern. Das Licht ist weitflächig, überall voll da und scheint herunter auf die Schreibtische, die Monitore, Drucker, die Beistellmöbel, die verschiedenen Frisuren und Scheitel, die kahlen Kopfhäute, die es zurückstrahlen. Draußen vor den Fenstern die letzten Stunden Tag. Goldenes Licht. Die Häuser der Stadt scheinen auf. Wenn man ans Fenster treten würde, dort, wo die gläserne Fassade die Luft der Stadt berührt, dann würde man unten den Fluss sehen, der jetzt auch schon aufstrahlt in der Abendsonne, man würde die Ziegelbrücke mit den vier hochragenden Türmen sehen, die diesen Fluss überspannt, das Grün und das Blühen der Bäume.
Zwei junge Frauen am anderen Ende des Raumes blicken besorgt auf eine verkümmerte Topfpflanze. Auch sie schauen rüber zum Fenster. Eine der beiden deutet mit der Hand auf die Fensterfront, auf die Pflanze, dann an die Decke, die andere nickt und hält während des gesamten Gesprächs eine sehr kleine Gießkanne aus gelbem Plastik in der Hand. Auf der anderen Seite der gläsernen Fassade: die Luft des Abends über der Stadt. Und es muss eine warme Luft sein, die nach allem Möglichen riecht, während es hier drin, auf der klimatisierten Seite, nach frisch verlegtem Teppichboden riecht, nach Druckertoner, nach verbranntem Staub aus den Lüftern der Computer, ausgezogenen Schuhen, Plastik und heiß gewordenen Schreibtischlampen.
Es wird draußen, vor dem Bürokomplex, wenn ich ihn verlasse, in einer Stunde vielleicht oder etwas mehr, ein warmer Abend sein. Am Flussufer, auf der Ziegelbrücke, auf den Bänken vor dem gläsernen Gebäude, dem grünen Parkstück auf der anderen Straßenseite, werden Menschen in kurzen Hosen, Kleidern, Unterhemden, mit Hüten und Baseballmützen herumsitzen, auf und ab laufen.
Ich schaue einmal noch zu den beiden Frauen hin, die eine hält jetzt ein schwach herabhängendes Blatt in ihrer Hand.
Ich erinnere mich an das, was Richard gesagt hat, vor ein paar Wochen nur, unmöglich kann das länger her sein, als dieses gläserne Gebäude, die Stadt davor, der Abend, die warme Luft noch absolut undenkbar gewesen sind. Ich sehe die eine der beiden Frauen vom Schreibtisch, auf dem sie halb gesessen hatte, aufstehen, die gelbe Gießkanne in der Hand, und denke an Richard, wie er sagt:
Unter denen, die draußen auf dem Feld sitzen, erkennt man die Toten daran, dass der Schnee auf ihnen liegen bleibt.
ERSTER TEIL
Ich verließ die Stadt auf meinen Füßen zur kältesten Zeit des Jahres. Am Morgen war es dunkel gewesen, als ich aus dem Haus ging. Als ich dann am Stadtrand ankam, war bereits ein trübgraues Licht über den Himmel gekrochen. Ein paar dunkle Wolkenfetzen hingen unbewegt vor dem hellen Grau, kamen auch nicht an gegen die flächige Konturlosigkeit, gegen das Weiche, das sich über der ganzen Stadt und, wie ich sehen konnte, als ich ihre Grenze erreichte, auch über das umliegende Land erstreckte.
Ich trat hinaus in eine vom Schnee weich und ruhig gewordene Landschaft.
Diese Stadt geht nicht über in Dörfer, Satellitensiedlungen, Industriegebiete – an ihren Grenzen beginnen die Felder der umliegenden Bauernhöfe, alles war zugeschneit, vereinzelte Forste ragten aus der Landschaft mit ihren schwarzen, laublosen Zweigen und Stämmen, die Badeseen waren zugefroren und ebenfalls von einer weißen Schicht bedeckt.
Es war kein lange vorher gefasster Entschluss. Ich konnte einfach plötzlich nicht mehr in meiner Wohnung bleiben, in meiner Straße, dem Viertel, kein einziges Mal mehr um dieselbe Ecke laufen wie gestern schon, mit dem kleinen Supermarkt auf der einen und dem großen Supermarkt auf der anderen Straßenseite, der Haltestelle der Straßenbahn zwischen den beiden Fahrspuren, den zerkratzten Scheiben des Wartehäuschens, dem Schienengeräusch, wenn die Straßenbahn an der Kreuzung um die Kurve fuhr. Ich wollte das auf einmal alles nicht mehr haben oder sehen, mir war das Geld ausgegangen und infolgedessen auch irgendwie die Zeit abgelaufen. Ich brachte keine Geduld mehr auf für die Arbeitsprozesse der Automaten, die meine Fahrscheine druckten, den Einwählvorgang meines Internetanschlusses, Warteschlangen von Menschen, selbst wenn ich an einer Tankstelle vorbeilief, an der ein fremder Mensch ein fremdes Auto betankte, machte mich das endlose Gluckern aus dem Einfüllstutzen in den Tank, das Rattern der Säule beim Zählen von Litern und Geldbetrag unheimlich nervös.
Ich tat einen Schritt aus der Stadt hinaus in die verschneite Landschaft, in Richtung Norden, wo das Land übergeht ins Meer, wo an der Küste, nah an einen breiten Strand gebaut, das Haus meiner Eltern steht, in dem ich aufgewachsen bin und auf dessen Klingel ich meinen Finger legen würde, ohne Vorankündigung. Wo ich ein paar Tage oder ein paar Wochen verbringen könnte und nachdenken über die Vergangenheit und die nächste Zukunft.
Nach wenigen Hundert Metern, die ich eine Landstraße entlanggelaufen war, hatte sich um die Stadt schon ein dunstiger, kalter Nebel gelegt. Es war nicht mehr mit Sicherheit zu sagen, ob die dunklen Schemen der Hochhäuser tatsächlich noch dort zu sehen waren oder vielleicht schon auf das Grauweiße, das immer dichter um mich herum aufzog, von meiner bereits verdämmernden Erinnerung aufgemalt wurden. Ein kurzes Zurücksehen vielleicht, nach den ruhig am Stadtrand liegenden Hochhaussiedlungen, die ich in einem hohl in meinem Kopf umherlaufenden Selbstgespräch abwechselnd als mein Zuhause oder die Zivilisation bezeichnete, schließlich aber als Nichts richtig zu greifen bekam, das Zurückschauen also einfach bleiben ließ und nur noch auf das andere eintönige Gespräch meiner im Schnee knirschenden Stiefel hörte.
Die Straße, an der ich entlanglief, zog sich als feucht-schwarze Linie durch die Landschaft. Lange bevor sie schließlich auftauchten, waren die vorbeifahrenden Autos aus der Ferne zu hören, angekündigt durch das Fauchen der nassen Reifen auf dem Asphalt.
Nach einiger Zeit mündete die Landstraße, an der ein parallel geführter Radweg verlief, auf dem es sich gut gehen ließ, in den Beschleunigungsstreifen einer mehrspurigen Bundesstraße. Gelbe Schilder zeigten in Richtung kleiner Ortschaften nahe der Stadt. Der Fahrradweg knickte kurz vor der Kreuzung ab, lief rot markiert über die Fahrbahn, die er die ganze Zeit begleitet hatte, und führte auf der anderen Seite wieder zurück in die Stadt. Hinter diesem Knick stieg sanft das verschneite Metall einer Leitplanke aus dem Boden, nahm den Verlauf der Bundesstraße an und zog sich an deren Rand bis zum Horizont. Im regelmäßigen Abstand von fünfzig Metern waren Leitpfosten aufgestellt, mit ebenfalls vom Schnee verklebten Reflektoren. Ich lief weiter auf der Böschung, die hinter der Leitplanke schief abfiel, bis mir von diesem schrägen Gehen der Rücken wehtat, dann lief ich im angrenzenden Feld, das unter der Schneedecke sehr uneben war von Aufwerfungen, Ackerfurchen, Traktorrillen und Steinen. Ich überquerte einen Bewässerungsgraben mit einem Sprung, der Verkehr auf der Bundesstraße war stärker geworden. Unausgesetzt fuhren jetzt Autos in Richtung der Stadt oder in Richtung der Autobahn, die irgendwo in dem grauen Dunst vor mir in der Landschaft lag. Auf dem offenen Feld war ein kalter Wind aufgekommen, der mir ins Gesicht biss an den Stellen, die nicht von meinem dunkelgrauen Wollschal umwickelt waren, der auf der Innenseite warm und feucht vom Atem auf den Lippen lag.
Außer diesem Schal trug ich gefütterte Lederhandschuhe, eine Wollmütze und einen dicken Mantel, schwere Wanderstiefel und einen kleinen Rucksack auf meinem Rücken, in dem sich ein paar Äpfel befanden, eine zusammengerollte Tageszeitung, die ich beim Verlassen des Hauses aus dem Briefkasten eines Nachbarn gezogen hatte, ein Rest Brot, ein Fotoapparat und eine Thermoskanne mit heißem Wasser. Wenn ich schnell genug ging, wurde mir in dieser Kleidung so warm, dass mein Kopf unter der Mütze zu jucken begann, dann ging ich wieder etwas langsamer. Nur wenn ich irgendwo stehen blieb, um mir etwas anzusehen, eine große Werbetafel oder einen Jägerstand, wenn ich in einiger Entfernung ein Tier sah und es nicht verscheuchen wollte, wurde mir schnell kalt, vor allem an den Füßen.
Nach einigen Stunden des Gehens entlang der Bundesstraße inspizierte ich eine Scheune, die an einem sich leicht noch unter der Schneedecke abzeichnenden Feldweg lag und in der sich mit weißer Plastikfolie umwickelte Heuballen befanden. Im hinteren Bereich, kaum mehr sichtbar in der fensterlosen Konstruktion, eine schwarze Abdeckplane über etwas Aufgehäuftem, die mit alten Autoreifen beschwert war. Es roch nach gar nichts, obwohl das Holz der Außenwände sehr feucht war und auf dem erdigen, platt getretenen Fußboden auch einiger Müll herumlag. Leer getrunkene Bierdosen vor allem, Wurstverpackungen, ein zerknüllter Sack Hundetrockenfutter. Ich fand zwischen diesen Dingen keinen Platz, an dem ich mich hätte ausruhen können oder vielleicht sogar etwas schlafen, und lief also weiter über das Feld und durch einen Fichtenforst, dessen Boden trocken und weich war unter meinen Schuhen und übersät mit braunen Nadeln. Zwischen den letzten Stämmen in diesem Forst blieb ich eine Weile stehen und aß einen Apfel. Man überblickte von hier aus eine Art Talsenke, eine weite Ebene, an deren Ende die Bundesstraße einen Hügel hinaufführte. Kurz vor der Hügelkuppe, für eine ganze Weile noch unlesbar weit entfernt, überspannte ein großes Fernverkehrsschild die Fahrbahn, von dem ich hoffte, die Angabe der verbleibenden Kilometer zur Autobahn sei dort aufgeschrieben.
Der Wind blies weiterhin stark über die vor mir liegende Landschaft. Am Himmel hatte sich nichts getan, und nur an dem warmen, klopfenden Gefühl in meinem Rücken, meinen Knien und Füßen konnte ich spüren, dass ich sehr lange schon gelaufen sein musste. Immer wieder versuchte ich mich aufzurichten, aus der eingesackten Haltung, in die ich aber sofort wieder zurückfiel, sobald ich an etwas anderes dachte. Ich redete mir laufend ein, dass dieses Aufrichten ein Trotz gegen die Kälte war und dass es mich so trotzend dann weniger fror. Auf den Feldern vor mir trieb der Wind Schneeverwehungen vor sich her, sie schlängelten sich über den gleichfarbigen Untergrund, waren richtig nur dann zu sehen, wenn sie die Fahrbahn der Bundesstraße erreichten, und trugen sonst zu einer ständigen Unruhe in den Feldern und Flächen bei, zu einer Art Seegang vielleicht. Es kam mir vor, als gehe ein großer Umbau vonstatten in den kleinsten Teilen, und als ich selbst in die Ebene hineingewandert war, tief in eines der Felder, glaubte ich meinen eigenen Blick von dort hinten, vom Forst aus, den Apfel essend, im Rücken zu spüren, sah mich vorangehen in eingesackter Haltung, alles unterhalb der Brust immer unschärfer und konturloser werdend, von den weißgrauen Schneewehen erfasst, die Beine schon aufgelöst und übergegangen in die Landschaft.
Ich war sehr müde geworden, als ich sah, wie die Bundesstraße, deren Verlauf ich bis zum Einbruch der Dunkelheit gefolgt war, in ein kleeblattförmiges Autobahnkreuz mündete. Kleine Seitenarme zweigten ab, die alle Fahrtrichtungen miteinander verbanden. Das System der Auf- und Abfahrten musste mit Vorsicht überquert werden. Die Autos hatten ihre Scheinwerfer den ganzen Tag schon angestellt, orientierten sich aneinander und folgten dem fließenden Verkehr bei schlechter Sicht.
Aber ich erkannte schon, dass sich auf der anderen Seite der Brücke, die über die Fahrspuren der Autobahn führte, ein Rastplatz befand. Eine große Tankstelle, deren gelbes Licht in der dunkelgrauen Landschaft glomm, ein Selbstbedienungsrestaurant, ein weitläufiger Parkplatz und etwas abseits ein würfelförmiges Hotelgebäude mit sehr kleinen Fenstern und einem schmutzigen Schild auf dem Dach, auf dem ein Bettensymbol abgebildet war und in großen roten Zahlen der Preis für eine Nacht im Einzelzimmer. Von dem heißen Wasser in meiner Thermoskanne hatte ich lange Zeit nur immer einen sehr kleinen Schluck nehmen können, der mir fast den Mund verbrühte, und meine restlichen Äpfel hatte ich alle im Gehen aufgegessen. Ich war sehr matt geworden in der rauen Kälte, dem Klirren der gefrierenden Luft und fühlte mich innerlich ganz vertrocknet. Etwa auf halber Strecke über die Autobahnbrücke blieb ich stehen, weil ich glaubte, ich würde gerne runterschauen auf die dort unten ihren jeweils eigenen Zielen entgegensteuernden Fahrzeuge, aber der Wind fuhr heftig durch die Schneise der Autobahn, und so ungeschützt hielt ich es nur wenige Sekunden aus. Die aufkommende Dunkelheit, die Scheinwerfer und das Spritzwasser der Fahrbahn, gegen das sie alle ihre Scheibenwischer angestellt hatten, machten es auch unmöglich, von der Brücke aus die Menschen hinter den Windschutzscheiben zu erkennen.
Auf dem Gelände des Rastplatzes kam ich zuerst an den langen Reihen der abgestellten Lastwagen vorbei. In den Führerhäusern waren die Vorhänge zugezogen. Manche hatten noch den Motor laufen, um die Heizung in Betrieb zu halten. Die meisten Fahrer aber, stellte ich mir zumindest vor, lagen in den Kojenbetten hinter den Sitzen, schliefen oder blätterten vielleicht noch in einer Illustrierten, überflogen den Spielbericht ihrer Fußballmannschaft auf einem kleinen Laptop. Sie alle hatten jedenfalls zu warten und irgendwie die Zeit totzuschlagen, bis die Fahrzeitpause abgelaufen war und die Ladung in ihren Anhängern weitertransportiert werden durfte.
Ich lief auf meinen schneeverklebten Stiefeln zwischen diesen teilweise rhythmisch aufröhrenden und Abgase ausdampfenden, insgesamt aber wie eine schlafende Kleinstadtstraße aufgereihten Fahrzeugen hindurch, näherte mich der Tankstelle von ihrer Rückseite, wo ein Reifendruckgerät und ein Staubsauger unter dem Lichtkegel einer Laterne angebracht waren. Vor den Toilettentüren stand ein silberner Kleinwagen, ebenfalls mit laufendem Motor, mit einer sehr jugendlich aussehenden Person auf dem Fahrersitz, die mit beiden Händen das Lenkrad festhielt, als könne sie jeden Moment losrollen. Auch hier stach mir die Luft beim Einatmen noch kalt in die Nase, und trotzdem konnte ich den Benzingeruch wahrnehmen. Zum ersten Mal, seit ich losgelaufen war, konnte ich überhaupt etwas riechen.
Durch die Scheiben sah ich innen im Verkaufsraum der Tankstelle den Rücken einer Verkäuferin im roten Polohemd. Sie bückte sich immer wieder hinter den Tresen und holte Zigarettenstangen hervor, die sie dann aufriss und die einzelnen Schachteln in ein Regal hinter der Kasse sortierte. Ein Kaffeeautomat befand sich gerade im Selbstreinigungsmodus, zwischen den Süßwaren und Getränken saßen, in einem Metallregal, Stofftierversionen des Tankstellenmaskottchens eng beieinander.
Zwischen der Tankstelle und dem Flachbau, in dem, wie ich jetzt sehen konnte, das Selbstbedienungsrestaurant, ein Automatenspielkasino und ein kleiner Erotikmarkt untergebracht waren, befand sich ein breiter Parkplatz für Pkws. Nur wenige Autos standen hier, ebenfalls mit laufenden Motoren. In einigen war das Innenlicht eingeschaltet, ich sah die Personen auf den Sitzen, die scheinbar gedankenlos ihre eigenen Spiegelungen in der Windschutzscheibe betrachteten. Die Beifahrertür einer großen Limousine mit getönten Scheiben sprang auf, eine Frau in weißer Bluse kam auf hohen Schuhen heraus, lief schnell zum Kofferraum, öffnete die Klappe, holte einen Picknickkorb heraus und verschwand dann mit hektischen Bewegungen wieder in der beheizten Fahrgastzelle.
Ein ausgetretener Pfad führte vom Parkplatz eine Böschung hinab zwischen laubloses Gebüsch. Ich ging ihm nach, geistesabwesend, bis ich auf eine kleine Nische stieß, in der der Schnee geschmolzen und einer schwarzen, schlammigen Fläche gewichen war, auf der überall feuchte, fleckige Papiertaschentücher herumlagen. Dann kehrte ich wieder um und lief zurück auf den Parkplatz.
Auf den Toiletten des Selbstbedienungsrestaurants, für die man auf ein kleines Tellerchen im Vorraum etwas Geld legen musste, ohne dass jemand dort war, der einen überwachte oder dieses Geld schließlich an sich nahm, trank ich aus dem Hahn des Waschbeckens eine große Menge Wasser, was mich noch hungriger machte.
Ich belud mir am Buffet einen Teller mit Gemüse, Kartoffeln, Fleisch und Soße, den sich die Kassiererin kurz ansah, etwas in ihr Tastenfeld tippte und dann einen irrsinnig hohen Geldbetrag nannte mit müder Stimme, den ich ihr überrumpelt und ohne Beschwerde in die Hand zählte. Ich hätte mich an diesem Punkt gerne mit ihr unterhalten, nahm aber stattdessen mein Tablett mit dem Teller darauf und setzte mich an einen der vielen Tische, die an der Fensterseite des Flachbaus aufgestellt waren in einem offenen Raum, an den das Buffet, der Automatenspielbereich und der Eingang zum Erotikmarkt angrenzten.
Während ich aß, hörte ich das Brummen der Kühlschränke am Buffet, hin und wieder ein klimperndes Aufjubeln der Automaten, die dann wild zu blinken begannen, ihren Ausschüttungsmodus simulierten, um Vorbeigehende zum Spielen zu animieren. Am Eingang des Erotikmarktes war eine Frauensilhouette aus Leuchtstoffröhren angeschaltet worden, ein ausgestrecktes und ein abgewinkeltes rechtes Bein leuchteten abwechselnd an ihrem Körper auf, mit einer viel zu langen Pause dazwischen, sodass es nie wie die Bewegung aussah, die es darstellen sollte. Auf dem glatten Plastikfurnier meines Tisches, das eine helle Holzsorte nachahmte, spiegelten sich diese bunten Lichter sehr verschwommen wider. Irgendwann fiel mir auf, dass ich meinen Teller schon längst leer gegessen und mich wohl für lange Zeit an diesen bunten Lichtpunkten, ihrem steten Wechsel festgestarrt hatte, reglos und ohne einen einzigen Gedanken. Mein Körper war unbeschreiblich schwer geworden auf dem Stuhl, und ich bemerkte, dass ich weder meinen Mantel ausgezogen noch meine Mütze abgenommen hatte. Mir wurde heiß, mein Gesicht glühte, ich wollte aufstehen, war aber nach dem schweren Essen schläfrig und träge geworden. Vor der Glastür am Eingang sah ich draußen, an einem hohen Aschenbecher, eine Angestellte des Restaurants eine Zigarette rauchen und dabei schnell auf der Stelle treten, um sich warm zu halten. Ich wollte zu ihr hingehen und ein Gespräch anfangen, aber als ich es schließlich geschafft hatte, mich von dem Stuhl hochzudrücken, warf sie schon ihren Zigarettenrest in den Aschenbecher und verschwand mit schnellen Schritten irgendwo hinter dem Gebäude.
Draußen war nichts mehr vom Grau des Tages übrig geblieben, die ganze Landschaft weggesunken in eine schwarze Nacht, und durch den Lichtschein der hoch aufragenden Laternen auf dem Rastplatz fiel jetzt neuer Schnee in feinen Flocken.
Unsagbar müde näherte ich mich dem Hotelgebäude, manchmal schloss ich für eine Weile die Augen und spürte, wie der Schnee auf meinen Lidern schmolz. Wenn ich sie dann wieder öffnete, einen Spaltbreit, um mich zu vergewissern, dass ich weiterhin auf dem rechten Weg lief, sprühten lange, sternförmige Lichtreflexe aus den Laternen und den Scheinwerfern der Autos.
Ich schob mich durch die Drehtür in den Empfangsbereich des Hotels, einen gefliesten Raum mit niedriger Decke, und wie ferngesteuert ging ich geradeaus, zu einem leuchtenden Cola-Automaten an der gegenüberliegenden Wand, an dem mein Blick sich festgefangen hatte. Erst als ich davorstand, merkte ich, dass ich nichts von der Maschine wollte. Ich drehte mich herum, bis ich den Rezeptionstresen im Blick hatte, hinter dem ein nachlässig uniformierter Junge saß und in einen Computerbildschirm starrte. Aus dem Augenwinkel hatte ich schon ein paar schmächtige Ledersessel gesehen, die auf einem bunten Teppich um einen Glastisch herum angeordnet waren und den Eindruck machten, als hätte sich noch niemals jemand in sie hineingesetzt.
Kurz war da der Wunsch, einfach in diesen Möbeln eine Weile auszuruhen, bis ich mich kräftig genug fühlte, mit dem uniformierten Jungen zu sprechen. Ich glaubte nicht mehr lange auf meinen Beinen bleiben zu können.
An der Wand über dem Schlüsselregal der Rezeption war ein abstraktes Gemälde von großem Format angebracht. Rot, Gelb und Orange, kleine blaue Flecke, einige kohlenschwarze Striche, aggressiv hineingeworfen, schon im Zerfließen angedeutete Formen, ein Feuersturm, dachte ich mir. Jemand hatte dieses Bild aus einem Brand heraus gemalt, in einer unglaublichen Konzentration in die Flammen geschaut, die Hitze im Gesicht, und darunter saß, im weißlich fahlen Widerschein des Monitors, der uniformierte Junge, auf den ich mich zubewegte, nur von der Aussicht auf ein Bett schrittweise weitergestoßen und so halb schon eingeschlafen, dass ich wusste, sobald ich die Augen schloss, würde ich übertreten in die Traumwelt.
Ich sollte ein Formular ausfüllen, in dem meine Handschrift dann seltsam schwammig aussah, und bekam einen Zimmerschlüssel, den Preis bezahlte ich im Voraus. Der Junge wünschte mir eine gute Nacht, ich zeigte mit schlaffem Arm auf eine der weißen Pressspantüren mit den goldfarbenen Klinken, die vom Eingangsbereich abgingen, und er wies mit einer einstudierten Handbewegung, wie ein Steward im Flugzeug, auf ein Schild an der Wand. Ein Treppensymbol war darauf abgedruckt, ein Richtungspfeil und eine Reihe Zimmernummern.
In der Nacht schraubte ich mich unruhig durch das steife Bettzeug und durch ein wirres Gezeter in meinem Kopf. Zuerst wachte ich auf und zog mich aus, dann wachte ich auf, um das Fenster zu öffnen, und noch mal, um es wieder zu schließen. In den Zeiten, die ich nur halb weggedämmert verbrachte, wechselte draußen auf dem Rastplatz eine große, umfassende Ruhe mit dem Aufdröhnen von Motoren, den wummernden Bässen aus einer High-End-Anlage in einem Kleinwagen, dem davon die ganze Karosserie schepperte, Lachen und dann wieder zurück in Nichts und Stille. Die Laternen, die den Rastplatz beleuchteten, blieben die ganze Nacht in Betrieb. Ein helles Lichtquadrat fiel in den Raum, auf die Ecke, in der mein Rucksack stand, und auf die Zimmertür daneben in einer Art, dass ich dachte: wie für einen Auftritt. Jemand müsste hereinkommen und die Augen abschirmen mit der Hand und dann zum unsichtbar im Dunkel hockenden Publikum zu sprechen beginnen.
Ich wachte auf, als draußen schon wieder einige Helligkeit aufgekommen war. Der Himmel war weiterhin grau bewölkt, und dicke Schneeflocken taumelten jetzt über dem Rastplatz und der Autobahn. Es gab zu dieser Stunde kaum Verkehr, auf den weißen Fahrbahnen waren nur schwach ein paar Reifenspuren zu erkennen.
Ich stand auf und zog mich an, wollte aber noch nicht gehen und setzte mich auf einen der beiden Holzstühle mit buntem Sitzbezug, die dem Bett gegenüber an die Wand gestellt waren ohne Tisch.
Aus meinem Rucksack nahm ich das eingewickelte Brot und aß einige trockene Stücke, holte mir Wasser für meine Thermoskanne am Waschbecken neben der Tür. Dann rollte ich die Tageszeitung, die ich aus dem Nachbarbriefkasten genommen hatte, auf meinem Schoß auf, blätterte darin herum und fand irgendwo in der Mitte die fast halbseitige Abbildung einer Luftaufnahme.
Moderne Kulturlandschaft stand als Bildunterschrift darunter. Die Aufnahme war aus einiger Höhe aufgenommen worden. Ein kleiner Ort, nur als Fleck zu sehen, lag an einer Straße ohne Kurven, die quer über das gesamte Bild lief. Ansonsten waren auf dem Bild nur noch unzählige kreisrunde Felder zu sehen, künstlich bewässert, riesengroß und jedes in einem anderen Stadium der Reifezeit. Ich fand das Bild sehr schön, weil ich dachte, auf ihm sei die Wiederkehr, das Turnusmäßige der Zeit abgebildet. Wachstum, Reife, Ernte, wie auf Hunderten riesiger Uhren aus Mais und Weizen. Ich beschloss die Tageszeitung zu behalten und steckte sie zurück in meinen Rucksack. Dann nahm ich meinen Fotoapparat heraus und machte ein Bild vom Rastplatz vor dem Fenster. Nachdem ich den Auslöser gedrückt hatte, die Kamera gesenkt und wieder allein mit meinen Augen aus dem Fenster schaute, überkam mich zum ersten Mal ein tiefer Zweifel, ob sich all das noch mal ändern könnte.
Abb. 1
Als am Abend des 10.April 1815 der Berg Tambora auf der Insel Sumbawa, die zweihundert Jahre lang abwechselnd von holländischen, britischen und japanischen Besatzern kontrolliert worden war, explodierte, stieß er mit einem Mal einhundertvierzig Milliarden Tonnen Gesteinsmasse in die Luft, anderthalb Kilometer Berg, von der Spitze abwärts, sprengten sich aus dem alten Gefüge und regneten auf die umliegende Landschaft herab. Überfaustgroße Brocken schlugen in die Reisfelder und Hütten der Bauern ein, Ascheregen und Schwefelregen folgten, Tsunamiwellen, die Dörfer und Siedlungen rund um den Tambora wurden allesamt vernichtet. Noch bevor man die kilometerhohe Aschesäule sehen konnte, die aus dem Vulkankrater aufstieg, hörte man überall auf den indonesischen Inseln die Detonationen. Aufgeschreckt und hektisch gingen die Besatzer in Stellung, Schiffe wurden aufs Javameer ausgesandt, man griff zu den Waffen und spähte in den Abend nach feindlichen Truppen.
Feuerstürme, rot glühende Gaswolken, Asche und flüssiges Gestein fluteten die Flanken des Tambora herab ins Meer. Eine schaumige Kruste bildete sich auf der Wasseroberfläche, in sie eingebacken die Vegetation, Häuser, Tiere, Menschen, die in dem heißen Rutschen und Fließen umgekommen und mitgerissen worden waren. Großflächige Bruchstücke dieser Schaumkruste trieben hinaus auf die See und dort jahrelang herum. Immer wieder stießen Fischer und Fernreisende auf solches Treibgut.
Infolge des Ausbruchs verfinsterte sich der Himmel. Der Staub, die Asche und die Gase stiegen in die Stratosphäre, gelbliche Dunstschleier, die vom Wind um den ganzen Erdball getragen wurden, das einfallende Sonnenlicht wurde von diesem säurehaltigen Dunst zurückgeworfen. Wenn es regnete, regnete es Schwefel und Asche, die Böden und das Grundwasser wurden vergiftet, und durch den Mangel an Licht blieb es ein Jahr lang Winter auf der nördlichen Hälfte der Welt.
Den Menschen in Europa und Nordamerika war die Ursache für diese Verdunklung, die Kälte und die ungewohnten Niederschläge lange unklar. Viele zogen aus ihren Häusern aus und hofften auf Besserung anderswo, fuhren vielleicht auf einem Schiff von Europa nach Amerika oder von dort zurück und fanden dann, auf der anderen Seite des Ozeans, auch nur dieselbe Dunkelheit vor, Schneefälle im Sommer, erfrorene Felder, Hunger. Keiner wusste, dass weit entfernt auf dem Planeten etwas aufgerissen war, explodiert, und so starrten sie fragend in den sternenlosen Himmel.
Als ich Richard vom Ausbruch des Tambora erzählte und ihn fragte, könnte es nicht sein, dass wieder irgendwo in einem fernen Erdteil eine solche Explosion stattgefunden hat und wir jetzt wieder ahnungslos umhergehen in der Kälte, zuckte er nur mit den Schultern, wollte davon gar nichts wissen. Es kam mir sogar so vor, als würde er richtig wütend, je länger ich versuchte, den Ursachen auf den Grund zu kommen.
Abb. 2
Auf der Karte, die ich mir im Verkaufsraum der Tankstelle nochmals genau anschaute und in kleinen Teilabschnitten mit meinem Gedächtnis abzufotografieren versuchte, zog sich die Autobahn gerade hoch in den Norden, teilte sich in einen nach Westen abgehenden Zweig und einen kleineren, der bis kurz vor die Küste führte, dort zu einer Landstraße wurde und sich schließlich auffächerte in Richtung der vielen kleinen Dörfer und Ortschaften am Meer.
Im Selbstbedienungsrestaurant hatte ich meinen Rucksack wieder mit Essen aufgefüllt. Ein paar Äpfel und Bananen und in Frischhaltefolie eingewickelte Käsebrötchen. Auch die Thermoskanne war wieder voll, und den Brotlaib hatte ich gegen ein Gefühl der Sättigung ankämpfend noch im Hotelzimmer aufgegessen, in der Hoffnung, dass ich dann erst spät am Tag wieder Hunger bekommen würde. Der Schnee war ohne Pause auf die Landschaft gefallen, die Lastwagen standen entweder eingeschneit auf dem Parkplatz oder waren gerade losgefahren und hatten nur ein dunkles Rechteck zurückgelassen. Ansonsten waren alle Spuren von gestern längst verschwunden.
Das Land ging schnell wieder über in die bekannte Form. Links von mir die Autobahn, rechts Felder, Forste, Landstraßen, Drainagegräben, verschneite Jauchegruben und in einiger Entfernung ein Großmastbetrieb, in dem es ganz still zu sein schien. Einmal durchquerte ich einen Gewerbepark, der zwischen die Autobahn und eine Reihe größerer Ortschaften gebaut war. Ein großes, fensterloses Möbelhaus mit einem riesigen Parkplatz davor, über den zwei Menschen einen mit eingeschweißten Schrankwandteilen überladenen Einkaufswagen wacklig herumsteuerten, auf dem Weg zu einem ganz unsinnig weit vom Ausgang entfernt geparkten Fahrzeug, ein Autohaus und eine Einkaufspassage, an deren gläserne Fassade die Leuchtreklamen der ansässigen Franchisebetriebe montiert waren. Zwischen den Parkplatzflächen, die sauber voneinander abgetrennt waren durch Reihen kleiner Nadelbäumchen, befand sich auf Höhe des Einkaufszentrums eine Bushaltestelle mit einem Wartehäuschen, in dem ein dicker Mann ohne Jacke oder Mantel stand und eine Zigarette rauchte.
Als ich mich noch mal umschaute, sah ich, wie die beiden Personen auf dem Nachbarparkplatz große Probleme hatten, ihre gekauften Möbelteile in das kleine Auto zu laden, mit dem sie gekommen waren. Die eine fasste sich zum Nachdenken an den Kopf, während die andere große Gesten machte, die aber nicht vorwurfsvoll, sondern eher wie Vorschläge aussahen.
Danach sah ich niemanden mehr. Das Gehen an der Autobahn wurde häufig durch Zäune, Wassergräben und Fischteiche erschwert, weshalb ich mich immer weiter von ihr entfernte und wieder in den Feldern lief. Ich durchquerte einen Windpark, in dem alle Räder still standen, obwohl ein strenger Luftzug über die Landschaft ging.
Oft hatte ich das Gefühl, dass es gerade wieder angefangen hatte zu schneien, war mir dann aber nie sicher, ob es davor überhaupt einmal aufgehört hatte oder ob ich einfach nur unaufmerksam gewesen war, weil ich über irgendetwas nachgedacht hatte. Diese Frage verscheuchte dann aber meistens auch den Gedanken, den ich vielleicht gerade hatte, und so konnte ich nicht mal mehr mit Sicherheit sagen, ob ich tatsächlich über etwas nachgedacht hatte, oder wo ich gewesen war in meinem Kopf.
Wenn ich einen Verschlag, einen Unterstand oder eine Scheune vorfand, versuchte ich zu schlafen, ich kauerte mich in eine Ecke und trieb dann für eine Weile auf einer seichten, vom Zittern meiner Glieder durchsetzten Bewusstlosigkeit dahin, für ein paar Stunden manchmal, bis ich wieder weiterging, durch die Dunkelheit der Nacht oder die trübe Ödnis des Tages. Manchmal mogelten sich im halbwachen Zustand beim Gehen Trugbilder in die Landschaft, ich sah dann Rauchsäulen aufsteigen aus dem Wald oder eine über die Schneedecke eilende Person, die plötzlich stehen blieb, wie ertappt, und zu einem Verkehrsschild wurde. In der Nacht war unter den Schemen der Wälder und Siedlungen in einiger Entfernung oft ein Kriechen, die metallenen Arme der hohen Fernleitungsmasten wurden weich, griffen nach vorn und zogen sich entlang der Stromleitungen übers Land.
Ich schüttelte dann meinen Kopf und Körper wie ein nass gewordener Hund, und meistens kehrte auch alles an seinen ursprünglichen Platz zurück.
Es brauchte keine Schilder oder bekannte Gebäude, um zu bemerken, dass ich dem Ort immer näher kam.
Ich spürte, dass die Spuren meiner Stiefel im Schnee, auch wenn er sonst ganz unberührt war, auf anderen Spuren verliefen, die sich unter der weißen Schicht durch die Landschaft zogen. Ich wurde vorsichtig beim Gehen.
Bald erreichte ich das ehemalige Militärgebiet zwischen dem Inland und dem Ort an der Küste und schaute mich um nach den markierten Feldwegen. Dieses weitläufige, größtenteils gesperrte Gebiet umschließt den Ort im Süden in Form einer großen Niere und erstreckt sich weit über die Landkreisgrenzen hinaus. Wer sich dem Ort mit einem Auto nähert, muss das Gebiet umfahren. Durch seine große Ausdehnung fällt einem der Umweg gar nicht auf. Man fährt an einem langen Streifen Wald vorüber, auf der anderen Straßenseite ziehen die Felder vorbei, Raps und Weizen, Futtermais, Kartoffeln und Zuckerrüben. Rot bestrichene Holzpfosten, die selbst in der vollkommen überschneiten Landschaft gut zu sehen sind, markieren zu beiden Seiten die Wege, die zum Gehen durch das Gebiet freigegeben wurden.
Hundert Jahre lang war das Gebiet den Truppen der wechselnden Regierungen und Besatzer Militärstützpunkt und Waffenübungsplatz gewesen, bevor die letzten von ihnen vor ein paar Jahrzehnten abzogen, einige Wege absteckten zum zivilen Gebrauch, das Kriegsgerät fast vollständig mitnahmen und sonst alle Türen und Gatter, die vorher so gut verschlossen und bewacht waren, offen stehen ließen, auf dass allen gleich einleuchten konnte, es war nicht der Ort so kostbar, dass er bewacht werden musste, sondern die Aufgabe des Bewachens selbst.
Meine Eltern hatten nach dem Abzug der Truppen eines der sehr preiswerten Häuser in der Nähe des aufgelassenen Militärstützpunktes gekauft. So günstig kam man nirgendwo sonst im Land an eine Immobilie am Meer. Und als ich das dachte, während meiner ersten Schritte entlang der roten Pfosten, wurde mir bewusst, dass ich es bisher vermieden hatte, während des ganzen Gehens, überhaupt an meine Eltern zu denken, die ja schließlich, in ihrem Haus sitzend, mein Ziel gewesen waren.
Wegen der erhöhten Militärpräsenz, der immer neuesten Kriegsgeräte, die man für den Ernstfall im Gebiet testete, war den Bewohnern des Ortes die Nutzung der sie umgebenden Landschaft weitestgehend verboten worden. Es gab auch kaum kommerziellen Fischfang, da der kleine Ortshafen ebenfalls durch das Militär besetzt war – ein Kontrollposten mit Wachturm und ein ständig vor der Küste patrouillierendes Kanonenboot, das Technik und Soldaten vor seeseitigen Angriffen beschützen sollte.
Im Wesentlichen lebte die Bevölkerung von den Bedürfnissen der Soldaten. Der kleine Ort war dazu übergegangen, einem anderen kleinen Ort, der die Kaserne war, als Versorgungsstelle, Kneipe, Wäscherei, Möbelwerkstatt und Eiscafé zur Verfügung zu stehen. Mit dem Abzug der Truppen wurde dieses Abhängigkeitsverhältnis einseitig aufgekündigt.