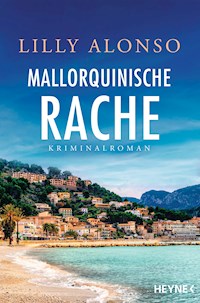
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Casasnovas ermittelt auf Mallorca
- Sprache: Deutsch
Kurz vor der Frühpension geht’s erst richtig los: Sargento Lluc Casasnovas muss noch einmal alles geben
Ramón Cabot wird am hellichten Tag im voll besetzten Sóller-Express erstochen. Der Fall scheint klar: Cabot hat sich während der Fahrt mit seinem Erzfeind Pablo Rivera gestritten. Sargento Lluc Casasnovas übernimmt den Fall. Es soll der krönende Abschluss seiner Karriere werden, bevor er in Frühpension gehen und sich endlich seinem sträflich vernachlässigten Garten widmen kann. Doch so einfach ist das nicht: Es scheint einfach keine Zeugen zu geben, genauso wenig wie eine Tatwaffe. Und dann ist da auch noch Llucs Nachfolgerin Josefina García, die ihm ständig dazwischen pfuscht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
An der nördlichen Küste Mallorcas, am Fuße des Tramuntana-Gebirges und umgeben vom glitzernden Atlantik, liegt die kleine Ortschaft Sóller. Manche sagen, es sei der schönste Ort der ganzen Insel – auf jeden Fall aber der friedlichste. Bis eines Tages eine Leiche im Sóller-Express aufgefunden wird. Sargento Lluc Casasnovas steht vor einem Rätsel: Der Tote, Ramón Cabot, ist ein bekannter Bürger der Stadt, er wurde mitten am Tag im vollen Zug erstochen, und doch will niemand etwas gesehen haben. Wie ist das nur möglich?
Je länger Sargento Casasnovas ermittelt, desto komplizierter wird der Fall. Wurde Cabot von einem Kontrahenten ermordet, mit dem er kurz vor seinem Tod gestritten hat? Was verbirgt die mysteriöse Deutsche, die Cabot zu verfolgen schien? Ist der attraktiven Reporterin Lucía zu trauen? Und was hat der beste Freund von Lluc Casasnovas mit dem Toten zu tun?
Schritt für Schritt entwirrt Lluc die Fäden – und wünscht sich dabei sehnlichst in die kurz bevorstehende Frühpension. Denn seine ausnehmend engagierte Nachfolgerin Fina, die vor lauter Eifer seine Ermittlungen behindert, macht die Sache nicht gerade leichter. Zwischen verschrobenen Kleinstadtbewohnern, alten Familienfehden und mallorquinischen Traditionen ahnt Lluc bald, dass er es dieses Mal mit dem verzwicktesten Fall seiner Karriere zu tun hat …
Die Autorin
Geboren und aufgewachsen in Hannover, hat Lilly Alonso in Berlin studiert und gelebt, bis die Liebe sie schließlich nach Mallorca geführt hat. Hier genießt sie seit fast 20 Jahren das Inselleben, arbeitet als Zahnärztin, beobachtet Land und Leute und schreibt Krimis.
LILLY ALONSO
MALLORQUINISCHE RACHE
KRIMINALROMAN
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 04/2022
Copyright © 2022 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Ingola Lammers
Umschlaggestaltung: zero-media.net unter Verwendung von Alamy Stock Foto (Boris Stroujko), FinePic®, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27238-8V002
www.heyne.de
Für Robert
1
Es war ein Fehler gewesen, gerade heute in diesen Zug zu steigen. Ramón Cabot zählte zwölf Reihen zweisitziger Bänke auf beiden Seiten des Gangs. Am Ende, zum begehbaren Austritt des Waggons hin, wäre noch Platz für eine weitere Bank gewesen. Aber eine dreizehnte Reihe, eine Einladung zum Unglück, hatte vermutlich selbst die geschäftstüchtigen Betreiber der Zuggesellschaft abgeschreckt. Es funktionierte nicht, das wusste Ramón aus eigener Erfahrung. Das Unheil ließ sich nicht durch billige Tricks aufhalten.
Dreißig Jahre waren seit seiner letzten Fahrt mit dem Roten Blitz vergangen. Nomen war in diesem Fall nicht Omen, denn weder war die über hundert Jahre alte historische Schmalspureisenbahn rot noch schnell. Warum die Deutschen den Zug so nannten, würde sich für Cabot in die Annalen der großen Mysterien einreihen. Er hatte eine ruhige Fahrt im Sinn gehabt, als er, die Última Hora unterm Arm, im von Journalisten belagerten Bahnhof von Palma eingetrudelt war. Ein bisschen lächeln, sich durch die Blitzlichter der Kameras und festen Händedrucke der Menschen, die wichtig genug waren, in einer Zeitung zu erscheinen, seine eigene Wichtigkeit bestätigen lassen. Nicht dass er es nötig hatte, aber als einer der Hauptaktionäre der Zuggesellschaft konnte zumindest bei solchen Gelegenheiten sein Bauch ein wenig gepinselt werden.
Alles war bis dahin mit der Harmlosigkeit von süßer Brause verlaufen: Ein mit Luftballons geschmückter Bahnhof an der geschäftigen Plaza España der Inselhauptstadt. Die braven und vorhersehbaren Fragen der Reporter, auf die Ramón Cabot einstudierte Antworten aus dem Ärmel geschüttelt hatte. Nonchalant, mit dem beiläufigen Charme des Mannes von Welt. Etwas Selbstironie, ein angedeuteter Lacher an der richtigen Stelle für den Spritz. Das Ganze serviert vor einer Kulisse neugieriger Menschen aus aller Herren Länder, durch rote Kordeln sicher vom VIP-Bereich ferngehalten.
Begleitet von den latinoinspirierten Klängen einer Liveband, die mit einer in die warme Juniluft geschmetterten Version von Mediterráneo den Zug auf die Reise schickten, war Cabot in den letzten Waggon des alten Zuges gestiegen. Gemütlich in einer freien lederbezogenen Bank versunken, zufrieden mit dem erfolgreichen Verlauf des Vormittags.
Bis dann ausgerechnet Pablo Riveras schwarz geleckter Haarschopf im Türrahmen des Waggons erschienen war, gefolgt vom Rest seines bulligen Körpers.
Cabot drehte sich ruckartig zum Fenster und starrte konzentriert ein Loch in den blank gefegten Bahnsteig.
Aus dem Augenwinkel nahm er eine Bewegung wahr, die darauf deutete, dass Rivera seinen Schritt verlangsamte und stehen blieb.
Ramón Cabot hielt den Atem an. Er überlegte einen Moment, schnell auszusteigen, hockte entschlussunfähig, aber absprungbereit auf der Sitzbankkante. Ein kurzes Zögern, zwanzig Sekunden, die den Lauf der Geschehnisse hätten verändern können. Doch der alte Zug setzte sich knarzend in Bewegung.
Als Pablo Rivera die umklappbare Sitzlehne der Zweierbank vor Cabot gegen die Fahrtrichtung einschlug und dadurch die beiden hintereinander angeordneten Reihen in eine sich zugewandte Viererkonstellation verwandelte, wusste Cabot endgültig, dass es kein Entkommen gab.
»Cabot.« Rivera lächelte. Der stechende Blick dieser Kohleaugen fixierte Cabot wie ein präpariertes Insekt.
Sein linker Fuß juckte. Diese Art von aufdringlichem Jucken, die an Schmerz grenzte und einen direkten Befehl an die Finger zu schicken schien, sich unter den Rand seiner mit Noppen besohlten Tod’s Loafer zu bohren und zu kratzen. Cabot atmete tief ein. Widerstand dem Drang. Nickte. »Rivera.«
Der Fuß zuckte unkontrolliert.
Nachgeben hätte ein Zeichen der Schwäche gesetzt, einen Angriffspunkt, wo er nur Konsequenz präsentieren wollte. Eine klare Botschaft. Allerdings würde Pablo Rivera keinen Keim des Zweifels in seiner Haltung säen, egal wie sehr er sich bemühte. In Hoffnung auf eine kurze und schmerzlose Begegnung schlug Cabot demonstrativ seine mitgebrachte Zeitung auf.
Doch Rivera schien von nonverbaler Kommunikation nichts zu halten. »Ich verstehe nicht, warum Sie sich einem Fortschritt versperren.« Sein schleimiges Lächeln hätte sich einer vertrockneten Schnecke bei ihrer Fortbewegung als große Hilfe erwiesen. Der typische Pijo aus Madrid, ein Snob mit kariertem Hemd, Rolexuhr und verknotetem Pullover um die Schultern. Wie um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, schlug Rivera ein Bein über das andere. Aufgrund des Platzmangels nahm die Bewegung mehr Zeit in Anspruch als gewöhnlich, und Cabot nutzte die Gelegenheit, sich unbemerkt an der nackten Fußsohle zu kratzen.
Statt Linderung zu bewirken, verstärkte sich der Juckreiz.
»Denken Sie an die Vorteile, die ein Verkauf des Zuges an unsere Firma für Sóller bedeuten würde«, fuhr Rivera fort. »An die Arbeitsplätze, die beim Ausbau der Strecke entstehen. Geschweige denn die Besucherzahlen im Tal, die eine Modernisierung bewirken wird.«
Ramón Cabot seufzte. Dieses Zusammentreffen war kein Zufall. »Der Zug transportiert eine Million Menschen jährlich, ist das nicht eindrücklich genug?« Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, ärgerte er sich, erneut auf das Argument eingestiegen zu sein, das wieder in der alten Diskussionsspirale enden würde.
»Wir sind Geschäftsleute.« Rivera lächelte und entblößte eine Linie weißer Zähne, in Reih und Glied wie der perfekte Gartenzaun einer amerikanischen Spießervorstadt. »Alles ist optimierbar.« Er löste den Knoten seines umgebundenen Pullovers.
Cabot wandte sich ab. Der Typ weigerte sich zu kapieren, dass niemand im Tal einen Verkauf und die damit einhergehende Kommerzialisierung begrüßen würde. Gemessen an dem Druck, den der Madrilene bisher auf alle Aktionäre ausgeübt hatte, musste eine immense Bedeutung mit dem Verkauf verknüpft sein. Um das Thema zu wechseln, deutete er aus dem Fenster. »Schauen Sie mal, das ist eine meiner Lieblingsstellen. Ist das nicht überwältigend?«
Pablo Rivera setzte an, etwas zu entgegnen, fing sich dann aber und stieß seufzend den Atem aus. »Ohne Frage. Das ist der Grund, warum wir uns so bemühen.«
Das langsam vorbeiziehende Panorama sattgrüner Ausläufer des Gebirges um Bunyola verfehlte auch dieses Mal nicht die beruhigende Wirkung auf Cabot – wie Weihrauch, der böse Geister vertrieb. Selbst der Schmerz in seinem Fuß ließ ein wenig nach. In der Ferne thronte eine Posesión burgähnlich auf einem Hügel, ein sandsteinfarbener Herrensitz, umgeben von Palmen, Pampasgras und den grünen Spitzen der Bergkette der Serra de Tramuntana. Ein azurblauer Himmel setzte dem Ganzen die Krone der Unwirklichkeit auf.
Der alte Zug, dem man seine über hundert Jahre ansah, verlangsamte das kriechende Tempo. Das Knarzen und Knacken der auf Hochglanz polierten Holzpaneele war nun deutlich über dem Klopfen der Räder auf den Schienen zu hören.
»Hier steckt so viel Potenzial. Wir könnten die historischen Punkte ausbauen, sie überzeichnen. Und was fehlt hinzufügen.«
Überzeichnen?
»Ein Disneyland passt nicht in eine Region, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden ist.«
Riveras Brauen zogen sich zusammen, bis sie fast eine Linie bildeten, sein Blick wurde hart. Doch statt des erwarteten Ausbruchs glättete sich sein Gesicht wieder. »Das haben Sie völlig missverstanden, Cabot. Wir respektieren die Einzigartigkeit des Tals und schätzen die Tradition des Zuges. Der Erhalt ist uns ein wichtiges Anliegen.«
»Da bin ich aber beruhigt, dass wir uns wenigstens in diesem Punkt einig sind.«
Pablo Rivera begann einen Sermon über die gesegneten Vorzüge eines Kaufs der Eisenbahn durch seine Firma, den er wie ein Callcenter-Mitarbeiter beim Telemarketing herunterleierte. Cabot blendete das Geschwafel aus.
Lilafarbene Bougainvilleen säumten die Bahngleise, und er bedauerte, kein Handy dabeizuhaben. Mit den bunten Blumen als Rahmen hätte die Landschaft das perfekte Bildmotiv abgegeben. Das schien auch das ältere deutsche Ehepaar auf der anderen Seite des Ganges zu finden, das versuchte, an ihm vorbei ein Foto zu schießen. Ramón Cabot lehnte sich in der braun gepolsterten Lederbank zurück, um die Sicht freizugeben. Ohne ein Wort des Dankes gingen die beiden dazu über, in pfälzischem Dialekt über den »Worschtbelach« ihrer mitgebrachten Brote zu debattieren, die der Mann – einen Fuß in grauen Socken unter den Birkenstocksandalen rücksichtslos in den Gang gestreckt – nicht essen wollte.
Fünfundzwanzig in Hessen verbrachte Jahre hatten Cabots Gehör für die Dialekte der Umgebung geschärft. Ganz zu schweigen davon, die gleiche Zeitspanne mit einer Neustädterin zusammen gewesen zu sein, die behauptete, nur wenige Kilometer voneinander entfernte Dörfer anhand ihrer Aussprache unterscheiden zu können.
Die Frau senkte die Stimme und deutete mit dem Kinn in Cabots Richtung: »Ist das nicht der Mann von der Claudia?« Wegen der verlangsamten Geschwindigkeit des Zuges war sie dennoch gut zu verstehen.
»Welsche Claudia? Kenn isch net.« Der Mann wühlte in seinem Rucksack.
»Na, die aus dem Fernsehen.«
Cabot rückte sich auf der Bank zurecht und sah aus dem Fenster. Seit seiner Rückkehr aus Deutschland vor einem Jahr wurde er kaum mehr auf der Straße angehalten. Das Flüstern und Ellenbogenstoßen, wann immer er ein Café betrat, war seltener geworden. In Sóller kümmerte sich keiner um Claudia Kamps Ex-Mann. Niemand kannte sie hier, auch nicht ihre Sendung, die allabendlich um 19 Uhr im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Cabot hatte sich an die neue Freiheit gewöhnt, nicht jeden seiner Schritte einer vorherigen Prüfung unterziehen zu müssen, um der hohen Latte der öffentlichen Meinung gerecht zu werden.
Die Pfälzerin drehte sich beleidigt weg und konzentrierte sich stattdessen auf das nächste Fotomotiv, bestehend aus der Decke des Zuges, wo drei historische Art-déco-Messinglampen in wechselnder Intensität flackerten. Aus erdfarbenen Kordeln geflochtene Gepäcknetze über den Sitzreihen boten Ablagemöglichkeit für kleinere Taschen. Doch statt der runden Hutschachteln und lederbeschlagenen Schalenköfferchen der vorletzten Jahrhundertwende lag ein zusammengeknüllter blauer Anorak einsam auf dem Flechtwerk.
Die Hand der Frau zuckte zurück, als die vorderen drei Reihen in den Fokus ihrer Kameralinse gelangten, belegt von Kindern einer Schulklasse, die keinen Platz mehr im angrenzenden Waggon mit ihren anderen Kameraden gefunden hatten. Wie auf ein unsichtbares Signal erhöhten sie ihr Gekreische um etliche Dezibel.
Was stimmt nur mit der heutigen Jugend nicht, fragte sich Cabot. Die Pandemie der kognitiven Dissonanz schien unaufhaltsam, begleitet von einem kontinuierlichen Verfall der Verhaltensregeln. Sie wirkten immer ungebildeter und immer frecher.
Der Juckreiz in Cabots Fuß kehrte zurück, dieses Mal schlimmer als zuvor. Hätte er vorhin nicht den Moskitostich ertastet, wäre er glatt auf die Idee gekommen, einen Zusammenhang mit Riveras Penetranz zu erkennen, der ihn weiterhin aufdringlich musterte und über seinen nächsten verbalen Schachzug nachzudenken schien.
Die Waggontür zur letzten Austrittsplattform öffnete und schloss sich. Jemand kam den Gang entlang und zog eine Wolke aus kaltem Zigarettenqualm hinter sich her. Cabot rümpfte die Nase und hielt die Luft an, bis der Durchzug der beidseitig geöffneten Fenster den schlimmsten Teil des Gestanks weggeweht hatte.
Das Leder der Bank hinter Ramón Cabot knarzte, als die Person sich auf den Sitz fallen ließ.
Pablo Rivera griff in die Hosentasche und holte sein vibrierendes Handy hervor. Eine Sprachmitteilung erforderte seine Aufmerksamkeit, und Cabot nutzte die Verschnaufpause, um im Kopf alle Möglichkeiten der Flucht durchzugehen. Der Zug schien voll ausgebucht zu sein. Ein Wechseln des Waggons barg die Gefahr, keinen Sitzplatz zu ergattern. Die hintere Aussichtsplattform des Zuges bot eine andere Alternative. Er konnte eine Zigarettenpause vorschieben und die vorbeiziehende Landschaft im Freien genießen, wie viele Touristen es machten. Notfalls auch bis sie in Sóller ankamen. Doch leider rauchte er nicht. Und wenn Rivera ihm nach draußen folgte, würde sein Fluchtmanöver auffliegen. Ganz zu schweigen davon, ihn wieder auf der Pelle zu haben. Im schlimmsten Fall gäbe es noch den Weg des geringsten Widerstands, der darin bestand, Rivera aus dem Zug zu stoßen – auch wenn es hier eine gewisse Reibung zu überwinden gab. Ramón schmunzelte bei dem Gedanken. Humor schadete nie. Und stockte.
Oder Rivera ihn.
Ein kleiner Unfall als Lösung seiner Probleme.
Das war trotz aller Absurdität nicht mehr so witzig, und die Aussichtsplattform verlor ihre Attraktivität. Überhaupt – was waren das für Gedanken? Es wurde Zeit, aus diesem verdammten Zug zu verschwinden.
Ein lauter Knall ertönte aus einer der hinteren Reihen. Cabot fuhr herum.
Ein goldblonder Mann beugte sich von seinem Sitz in den Gang und griff nach einem Smartphone, das auf den Boden gefallen war.
Der hatte ihm gerade noch gefehlt.
Margarita Rulláns Sohn.
Ramón hätte sich denken können, dass der dabei war, wenn die Betreibergesellschaft eine Sonderfahrt für Aktionäre und prominente Bürger Sóllers veranstaltete. Obwohl diese Fahrt außer Reportern beim Ein- und Aussteigen nichts Besonderes aufzuweisen hatte. Doch wo für die Presse posiert wurde, durfte Carlos nicht fehlen.
Obwohl Ramón schon seit der Schulzeit eine passive Antipathie gegen Margarita Rullán hegte und sie beide niemals unter einem Mistelzweig stehen würden, hatte selbst sie diesen Sohn nicht verdient. Sie war smart, das musste er ihr zugutehalten. Immerhin hatte sie es zur Bürgermeisterin gebracht.
Carlos nahm das heruntergefallene Telefon an sich und ging zu dem über, was er immer tat, wenn Cabot das Pech hatte, dem goldlockigen Schönling zu begegnen.
Das Opfer du jour war eine blonde Frau in der gleichen Reihe auf der anderen Seite des Ganges, der Carlos seine lustmolchigen Blicke zuwarf. Selbst aus seiner Position konnte Ramón die Einleitung der Bagger-Arie erkennen, die das Leitmotiv in Carlos Leben zu sein schien.
Die Frau kam ihm vage bekannt vor. Flüchtig wie die Erinnerung einer alten Melodie oder der Hauch eines vergessenen Duftes. Vielleicht war es die Art, ihren Kopf zu halten, das Kinn rebellisch vorgestreckt, oder die für das feine Gesicht zu groß geratene Nase? Ramón Cabot kniff die Augen zusammen und versuchte sich zu erinnern, aber weder ein Name noch eine dazugehörige Geschichte wollte ihm einfallen. Er schüttelte den Kopf. Nun sah er schon Gespenster.
Er war im Begriff, sich wieder in Fahrtrichtung zurückzudrehen, als er die Person einige Reihen hinter sich entdeckte. Cabot hatte sie gar nicht einsteigen sehen.
Sein Herzschlag beschleunigte sich. Hastig wandte er sich nach vorne.
Cabot blinzelte mehrmals, bis ihm einfiel, sich auf seinen Atem zu konzentrieren, wie es sich in solchen Situationen stets bewährt hatte. Auf das rhythmische Ein und Aus der Luft, das ihm ermöglichte, Herr seiner Gedanken zu bleiben.
Nach einigen Momenten hatte sich sein Puls normalisiert. Der Schlüssel zum Erfolg der Technik bestand darin, damit zu beginnen, bevor die erstickenden Emotionen eine Chance erhielten, aus dem siebten Höllenkreis aufzutauchen. Gefühle, die wie die Gebeine eines Toten lieber begraben blieben.
Würde er es nicht besser wissen, könnte man bei dieser Waggonbesetzung fast von einer Verschwörung ausgehen.
Wie lächerlich, schließlich war das nicht der Orientexpress und er nicht Cassetti.
Ramón Cabot sah auf die Uhr – eine halbe Stunde bis zur Ankunft in Sóller. Die würde er auch noch überleben.
Pablo Rivera beendete soeben das Abhören der Sprachnachricht, die seinem Gesichtsausdruck nach nicht zur Besserung seiner Laune beigetragen hatte.
Sein Gegenüber starrte ihm aus dunklen Augen entgegen, dessen nachtschwarze Iris ohne erkennbaren Übergang mit der Pupille verschmolz. Wie einer dieser Fernsehvampire, dem keine Bewegung entging.
»Wir werden das nicht akzeptieren, Cabot. Mit diesem Spiel kommen Sie nicht durch.« Alle Freundlichkeit war aus seiner Stimme verschwunden. Übrig blieb ein dunkles Brummen, das viel besser zu diesem merkwürdigen Vampirblick passte. »Ich würde mir an Ihrer Stelle gut überlegen, was Sie tun.«
»Was für ein Spiel?«
Pablo Rivera verdrehte die Augen. Seine offene Feindseligkeit hinterließ Cabot einen Moment sprachlos. Eben noch wohltemperierter Geschäftsmann aus Madrid, zeigte dieser Emporkömmling nun, aus welchem Stall er wirklich stammte. Was Ramón Cabot neugierig auf den Inhalt der Sprachnachricht machte, die diesem abrupten Wandel vorangegangen war.
»Sie repräsentieren nur eine Einzelmeinung unter elf Aktionären.« Rivera sprach jetzt so laut, dass er selbst die lärmenden Kinder übertönte, und akzentuierte jedes Wort mit seinem vorgestreckten Zeigefinger. »Sie haben eine Stimme, nicht alle elf.«
Der Typ drehte langsam durch.
»Jetzt aber mal halblang! Wollen Sie mir meine Meinung absprechen? Die im Übrigen tatsächlich mehr zählt als die der anderen Aktionäre, da ich nun mal der Hauptaktionär bin und die meisten Anteile besitze. Das scheinen Sie gerne zu vergessen, Rivera.« Ganz zu schweigen von den Bürgern und Bürgerinnen Sóllers, die sich gegen einen Verkauf ausgesprochen hatten.
Ein Junge der Schulklasse drehte sich auf seinem Sitz um und verfolgte das Wortgefecht mit offenem Mund. Braune Schokokrümel klebten rechts an seiner Oberlippe und hinterließen einen einseitigen Clark-Gable-Schnurrbart.
»Ihre Meinung und Ihren Größenwahn haben Sie bis zum Abwinken klargemacht. Hören Sie endlich auf, die anderen zehn Aktionäre zu beeinflussen!« Riveras Stimme war zu einem Schreien mutiert.
Unfassbar. Der Typ war completamente loco. Völlig irre.
Spätestens jetzt hatten sie die Aufmerksamkeit des ganzen Waggons. Das pfälzische Ehepaar hatte aufgehört zu diskutieren und sah unverhohlen mit großen Augen zu ihnen. Selbst die Kinder hatten ihr Gekreische eingestellt.
Das wahnsinnige Jucken setzte wieder ein, und Ramón scharrte mit den Füßen. »Ich beeinflusse niemanden. Ich habe nun einmal meine Haltung zu dem Verkauf. Was die einzelnen anderen Aktionäre daraus machen, ist ihre Sache.«
»Die anderen hören aber auf Sie.«
»Machen Sie Ihr Problem nicht zu meinem, Rivera.« Cabots Fuß meldete sich jetzt schmerzhaft, und er stampfte auf in der Hoffnung, mit der Bewegung den Mückenstich zu treffen.
Das Auftreten fiel lauter aus als beabsichtigt und klang selbst in seinen Ohren wie eine offensive Wutreaktion.
Rivera schien es ebenfalls so zu interpretieren. Er sprang auf, und sein ausgestreckter Zeigefinger schoss nach oben und stoppte gefährlich nah vor Cabots Nase. »Ich warne Sie. Das Wissen über die Leichen im Keller anderer Leute ist keine Einbahnstraße. Sie funktioniert in beide Richtungen.«
»Ich kann Ihnen nicht mehr folgen«, erwiderte Ramón Cabot trotzig, obwohl er sehr wohl eine Ahnung hatte, was sein Kontrahent da andeutete.
»Ich rede von den Skeletten, die Sie bestimmt nicht ans Tageslicht befördert sehen wollen.«
Das Krümelmonsterkind aus der vorderen Reihe riss die Augen auf und rüttelte seinen Bankkameraden an der Schulter. »Escucha! Hör zu! Der hat Zombies zu Hause.«
»Sie werden Ihre Sturheit bereuen, Cabot.« Gerade als Ramón dachte, Pablo Riveras Zeigefinger auf seinem Gesicht zu spüren zu bekommen, drehte dieser sich abrupt um.
Er eilte zum vorderen Ausgang und knallte beim Verlassen des Abteils die Tür hinter sich so zu, dass die daneben hängende Zeichnung des zwölfjährigen Joan Miró fast aus der Verankerung gerissen wurde. Nicht einmal an seinen Pullover hatte er gedacht, der nun einsam und verlassen dalag.
Betretenes Schweigen erfüllte den Waggon für einige Sekunden, bevor die Kinder losgackerten.
Ramón fing den Blick des Pfälzers auf, der ihm beeindruckt zunickte. »Ah joo. Demm hoschts awwer gewwe.«
Er spürte das Brennen von zwölf Reihen auf ihn gerichteter Augenpaare und stellte sich die Schlagzeile der morgigen Lokalzeitung vor. Automatisch griff er in seine Hosentasche und tastete nach dem universellen Schutzschild der heutigen Zeit – als er sich wieder daran erinnerte, kein Handy bei sich zu tragen. Seit gestern Abend war es wie vom Erdboden verschluckt. Wann hatte er es das letzte Mal in der Hand gehabt? War es vor oder nach dem Treffen mit dem Polizisten gewesen? Vermutlich hatte er es in der Bar Plaza vergessen und fühlte sich nun, als wäre ein wichtiges Körperteil amputiert worden.
Glücklicherweise hatte er die Última Hora dabei. Bevor Cabot sich der Zeitung widmete, klappte er demonstrativ Pablo Riveras Sitzbank wieder in Fahrtrichtung um – für den Fall, dass eine der anwesenden Herrschaften auf die Idee kam, in Riveras Fußstapfen zu treten.
Endlich konnte er wenigstens ungehindert seine Fußsohle kratzen. Erleichtert streckte er das Bein und glitt dabei auf einer rutschigen Unterlage aus. Ein Blick in den schmalen Spalt zwischen den Sitzen offenbarte ein etwa DIN-A6-großes weißes Papier auf dem Boden.
Ein zusammengefalteter Zettel, nun verziert vom dunklen Wellenmuster der Gummisohlen seiner Tod’s-Schuhe.
Cabots Finger lösten sich vom erbsengroßen Hügel des Mückenstichs, tasteten nach dem Papier und entfalteten es.
Er überflog die Zeilen. Runzelte die Stirn. Las erneut. Doch der Sinn erschloss sich auch im zweiten Durchgang nicht.
Was sollte das denn?
Er wendete das Blatt und untersuchte die Rückseite nach mehr Hinweisen auf einen Adressaten oder Absender. Doch außer seinem Sohlenabdruck, der wie die gleichmäßige Zeichnung einer Tapete die weiße Fläche füllte, war die Rückfront des Zettels blank.
Ein Schauer des Unbehagens kroch ihm das Rückgrat hinauf und runzelte seinen Nacken in Gänsehaut.
Sicherlich ein dummer Scherz.
Vielleicht die Kinder?
Trotz des plötzlichen Gefühls, unter stärkerer Beobachtung zu stehen als noch einen Moment zuvor, widerstand Cabot dem Drang, sich umzudrehen, und fixierte stattdessen die Wörter auf dem Papier in seiner Hand.
Verstohlen wagte er es, seinen Blick zu den Schülern zu erheben, doch ihre Aufmerksamkeitsspanne für die Umwelt hatte bereits ihren Zenit überschritten und sie zurück zu ihren Handys geführt.
Genieße deine letzte Stunde.
Die Druckbuchstaben flimmerten vor Cabots Augen. Er blinzelte sie sich wieder scharf und unterbrach ihren Tanz auf dem weißen Untergrund.
Mit dem Kopf an den Holzrahmen des Fensters gelehnt sog er die nach Kräutern duftende Luft der Landschaft ein. Doch selbst der Lavendel konnte seinen rasenden Herzschlag nicht beruhigen.
Die alte Eisenbahn bretterte in eine Unterführung, und der Sog des Durchzugs der geöffneten Fenster riss ihm das Papier aus den Fingern. Es verschwand in der Finsternis des Tunnels, dramatisch untermalt von dem Echo der klopfenden Räder auf den Schienen, das von den engen Wänden widerhallte.
Cabot schluckte hart. Er beschloss, es als gutes Zeichen zu werten. So musste er den Wisch nicht einmal entsorgen.
Wie in einem Signal flackerte das Licht der Art-déco-Lampen des Abteils zweimal an und wieder aus, um dann ausgeschaltet zu bleiben.
Der Waggon hämmerte durch den finsteren Tunnel.
Etwas bohrte sich in Cabots Rücken.
Schmerz explodierte in einem Sternenhagel. Verbreitete sich gleißend und verbrannte ihm die Sinne, seine Stimme, den Atem.
Sein lautloser Schrei vereinte sich mit dem rhythmischen Kabumm-Kabumm-Kabumm der Schienen und dem Lärm der Kinder zu einer Sinfonie der Pein, als sein Herz den Hieb abbremste.
Und sein Fuß hörte endlich auf zu jucken.
2
Pablo Riveras Inneres brannte vor Scham.
Schon wieder!
Das ohrenbetäubende Dreifachklopfen des Zuges über die Schienen empfing ihn, als er die Austrittsplattform betrat, die die letzten beiden Waggons voneinander trennte. Die engen Wände des drei Kilometer langen Alfabiatunnels verstärkten das laute Geräusch, und Pablo presste die Handflächen auf die Ohren.
Jetzt, nachdem die Wut und der Druck sich entladen hatten, sah Pablo sich mit den Wrackteilen seines Schiffbruchs konfrontiert.
Leider zu spät.
Er hatte schon wieder die Kontrolle verloren.
Und das vor Zeugen und trotz der teuren Therapie!
Noch unentschlossen pendelte er zwischen den Alternativen, es Doktor de Miguel zu verschweigen – immerhin hatte Pablo beachtliche Fortschritte aufzuweisen – oder den Ausbruch und Rückfall zu beichten. Was unweigerlich zu einer Extrasitzungsrunde führen würde.
Er schauderte, als sich die Szene im Zug vor seinem inneren Auge abspulte. Allein die kreischenden Kinder im Rücken hätten als Auslöser einer Entgleisung ausgereicht, geschweige denn Cabots entnervende Gleichgültigkeit oder das Flackern der Lichter im Abteil. Pablo machte sich eine mentale Notiz, die Schwankungen der Leuchtdichte als Auslöser für seinen Temperamentsausbruch anzugeben – falls er sich für die Variante der therapeutischen Beichte entschied.
Wenigstens war er aus dem Abteil geflüchtet, bevor sein Kontrollverlust den üblichen Verlauf genommen hatte. Das durfte ihm nie wieder passieren. Es reichte, dass er so alles wirklich Wichtige im Leben verloren hatte.
Obwohl sich auch darüber die Einsicht erst hinterher eingestellt hatte. Wie immer.
Pablo betrachtete angewidert die schattenhaften Umrisse seiner Hand. Diesen Körperteil, der in Momenten des Druckes ein Eigenleben zu führen schien. Er konnte es Amaya nicht verübeln, dass sie die Scheidung eingereicht hatte. Wenn es eine Chance auf Wiedergutmachung gegeben hätte, wäre er aus Dank den gesamten Jakobsweg gelaufen.
Barfuß.
Doch Cabot war eine andere Nummer. Er musste es schlauer angehen. Notfalls mit anderen Mitteln. Zu viel hing von diesem Deal ab.
Nachdem er mit gesenktem Kopf den halben Zug auf der Suche nach einem adäquaten Sitzplatz durchlaufen hatte, war Pablo der Luftzug um die Schultern aufgefallen.
Er rieb sich über den bloßen Nacken, der im Durchzug der beidseitig geöffneten Fenster langsam, aber sicher versteifte.
Jetzt hatte er an einem Tag die Contenance, das Geschäft des Jahrhunderts und sein liebstes Souvenir verloren.
Er dachte an Amaya. An die Shoppingtour durch Bloomingdales auf ihrer letzten gemeinsamen Reise nach New York, wo er ein Vermögen für ein bisschen Stoff ausgegeben hatte. Damals, als Pablos Leben noch in Ordnung gewesen war. Zumindest hatte er sich das eingeredet.
Doch damit war er wieder bei seinem Uroboros angekommen, der sich in den eigenen Schwanz biss und die Negativschleife seiner Gedanken in Gang setzte: das trügerische Gefühl der Hoffnung, während sie im Flugzeug Champagner geschlürft und sich Besserung geschworen hatten. Ihre Hand in der seinen, feucht am Pflaster um ihren Zeigefinger, wo der Kippriegel für den ausklappbaren Bildschirm am Sitz eine Quetschwunde verursacht hatte. Pablos durchgestylte Wohnung in Madrid, trostlos ohne Amayas Lachen und ihre überall verteilten Klamotten. Zweihundert Quadratmeter Leere, vergleichbar mit dem Inhalt seines Singlekühlschranks.
Er hatte es sich alles selbst zuzuschreiben.
Sollte Cabot sich doch zum Teufel scheren, gleich und gleich gesellte sich gern. Pablo würde nicht buckeln. Er würde sich alles zurückholen.
Den Deal, sein Souvenir.
Und dann sein Leben.
Zielstrebig schritt er über die überbrückte Verbindung der zwei Waggons.
Der letzte Waggon lag in Finsternis. Verwundert blieb Pablo vor der Glastür stehen, die den Innenraum von der Austrittsplattform trennte. Einige Fahrgäste waren mit ihren Handys beschäftigt, und ihre Gesichter leuchteten geisterhaft im Schein der blauen Frequenzen der Bildschirme. Außer diesen Lichtpunkten herrschte absolute Dunkelheit. Pablo drehte sich um, warf einen prüfenden Blick zum vorletzten Waggon, aus dem er soeben gekommen war. Hier funktionierten die alten Deckenlampen einwandfrei und tauchten das Abteil in ein warmgelbes Ambiente.
Der Lichtausfall kam ihm gelegen. So konnte er im Schutz der Dunkelheit hinein und schnell ohne verbales Intermezzo wieder verschwinden. Und das zurückholen, was ihm gehörte.
Entschlossen griff er nach der Türklinke, als ihn ein Geräusch hinter ihm erstarren ließ.
Pablo wirbelte herum.
Angelehnt an das Metallgitter der Plattformbrüstung stand jemand.
Der schemenhafte Umriss der Person bewegte sich, und es folgte ein Laut wie das Klacken eines aufgeklappten Zippofeuerzeugs. Dann eine winzige Flamme, die die Dunkelheit in sich aufzusaugen schien.
Pablo Rivera stieß die Luft aus, er hatte gar nicht gemerkt, dass er sie angehalten hatte, und drehte sich wieder zur Waggontür. Nur jemand, der eine Zigarettenpause einlegte.
Durfte man im Tunnel überhaupt rauchen?, schoss es ihm durch den Kopf, als eine Hand sich mit festem Druck auf seine Schulter legte, ihn mitten im Schritt stoppte und Pablos Finger ins Leere griffen.
3
Ein lautloser Schrei entfuhr dem dünnen Mädchen, noch bevor es über Bord gestoßen wurde.
Wo ihr Körper die glatte Meeresoberfläche durchbrach, entstand eine weiße Fontäne, die Millionen von Wassertropfen in die Luft schleuderte.
Lluc Casasnovas duckte sich, wie um dem Schauer auszuweichen, obwohl sein Boot mehrere Hundert Meter entfernt vor Anker lag.
Er senkte das Fernglas.
»Bei der Sunseeker dort drüben stimmt etwas nicht. Wir sollten nachsehen …«
»Du bist nicht im Dienst, Lluc.« Juan verharrte in seiner meditativen Haltung und sah nicht einmal auf, während er sprach.
»Mein Pflichtbewusstsein hänge ich nicht mit der Uniformjacke an den Garderobenhaken.«
Juan seufzte und öffnete ein Auge. »Junge Leute, die Arschbomben vom Boot machen. Keine Terroristen, keine Drogenschmuggler. Du musst lernen, dich zu entspannen. Das ist das Alpha und Omega des Angelns.«
Lluc setzte erneut den Feldstecher an. Das Mädchen kletterte nun mühsam die Badeleiter ins Boot zurück und zog sich die verrutschte, am Körper klebende Hose zurecht. Einer ihrer Begleiter stieg auf die Reling, sprang in die Höhe und ließ sich mit angezogenen Knien ins Meer plumpsen. Die daraus resultierende Wasserbewegung drohte einen Minitsunami auszulösen. Arschbombe 2.0. Die perfektionierte Version.
Widerwillig legte Lluc das Fernglas in den wasserabweisenden Segeltuchbeutel zurück. Sein Freund behielt recht. Die jungen Leute amüsierten sich. Und das sollte er eigentlich auch tun.
Denn heute begann die letzte Woche seines Lebens.
Seines alten Lebens.
Alles würde vorbei sein: sein Täglich-grüßt-das-Murmeltier-Job. Die erbärmliche Freizeitgestaltung – hier musste er allerdings die einsamen Abendessen mit seiner Lieblingsnachrichtendame des ersten Programms ausklammern, die ihm lächelnd vom Bildschirm Gesellschaft leistete. Sie trug die Meldungen des Tages in so charmanter Weise vor, dass selbst das Scheitern der spanischen Regierungsbildung und die brennenden Proteste in Katalonien wie hoffnungsvolle Botschaften klangen. Das würde bleiben.
Der heutige Morgen stellte den Auftakt der neuen Ära dar, ein Probefreizeiten sozusagen, der Pilotfilm für die Serie der grandiosen Tage, die ihm in Zukunft bevorstanden. Er sollte also besser auf Juan hören und sich entspannen.
Re-nais-sance.
Ein wundervolles Wort. Er ließ es sich auf der Zunge zergehen wie die Meersalzschokolade aus dem Trüffelladen in Palma, die er sich in wochenweisen Riegelportionen streng rationierte.
Die weiße Llaüt – ein traditionelles balearisches Fischerboot aus Holz – schaukelte sanft auf den kurzen Wellen, ein leichtes Rollen wie das rhythmische Wippen einer Wiege. Nur ein von einer weiblichen Stimme gesummtes Schlaflied fehlte noch zum perfekten Schlummer. Lluc schloss die Augen. Die Angelrute wog schwer in seiner Hand, und er verstärkte den Griff, um sie nicht versehentlich loszulassen, sollte der Schlaf ihn tatsächlich überkommen.
Das hysterische Kreischen eines Vogels holte ihn aus seinem entspannten Dämmerzustand.
Vom Inselfelsen des Morro de Sant Joan, einen Steinwurf entfernt von der Stelle, an der sie ankerten, erhob sich eine Korallenmöwe in die Luft, stürzte im Sinkflug auf das türkisblaue Wasser und tauchte den roten Schnabel zielgerichtet zwischen zwei Wellen. Sie verschwand in den Lüften, ohne dass Lluc ihre Beute genau erkennen konnte.
Aber da hatte etwas in ihrem Schnabel gehangen, was auf Lebensformen in diesem Gewässer hindeutete. Fische. Lluc brauchte nur über die Bordkante des Holzbootes zu sehen, um selbst mit bloßem Auge ganze Schwärme in unterschiedlichen Größen und Formen im klaren Wasser zu erkennen.
Warum bissen sie dann nicht an?
Er drehte den Kopf zu Juan, der still neben ihm hockte und eine Ruhe ausstrahlte wie ein zufriedener Buddha. Stämmig und breitschultrig, mit der majestätischen Stabilität einer Pyramide, während die einzige Bewegung in dem Spiel des Windes durch die Spitzen seiner langsam ergrauenden hellbraunen Haare bestand. Das mussten auch die Fische bemerkt haben und seiner Angelrute gefolgt sein wie einem Licht am Ende des Tunnels.
Lluc sah betreten in seinen leeren Eimer, der blanke Plastikboden ein mahnender Hinweis auf seine mangelnde Angelkunst. Ganz im Gegensatz zu Juans Kübel. Eine dicke Llampuga starrte ihm dort vorwurfsvoll aus toten Augen entgegen, die regenbogenfarbenen Schuppen sonnenlichtbrechende Miniprismen. Der Fisch wog bestimmt fünf Pfund, doch Juan hatte ihn lachend als Zufallsfang abgetan. Der Grund, aus dem sie schon kurz vor der Morgendämmerung hier gesessen hatten, befand sich in Juans zweitem Eimer:Calamares.
Fünf alabasterfarbene Körper, die wie Geister im Wasser schwebten.
»Calamares sind nachtaktiv, also am besten abends oder vor Sonnenaufgang zu fischen«, hatte Juan mit dieser dunklen Stimme erklärt, die bei genauer Betrachtung ebenfalls für das Summen von Schlafliedern geeignet war. »Ab September ist Hauptfangsaison, weswegen du theoretisch auch zu anderen Tageszeiten welche angeln kannst.«
Theoretisch.
Juans Erfolg hing zweifellos mit dieser Entspanntheit zusammen, die selbst Lluc fast körperlich spüren konnte.
Also schloss er die Augen und tauchte in der Dunkelheit hinter seinen geschlossenen Lidern nach der Perle der Ruhe, die sich dort irgendwo befinden musste. Schließlich hatte Juan sie auch gefunden. Offensichtlich suchte Lluc an der falschen Stelle, oder seine Suchmethode war verkehrt, denn da war kein Frieden. Keine wohlige Entspannung oder zufriedene Akzeptanz. Das Einzige, das sich breitmachte wie ein unerwünschter Besucher, war grenzenlose Langeweile.
Und die Gedanken an die öden Fälle, die ihm heute Nachmittag bevorstehen würden – womit er wieder bei der Langeweile ankam: die letzte Woche im Delikatessenladen des Carrer de Sa Luna entwendete Lieferung des Dattel-Balsamicos und der teuren Sonderedition des aus Sóller stammenden Cabraboc-Gins. Die Einzigartigkeit des Gins mit seinem Bouquet von Anis und Orangen war nicht zu leugnen, obwohl er selbst die reguläre Variante bevorzugte, die über ein stärkeres Zitrusaroma verfügte. Dennoch hatte gestohlener Alkohol, egal welcher Exzellenzstufe, nicht ganz oben auf seiner Liste der Aktivitäten gestanden, als er den Chefposten der Dienststelle in Sóller angetreten hatte.
Er rieb sich nachdenklich über das borstige Kinn, wo er an diesem Morgen graue Stoppeln in dem dichten Bartwuchs entdeckt hatte. Nein, das brauchte er mit Anfang fünfzig nicht mehr.
Ebenso wenig das Abzeichnen der Protokolle der Barschlägerei an der Rambla im Puerto, die mit zwei gebrochenen Nasen und einer Platzwunde den Flamencoabend mit Livemusik beendet hatte. Natürlich fühlten sich die Anwohner gestört, weil drei Konzertgitarren und vier im Takt der rauchigen Gitano-Stimme klatschende Hände – allesamt mikrofonverstärkt – nicht unbedingt die Nachtruhe förderten. Aber ein Anruf bei der Policía Local hätte ausgereicht, um dem Spuk ein Ende zu bereiten.
Von den entlaufenen Katzen, Hunden, Pferden und manchmal auch aus dem Altersheim für Demenzerkrankungen entwischten Patienten ganz zu schweigen. Erst letzte Woche hatten sie María Francisca, die Schwiegermutter des Metzgers aus der Sa Lluna, oben auf dem Friedhof aufgesammelt. Sie hatte mitten auf dem Grabstein der Familiengruft der Colls gesessen. Zwischen den noch frischen Gladiolen und getopften Chrysanthemen der kürzlich stattgefundenen Beerdigung und mit Blick aufs Alfabia-Gebirge in aller Seelenruhe ihre Coca de verduras gekaut, die sie vom Mittagessen unverpackt in ihrer Jackentasche transportiert hatte.
In den seltenen Momenten der Wahrhaftigkeit, wenn die Langeweile stark genug war und keine andere Ablenkung ihr schillerndes Gefieder präsentierte, hinter dem er sich verstecken konnte, wusste Lluc, dass das nicht der wahre Grund seiner Verdrossenheit war. Aber mit der Wahrheit verhielt es sich wie mit zahlreichen anderen Dingen im Leben. Es hing davon ab, wie viele Stufen man bereit war, ins Kellergeschoss des eigenen Bewusstseins hinabzusteigen, in dem die Unzufriedenheit hauste. Die Treppen bis zum ersten Absatz waren noch leicht. Die Luft wohltemperiert und trocken.
Natürlich konnte man Sóller kriminaltechnisch nicht gerade mit Chicago oder der Bronx vergleichen. Lluc hatte gewusst, worauf er sich einließ, als er vor zehn Jahren den Posten angetreten hatte. Mit knapp über vierzehntausend Einwohnern war Sóller ein Dorf an der Nordwestküste Mallorcas, selbst wenn es als Kleinstadt galt. Selbstverständlich kannte Lluc nicht sämtliche Bewohner, aber viele waren ihm vertraut. Es war mühsam, Neutralität zu wahren und seinem Job nachzugehen, wenn die Leute einen richterlichen Spruch von ihm erwarteten, um dann mit Missbilligung und bösen Blicken in der Bar Plaza gestraft zu werden.
Irgendjemandes Fuß befand sich immer unter Llucs Sohle des Gesetzes. Er war es müde, in ihre Geschichten hineingezogen zu werden.
Nur eine Stufe tiefer auf der Treppe des Bewusstseins veränderte sich das Klima. Modrige, feuchte Wärme schlug ihm hier entgegen. Lluc wusste, nur einen Schritt weiter war die Luft so abgestanden, dass es ihm die Kehle zuschnüren und das Atmen schwerfallen würde. Also blieb er, wo er war.
Außerdem war es so langweilig auch wieder nicht.
Das laute Motorgeräusch eines nahenden Bootes zerrte Lluc aus seinen Gedanken. Noch bevor der runde Rumpf eines grauen RIB Boots am Buchteingang erschien, wusste er, welcher von Sóllers Bootsbesitzern sich da die Ehre gab.
Juan sah von seiner Angelrute auf. »Blu«, sagte er und grinste. Lluc nickte zustimmend.
Die zwei Außenborder mit fünfhundert PS von Tolo Alcovers neuem Kätzchen schnurrten in unverkennbarem Timbre, das es von allen anderen Kuttern seiner Bootsverleihflotte abhob. Eigentlich war der Flitzer zum Mieten für die betuchten Gäste des Jumeirah-Hotels vorgesehen gewesen, doch seit dem Kauf im Mai hatte Lluc nur Tolo damit herumfahren sehen.
Wie ein Messer schnitt das Boot durchs Wasser, ein anthrazitfarbenes Zwölfmetergeschoss aus aufblasbarem Gummi mit Teakdeck, das sowohl Batman als auch Dr. No stolz gemacht hätte. Oder einen südamerikanischen Drogenbaron, der nicht mehr inkognito reisen wollte.
Das Boot verlangsamte das Tempo und glitt auf sie zu.
Statt eines hollywoodreifen Bösewichts winkte ihnen nur Tolo zu, dessen kleine Gestalt fast vollständig hinter der Steuerkonsole verschwand. Tolo in seinen orangefarbenen Shorts, die ihm bis über die unbehaarten Knie reichten, und einem weißen Poloshirt mit einem skizzierten Abbild der Blu und dem Aufdruck ToloTours.
Das gleiche Shirt, das die Arbeitskleidung seiner Belegschaft ausmachte und das Lluc auch gerade trug. Nach dem Kauf der Blu hatte Tolo sein Logo verändert, neue Shirts anfertigen lassen und die Vorgängermodelle an halb Sóller als Werbegeschenk verteilt. Wegen des weichen und luftigen Stoffes war das Shirt schnell zu Llucs Favoriten dieses Sommers aufgestiegen.
»Du verscheuchst uns die Calamares.« Luc wedelte mit der Hand. »Verschwinde.«
Tolos Lachenübertönte den tuckernden Motor, als er das Boot neben die Barkasse steuerte. Er schob sich die Sonnenbrille auf die pechschwarzen Haare, deren südländische Farbe nicht zu seiner sonnenbrandanfälligen britischen Haut passte und wie gefärbt wirkte. »Dann hast du jetzt wenigstens jemanden, dem du die Schuld in die Schuhe schieben kannst.«
Sehr witzig. Reflexartig beugte Lluc sich nach vorne, um die Sicht auf den leeren Eimer zu versperren. Obwohl Tolo, der gerade mal über das Lenkrad gucken konnte, nicht wirklich Einblick gehabt hätte. »Was weißt du denn schon?«
Er zeigte auf den in schwarzen Buchstaben gedruckten Namen des luxuriösen Schlauchboots. »Du kannst noch nicht mal blue richtig schreiben. Da fehlt ein e nach dem u.«
Tolo stemmte die Hände in die Hüften. »Ich bin Spanier, und mein Boot soll Blu heißen, nicht Blu-e.« Er sprach es wie »blu-äh« aus.
Sinnlos, dieses Gefecht weiterzuverfolgen. »Bien, gut, schreib es, wie du willst.« Lluc hob beschwichtigend die Hände. »Wieso eigentlich Blu?« Schließlich war das Boot dunkelgrau und Tolo seines Wissens nach nicht farbenblind.
»Wie sonst? Red passt ja nun gar nicht!«
Lluc öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Tolo blieb der unangefochtene Meister der schlagenden Argumente.
Juans dunkle Stimme meldete sich zum ersten Mal zu Wort, während er seine zuckende Angelrute mit langsamen Bewegungen einkurbelte. »Marta und ich erwarten euch heute Abend beide zum Essen.« Ein etwa zwanzig Zentimeter langes Exemplar bohrte sich den letzten Meter durch die kristallklaren Wellen und trübte kurz vor der Oberfläche das Türkisgrün des Wassers mit einer dunklen Tintenwolke.
»Um acht bin ich da. Bis später.« Tolo drehte die Blu ab. »Ach, Lluc – schönes Shirt!«, rief er grinsend über die Schulter, bevor er Gas gab.
»Das habe ich einem toten Schmuggler in einer Höhle an der Torre picada abgenommen.«
Tolo verdrehte die Augen, hob die Hand zum Abschied, gab Gas und raste aus der Bucht, eine weiße Schleppe aus aufgewirbeltem Wasser hinter sich herziehend.
Die Llaüt schaukelte kräftig in den aufgewühlten Wellen. Lluc sah auf die zerklüftete Steilküste, die sich hoheitsvoll über dem Azur des Wassers erhob. Unzählige Grotten im wasserangrenzenden Teil des Felsens, Löcher aller Dimensionen und Höhlen zersetzten das gesamte Massiv aus Kalkgestein wie einen Meeresschwamm. Was Lluc gerade als Witz gemeint hatte, gehörte einer nicht allzu entfernten Vergangenheit an. Er konnte sich noch wörtlich an die Geschichten seines Vaters erinnern, der als Zehnjähriger nachts bei Sa Costera die Klippen bestiegen hatte, um geschmuggelte Zigaretten in einer Höhle für den Vertrieb nach Palma zu verstecken. Als in der Wirtschaftskrise des nachkriegszeitlichen Franco-Spaniens alles geschmuggelt wurde, was irgendwie transportierbar war. Medikamente, Zigaretten, Fahrräder – der Schwarzmarkt war aufgeblüht wie im März die Orangenbäume, wenn der zarte Duft das ganze Tal mit dem jasminähnlichen Aroma erfüllte.
Die Schmuggler hatten nur eine Tradition weitergeführt, die jahrhundertelang vor ihnen von Piraten eingeführt worden war.
Lluc legte den Kopf in den Nacken und blickte auf zu einem Felsvorsprung in der Form eines menschlichen Profils. In Höhe des fliehenden Kinns klaffte ein Loch im Gestein, und die Dichte der Schatten ließ auf eine tiefere Aushöhlung schließen. Wie erklomm überhaupt jemand die steile Felswand, in der sich nur Bergziegen und Mönchsgeier in ihrem Element fühlten, geschweige denn mit einem Klapprad auf dem Rücken geschnallt? »Mir kann keiner erzählen, dass jahrhundertelang erst Seeräuber und dann Schmuggler hier spurlos ihr Unwesen getrieben hatten, ohne irgendwelche Waren oder Truhen liegen zu lassen. Zum Beispiel da oben.« Er zeigte auf die Höhle im Kliff. »Dort könnte ein einäugiger Korsar die Dukatensäcke einer gekaperten Galeere versteckt haben, und bevor er sie wieder abholen konnte, wurde sein Schiff von der königlichen Flotte versenkt. Oder die Planken von seinem Blut durchtränkt, als ihm seine meuternde Crew im Schlaf die Kehle durchschnitt.«
Juan wirkte skeptisch. »Dann hätten die Schmuggler spätestens nach dem Krieg das Gold deines Barbarossa-Piraten gefunden.«
»Doch nicht bei den Tausenden von kleinen Ausbuchtungen und Höhlen, die die ganze Steilküste durchlöchern. Schau dir diesen Schweizer Käse an.« Lluc betrachtete fasziniert das Ufer, das in einer senkrechten Wand mehrere Hundert Meter über dem Wasser aufragte. »Ich fresse einen Besen, wenn in einer von ihnen keine versteckten Schätze rumliegen.«
Juan öffnete eine Kiste im Bug des Holzbootes und kramte einen Moment darin herum, bis er gefunden hatte, was er suchte.
Grinsend reichte er Lluc einen Salzstreuer.
»Was soll ich damit?«
»Gesalzen schmeckt der Besen besser.«
Lluc setzte zu einer ähnlich gewürzten Entgegnung an, wurde jedoch von einem Mehrklang hintereinander eintreffender Nachrichten unterbrochen.
Die Kurzmitteilungen informierten ihn über eingegangene Anrufe, während sich sein Telefon im schwarzen Telekommunikationsloch der Steilküste befunden hatte, das nur einen punktuellen Empfang zuließ. So wie jetzt.
Lluc überflog die Auflistung der Anrufe. Alle von derselben Nummer: Francisca Gual, der umständlichsten Mitarbeiterin der Welt. Seine Assistentin trat heute nach zweiwöchigem Urlaub den ersten Arbeitstag an. Sicherlich folgte sie dem Drang ihrer latenten Neurose, ihm zu versichern, dass alle Bleistifte in Reih und Glied angespitzt im Stifteköcher steckten und die Kanten sämtlicher Formulare wieder ordentlich übereinander lagen bevor er am Nachmittag seinen Dienst antrat.
Doch zehn Anrufe in Abwesenheit, vier Mailboxbenachrichtigungen?
Selbst für Gual eine außergewöhnliche Statistik, die Lluc Unbehagen erzeugte.
Die schwache Verbindung reichte für einen Rückruf nicht aus, und auch der Versuch, den Anrufbeantworter abzuhören, landete im Nichts des Funklochs.
Normalerweise traf circa fünf Minuten nach Guals erfolglosem Anruf eine WhatsApp-Sprachnachricht ein, in der sie ihr Anliegen eingehend schilderte. Fünf Minuten, da die durchschnittliche Aufnahmelänge der Mitarbeiterin vier Minuten und dreißig Sekunden betrug – dazu kamen dreißig Sekunden Überlegungszeit, wie sie den Sachverhalt am verwickeltsten formulieren konnte. Machte fünf Minuten.
Lluc öffnete WhatsApp. Er hatte richtig vermutet.
Doch bevor er den Chatverlauf seiner Kollegin aufrufen konnte, erlosch das Display in einer dunklen Fläche.
Verdammt. Lluc blinzelte die letzte Nebelschicht des gestrigen Gelages in der Bar Plaza fort. Er hatte am Abend mit Tolo das Auftaktspiel der spanischen Nationalmannschaft auf dem riesigen Bildschirm der Bar Plaza verfolgt und in der Hitze der Aufregung nicht nur die Kontrolle über die geleerten Gläser vergessen. Vermutlich hing sein Ladekabel noch immer in der einsamen Steckdose unter der Sitzbank, wo er seinem schwächelnden Handyakku neuen Lebenssaft eingeflößt hatte. Die Batterie hatte über Nacht durchgehalten – bis jetzt.
»Juan, hier stimmt wirklich etwas nicht. Wir sollten sofort zurück.«
4
Fast hätte Lluc Rosa im Gewühl übersehen – doch sein rasendes Herz registrierte sie schon vor dem Gehirn.
Um das vergessene Ladekabel einzusammeln, hatte er nicht den direkten Weg ins Revier eingeschlagen, sondern war mit Abstecher zur Plaza ins Dorf zurückgefahren und hastete über den Kirchplatz.
Was immer sich in Sóller abspielte, geschah vor der Kulisse der Berge der Tramuntana. Selbst hier im Zentrum und Brennpunkt des Ortes, am Dorfplatz der Plaça Constitució, lugte über jeder mediterranen Jugendstilfassade die mächtige Spitze eines von Mallorcas Riesen.
Die Terrasse seines Stammcafés Bar Plaza wirkte wie ein praller Weinstock mit vielen bunten Trauben. Soweit Lluc erkennen konnte, waren sämtliche Tische mit Menschen in T-Shirts aller Couleur besetzt.
Das neue Mädchen, Catalina, wenn er sich recht erinnerte, rief ihm vom Eingang aus zu »Du kannst den nehmen« und wies mit geschirrbeladener Hand auf einen einsamen Zweiertisch in der Ecke.
Lluc schüttelte den Kopf und hob sein totes Telefon. »Später vielleicht. Habe gestern mein Ladekabel vergessen und muss schnell ins Revier.«
Er betrat den Innenraum, erklärte dem Barmann sein Anliegen, der nach erfolglosem Durchwühlen sämtlicher Schubladen unter der Theke zum Suchen ins Büro nebenan verschwand.
Unauffällig schielte er zu der hageren Person, die an einem der hinteren Tische angehalten hatte, vertieft in einen Monolog. Nach den befremdeten Gesichtern der Zuhörer zu schließen hatte der alte Kiko sein Lieblingsthema herausgekramt und schien wie immer nicht zu bemerken, dass seine Passion in anderen Menschen Unbehagen auslöste.
Lluc wandte sich schnell um in der Hoffnung, unentdeckt zu bleiben, und ließ seinen Blick durch die offene Glasfront über die Gaudí-inspirierten Bauwerkfassaden der Banco de Sóller und der Pfarrkirche Sant Bartomeu wandern. Bei dem Gedanken, der nächste Rezipient eines irren Vortrages zu werden, zogen sich die Knorpelgänge seiner Ohrmuscheln zusammen.
Wie das letzte Mal, das in einer geschlagenen halben Stunde höflich nickenden Zuhörens resultiert hatte. Und das nur, weil Lluc es nicht fertigbrachte, das Glück in den vor Begeisterung funkelnden Augen mit einer brüsken Abfuhr zum Erlöschen zu bringen. Wenigstens hatte einer von ihnen seine Freude gehabt.
Der Auftakt seiner letzten Woche begann so wenig Erfolg versprechend, dass Lluc beschloss, diesem Abwärtstrend frühzeitig entgegenzuwirken.
Er stützte die Unterarme auf der Theke ab und studierte die Tageskarte, die mit weißer Kreide auf eine Schiefertafel gekritzelt worden war. Wenn sich der Spuk dieses Vormittages aufgelöst hatte, würde er Albóndigas en tomate, Hackbällchen in Tomatensoße, bestellen, und statt des üblichen Cafés zum Nachtisch einen Gató, den mallorquinischen Mandelkuchen. Zur Kompensation. Weil heute Montag war und er eine weitere Woche ertragen musste. Sieben Tage voller Generve.
Seeluft machte hungrig, und die Aussicht auf das Mittagessen lichtete Llucs Stimmung. Er hoffte für Gual, dass dieser Stress nicht auf einer ihrer spontan obsessiven Mitteilungslaunen basierte. Unwahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschließen.
Doch trotz all ihrer Eigenheiten musste Lluc sich eingestehen, Gual in ihrer Abwesenheit vermisst zu haben. Glücklicherweise existierte die lokale Absprache im Revier, die maximale Urlaubsdauer auf zwei Wochen zu beschränken. Sie arbeiteten nun schon viele Jahre verlässlich zusammen, und er wollte nicht alleine den Abgang machen. Eine letzte Dienstwoche ohne Gual glich einer Paella ohne Safran, einem Pa amb oli ohne Öl oder einem Silvester ohne die spanische Tradition der zwölf Trauben zu Mitternacht.
Jetzt im Juni, mit frühsommerlichen siebenundzwanzig Grad, schien sich die halbe Welt die Rucksäcke umzuschnallen und ins Dorf zu pilgern.
Trotz der milden Temperaturen hatten viele der lehmverputzten Natursteinhäuser ihre gesprossten Fensterläden geschlossen – wobei farblich ein modisches Taubenblau zunehmend das klassische Tramuntana-Dunkelgrün des Holzes verdrängte. Diese scheinbare Lichtempfindlichkeit der Mallorquiner basierte auf einem Habitus sonnenverwöhnter Menschen, als würden die Insulaner über fotophobe Vampirgene verfügen und ab einem gewissen Schwellenwert Körperzellen, Teppiche und Spitzentischdecken zu Staub zerfallen.
Lluc lenkte seinen Blick an den Engelstatuen der Kirche vorbei, welche statt Gargoyles die Turmspitzen bewachten, und landete auf dem zerklüfteten Berggipfel des L’Ofre.
Zusammen mit dem Penyal des Migdia, der Serra d’Alfábia wie auch dem Puig des Teix umringten Mallorcas höchste Berge das goldene Tal von Sóller wie majestätische Wächter. Sie verfügten über legendäre Wanderwege in atemberaubender Landschaft, die Touristen und Einheimische gleichermaßen anzogen.
Um diese zu erreichen, mussten sie dafür durch den Tunnel des Alfabiagebirges anreisen, der Sóller mit dem Rest Mallorcas verband und einem magischen Portal glich. Denn die Welt am Eingang entsprach in keiner Weise derjenigen, die einen am Ausgang der drei Kilometer langen Dunkelheit erwartete.
Eine befreundete Kollegin bei der Policía Nacional hatte es einmal als Passieren der unsichtbaren Grenze zu Tolkiens Mittelerde bezeichnet. Hinein ins immergrüne Auenland, der Heimat der Hobbits.
Llucs geografische und sonstige Kenntnisse über das Hobbitland passten mengenmäßig in ein Streichholzbriefchen, doch zumindest entsprach die durchschnittliche Körpergröße des Sóllerics dem Bild.
In Llucs Augen folgte der Mythos der Region einem simpleren Rezept, das weniger Fantasie erforderte: Man nahm ein Hochgebirgsambiente, exotisierte es durch strategisch gepflanzte, meterlange Dattelpalmen und platzierte es direkt an der Küste. Anschließend feuerte man eine gigantische Partykanone über dem Tal ab, die in einer bunten Farbexplosion gelbe, orange und lila Sprenkel verschoss.
Denn durch Sóllers ungewöhnliche Lage, eingekeilt zwischen hohen Bergen und dem Meer, entstand ein ideales Mikroklima für Zitrusfrüchte. Terrassenförmig angeordnete Orangen-, Zitronenhaine und Olivenhaine, Bougainvilleahecken und anderes mediterranes Gewächs sprossen auf jedem Berghang und an jeder Ecke im Dorf.
Das knallrote knöchellange Kleid war der Grund, warum Lluc sie in diesem Gewühl überhaupt erblickte.
Rosa.
Sein Puls beschleunigte sich augenblicklich und trieb ihm die Hitze ins Gesicht.
Ein Haufen Schmetterlinge stob flatternd in seinem Magen auf.
Die leuchtende Farbe des Kleides akzentuierte ihre leicht gebräunte Haut – glatt und seidig und wie von innen angestrahlt. Rosa trug das Haar hochgesteckt zu einem Knoten, was ihr die Eleganz einer dunklen Grace Kelly verlieh, und überquerte mit kleinen Schritten die mit Orangenbäumchen gesäumte Plaza.
Wie um einen Akzent zu setzen, ertönte die altmodische Hupe der Straßenbahn. Der gleiche heisere Ton, an den sich Lluc aus seiner Kindheit erinnerte und bei dem es sich wahrscheinlich noch um die Originalversion von 1912 handelte.
Verwundert warf er wieder einen Blick auf die Uhr: 13:32 Uhr. Für den Dienstschluss im Ayuntamiento, wo Rosa arbeitete, war es noch zu früh. Vielleicht ein mittäglicher Shoppingtrip? Die zentrale Lage des Rathauses am Kirchplatz erlaubte einen schnellen Abstecher in die anliegenden Geschäfte, bevor sie am Nachmittag zur Siesta schlossen.
Und tatsächlich hatte Rosa nun den Platz überquert und schritt in Richtung Carrer de Sa Lluna.
Lluc seufzte und drehte sich in seinem Stuhl, um ihr nachzublicken, bis sie in der gequetschten Menschenmenge von Sóllers Haupteinkaufsgasse verschwand.
Er revidierte seine Meinung über die vermeintliche Negativtendenz des Tages. Der Kurs hatte soeben einen steilen Aufwärtstrend erfahren.
Natürlich hielt Lluc auf der Plaza stets die Augen offen in unbewusster Hoffnung auf eine zufällige Begegnung. Doch selbst die unmittelbare Nähe von Rosas Arbeitsstelle im Bauamt des Rathauses zu seinem Lieblingscafé stellte keine Garantie dar und führte nur selten dazu, dass ihre Wege sich kreuzten.
Scham stieg in ihm auf. Er fühlte sich wie ein alberner Teenager bei seiner ersten Schwärmerei.
Und im Grunde hatten die letzten zehn Jahre daran nichts geändert. Seit dieser Nacht in Pepes Bar, in der Llucs Leben die falsche Abzweigung genommen hatte.
Resolut wischte er in routiniertem Zug alles zur Seite: das irritierende Gefühl der Peinlichkeit, die machtvolle Emotion seiner Zuneigung zu Rosa, das Tauziehen zwischen beiden.
Doch statt der sicheren und komfortablen Gleichgültigkeit, die sich dann für gewöhnlich einstellte, blieb heute das nervöse Hochgefühl zurück.
Zehn Jahre, seit sie ihn verlassen hatte. Und trotzdem kam es Lluc wie gestern vor.
Doch das blieb sein Geheimnis.
Er hörte das unverwechselbare Schlurfen von ausgetretenen Turnschuhen und hoffte, die Person würde ihre Schritte in eine andere Richtung lenken.
»Es ist Zeit loszulassen«, sagte die Stimme gelassen. Lluc starrte auf die Tresenplatte vor sich und zog den Kopf ein, als würde ihn das unsichtbar machen.
»Die Zeit ist reif. Meinst du nicht?« Kiko positionierte sich wie selbstverständlich neben Lluc und stellte seinen Jutebeutel auf dem Boden ab.
Lluc gab vor, hochinteressiert das auf der Theke ausliegende Werbeprospekt über die anstehende Party des San Joan zu studieren, und schielte möglichst unauffällig aus dem Augenwinkel zu Kiko. Er sah wie ein ganz normaler alter Mann aus, die blauen Augen wach und fokussiert, seine Jeans und das saubere T-Shirt ordentlich gebügelt. Lluc wusste nicht, warum er den Duft von Katzenurin oder braune Flecken um den Hosenboden erwartete, und jedes Mal prophylaktisch die Luft anhielt, wenn Kiko sich näherte. Auch schwebte sein Haar nicht wirr und grau wie eine Gewitterwolke um den Kopf, sondern lag adrett gescheitelt und ordentlich über den Ohren geschnitten. Ganz im Gegensatz zu Llucs Haar.
»Reif wofür?« Lluc ahnte, er würde an diesem Tag nicht einfach davonkommen.
»Sie loszulassen.« Kiko sah ihn an, die blaue Iris so klar wie das Wasser um Sa Foradada bei ruhigem Seegang. Es war, als blickte Lluc in einen Spiegel, der seine Seele reflektierte.
Vehement schüttelte er den Kopf. »Ich weiß nicht, wovon du redest.«
»Es ist Zeit, alte Wunden zu heilen, mein Freund. Lass sie gehen.« Kiko machte eine Kopfbewegung in Richtung Carrer de Sa Lluna. »Dein Weg ist ein anderer, und er muss beschritten werden. Wenn du es nicht tust, gibt es niemanden, der ihn geht.«
Sprachlos starrte Lluc auf die Petersilie, die wie ein ungebändigter Haarschopf über den Rand von Kikos Beutel ragte, und in ihm den Impuls wachrief, die Kräuter mit einer Schere zu stutzen. Er fühlte sich wie ein Schuljunge, der beim Abschreiben erwischt worden war.
Woher wusste der Alte …? Hatten ihm das seine Freunde, die Außerirdischen, bei ihrer letzten Aufwartung im Tal zugeflüstert? Anstatt seine Nase in fremde Dinge zu stecken, sollte er lieber nach Hause gehen und den Inhalt seines Koffers überprüfen. Damit nichts fehlte, falls unangemeldeter Besuch erschien.
Lluc seufzte und fuhr sich durchs dichte Haar. Kinder und Narren trafen mit zielgerichteter Effizienz den wunden Punkt, als würde er ein Fähnchen tragen.
Und Kikos Koffer stand immer gepackt bereit, das wusste jeder im Dorf.
Beim Boom der angeblichen Ufosichtungen im Tal gegen Ende der Achtzigerjahre, als die Anhänger der Theorien über Außerirdische sich an der Militärbasis des Puig Mayor versammelt hatten, war Kiko ganz vorne mit dabei gewesen. Es erforderte kein detektivisches Gespür, um zu vermuten, dass eher ein fehlgeschlagener psychedelischer als ein tatsächlicher Trip in das Innenleben eines Raumschiffs Kiko für alle Zeiten verändert hatte.
Der alte Mann war einer von ihnen, ein fester Bestandteil der Dorfgemeinschaft und aus dem gleichen verschroben seltsamen, aber harmlosen Holz geschnitzt wie die meisten hier. Bueno, Kikos Holz war ein bisschen mehr als seltsam und wies wurmstichige leere Gänge auf, die sich dann mit merkwürdigen Überzeugungen füllten.
»Was machen die Orangen?«, wechselte Lluc das Thema.
»Dieses Jahr besonders gut. Ich werde Extrahilfe für die Ernte brauchen und habe deswegen schon mit Juan gesprochen. Vielleicht kann er mir ein paar von seinen Helfern borgen.« Kiko zog ein Stofftaschentuch aus der Hosentasche und schnäuzte sich geräuschvoll. »Auch für November, wenn die Kiwis reifen.«
Lluc verschwieg lieber, noch bis vor Kurzem geglaubt zu haben, sie würden wie Kartoffeln in der Erde wachsen – immerhin sahen sie aus wie Kartoffeln. Glücklicherweise konnte Kiko von seinen landwirtschaftlichen Erzeugnissen leben. Jeden anderen Job hätte er spätestens am zweiten Tag verloren, falls sich der erste als zu betriebsam für ein kleines Pläuschchen über seine Freunde aus dem Weltraum erwiesen hätte.
Lluc dachte an seinen eigenen Garten, an die Aprikosen- und Kirschbäume und die Ernte, die sie erbracht hatten. Im Tal von Sóller wuchsen Orangen, Zitronen und Oliven wild. Gerade wegen dieser günstigen Umweltbedingungen war das Ergebnis seiner – zugegebenermaßen laxen – Gartenbemühung etwas befremdlich: ganze sieben Aprikosen. Verteilt auf vier Bäume.
Außerdem sechs Kirschen, wovon zwei von den Vögeln schon halb weggepickt worden waren. Er hatte sie gezählt.
Aber diese traurige Ausbeute sollte sich bald ändern, wenn er seinen Polizeidienst quittierte und in wohlverdiente Frührente ging. Die Tinte auf Llucs Antrag war noch nicht getrocknet gewesen, da hatte die Zentralverwaltung in Palma schon reagiert. Josefina García kam brav jeden Tag hochgefahren und plante bereits die Veränderungen, die sie in der Dienstelle durchführen würde, wenn sie erst den Chefsessel eingenommen hatte. Lluc kümmerte es nicht mehr. Zumindest fast nicht. Immerhin war er noch nicht weg.
Seitdem er den Entschluss gefasst hatte, gab es nicht nur ein Licht, sondern überhaupt erst wieder einen Horizont. Einen Ausblick auf eine Veränderung in seinem festgefahrenen Leben, in dem eine Fahrt nach Palma zum Sockenkaufen die einzige Abwechslung darstellte. Manchmal wünschte er sich sogar Alejandra zurück. Die Streitereien zu Hause hatten ab und zu einen ordentlichen Adrenalinstoß mit sich gebracht. Seit der Scheidung herrschte nur Stille. Und mit der Stille kamen die Gedanken.
Nach einer gefühlten Ewigkeit – lang genug, um ein Drittel von Tolstois Krieg und Frieden zu lesen – kehrte der Barmann endlich mit dem Ladekabel und einer erleichterten Miene auf dem Gesicht zurück.
»War schön, dich zu sehen, Kiko. Ruf mich an, wann immer ich dir behilflich sein kann.« Ersteres war zwar gelogen, was aber durch das ernst gemeinte Letztere mehr als wettgemacht werden sollte. Waren es nicht Taten, die zählten?
Der Alte verstand die Botschaft über das Ende des Gesprächs und schlurfte in seiner charakteristischen Weise davon.
»Freier Tag heute?« Der Barmann reichte das Kabel über den Tresen und heftete seinen Blick auf den ToloTours Aufdruck auf Llucs Shirt. »Dann weißt du auch nicht, was da los ist?«
»Was meinst du damit?« Lluc runzelte die Stirn.
»All die Polizeisirenen vorhin, dass man sein eigenes Wort nicht verstehen konnte. Als wäre eine Bank überfallen worden oder so.«
Heilige Scheiße. Was war da los? Lluc dankte dem jungen Mann und setzte sich nervös in Bewegung.
5
Ein Kanon aus lautem Telefonklingeln mehrerer Apparate empfing Lluc im Erdgeschoss des Polizeireviers. Warum nahm da niemand ab?
Vicente, der wachhabende Beamte am Eingang, sprang von seinem Stuhl auf, als er Lluc erblickte.
»Sargento, da sind Sie ja! Wir haben Sie überall gesucht.« Seine Stimme klang fast so aufgeregt wie das Telefonklingeln, und mit einem Ruck zog er sich die grüne Uniformjacke über seinem immer ausladender werdenden Bauch zurecht.
Das Klingeln erstarb.
Lluc seufzte leise. Das waren genau die Situationen, die seine Haare hatten ergrauen lassen. Wo sollte er in der Mittagszeit schon gewesen sein? Jeder wusste doch, wo er sich zu dieser Zeit aufhielt. Irgendeiner dieser muy listos, dieser Schlaumeier, hatte sich kürzlich sogar den Scherz erlaubt, ihn in der Beurteilung von Llucs Stammcafé auf TripAdvisor als Inventar des Marktplatzes zu preisen. Tolo hatte die Bewertung entdeckt, was natürlich kein Zufall gewesen sein konnte. Obwohl das Lesen von Anzeigen genau seinem literarischen Niveau entsprach, war es selbst für Tolo unwahrscheinlich, auf TripAdvisor nach Tipps für sein eigenes Dorf zu suchen, das er besser kannte als das Innenleben eines Fünfhundert-PS-Motors. Somit war der Übeltäter ertappt.
»Was ist denn so dringend? Wo ist Gual? Und warum geht keiner ans Telefon?« Lluc sah zu den Büroräumen und wunderte sich im selben Moment, dass seine Assistentin nicht auf der Lauer gelegen und ihn schon an der Tür abgefangen hatte, wie sonst immer.
»Das ist es ja, Sargento. Gual ist los, und alle anderen sind mit.«
»Los? Wohin?«
»Zum Bahnhof. Es gab einen Mord.«
Im ersten Augenblick glaubte Lluc, sich verhört zu haben. Vicentes Aussprache hatte sich in letzter Zeit verändert, mit lispelnden S-Lauten und hallenden Ds, als suchte seine Zunge die richtige Stelle zum Antippen, und Lluc vermutete, dass ein neues Gebiss der Grund war.
»Ein was?«
»Ein Mord! Es gab einen Toten im Zug aus Palma.«
Zwei der Telefonapparate klingelten erneut.
Llucs Gehirn brauchte eine Sekunde, um die Nachricht zu dechiffrieren. Der letzte Mord in Sóller war vor vielen Jahren verübt worden, als nach einer Kneipenschlägerei einer der Beteiligten den anderen verfolgt und mit einem Metallrohr erschlagen hatte. Aber im Sóller-Express? Das war unmöglich.
Vicente setzte zu einer Erklärung an, doch Lluc hörte nicht mehr zu. »Würden Sie bitte ans Telefon gehen?« Der Mann schien völlig perplex, was Lluc ihm kaum vorwerfen konnte. Ein Mord!
Er selbst griff nach dem Hörer eines zweiten Apparats und rief Gual an. »Fasst nichts an, bevor ich da bin«, sagte er, als abgehoben wurde, und legte dann sofort wieder auf. Den Atem brauchte er jetzt fürs Laufen.
Der historische Bahnhof lag nur einige Minuten entfernt an der Plaça Espanya, gleich hinter dem Kirchplatz. Als Lluc eintraf, war der Eingangsbereich nicht abgesperrt. Eine Busladung Touristen, ausgestattet mit Reiseführern und Wanderkarten, tummelte sich im Erdgeschoss vor den im Bahnhofsgebäude beherbergten Kunstausstellungen. Lluc fluchte, als er sich im Slalom durch die Menschenmenge kämpfte, auch wenn der Andrang nachvollziehbar war. Welcher Bahnhof zeigte schon Werke von Picasso und Joan Miró – und das noch mit kostenlosem Eintritt?
Er eilte an der Sala Picasso





























