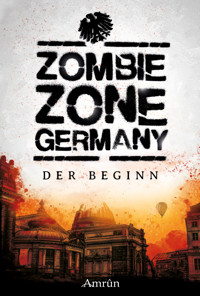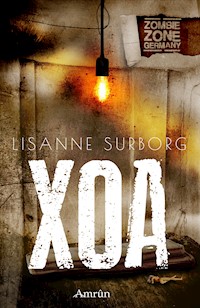Mängelexemplare: Das Familienvermächtnis - Der Jubiläumsband der preisgekrönten Anthologiereihe E-Book
Lisanne Surborg
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mängelexemplare
- Sprache: Deutsch
Schaurige Schattenwesen, düstere Dystopien und diabolischer Horror. Zum zehnjährigen Jubiläum der Mängelexemplare-Reihe kehren die unheimlichsten und makabersten Geschichten aus den legendären Bänden I bis IV zurück – kuratiert in komplett überarbeiteter Form. Dazu gesellen sich vier neue Schöpfungen aus schwarzen Federn. Mängelexemplare: Das Familienvermächtnis Das sind 13 phantastische Kurzgeschichten und das Schattenmärchen-Triptychon von Michael Marrak. Mit Lisanne Surborg, Vincent Voss, Stefanie Maucher, Constantin Dupien, Jana Oltersdorff, Melisa Schwermer, Xander Morus, Carlo Reißmann, Sanjina Karma, Markus K. Korb, Tobias Bachmann, Michael Dissieux, Lilly Rautenberger und Michael Marrak.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mängelexemplare:
Das Familien-
vermächtnis
Anthologie
Herausgegeben von Constantin Dupien
© 2023/2024 Amrûn Verlag Jürgen Eglseer, Traunstein
© der Kurzgeschichten bei den jeweiligen Autoren
ISBN TB – 978-3-95869-359-3
Lektorat: Lilly Rautenberger & Constantin DupienHerausgeberConstantin Dupien
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie unsere Webseite:
http://amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar
v1/23
Ein Schattenmärchen 1: O ihr Kreaturen!
Michael Marrak
Seid gegrüßt, Kinder. Folgt meiner Stimme.
Keine Angst vor dem Rauch, er verhüllt die Wirklichkeit und vertreibt die lästigen kleinen Blutsauger. Ihr findet mich dahinter. Seid leise und gebt acht beim Klettern, das Gestein ist locker und seine Kanten scharf. Nehmt eure Jungen auf den Rücken, seid behutsam und zügelt eure Gedanken.
Kommt näher, ich will eure Gesichter sehen. Schart euch dicht ums Feuer, denn meine Stimme ist wertvoll. Ich muss euch etwas über die Gefallenen erzählen – und euch warnen. Tretet heran, doch denkt nicht an Gott oder die Erlösung, denn das sind die Gedanken, die sie als Erstes hören – und die sie zu euch führen …
Niemals dürfen sie mich hier unten bei euch finden.
Niemals!
Ihr wisst, die Kreaturen lauschen nur nach den Titeln, die der erste Schatten ihnen verliehen hat. Die wahre Essenz bleibt ihnen verwehrt. Keines ihrer Augen darf diesen Ort jemals erblicken, versteht ihr? Schwört bei den letzten Funken des Lichts, dass ihr niemals an Gott denken werdet, solange ihr euch um mein Feuer schart. Jene, die ihre Gedanken nicht zu zügeln vermögen, sollen kehrtmachen und ihren Seelenfrieden an einem anderen Ort suchen. Schert euch fort, ihr unbelehrbaren Heilsträumer!
Doch ihr anderen, kommt näher. Achtet auf die Spalten, der Sturz in die Tiefe ist schmerzvoll – und manchmal endlos. Hört zu, was ich euch zu sagen habe.
Es war bereits Abend, als ich vor zwei Tagen von der Gedankenbank nach Hause kam. Ja, ganz langsam wird mein Kopf immer kleiner, und mein Körper schwindet. So ergeht es allen, die ihren Frondienst für die Schatten leisten. Ihre Köpfe haben nur mehr die Form von Geschwüren, kaum größer als zwei Männerfäuste. Schrecklich ist der Preis für eine Zusammenkunft mit den Regenten.
Still!
Habt ihr das auch gehört? Seid ihr sicher, dass sich auf dem Weg hierher kein heuchelndes Geistergesindel unter euch gemischt hat? Ich kenne die Stimmen jener, die sich in Schafspelze hüllen und Augen und Ohren der Regenten sind.
Legt eure Lupen ab und lasst mich eure Körper sehen! Ziert euch nicht, euch zu entblößen – doch vermeidet es, einander zu berühren, solange ihr nicht wisst, ob ihr rein seid. Falls sich unter eurer nackten Haut etwas versteckt, das nicht hierher gehört, werde ich es sehen. Sollte euer Fleisch befallen sein, werde ich es erkennen. Kein Seelenfresser und kein Traumwandler kann sich im Feuerschein vor mir verstecken.
Hütet euch vor jenen unter euch, die zwei Schatten werfen! Sie sind nicht das, was sie euch glauben machen wollen. Im erstbesten Moment werden sie euch in den Rücken fallen, euch Dornenfesseln anlegen und euch in ihre Ektoplasma-Bottiche stecken, randvoll mit amorphen Unwesen, die noch keine Form gefunden haben.
Verzeiht, es ist unhöflich von mir, in eurem Beisein an die Gräuel zu denken. Meine Erinnerungen treiben mich dazu, die verfluchten Erinnerungen und die brennenden Narben …
Nun, setzt euch. Ich sehe, dass ihr frei seid von Schuld und wahrhaftig ihr selbst. Das ist alles andere als selbstverständlich in diesen Zeiten. Ich möchte weitererzählen, weiterbestehen, solange sie diesen Ort meiden.
Vor zwei Tagen also kehrte ich zurück von der Gedankenbank und betrat die Ruine meines Hauses. Es ist ein nostalgisches Ritual, nach der Heimkehr einen Blick aus jedem der Fenster meiner Wohnung zu werfen – hinaus auf die im Abendrot erstarrten Häuserruinen und hinab auf die Trümmerberge, hinter denen leise Stimmen Lieder der Hoffnung singen. Der Schutt, das wisst ihr, hat scharfe Kanten und reißt tiefe Wunden in die Körper jener, die aus Fleisch und Blut geschaffen sind. Ich erinnere euch nicht ohne Grund daran. Unser warmes Blut ist die Apanage für die Regenten. Gierig lecken sie es wie Honig von den Trümmern und baden darin, wo es sich zu halb geronnenen Pfuhlen sammelt.
Schutt, Trümmer und Abgründe, daraus besteht die Welt, die sie uns gelassen haben. Die Welt, die wir die Oberfläche nennen. Jene, die die Revolution nicht überlebt haben, bevölkern das lichtlose Reich darunter: unsere Abwasserkanäle und U-Bahn-Tunnel, die verlassenen Bunker, Tiefgeschosse und Minenstollen.
Nichts für ungut, dort unten sind die Toten gut aufgehoben. Trieben sie auf der Oberfläche ihr Unwesen, würden die Städte noch mehr stinken. Und ihre rastlosen Kadaver würden sich unserer Organe bemächtigen, um sie in ihre eigenen verwesenden Überreste zu stecken. Zugegeben, dann und wann entwischt schon mal einer dieser Wiedergänger aus seinem Orkus, aber letztlich erhalten sie von unseren gelobten Herren regelmäßig Dinge, von denen sie sich nähren können. Dinge von uns. Mal einen Arm, mal ein Bein, eine Leber oder einen Haufen Gedärme. Es schickt sich nun mal nicht, die Toten verhungern zu lassen. Das zeugt nicht von Barmherzigkeit.
Warum die Regenten keine Köpfe verfüttern, wisst ihr. Unsere Köpfe fressen sie selbst. Das Geräusch der Maschinen, die geschaffen wurden, um unsere Schädel im Akkord zu knacken, verfolgt jeden von uns seit der Revolution bis in seine Träume. Und wer frei ist von Nachtmahren, der ist keiner von uns.
Seid also auf der Hut vor jenen unter euch, die im Schlaf lächeln! Es ist klüger, sie sofort zu erschlagen, als sie je wieder erwachen zu lassen. Ehe ihr euch verseht, werden sie sonst über euch herfallen und sich an euch und eurer Furcht laben – bis auch ihr jedwede Form von Dunkelheit herbeisehnen und mit einem Lächeln um die blau verfärbten Lippen von Schmerzen träumen werdet.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass einige wenige unter euch dieser neuen Welt sogar etwas Schönes abgewinnen – weil sie wissen, dass das Rad der Zeit niemals mehr zurückgedreht werden kann. Dass alles, was wir heute sehen, hören, fühlen und erleben, auf ewig so bleiben wird, wie es ist. Ich habe Verständnis für eure Sehnsucht. Die einzigen Optionen, die wir seit der Revolution der Schatten haben, sind, die Welt zu ertragen, dem Wahnsinn zu verfallen oder einer der ihren zu werden. Denn der triviale Tod, dessen sind sich derweil sogar die Ratten und die Kakerlaken bewusst, war ein Privileg der alten Welt. Was sterben darf und was nicht, bestimmen heute die Regenten.
Sie schafften die ihnen lästigen Naturgesetze ab wie den Lauf aller Dinge, öffneten die Grenzen, merzten alle Heiligen aus und sorgten für einen einheitlichen Status quo, denn jeder von uns besitzt nichts außer seinem eigenen Elend. Zudem müssen wir uns nicht mehr über das Wetter ärgern, denn ein Tag ist so heiß und düster wie der andere.
Um die verlorenen Seelen bei Laune zu halten, veranstalten die Regenten jeweils an Voll- und Neumond das unter ihresgleichen äußerst beliebte Denunzianten-Dankfest mit der Lotterie 20 aus 500. Seit der Zeitenwende läuft mir ein Schauer über den Rücken, sobald die von einem Totenchor vorgetragene Eröffnungshymne aus den Lautsprechern dringt; ein simpler Choral, in den jeder Regent, jeder Sympathisant und jeder wandelnde Schatten sofort mit einstimmt:
Einer von hier, zwei von dort,
drei aus der Mitte, sechs sind fort.
Sieben trifft der Blitz, acht das Beil,
neun schrei’n »Erbarmen!«, zehn baumeln am Seil.
Manch einer glaubt wegen des Festnamens sicher noch, dass bei einem Verhältnis von 25:1 lediglich ein verschmerzbarer Prozentsatz vom Schicksal ereilt wird, doch es verhält sich genau andersherum: Von fünfhundert Delinquenten werden zwanzig per Los begnadigt. Auf alle anderen wartet das Schlachthaus, wo die Maschinen der Schatten ihr Inneres nach außen kehren.
Wieso die Regenten so etwas tun? Nun, vielleicht bereitet es ihnen einfach Freude. Vielleicht aber kennen sie es von dort, woher sie stammen, gar nicht anders. Möglicherweise handeln sie gar in der Überzeugung, nichts Unrechtes zu tun, während sie uns und unsere Welt verzehren. Tabula rasa. Alles gehört an seinen Platz. Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Was wäre das doch für eine Ironie …
Von ihrer Warte aus betrachtet sind die Delinquenten nicht mehr als Verzugsindividuen mit schlechter Spendermoral, negativem Gedankenkonto und unbezahlten Freier-Wille-Rechnungen. Samt und sonders Abnormitäten, deren Mitesserschaft für das Regime der Schatten nicht länger tragbar ist. So verschwinden hartnäckige Belastungen flugs aus der Soll-Sektion. Des Schuldners Leid ist des Rechtschaffenen Freud’. Der frei werdende Wohnraum erlaubt es uns, in komfortablen Sechszimmer-Ruinen eine Luxusverdammnis zu fristen. Jedem das Seine.
Was starrt ihr mich so an?
Oh, natürlich, die Abnormitäten … Ein widerlicher Terminus, das gebe ich zu, aber traditionell, ja geradezu klassisch. Zudem verfügt die Henkergilde über einen erquicklichen Vorrat an Stricken, um die Unglücklichen vorab zu … na, ihr wisst schon.
Woher?
Was stellt ihr nur für Fragen? Wurde noch nie einer von euch ins Zentrum verschleppt, um den Glaubensgerichten der Regenten beizuwohnen? Die entfachten Feuer hatten immerhin einige der imposantesten Abendrote der vergangenen drei Dekaden in den Himmel gezaubert. Hat keiner von euch je eine der Fleischorgien verfolgt? Ich kann nicht sagen, ob ich euch beneiden oder bedauern soll. Ihr Glücklichen, die ihr nie das Grauen der Schlachtfeste erblickt habt. Ihr Bemitleidenswerten, denen all das noch bevorsteht. Denn eines ist gewiss: Keiner von euch wird einst sagen können, er habe es nie mit eigenen Augen gesehen.
Henker sind eine angesehene Kaste unter den Schatten. Gut ausgebildet, sehr erfahren im Umgang mit ihren Instrumentarien und behände bei dem, was sie tun. Immerhin hatten sie jahrtausendelang geübt, um ihr Handwerk zu perfektionieren und sich auf dieses Zeitalter vorzubereiten. Die Stricke, mit denen sie den Delinquenten vor dem Scheiterhaufen den Gnadentod gewähren, stammen übrigens von den Blumensträußen ihrer Bewunderer, die sich für sie allzu willig bücken oder die Beine spreizen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Die meine spielt im Hier und Jetzt. Ich ging also vor zwei Abenden in mein Haus, dessen Tür seit einem Vierteljahrhundert offen steht, und warf einen Blick durchs Fenster auf den Buhlturm. Auf seinem im Schein der Autodafés glänzenden Dach erblickte ich höchst Sonderbares. Dort lag zusammengekauert ein rotes, unförmiges Etwas. Mein erster Gedanke war: eine frisch gerissene Leiche. Einer von uns.
Nun rennt doch nicht gleich fort, Kinder. Was ich erzähle, ist längst geschehen. Meine Worte bekleiden lediglich die Vergangenheit. Alles ist gut, kein Schatten lauscht, die Gegenwart ist in Rauch gehüllt und entzieht sich ihren Blicken. Kommt zurück …
Na, seht ihr, nichts ist passiert.
Ich kniff beim Blick durchs Fenster die Augen zusammen, soweit es mein mürber Kopf zuließ, und blickte lange hinüber zu dem roten Ding auf dem Dach. Es war wirklich ein Leichnam. Man sieht nicht alle Tage frisches rohes Fleisch im Abenddunst dampfen. Doch war es eine Leiche von den Pfählen oder aus den Windkäfigen, die ein Hüter der Sühne dort hingelegt hatte, um sich im Dunkel der Nacht ungestört an ihr zu laben? Nein, denn ich entdeckte keine angebildeten Gliedmaßen. Jene, die noch an ihr hingen, gehörten ihr selbst. Keine zusätzlichen Körperteile waren zu sehen, keine Parasitenorgane, alles reiner Körper.
Also wagte ich mich hinaus, schlich durch die Ruinen, erklomm den Turm und näherte mich vorsichtig dem Kadaver – und heiß durchfuhr es mich bei seinem Anblick: Da lag kein Mensch vor mir, sondern einer der Herrscher.
Ein leibhaftiger Regent, aus seinem Schattenmantel geschält wie eine saftige Frucht!
Ich schwöre, was ich euch erzähle, ist wahr! Es war tatsächlich der Kadaver eines Gefallenen. Ich frohlockte innerlich bei seinem Anblick. Endlich – endlich! – auch einer der ihren! Dort, in seinem eigenen Blut liegend, das zäh und schleimig die Turmwand hinabfloss. Er war so schön, so wunderschön; metallroter Blut-Rosensaft auf blauem Taumetall-Wasser, der in zartes, hauchfeines Rotgespinst einzufließen begann. Lange betrachtete ich ihn, dann umfing ich seinen warmen, köstlich duftenden Körper mit beiden Armen und begann ihn abzulecken. Keine Ratteninnereien, keine Kerfe, keine madigen Früchte von den Ascheäckern der Regenten – reines, saftiges Schattenfleisch.
Ich schleppte den Kadaver an einen sicheren Ort, wo ich ihn ausweidete und mit scharfer Klinge zerlegte. Dabei studierte ich jede Gliedmaße und jedes Organ, aus dem er bestand.
Einer von uns schlachtet einen der ihren, stellt euch das nur vor! Wüssten sie doch nur um die Bedeutung meiner Entdeckung; wären sie nur fähig, die Tragweite zu erfassen. Mit ihren Klauen würden sie mich zerreißen und meine Erinnerungen fressen.
Zurück auf vertrautem Terrain, grillte ich das Regentenfleisch über dem Feuer und verzehrte einen Teil davon noch in derselben Nacht.
Oh, ich sage euch, welch ein Genuss!
Im Grunde unterscheidet sich das, was ihre Schattenhüllen verbergen, gar nicht so sehr von uns: ein Kopf, zwei Arme, zwei Beine – wenngleich in viel größeren Dimensionen. Nichts, das – abgesehen von ihrer Haut – ihre Herkunft und Natur erkennen lässt. Was ich damit sagen will, ist: Sie tragen keine Haut. Muskeln, Sehnen und Adern, ja, selbst einige ihrer Knochen liegen bloß. Sollten sie Schmerzen empfinden, müssen sie ohne ihre schwarzen Hüllen wahrlich Höllenqualen leiden.
Herrje, hört ihr das? Das ist die Herrscherglocke! 66 Schläge, dann werden die Schatten ausschwärmen, um zu jagen. 66 Schläge, die euch bleiben, um euch vor ihnen zu verstecken.
Flieht das Licht, Kinder! Geht und erzählt meine Geschichte den anderen. Beeilt euch. Verkündet allen, die ihr findet: Die Regenten sind sterblich, und ihr Fleisch mundet wunderbar. Verstreut euch in alle Winde, doch wählt eure Pfade mit Bedacht. Seid wachsam, wohin ihr eure Schritte lenkt und worauf ihr euren Fuß setzt, aber wagt euch nicht zu nah an die Gruben, denn der Sturz ist tief. Haltet euch im Verborgenen, unsichtbar für die Herren. Widersteht ihren Verlockungen und bleibt ihren Sigillen fern. Bedeckt eure Wunden, denn euer Blut ist eine Delikatesse. Lasst nicht zu, dass die Schatten oder ihre Larven euch wittern.
Just kommen sie herbei und fordern den Rest …
Rosa Schaum
Lisanne Surborg
I.
Ihre nackten Füße graben sich durch klammen Sand. Es zischt leise, wenn die weiße Gischt ihre Zehen umschäumt und sich wieder zurückzieht. Das Meer wiegt sich gemächlich und eiskalt unter einem goldenen Himmel, der funkelnde Spitzen auf die blauen Kämme setzt.
Joker dreht die Nase in den Wind und der faulige Gestank von Eingeweiden schlägt ihr ins Gesicht.
Sie wendet dem Meer ihren Rücken zu und nähert sich dem blutigen Haufen, an dem schon ein paar Möwen gezupft haben. Ihr Blick wandert nach links und erfasst den dünnen Metalldraht, der von den Dünen her bis ins Meer gespannt ist.
Sie streckt die Hand aus und gräbt durch das glitschige Gewebe, bis ihre Fingerspitzen auf Sand stoßen. Keine Nachricht verborgen, also ist es keine Drohung. Nur kalte Eingeweide, die wohl in der Nacht hier abgeladen worden sind.
Wahrscheinlich hat sich einfach jemand eines Dealers entledigt. Sie hofft, dass es nicht ihrer war.
Das Meer rauscht gleichmäßig und der Wind pfeift mit den Möwen um die Wette. Joker läuft zwei Schritte auf neutralem Grund und steigt über den silbernen Draht in ihre eigene Zone. Sie steuert auf den grauen Betonklotz zu, der schief im Sand steckt. Aber bevor sie den Bunker, in dem sie seit Jahren lebt, erreicht, wirbelt sie herum.
Vom Dünenwall her dringen schlurfende Schritte an ihr Ohr. Sie beobachtet einen alten Mann, der sich an den Abstieg zum Strand macht.
Sein graues Haar ist ungewaschen, in seinem Vollbart hängen Essensreste. In abgewetzten Lederschuhen schleppt er sich keuchend den Strand hinunter.
Jokers linke Hand hält kampfbereit einen angespitzten Schraubenzieher. Die rechte liegt an der ausgebeulten Tasche ihrer Jeans. Mit verengten Augen verfolgt sie, wie er nur wenige Meter von ihr entfernt durch den Haufen stolpert und menschliche Überreste durch den Sand zieht.
Er wendet sich nach Süden, sein Blick ist trüb.
Der Mann hat weder sie noch die Eingeweide wahrgenommen.
Sie sieht ihm nach, als er das neutrale Gebiet verlässt. Es dauert nicht lange, dann tauchen in der Ferne drei Gestalten auf. Joker wartet und sieht zu. Sie zählt nur acht Atemzüge, bis die Gestalten eine vierte von ihrem Grund ziehen. Der alte Mann liegt jetzt hinter dem Draht, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch er von den Möwen ausgeweidet wird.
Als Jokers Blick erneut zur Düne schwenkt, zuckt sie zusammen. Den bleichen, dunkelhaarigen Jungen im grauen T-Shirt hat sie nicht kommen hören.
Er sieht mit Bedauern zu der frischen Leiche am feindlichen Draht hinüber, dann zu Joker. Der Wind fegt geräuschvoll durch seine Kleider, und er zittert auf dem Gipfel der Düne. Er ist fast so dürr wie sie.
Während sie ihn drohend anfunkelt, starrt er mit unverhohlener Neugier zurück. Sie zählt acht Atemzüge, dann verschwindet er wieder hinter den Dünen.
II.
Ihre Hand ertastet sieben Stück. Das reicht für zwei Tage, vielleicht auch für drei.
Sie steigt aus dem Bett und hebt das klapprige Holzgestell an. Der linke vordere Pfosten ist hohl. Von unten schiebt sie das unauffällige Stoffsäckchen hinein und lässt das Bett wieder sinken.
Die Eingeweide neulich draußen vor dem Bunker hatten einem anderen Dealer gehört. Ihr eigener wurde kurz darauf ein ganzes Stück weiter nördlich gefunden.
Joker hätte sich das struppige Haar büschelweise ausreißen können, als ihr Bruder ihr davon erzählte. Alpha hat sich in der Stadt schon nach einem neuen Dealer umgesehen. Dass Joker sich einen kleinen Vorrat abgezweigt hat, weiß ihre Familie nicht.
Ihre nackten Füße klatschen über den grauen Betonboden. Über ihrem Kopf flackert eine Glühbirne. Schatten zucken auf den schmucklosen Wänden.
Meistens riecht es feucht im Bunker. Es sei denn, Alpha hüllt sich in diese dichte Qualmwolke, deren schwere Süße den Schimmelgestank für ein paar Stunden vertreibt.
Joker hat nicht immer im Bunker gelebt.
Bevor das System zerbrach, hat sie ganz normal in einem Haus gelebt. Mit ihrer richtigen Familie. Damals waren die Lebensmittel nicht mit Fahrradschlössern gesichert.
Joker gibt ihre Kombination ein, öffnet die Metalltür und zieht einen Kanten Brot heraus. Während sie kaut, schweift ihr Blick gedankenverloren über die vier anderen Schlösser.
Außer Alpha hat sie seit zwei Tagen niemanden mehr hier gesehen.
Joker stößt die Klappe wieder zu und verstellt das Zahlenschloss. Sie hat es in der Stadt geklaut, schon vor Jahren. Früher hatte sie nicht nur ein Schloss, sondern sogar ein Fahrrad dazu, aber das ist lange her.
In einer Ecke des Zimmers liegt Alpha in einem Sessel. Er starrt verklärt an die Decke und führt hin und wieder einen Glimmstängel an seine spröden Lippen.
Ihm gegenüber lässt sie sich auf ein speckiges Kissen fallen und zieht ihre dünnen Beine in den Schneidersitz. Alpha hat ihr den Namen Joker gegeben, aber sie nimmt es ihm nicht übel.
Sie beugt sich vor und greift mit zwei Fingern vorsichtig an seinen linken Knöchel. Geschickt zieht sie ein Plastiktütchen aus dem Strumpf, nimmt die Pille heraus und schluckt sie. Alphas Blick weicht nicht von der Decke.
III.
Rot unterlaufene Augen starren Joker an, als sie vom Meer zurückkommt.
Ihre Finger verkrampfen sich um den Schraubenzieher, die andere Hand ruht über der Tablette in ihrer Hosentasche. Es ist ein junger Kerl, den sie noch nie gesehen hat.
Er trägt einen schwarzen Jogginganzug, aber keine Schuhe. Seine Zehennägel sind gelblich verfärbt. Die roten Adern, die sich durch seine Augäpfel ziehen, bilden die einzige Farbquelle in seinem Gesicht.
Seine Lippen bewegen sich schnell, aber sie versteht nicht, was er sagt.
Nervös dreht sie den Schraubenzieher in den Fingern, als der Fremde eine Hand nach ihr ausstreckt.
Seine Augen rollen wild in den Höhlen, während er unverständliches Zeug brabbelt. Er macht einen Schritt auf sie zu.
Sie schreckt zurück und sieht zum Bunker.
Er steht auf ihrem Gebiet. Sie muss ihn töten.
Ihr Arm holt kräftig aus, da klärt sich sein Blick wieder und er sieht ihr in die Augen. Den Arm noch immer ausgestreckt, streicht er ihr vorsichtig über das wirre Haar.
Seine Lippen sind trocken und an einigen Stellen ist die dünne Haut aufgeplatzt. Sie sind noch immer geöffnet, aber er sagt nichts mehr.
Jokers Hand mit dem angespitzten Schraubenzieher zittert vor Anspannung, während sie ansonsten ganz still ausharrt.
Der Fremde riecht nach Schweiß und der Sorte Alkohol, die nicht zum Trinken gedacht ist. Sein Haar klebt ihm strähnig im Gesicht. Er schließt die Lippen kurz und als er sie wieder öffnet, platzen Bläschen in seinen Mundwinkeln. Sie schillern rosa in der Mittagssonne.
Joker macht einen Schritt zurück. Ihre linke Hand umklammert den Schraubenzieher, die rechte liegt weiter fest auf der Hosentasche.
In den Augen des Fremden flackert es, seine Hand sinkt in Richtung Boden und der restliche Körper folgt ihr.
Nur einen Schritt von ihren Zehenspitzen entfernt, windet sich der Junge im Sand. Er spuckt noch ein paar Bläschen aus, hält die Augenlider fest zusammengepresst und stirbt zusammengerollt wie eine Katze in der Sonne.
Jokers Finger lassen das Plastiktütchen fast fallen, als sie es hektisch aus ihrer Hosentasche ziehen. Eine einzige blaue Pille ist darin. Sie schluckt so hastig, dass sie trocken husten muss.
Sie stolpert rückwärts von der Leiche fort. Den Blick weiter auf das kalkige Gesicht des Jungen gerichtet, erlebt sie entsetzt mit, wie es in der Mittagshitze ganz weich wird. Seine mageren Züge lösen sich vom Muskelfundament und rutschen gemächlich in den Sand.
Der Schraubenzieher fällt ihr aus der Hand, als ihre Finger furchterfüllt die eigenen Wangen berühren. Gerade als sie die feste Narbe in ihrem Mundwinkel erreichen, bemerkt Joker das Geschrei in ihrem Rücken.
Sie reagiert nicht, kann den Blick nicht von der schmelzenden Haut abwenden.
Jemand springt sie von hinten an und stößt sie mit dem Gesicht voran in den klammen Sand.
Grobe Hände zerren an ihrem Haar und reißen sie wieder auf die Beine. Ihre rechte Hand liegt auf der Hosentasche, obwohl keine Tablette mehr darin ist. Die andere vermisst den Schraubenzieher.
Joker wird vorwärts geschubst, auf allen vieren wird sie durch den Sand geschleift. Sie kommt auf die Füße, stolpert über den Toten und wimmert, als sie mit den Händen in die zerlaufene Haut eintaucht.
Das kräftige Mädchen über ihr brüllt einen Namen, den Joker nicht richtig versteht. Vermutlich hat sie den Jungen so genannt, bevor er ausgerechnet hier, auf ihrem Gebiet, sterben musste.
Die Andere zieht Jokers Gesicht unerbittlich über den Strand. Muschelkanten schlitzen ihr die Haut auf und stechen in ihre Narbe. Als sie sich wehren will, hat das Mädchen ihre Handgelenke längst gepackt.
Sie ist größer und stärker als Joker. Der Schraubenzieher steckt nur ein paar Meter weiter im Sand, doch er könnte genauso gut am Meeresgrund liegen.
Joker will nach Alpha rufen. Aber als sie die Lippen öffnet, schluckt sie kaltes Salzwasser.
Sie würgt und erbricht sich ins Meer. Salz und Säure brennen in ihrem Inneren.
Joker stemmt verzweifelt die Knie in den Sand, aber die Fremde über ihr drückt sie mit doppelter Kraft nach unten.
Sie stellt sich vor, wie das Salzwasser ihr Gesicht aufweicht und vom Knochen tropfen lässt. Dann zwingt ein Reflex ihre Lippen auseinander, und zieht einen weiteren Schwall Wasser in ihren Körper. Die Panik verhindert jeden klaren Gedanken.
Da durchschlägt neben ihr etwas die Wasseroberfläche. Obwohl das Blut in Jokers Ohren rauscht, nimmt sie den dumpfen Laut wahr und die Bewegung zu ihrer Rechten.
Jemand zieht ihren Kopf aus dem Wasser, schleift ihren zittrigen Körper wieder durch den Sand. Sie bleibt auf der Seite liegen und versucht, Wasser gegen Luft zu tauschen. Eine saure, salzige Brühe läuft ihr aus Mund und Nase und tropft genauso in den Sand wie das Gesicht des Toten ein paar Meter weiter.
Joker blinzelt gegen die Sonne und sucht nach Alpha. Aber stattdessen steht da der Junge mit dem schwarzen Haar und dem grauen Shirt und beobachtet sie.
Als sie ihn auf der Düne erspäht hatte, dachte sie, ihn noch nie gesehen zu haben. Aus der Nähe erkennt sie hinter den hohlen Wangen und dem kantigen Kinn ein Kind wieder, das einst in ihrer Straße gewohnt hatte. Wie er damals hieß, weiß sie nicht mehr. Es ist auch egal.
»Wer bist du?«, fragt sie.
»Lombre.« Der Blick aus seinen dunklen Augen wandert kurz zum Meer, wo irgendwo die Angreiferin tot in den Wellen treibt.
»Wieso hast du das getan?« Sie stemmt ihre dürren Glieder in die Höhe und weist mit einer Kopfbewegung in die Wellen.
Die Gischt ist lieblich rosa und zeichnet Ränder an den Strand.
»Du hast ihn nicht getötet.« Er lässt den schweren Hammer von der rechten in die linke Hand und wieder zurück wandern, als wäre er ein glühendes Stück Kohle. »Sie wollte ihn rächen, aber du hast ihn ja gar nicht umgebracht.«
»Darum hast du sie totgeschlagen?«
Er zuckt mit den schmalen Schultern. Auf seiner Stirn bildet sich eine einzige steile Falte. »Und weil sie meine Familie getötet hat.«
Das Bild von dem verwirrten alten Mann flackert durch ihren Kopf. Wie er durch die Gedärme stolperte, ohne es zu bemerken, und wie sie ihn erschlugen, sobald er ihre Grenze überschritten hatte. Vielleicht war er sogar wirklich mit Lombre verwandt. Der Alte könnte sein Großvater gewesen sein.
Joker nickt und streicht sich die Sandschicht von ihrer nassen Kleidung. Vom Meer weht ein Wind her, der ihnen beiden durch die dünne Kleidung zieht.
IV.
Die Vorratsfächer der anderen sind immer noch unberührt, an den Schlössern ist keine einzige Ziffer gedreht worden.
Joker zittert und schluckt. Sie hat noch drei Tabletten in ihrem Versteck.
»Alpha, hast du die anderen gesehen?«
Er antwortet ihr nicht. Joker dreht sich um und findet vor, was sie erwartet hat. Er sieht nichts, hört nichts. Seine glasigen Augen zeigen in Richtung Bunkerdecke, sein Körper hängt so schlaff im ranzigen Sessel, als hätte ihm jemand sorgsam jede einzelne Sehne durchtrennt.
Joker überlässt ihn sich selbst. Während sie nervös auf und ab tappt, kämpft sie gegen das Verlangen an, den Bunker zu durchsuchen.
Sie hat noch drei. Das reicht vielleicht für zwei Tage.
Was Alpha hat, steckt stets in seinen Strümpfen. Joker weiß das, aber sie wagt nicht, ihn schon wieder zu bestehlen.
Sie hebt ihr Bettgestell an, zählt ruhelos die Pillen und streicht sich fahrig durch das stumpfe Haar.
Ob die anderen Verstecke haben? An ihren Betten?
Mit wenigen Schritten ist sie bei der Matratze, auf der seit Tagen niemand mehr geschlafen hat. Joker konzentriert sich auf ihre Fingerspitzen, auf das, was sie ertasten. Ein paar Asseln huschen über ihre Hände, sonst ist da nichts.
Für eine Weile hockt sie bewegungslos auf dem Betonboden, die kalte Wand im Rücken, und beobachtet das Gekreuch. Als das Gewusel ihr Kopfweh bereitet, stemmt sie sich hoch, kommt wankend auf die Beine. Sie will sich Alpha gegenübersetzen, um nicht allein zu sein.
Der Sessel aber ist leer.
Joker macht zwei unsichere Schritte nach vorn. Durch den Dunstschleier in ihrem Kopf schieben sich Gedanken. Ob Alpha vielleicht in die Stadt gegangen ist? Einen neuen Dealer suchen? Einen, der die alten Pillen hat?
Wenn das Gesicht des Jungen nicht vor ihren Augen geschmolzen wäre, dann wäre sie vielleicht selbst in die Stadt gegangen.
Alpha hat ihn nicht gesehen. Er hat keine Angst, den Bunker zu verlassen.
Die Glühbirne über ihrem Kopf knackt und knistert vor sich hin. Joker fühlt sich an die Asseln im Nebenraum erinnert.
Etwas raschelt.
»Alpha?«, fragt sie, als sie langsame Schritte wahrnimmt. Sie hallen auf dem Betonboden und prallen von den nackten Wänden ab. Die zarten Härchen auf ihren Armen stellen sich auf.
Joker spürt den feuchten Atem eines Menschen im Nacken.
Als sie herumwirbelt, steht ihr Bruder da und lächelt. Rund um die blaue Iris sind seine Augen rot gefärbt. Sein blondes Haar hängt strähnig herunter. Seine Lippen, noch spröder als sonst, zucken in einem holprigen Rhythmus. Als er mit Mühe ihren Namen formt, begreift sie, dass er gar nicht lächeln wollte.
Alpha hat Angst. Fast so viel wie sie.
Ein Schluchzen entfährt seiner Kehle, dann ein paar heisere Laute, die Joker nicht versteht. Er packt sie mit beiden Händen an den Oberarmen und drückt mit einer Kraft zu, die sie ihm nicht mehr zugetraut hätte.
Ihr Bruder zittert am ganzen Leib. Sie spürt es, weil er sie an sich presst.
Alpha riecht nicht länger nach dem süßlichen Qualm, sondern nach etwas Beißendem, das in der Nase sticht. Er verschluckt sich, hustet über ihrem rechten Ohr.
Etwas Warmes tropft auf ihr Shirt, dann geben seine Beine nach. Sie stemmt ihn einen Augenblick lang, dann kippt er nach vorn und sie nach hinten. Als ihr Rücken und das Steißbein auf dem Beton aufschlagen, überblendet der Schmerz sogar kurz ihre Angst.
Einen Moment später flammt die Panik auf. Joker brüllt Alphas Namen, aber sie spürt seinen Herzschlag nicht mehr.
Tränen laufen ihr übers Gesicht. Strampelnd versucht sie, sich von dem schlaffen Körper zu befreien. Verharrt acht Atemzüge, um Kraft zu sammeln, und befreit einen Arm, um mit der Hand gegen seine Schulter zu drücken.
Schwerfällig rutscht der Leichnam schließlich von ihr hinunter.
Jokers Shirt ist besudelt mit rosa Flecken. Als sie ihrem Bruder ins tote Gesicht sieht, fallen ihr die Bläschen auf, die noch immer aus seinem Mund quellen.
Sie platzen kaum hörbar. Eine nach der anderen lösen sie sich in Luft auf.
Joker schiebt mit den Fingerspitzen die Lider über die blaue Iris und drückt das Kinn hoch, bis Alphas Lippen sich schließen.
Dann verliert sein Gesicht an Form und fließt dem Boden entgegen.
Sie rappelt sich so schnell auf, dass sie stolpert und sich den Kopf an einer Tischecke anstößt. Dann packt sie Alpha an den Knöcheln und zerrt seinen schlaffen Körper ans Tageslicht.
Sie denkt darüber nach, auch ihn ins Meer zu werfen. Und darüber, ihn einfach auf neutralem Grund abzulegen.
Die Sonne blendet sie. Jokers Arme fühlen sich schwach an, und ihr Atem rasselt, als ihre nackten Füße endlich den warmen Sand berühren. Sie lässt die knochigen Fußgelenke ihres Bruders los und blickt auf.
Der neutrale Strandabschnitt ist nicht verlassen. Fünf Unbekannte starren sie und die frische Leiche an. Über Mund und Nase tragen die Fremden Schals, Tücher oder Atemschutzmasken, wie man sie von Ärzten kennt.
»Fleischschmelze!« Einer streckt den Finger aus und deutet auf Alpha. »Den hat es auch erwischt!«
Eine Frau drückt sich die Maske fester aufs Gesicht. »Wie viele sind noch im Bunker?«
»Acht«, sagt Joker.
Niemand erwidert etwas, doch sie erkennt die Angst in ihren Augen. Und die Anklage. Joker kniet sich in den Sand.
»Ihr müsst da drinnen bleiben«, sagt die Frau dann. »Ihr seid gefährlich für uns alle.«
Joker ignoriert sie. Mit den Händen beginnt sie, ein Loch zu graben. Der Sand ist feucht und kalt.
»Hey, du!«, ruft sie, denn sie hat den unscheinbaren Jungen längst bemerkt, der hinter der Gruppe in den Dünen sitzt. »Hilf mir!«
Und Lombre, der keinen Schutz vor Mund und Nase geschlungen hat, steigt über den Draht und kratzt mit ihr den Sand aus der Kuhle.
Zusammen schaufeln sie Alphas Grab.
V.
Ein faustgroßer Stein erinnert an die Stelle, an der Alphas Leichnam liegt. Sonst nichts.
Lombre und Joker haben den Bunker seit gestern nicht mehr verlassen. Jokers Pillen neigen sich dem Ende zu. Sie hat nur noch eine einzige übrig und ihre Hände zittern bereits unablässig.
Ob Lombre welche nimmt, weiß sie nicht. Er hat die bleiche Haut und die tiefliegenden Augen, die sie alle kennzeichnen. Aber sie hat ihn bis jetzt nichts schlucken sehen.
»Sie sind noch da.« Er flüstert, als könnte die Meute, die sich draußen versammelt hat, ihn sonst hören.
»Alpha war in der Stadt. Er kann es sich da geholt haben. Mein Bunker ist nicht der Seuchenherd.« Joker gräbt die Fingernägel tief in die Lehnen von Alphas Sessel. Sie lässt nicht locker, als der erste abbricht.
»Das wissen die da draußen aber nicht.« Lombre sitzt ihr gegenüber auf dem fleckigen Kissen. Zuerst denkt sie, dass sein ruhiger Blick aus dunklen Augen auf ihrer Narbe liegt. Joker hat sie, seit das System zerbrochen ist. Das Wundmal setzt an ihrem linken Mundwinkel an, zieht sich schräg nach unten und ist unsagbar hässlich.