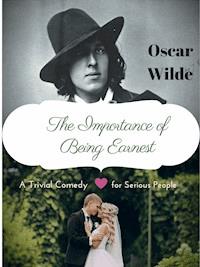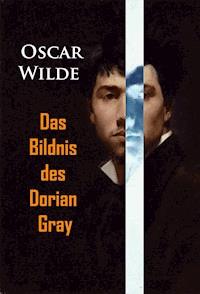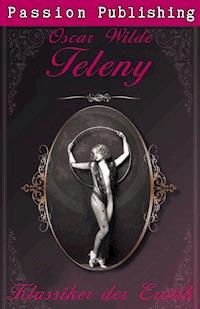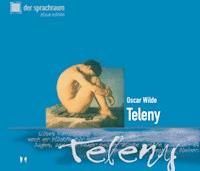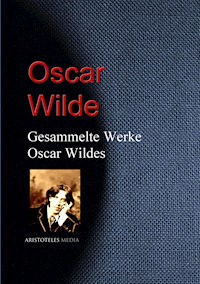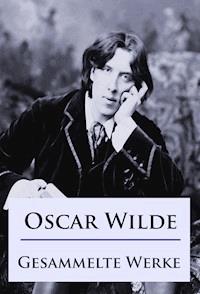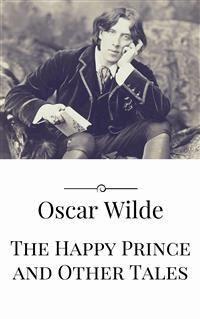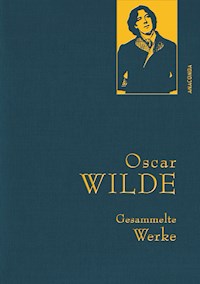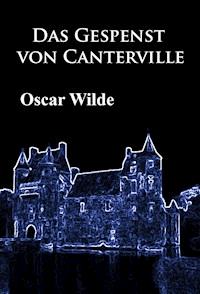Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Oscar Wilde Märchen gschrieben hat, ist kaum bekannt. Glänzte er doch mehr mit Klassikern wie Das Bild von Dorian Gray und Die Dringlichkeit, ernst zu sein und das philosophische Werk De Profundis. Wir lesen in diesem Buch folgende Märchen: Der glückliche Prinz, Die Nachtigall und die Rose, Der selbstsüchtige Riese, Der ergebene Freund, Die vornehme Rakete, Der junge König, Der Geburtstag der Infantin, Der Fischer und seine Seele und Das Sternenkind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oscar Wilde
Märchen
Märchen
Illustrierte Ausgabe
Oscar Wilde
Impressum
Texte: © Copyright by Oscar Wilde
Umschlag:© Copyright by Walter Brendel
Illustrationen: © Copyright by Lucian Zabel
Übersetzer: © Copyright by Wilhelm Cremer
Verlag:Das historische Buch, 2022
Mail: [email protected]
Druck:epubli - ein Service der neopubli GmbH,
Berlin
Inhalt
Der glückliche Prinz
Die Nachtigall und die Rose
Der selbstsüchtige Riese
Der ergebene Freund
Die vornehme Rakete
Der junge König
Der Geburtstag der Infantin
Der Fischer und seine Seele
Das Sternenkind
Der glückliche Prinz
Hoch über der Stadt auf einer schlanken Säule stand die Statue des glücklichen Prinzen. Er war ganz und gar mit dünnen Blättern von reinem Gold überzogen, als Augen hatte er zwei strahlende Saphire, und ein großer roter Rubin glühte auf seinem Schwertgriff.
Er wurde auch wirklich sehr bewundert. »Er ist so schön wie ein Wetterhahn,« bemerkte einer der Ratsherren, der nach dem Ruf strebte, künstlerischen Geschmack zu besitzen; »nur nicht ganz so nützlich,« fügte er hinzu, denn er fürchtete, die Leute könnten ihn für unpraktisch halten, und das war er wirklich nicht.
»Warum kannst du nicht wie der glückliche Prinz sein?« fragte eine vernünftige Mutter ihren kleinen Jungen, der verlangend nach dem Mond schrie. »Der glückliche Prinz denkt nicht im Traum daran, nach etwas zu schreien.«
»Gott sei Dank, es gibt wenigstens einen Menschen auf der Welt, der ganz glücklich ist,« murrte ein enttäuschter Mann, als er einen Blick auf die wundervolle Statue warf. »Er sieht ganz aus wie ein Engel,« sagten die Waisenkinder, als sie in ihren, hellroten Mänteln und den reinen, weißen Lätzchen aus dem Dom kamen.
»Woher wißt ihr das?« fragte der Mathematikprofessor, »ihr habt doch nie einen Engel gesehen.«
»O doch, in unseren Träumen,« antworteten die Kinder; und der Mathematikprofessor runzelte die Stirne und blickte sehr strenge drein, denn er billigte es nicht, daß Kinder träumten. Eines Abends flog eine kleine Schwalbe über die Stadt. Ihre Freunde waren schon vor sechs Wochen nach Ägypten geflogen, aber sie war zurückgeblieben, denn sie liebte das allerschönste Schilfrohr. Sie hatte es zu Anfang des Frühlings getroffen, als sie hinter einer dicken, gelben Motte den Fluß hinabflog, und sie war so durch seinen schlanken Wuchs angezogen worden, daß sie halt gemacht hatte, um mit ihm zu reden.
»Soll ich dich lieben?« fragte die Schwalbe, die gern sofort zur Sache kam, und das Schilfrohr machte ihr eine tiefe Verneigung. So flog sie immerfort um das Rohr herum, indem sie mit ihren Flügeln das Wasser berührte und kleine silberne Wellen machte. Das war ihr Liebeswerben, und es dauerte den ganzen Sommer.
»Es ist ein lächerliches Verhältnis,« zwitscherten die andern Schwalben; »das Rohr hat kein Geld und eine viel zu große Verwandtschaft,« und wirklich war der Fluß ganz voll von Schilfrohr. Dann, als der Herbst kam, flogen sie alle davon. Als sie verschwunden waren, fühlte die Schwalbe sich einsam und begann, seiner Geliebten müde zu werden. »Es weiß sich nicht zu unterhalten,« sagte sie, »und ich fürchte, es ist kokett, denn es liebäugelt immer nach dem Wind.« Und in der Tat, so oft der Wind wehte, machte das Schilfrohr die anmutigsten Verneigungen. »Ich gebe zu, daß es häuslich ist,« fuhr die Schwalbe fort, »aber ich liebe das Reisen, und meine Frau sollte infolgedessen auch das Reisen lieben.«
»Willst du mit mir kommen?« fragte sie schließlich; aber das Schilfrohr schüttelte seinen Kopf, es hing zu sehr an seinem Heim.
»Du hast mit mir gescherzt,« rief die Schwalbe. »Ich reise nach den Pyramiden. Lebe wohl!« und sie flog davon.
Sie flog den ganzen Tag über, und gegen Abend langte sie in der Stadt an. »Wo soll ich einkehren?« fragte sie; »hoffentlich hat die Stadt Vorkehrungen getroffen.«
Dann sah sie die Statue auf der schlanken Säule. »Dort will ich einkehren,« rief sie; »es ist eine hübsche Lage mit recht viel frischer Luft.« So ließ sie sich gerade zwischen den Füßen des glücklichen Prinzen nieder.
»Ich habe ein goldenes Schlafzimmer,« sprach sie sanft zu sich selbst, als sie sich umsah, und sie schickte sich an, einzuschlafen; aber gerade, als sie ihren Kopf unter ihren Flügel steckte, fiel ein großer Tropfen Wasser auf sie herab. »Wie seltsam!« rief sie; »nicht eine einzige Wolke ist am Himmel, die Sterne sind ganz hell und klar, und doch regnet es. Das Klima im nördlichen Europa ist wirklich schrecklich. Das Schilfrohr pflegte zwar den Regen zu lieben, aber das war nur seine Selbstsucht.«
Wieder fiel ein Tropfen.
»Was hat man von einer Statue, wenn sie nicht gegen den Regen schützt?« meinte die Schwalbe; »ich muß mir einen guten Kamin suchen,« und sie beschloß, fortzufliegen.
Aber bevor sie ihre Flügel geöffnet hatte, fiel ein dritter Tropfen, sie blickte auf und sah — — ja, was sah sie wohl? Die Augen des glücklichen Prinzen waren mit Tränen gefüllt, und Tränen rannen über seine goldenen Wangen hinab. Sein Gesicht war so schön im Mondlicht, daß die kleine Schwalbe von Mitleid ergriffen wurde.
»Wer bist du?« fragte sie.
»Ich bin der glückliche Prinz.«
»Warum weinst du dann?« fragte die Schwalbe; »du hast mich ganz naß gemacht.«
»Als ich noch lebte und ein menschliches Herz hatte,« antwortete die Statue, »da wußte ich nicht, was Tränen waren, denn ich lebte im Palast Sorgenfrei, wo dem Leid der Eintritt verboten ist. Den Tag über spielte ich mit meinen Gefährten im Garten, und des Abends führte ich den Tanz an im Großen Saal. Rund um den Garten zog sich eine ganz hohe Mauer, aber ich hielt es nie für der Mühe wert, danach zu fragen, was wohl dahinter lag, denn um mich herum war alles so schön. Meine Höflinge nannten mich den glücklichen Prinzen, und glücklich war ich auch wirklich, wenn Vergnügen ein Glück ist. So lebte ich, und so starb ich. Und jetzt, da ich tot bin, haben sie mich hier so hoch aufgestellt, daß ich alle Häßlichkeit und alles Elend meiner Stadt sehen kann, und wenn auch mein Herz aus Blei gemacht ist, so muß ich doch immerzu weinen.«
»Wie! Er ist nicht aus gediegenem Gold?« sagte die Schwalbe zu sich selbst. Sie war zu höflich, laut irgendeine Anspielung zu machen.
»Weit von hier,« fuhr die Statue mit leiser, wohlklingender Stimme fort, »weit von hier in einer kleinen Straße steht ein ärmliches Haus. Eins von den Fenstern ist offen, und ich kann eine Frau sehen, die an einem Tisch sitzt. Ihr Gesicht ist mager und müde, und sie hat grobe, rote Hände, die ganz von Nadeln zerstochen sind, denn sie ist eine Näherin. Sie stickt Passionsblumen auf ein seidenes Kleid, das die lieblichste der Ehrendamen der Königin auf dem nächsten Hofball tragen soll. In der Ecke des Zimmers liegt ihr kleiner Junge krank in einem Bett. Er hat Fieber und verlangt nach Apfelsinen. Seine Mutter kann ihm nur Flußwasser geben, deshalb weint er. Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe, willst du ihr nicht den Rubin aus meinem Schwertgriff bringen? Meine Füße sind auf diesem Postament befestigt, und ich kann mich nicht bewegen.«
»Ich werde in Ägypten erwartet,« sagte die Schwalbe. »Meine Freunde fliegen den Nil hinauf und hinab und sprechen mit den großen Lotosblumen. Bald werden sie in dem Grab des großen Königs schlafen gehen. Der König liegt dort in seinem bemalten Sarg. Er ist in gelbe Leinwand gehüllt und mit Spezereien einbalsamiert. Um seinen Hals hängt eine Kette von bleichen, grünen Jadesteinen, und seine Hände sind wie verwelkte Blätter.«
»Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe,« sagte der Prinz, »willst du nicht eine Nacht bei mir bleiben und mein Bote sein? Der Knabe ist so durstig und seine Mutter so traurig.« »Ich liebe eigentlich Knaben nicht,« antwortete die Schwalbe. »Letzten Sommer, als ich mich an dem Flusse aufhielt, da waren dort zwei rohe Knaben, die Söhne des Müllers, die immerfort Steine nach mir warfen. Sie trafen mich natürlich nie, dafür fliegen wir Schwalben viel zu gut, und ich stamme auch außerdem aus einer Familie, die berühmt ist wegen ihrer Gewandtheit; aber immerhin war es ein Zeichen von Respektlosigkeit.«
Aber der glückliche Prinz machte ein so trauriges Gesicht, daß er der kleinen Schwalbe leid tat. »Es ist hier sehr kalt,« sagte sie; »aber eine Nacht will ich bei dir bleiben und dein Bote sein.«
»Ich danke dir, kleine Schwalbe,« sagte der Prinz.
So pickte denn die Schwalbe den großen Rubin von des Prinzen Schwert herab und trug ihn im Schnabel über die Dächer der Stadt.
Sie kam an den Domtürmen vorbei, wo die weißen Marmorengel ausgemeißelt waren. Sie kam am Palast vorüber und hörte, wie man drinnen tanzte. Ein schönes Mädchen trat mit ihrem Geliebten auf den Balkon heraus. »Wie wundervoll sind die Sterne,« sagte er zu ihr, »und wie wundervoll ist die Macht der Liebe!«
»Hoffentlich wird mein Kleid rechtzeitig zum Hofball fertig,« antwortete sie; »ich habe bestellt, daß es mit Passionsblumen bestickt wird; aber die Näherinnen sind so faul.«
Die Schwalbe flog über den Fluß und sah die Laternen an den Schiffsmasten hängen. Sie flog über das Ghetto und sah, wie die alten Juden miteinander handelten und in kupfernen Wagschalen Geld abwogen. Schließlich kam sie zu dem ärmlichen Hause und blickte hinein. Der Knabe hustete fiebrig in seinem Bett, und die Mutter war vor Müdigkeit eingeschlafen. Die Schwalbe hüpfte hinein und legte den großen Rubin neben den Fingerhut der Frau. Dann flog sie leise um das Bett, indem sie die Stirne des Knaben mit ihren Flügeln fächelte. »Wie kühl ist es mir,« sagte der Knabe, »ich glaube, es geht mir besser,« und er sank in einen erquickenden Schlummer.
Dann flog die Schwalbe zurück zum glücklichen Prinzen und erzählte ihm, was sie getan hatte. »Es ist seltsam,« meinte sie, »aber ich fühle mich jetzt ganz warm, obgleich es so kalt ist.« »Das kommt, weil du eine gute Tat getan hast,« sagte der Prinz. Und die kleine Schwalbe begann zu denken und fiel dann in Schlaf. Denken machte sie immer schläfrig.
Als der Tag anbrach, flog sie zum Fluß hinab und nahm ein Bad. »Welch ein bemerkenswertes Phänomen,« sagte der Professor der Ornithologie, als er über die Brücke ging. »Eine Schwalbe im Winter!« Und er schrieb einen langen Bericht darüber an die Zeitung der Stadt. Alles sprach über diesen Bericht, denn er war voll von Ausdrücken, die niemand verstand.
»Heute abend fliege ich nach Ägypten,« sagte die Schwalbe und wurde bei der Aussicht sehr fröhlich. Sie besuchte alle öffentlichen Denkmäler und saß lange Zeit oben auf dem Kirchturm. Überall, wohin sie kam, zirpten die Spatzen und sagten zueinander: »Was für ein vornehmer Fremder!« so daß sie sich sehr gut unterhielt.
Als der Mond aufging, flog sie zum glücklichen Prinzen zurück. »Hast du einen Auftrag nach Ägypten?« rief sie; »ich reise gerade ab.«
»Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe,« sagte der Prinz; »willst du nicht noch eine Nacht bei mir bleiben?«
»Ich werde in Ägypten erwartet,« antwortete die Schwalbe. »Morgen wollen meine Freunde zum Zweiten Wasserfall hinauffliegen. Das Flußpferd kauert dort zwischen den Binsen, und auf einem großen Granitthron sitzt der Gott Memnon. Die ganze Nacht durch beobachtet er die Sterne, und wenn der Morgenstern scheint, stößt er einen Freudenruf aus, und dann ist er still. Um Mitternacht kommen die gelben Löwen an den Rand des Wassers, um zu trinken. Sie haben Augen wie grüne Berylle, und ihr Brüllen ist lauter als das Brüllen des Wasserfalles.«
»Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe,« sagte der Prinz, »weit von hier, am Rande der Stadt, sehe ich einen jungen Mann in einer Dachkammer. Er lehnt sich über ein Pult, das mit Papieren bedeckt ist, und neben ihm in einem Glase steht ein Bund verwelkter Veilchen. Sein Haar ist braun und kraus, seine Lippen sind rot wie Granatäpfel, und er hat große und verträumte Augen. Er versucht, ein Stück für den Direktor des Theaters fertigzustellen, aber ihm ist zu kalt, um noch etwas zu schreiben. Im Kamin brennt kein Feuer, und der Hunger hat ihn ganz matt gemacht.«
»Ich will noch eine Nacht bei dir verweilen,« sagte die Schwalbe, die wirklich ein gutes Herz hatte. »Soll ich ihm auch einen Rubin bringen?«
»Ach, ich habe jetzt keinen Rubin mehr,« sagte der Prinz, »meine Augen sind alles, was mir geblieben ist. Sie sind aus seltenen Saphiren gemacht, die man vor tausend Jahren aus Indien gebracht hat. Picke einen aus und bring’ ihn ihm. Er wird ihn an einen Juwelier verkaufen, sich Nahrung und Brennholz verschaffen und sein Stück beenden.«
»Lieber Prinz,« sagte die Schwalbe, »das kann ich nicht tun,« und sie begann zu weinen.
»Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe,« sagte der Prinz, »tu nur, wie ich dir gesagt habe.«
Da pickte die Schwalbe des Prinzen Auge aus und flog damit zu des Studenten Dachkammer. Es war ganz leicht hineinzukommen, denn im Dach befand sich ein Loch. Sie schoß hindurch und gelangte ins Zimmer. Der junge Mann hatte seinen Kopf in seinen Händen vergraben, so daß er das Flattern der Schwalbenflügel nicht hörte, und als er aufblickte, fand er den schönen Saphir auf den verwelkten Veilchen liegen.
»Man beginnt mich zu schätzen,« sagte er; »dies ist von einem großen Verehrer. Jetzt kann ich mein Stück beenden,« und er sah sehr glücklich aus.
Am nächsten Tag flog die Schwalbe zum Hafen hinunter. Sie saß auf dem Mast eines großen Schiffes und beobachtete die Matrosen, wie sie schwere Kisten an Stricken aus dem Schiffsbauch heraufzogen. »Hebt — an!« schrien sie jedesmal, wenn eine Kiste heraufkam. »Ich reise nach Ägypten,« rief die Schwalbe, aber niemand bekümmerte sich darum, und als der Mond aufging, flog sie zurück zum glücklichen Prinzen.
»Ich bin gekommen, um dir Lebewohl zu sagen,« rief sie.
»Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe,« sagte der Prinz, »willst du nicht noch eine Nacht bei mir bleiben?«
»Es ist Winter,« antwortete die Schwalbe, »und bald wird der kalte Schnee hier sein. In Ägypten brennt die Sonne warm auf den grünen Palmzweigen, und die Krokodile liegen im Schlamm und blicken träge umher. Meine Gefährten bauen ein Nest im Tempel von Baalbek, und die blaßroten und weißen Tauben beobachten sie und girren sich zu. Lieber Prinz, ich muß dich verlassen, aber ich will dich nie vergessen, und nächstes Frühjahr werde ich dir zwei schöne Edelsteine bringen für die, die du fortgegeben hast. Der Rubin soll röter sein als eine rote Rose, und der Saphir so blau wie die weite See.«
»Unten auf dem Platz«, sagte der glückliche Prinz, »da steht ein kleines Streichholzmädchen. Sie hat ihre Streichhölzer in den Rinnstein fallen lassen, und sie sind alle verdorben. Ihr Vater wird sie schlagen, wenn sie kein Geld nach Hause bringt, deshalb weint sie. Sie hat weder Schuhe noch Strümpfe, und ihr kleiner Kopf ist bloß. Picke mein anderes Auge aus und bringe es ihr, dann wird ihr Vater sie nicht schlagen.«
»Ich will noch eine Nacht bei dir bleiben,« sagte die Schwalbe, »aber dein Auge kann ich nicht auspicken. Du würdest dann ganz blind sein.«
»Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe,« sagte der Prinz, »tue, wie ich dir gesagt habe.«
So pickte sie denn das andere Auge des Prinzen aus und flog damit hinab. Sie schoß hinter das Streichholzmädchen und ließ den Edelstein in ihre hohle Hand gleiten. »Was für ein köstliches Stück Glas,« rief das kleine Mädchen; und sie rannte jubelnd nach Hause.
Dann kam die Schwalbe zurück zu dem Prinzen. »Du bist jetzt blind,« sagte sie, »deshalb will ich immer bei dir bleiben.« »Nein, kleine Schwalbe,« sagte der arme Prinz, »du mußt fortgehen nach Ägypten.«
»Ich werde immer bei dir bleiben,« sagte die Schwalbe, und sie schlief zu des Prinzen Füßen.
Den ganzen nächsten Tag saß sie auf des Prinzen Schulter und erzählte ihm Geschichten von allem, was sie in seltsamen Ländern gesehen hatte. Sie erzählte ihm von roten Ibissen, die in langen Reihen auf den Bänken am Nil stehen und in ihren Schnäbeln Goldfische fangen; von der Sphinx, die so alt ist wie die Welt, die in einer Wüste lebt und alles weiß; von Kaufleuten, die langsam neben ihren Kamelen dahinschreiten und Bernsteinperlen in ihrer Hand tragen; von dem König der Mondberge, der so schwarz ist wie Ebenholz und einen großen Kristall anbetet; von der großen, grünen Schlange, die in einem Palmbaum schläft und zwanzig Priester hat, die sie mit Honigkuchen füttern; und von den Pygmäen, die über einen weiten See auf großen, flachen Blättern dahinsegeln und immer im Kriege mit den Schmetterlingen sind.
»Liebe, kleine Schwalbe,« sagte der Prinz, »du erzählst mir von wunderbaren Dingen, aber wunderbarer als alles ist das Leiden von Männern und Frauen. Kein Geheimnis ist so groß als das Elend. Fliege über meine Stadt und erzähle mir, was du dort siehst.«
Da flog nun die Schwalbe über die große Stadt und sah, wie sich die Reichen in ihren schönen Häusern belustigten, während die Bettler an den Toren saßen. Sie flog in dunkle Gassen und sah die blassen Gesichter verhungernder Kinder gleichgültig auf die schwarzen Straßen starren. Unter einem Brückenbogen lagen zwei kleine Knaben aneinander geschmiegt und versuchten, sich warm zu halten. »Wie hungrig wir sind!« sagten sie. »Ihr dürft hier nicht liegen,« rief der Wächter, und sie wanderten hinaus in den Regen.
Dann flog sie zurück und erzählte dem Prinzen, was sie gesehen hatte.
»Ich bin mit reinem Gold bedeckt,« sagte der Prinz, »du mußt es Blatt für Blatt abnehmen und es meinen Armen geben; die Lebenden glauben immer, daß Gold sie glücklich machen kann.«
Blatt auf Blatt von dem reinen Gold pickte die Schwalbe ab, bis der glückliche Prinz ganz stumpf und grau aussah. Blatt auf Blatt von dem reinen Gold brachte sie den Armen, und die Gesichter der Kinder röteten sich, und sie lachten und spielten ihre Spiele in den Straßen. »Jetzt haben wir Brot!« riefen sie.
Dann kam der Schnee, und nach dem Schnee kam der Frost. Die Straßen sahen aus, als seien sie aus Silber gemacht, so glänzten und gleißten sie; lange Eiszapfen hingen wie Kristalldolche von den Dachrinnen herab, alles ging in Pelzen, und die kleinen Knaben trugen rote Kappen und liefen Schlittschuh auf dem Eis.
Die arme, kleine Schwalbe wurde kälter und kälter, aber sie wollte den Prinzen nicht verlassen, sie liebte ihn zu sehr. Sie pickte Krümel vor des Bäckers Türe auf, wenn der Bäcker nicht hinsah, und versuchte, sich warm zu halten, indem sie mit den Flügeln schlug.
Aber zuletzt wußte sie, daß sie sterben mußte. Sie hatte gerade die Kraft, noch einmal auf die Schulter des Prinzen zu fliegen.
»Leb’ wohl, lieber Prinz,« flüsterte sie, »darf ich deine Hand küssen?«
»Ich freue mich, daß du endlich nach Ägypten gehst, kleine Schwalbe,« sagte der Prinz, »du hast dich viel zu lang hier aufgehalten; aber du mußt mich auf die Lippen küssen, denn ich liebe dich.«
»Ich gehe nicht nach Ägypten,« sagte die Schwalbe. »Ich gehe in das Haus des Todes. Der Tod ist der Bruder des Schlafes, nicht wahr?«
Und sie küßte den glücklichen Prinzen auf die Lippen und sank tot zu seinen Füßen hin.
In diesem Augenblick ertönte ein seltsames Krachen in der Statue, als sei darin etwas zerbrochen. Das bleierne Herz war vollständig entzweigesprungen. Es herrschte aber auch wirklich ein grimmig starker Frost.
Früh am nächsten Morgen ging unten über den Platz der Bürgermeister in Gesellschaft der Stadträte. Als sie an der Säule vorbeikamen, blickte er zur Statue empor: »Lieber Himmel! wie schäbig der glückliche Prinz aussieht!« sagte er. »Er sieht wirklich schäbig aus!« schrien die Stadträte, die immer mit dem Bürgermeister übereinstimmten; und sie stiegen hinauf, um ihn zu betrachten.
»Der Rubin ist aus seinem Schwert gefallen, die Augen sind fort, und er hat keine Vergoldung mehr,« sagte der Bürgermeister; »er ist wahrhaftig nicht viel mehr wert als ein Bettler!« »Nicht viel mehr wert als ein Bettler,« sagten die Stadträte. »Und hier liegt tatsächlich ein toter Vogel zu seinen Füßen!« fuhr der Bürgermeister fort. »Wir müssen wirklich eine Verordnung erlassen, daß Vögeln nicht erlaubt ist, hier zu sterben.« Und der Stadtschreiber notierte sich die Anregung. So rissen sie denn die Statue des glücklichen Prinzen herab. »Da er nicht mehr schön ist, ist er nicht mehr nützlich,« sagte der Professor der schönen Künste an der Universität.
Dann schmolzen sie die Statue in einem Schmelzofen, und der Bürgermeister veranstaltete eine Ratssitzung, um zu entscheiden, was mit dem Metall geschehen sollte. »Natürlich müssen wir eine andere Statue haben,« sagte er, »und es soll eine Statue von mir sein.«
»Von mir,« sagte jeder der Stadträte, und sie zankten sich. Als ich das letztemal von ihnen hörte, zankten sie sich noch immer.
»Was für eine merkwürdige Sache!« sagte der Werkmeister in der Gießerei. »Dieses zerbrochene Bleiherz will in dem Ofen nicht schmelzen. Wir müssen es wegwerfen.« So warfen sie es auf einen Kehrichthaufen, wo auch schon die tote Schwalbe lag.
»Bringe mir die beiden kostbarsten Dinge, die es in der Stadt gibt,« sagte Gott zu einem seiner Engel, und der Engel brachte ihm das bleierne Herz und den toten Vogel.
»Du hast recht gewählt,« sagte Gott, »denn in meinem Paradiesgarten soll dieser kleine Vogel für immer singen, und in meiner goldenen Stadt soll mich der glückliche Prinz preisen.«
Die Nachtigall und die Rose
»Sie sagte, sie würde mit mir tanzen, wenn ich ihr rote Rosen brächte,« rief der junge Student; »aber in meinem ganzen Garten ist keine rote Rose.«
Aus ihrem Nest auf dem Stamme der Steineiche hörte ihn die Nachtigall, und sie blickte neugierig durch die Blätter hinaus. »Keine rote Rose in meinem ganzen Garten!« rief er, und seine schönen Augen füllten sich mit Tränen. »Ach, von was für Kleinigkeiten hängt das Glück ab! Ich habe alles gelesen, was die weisen Männer geschrieben haben, und alle Geheimnisse der Philosophie sind mein, aber weil mir eine rote Rose fehlt, ist mein Leben elend geworden.«
»Hier ist doch endlich einer, der wahrhaft liebt,« sagte die Nachtigall. »Nacht für Nacht habe ich von ihm gesungen, obgleich ich ihn nicht kannte: Nacht für Nacht habe ich den Sternen seine Geschichte erzählt, und jetzt sehe ich ihn. Sein Haar ist dunkel wie die Hyazinthenblüte, und seine Lippen sind rot wie die Rose, nach der er verlangt; aber Leidenschaft hat sein Gesicht zu bleichem Elfenbein gemacht, und Kummer hat sein Siegel auf seine Stirne gedrückt.«
»Der Prinz gibt morgen abend einen Ball,« murmelte der junge Student, »und meine Geliebte wird ihn mitmachen. Wenn ich ihr eine rote Rose bringe, wird sie mit mir tanzen bis zum Morgen. Wenn ich ihr eine rote Rose bringe, werde ich sie in meinen Armen halten, sie wird ihr Haupt an meine Schulter lehnen, und ihre Hand wird sich in meine schließen. Aber es wächst keine rote Rose in meinem Garten, deshalb werde ich einsam sitzen, und sie wird an mir vorübergehen. Sie wird mich nicht beachten, und mein Herz wird brechen.«
»Das ist wirklich die wahre Liebe,« sagte die Nachtigall. »Wovon ich singe, das erleidet er: was mir Lust ist, ihm ist es Schmerz. Sicherlich, Liebe ist etwas Wundervolles. Sie ist kostbarer als Smaragde und wertvoller als echte Opale. Für Perlen und Granatäpfel kann man sie nicht kaufen, noch ist sie auf dem Marktplatz ausgestellt. Man kann sie bei keinem Händler erstehen, noch läßt sie sich in einer Wagschale für Gold auswiegen.« »Die Musiker werden auf ihrer Galerie sitzen«, sagte der junge Student, »und auf ihren Saiteninstrumenten spielen, und meine Geliebte wird zur Musik der Harfe und der Violine tanzen. Sie wird so leicht dahintanzen, daß ihre Füße nicht den Boden berühren, und die Höflinge in ihren glänzenden Kleidern werden sich um sie drängen. Aber mit mir wird sie nicht tanzen, denn ich habe ihr keine rote Rose zu geben,« und er warf sich auf das Gras hin und verbarg sein Gesicht in seinen Händen und weinte.
»Warum weint er?« fragte eine kleine grüne Eidechse, als sie mit dem Schwanz in der Luft an ihm vorbei rannte.
»Ja, warum?« sagte ein Schmetterling, der hinter einem Sonnenstrahl dahinflatterte.
»Ja, warum?« flüsterte ein Gänseblümchen mit sanfter, leiser Stimme zu seiner Nachbarin.
»Er weint um eine rote Rose,« sagte die Nachtigall.
»Um eine rote Rose!« riefen sie; »wie unendlich lächerlich!« und die kleine Eidechse, die so etwas wie ein Zyniker war, lachte aus vollem Halse.
Aber die Nachtigall verstand im Innersten den Schmerz des Studenten, und sie saß schweigend auf dem Eichbaum und dachte nach über das Geheimnis der Liebe.
Plötzlich breitete sie ihre braunen Flügel zum Fliegen aus und schwang sich in die Luft. Wie ein Schatten glitt sie durch den Hain, und wie ein Schatten segelte sie über den Garten. Im Mittelpunkte des Rasenplatzes stand ein schöner Rosenstrauch, und als sie ihn sah, flog sie zu ihm hin und setzte sich auf einen Zweig.
»Gib mir eine rote Rose,« rief sie, »und ich will dir mein süßestes Lied singen.« Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf. »Meine Rosen sind weiß,« antwortete er; »so weiß wie der Schaum des Meeres und weißer als der Schnee auf dem Berge. Aber geh’ zu meinem Bruder, der rings um die alte Sonnenuhr wächst, und vielleicht wird er dir geben, was du wünschest.«
Da flog die Nachtigall hinüber zu dem Rosenstrauch, der rings um die alte Sonnenuhr wuchs.
»Gib mir eine rote Rose,« rief sie, »und ich will dir mein süßestes Lied singen.«
Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf.
»Meine Rosen sind gelb,« antwortete er; »so gelb wie das Haar der Seejungfer, die auf einem Thron von Bernstein sitzt, und gelber als die gelbe Narzisse, die auf der Wiese blüht, bevor der Mäher kommt mit seiner Sense. Aber geh’ zu meinem Bruder, der unter des Studenten Fenster wächst, und vielleicht wird er dir geben, was du wünschest.«
Da flog die Nachtigall hinüber zu dem Rosenstrauch, der unter des Studenten Fenster wuchs.
»Gib mir eine rote Rose,« rief sie, »und ich will dir mein süßestes Lied singen.«
Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf.
»Meine Rosen sind rot,« antwortete er; »so rot wie die Füße der Taube und röter als die großen Wedel der Koralle, die in der Tiefe des Meeres hin und her wogen. Aber der Winter hat meine Adern erkältet, der Frost hat meine Knospen zerstört, der Sturm hat meine Zweige gebrochen, und so werde ich dieses Jahr überhaupt keine Rosen haben.«
»Eine rote Rose ist alles, was ich brauche,« rief die Nachtigall, »nur eine rote Rose! Gibt es denn keine Möglichkeit, eine zu erlangen?«
»Es gibt eine Möglichkeit,« antwortete der Strauch; »aber sie ist so schrecklich, daß ich es nicht wage, sie dir zu nennen.« »Nenne sie mir,« sagte die Nachtigall, »ich fürchte mich nicht.« »Wenn du eine rote Rose wünschest,« sagte der Strauch, »dann mußt du sie bei Mondschein aus Musik bilden und sie mit deinem eigenen Herzblut färben. Du mußt vor mir singen, deine Brust gegen einen Dorn gedrückt. Die ganze Nacht durch mußt du mir singen, und der Dorn muß dein Herz durchbohren, und dein Lebensblut muß in meine Adern fließen und mein Blut werden.«
»Tod ist ein hoher Preis für eine rote Rose,« rief die Nachtigall, »und Leben ist einem jeden sehr teuer. Es ist angenehm, im grünen Gehölz zu sitzen, die Sonne auf ihrem goldenen Wagen zu beobachten und den Mond auf seinem Perlenwagen. Süß ist der Duft des Weißdorns, und süß sind die Glockenblumen, die sich im Tal verbergen, und das Heidekraut, das auf dem Hügel blüht. Aber Liebe ist besser als Leben, und was ist das Herz eines Vogels, verglichen mit dem Herzen eines Menschen?«
Da breitete sie ihre braunen Flügel zum Fliegen aus und schwang sich in die Luft. Wie ein Schatten glitt sie über den Garten, und wie ein Schatten segelte sie durch den Hain. Der junge Student lag noch auf dem Grase, wo sie ihn verlassen hatte, und die Tränen waren noch nicht getrocknet in seinen schönen Augen.
»Sei glücklich,« rief die Nachtigall, »sei glücklich; du sollst deine rote Rose haben. Aus Musik will ich sie bei Mondschein bilden und sie färben mit meinem eigenen Herzblut. Alles, was ich zum Dank dafür verlange, ist, daß du ein wahrer Liebhaber bist, denn Liebe ist weiser als Philosophie, mag diese auch noch so weise sein, und stärker als Macht, mag diese auch noch so stark sein. Feuerfarben sind ihre Schwingen, und feuerfarben ist ihr Leib. Ihre Lippen sind süß wie Honig, und ihr Atem ist wie Weihrauch.«
Der Student blickte auf von dem Gras und lauschte, aber er konnte nicht verstehen, was die Nachtigall zu ihm sprach, denn er kannte nur Dinge, die in Büchern niedergeschrieben sind. Aber der Eichbaum verstand und wurde traurig, denn er liebte die kleine Nachtigall, die ihr Nest in seinen Zweigen gebaut hatte.
»Sing’ mir noch ein letztes Lied,« flüsterte er; »ich werde mich sehr einsam fühlen, wenn du fort bist.«