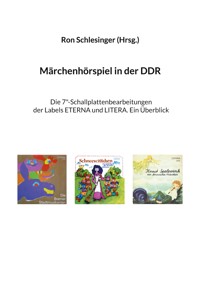
Märchenhörspiel in der DDR E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie gehören zur DDR-Kindheit wie Sandmännchen, Pionierhalstuch und Piko-Modelleisenbahn: die beliebten Märchenschallplatten. Produziert werden die Tonträger aus schwarz-glänzendem Vinyl im VEB Deutsche Schallplatten unter den Labels ETERNA und LITERA. Heute erleben die Märchenbearbeitungen ein Comeback als Hörspiel-CD, -Download sowie in Streamingdiensten. Doch wer überschaut noch die Fülle der vielen Geschichten? Die meisten werden sich an Dornröschen und Rumpelstilzchen, Pittiplatsch und Schnatterinchen sowie Herr Fuchs und Frau Elster erinnern. Aber was ist noch gleich mit Knut Spelevink? Wer wohnt in Samuil Marschaks Katzenhaus? Und welcher frühe Star des DDR-Fernsehens erzählt das Sputnikmärchen? Dieses Buch gibt Antworten und ist das erste seiner Art, das alle auf 7"-Singleschallplatte erscheinenden Märchen vorstellt: Es nennt zu jeder Bearbeitung den Produktionsstab sowie die Mitwirkenden, gibt eine kurze Inhaltsangabe, zeigt das Plattencover und beschreibt einige Hintergründe der Produktionen. Da die erzählten Geschichten seinerzeit auch (sozialistisch) erziehen und musisch bilden sollen, rücken ebenso politisch-weltanschauliche sowie gestalterische Aspekte in den Mittelpunkt. Am Rande werden Hörspielbearbeitungen des DDR-Rundfunks und/oder weitere LITERA-Veröffentlichungen (12") des jeweiligen Märchens erwähnt. Alles in allem: ein höchst lesbares Handbuch - nicht nur für Hörspielfans.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Da saßen sie, beide erwachsene Menschen
und dennoch Kinder, Kinder im Herzen,
und es war Sommer, warmer gesegneter Sommer.
H. C. Andersen
„Die Schneekönigin“, 1844
Besonderer Dank für die Unterstützung
Books on Demand GmbH, Norderstedt
Bundesarchiv, Berlin
Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Inhaltsverzeichnis
Zur Einführung
Die 7“-Schallplattenbearbeitungen von A bis W
A
debar, der Klapperstorch (1984)
Aladin und die Wunderlampe (1960)
Als Pittiplatsch den Regenbogenvogel fangen wollte (1984)
Als Pittiplatsch die Freche Lippe war (1983)
Als Pittiplatsch zum Knopfstern fliegen wollte (1984)
Aschenputtel (1978)
B
auer und der Krämer, Der (1974)
Bremer Stadtmusikanten, Die (1959)
C
hodscha Faulpelz (1975)
D
äumelinchen (1965)
Dornröschen (1960)
Dornröschen (1978)
E
delsteinberg, Der (1974)
Eigensinnige Kätzchen, Das (1975)
Ein Körnchen Wahrheit (1974)
Ein riesengroßes Tier (1975)
Ein Scheffel Glück (1974)
Ein Sputnikmärchen (1961)
F
lattergespenst in der Gartenlaube, Das (1984)
Fliegende Regenschirmchen, Das (1975)
Frau Holle (1958)
Froschkönig, Der (1960)
Fuchs und der Kranich, Der (1974)
Fummel und Bummel an der Ostsee (1962)
Fummel und Bummel bei den Katzenkindern (1963)
Fummel und Bummel beim Weihnachtsmann (1963)
Fummel und Bummels Osterbesuch (1961)
G
eschenk des Zauberers, Das (1963)
Geschichten mit Herrn Fuchs und Frau Elster (1978)
Geschichte vom kleinen Spatz, Die (1974)
Geschichte vom klugen Schuhmacher, Die (1974)
Gestiefelte Kater, Der (1960)
Gewitzte Huhn, Das (1974)
Gierige Kaufmann, Der (1978)
Goldene Axt, Die (1959)
H
ähnchen Schreihals (1975)
Hälfte vom Lohn, Die (1974)
Hänsel und Gretel (1965)
Hans im Glück (1966)
Hase als Betrüger, Der (1978)
Hase und der Igel, Der (1973)
Heiner und seine Hähnchen (1984)
Herr und sein Knecht, Der (1974)
Hühnchen und Hähnchen (1978)
I
gel, Der (1984)
K
aisers neue Kleider, Des (1960)
Katzenhaus, Das (1959)
Kleine Frikk, Der (1973)
Kleine Häwelmann, Der (1982)
Kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen, Das (1960)
Kluge Jungfrau, Die (1974)
Knut Spelevink (1967)
Koboldsturm, Der (1984)
König Drosselbart (1958)
Kofferheule, Die (1978)
Koralle, Die (1967)
Kuckuck und die Katze, Der (1985)
M
ärchen vom springenden, singenden Brunnen, Das (1966)
Mascha und der Bär (1974)
Meister Ali, oder die Gewalt der Töne (1975)
Mondjungfrau und die Sonnenjungfrau, Die (1980)
R
otkäppchen (1960)
Rotkäppchen (1975)
Rübchen, Das (1974)
Rumpelstilzchen (1960)
S
andmann ist da, Der (1963)
Satzzeichen, Die (1974)
Schneeweißchen und Rosenrot (1963)
Schneewittchen (1963)
Schneewittchen (1978)
Seifenblase, Die (1974)
Sieben Sachen, Die (1974)
Spiegel der Himmelsfeen, Die (1980)
Sprechstunde bei Dr. Waumiau (1984)
T
apfere Asmun, Der (1959)
Tapfere Schneiderlein, Das (1962)
V
ergeßliche Schnatterinchen, Das (1984)
Verzauberte Hund, Der (1973)
Vom dummen Mäuschen (1974)
Vom Hühnchen, das goldene Eier legte (1978)
Vom klugen Mäuschen (1974)
Vom Nachtigallenkönig und der Prinzessin mit dem haselnußbraunen Haar (1977)
Vom schlauen Mädchen und der dummen Katze (1974)
Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen (1966)
W
anja Tolpatsch (1974)
Warum der Mond keine Kleider hat (1974)
Wolf und die sieben Geißlein, Der (1960)
Wolf und die sieben jungen Geißlein, Der (1978)
Wolke, die nicht regnen wollte, Die (1976)
Ein erstes Resümee
Anmerkungen
Quellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Hörspiel-CDs mit 7“-Märchenschallplatten
Zur Einführung
Märchenschallplatten gehören zur DDR-Kindheit wie Sandmännchen, Pionierhalstuch oder Piko-Modelleisenbahn. Die Tonträger aus schwarz-glänzendem Vinyl in aufwändig gestalteten Plattenhüllen bringen die Geschichten von Dornröschen und Knut Spelevink, Pittiplatsch und Schnatterinchen ins heimische Kinderzimmer oder in die staatlichen Kindereinrichtungen, in denen fast immer ein (Mono-)Plattenspieler steht. Denn teure Kassettenabspielgeräte sind wenig verbreitet. Zudem bieten die Stadt- oder Kreisbibliotheken in der DDR eine Vielzahl von Kinder-Schallplatten zum Ausleihen oder Vor-Ort-Hören an – auch weil diese ihren Beitrag zur Erziehung und (musischen) Bildung leisten sollen.
Produziert sind die Tonträger vom staatlichen Monopolanbieter VEB Deutsche Schallplatten, der ab 1958/59 die ersten 7“-Vinylschallplatten bzw. Singles (= 17,5 cm; 45 U/Min) mit Märchen in den DDR-Läden für je 6,80 Mark anbietet: zuerst unter seinem Label ETERNA, später unter LITERA. Ab 1965 kommen 12“-Langspielplatten (= 30 cm; 33 ⅓ U/Min) zu einem Einzelpreis von 12,10 Mark hinzu. Bis zum Ende der DDR im Jahr 1990 werden über 70 Single-Schallplatten hergestellt, die Bearbeitungen von Märchen enthalten. Dazu kommen noch über 30 LP mit Geschichten von Grimm, Andersen & Co.
Doch obwohl die DDR (und auch LITERA) seit fast 35 Jahren Geschichte ist, haben die Märchenschallplatten die Zeiten überdauert. Mehr noch: Sie sind ein Teil der ostdeutschen Erinnerungskultur, die bis heute weiterlebt und die von Eltern und Großeltern an Kinder und Enkel weitergegeben wird – so wie die populären, oft im TV ausgestrahlten sowie auf DVD und Blu-ray veröffentlichten DEFA-Märchenfilme oder die anspruchsvoll illustrierten, bis heute mehrfach aufgelegten Märchenbücher. Denn auch einige der DDR-Schallplattenaufnahmen mit Märchen werden seit den 2000er-Jahren wieder veröffentlicht: als Hörspiel-CD, -Download sowie in Streamingdiensten. Zudem sind die originalen 7“-Singles und 12“-LP begehrte Sammlerstücke auf Online-Marktplätzen.
Die ETERNA- und LITERA-Märchenschallplatten sind demnach bis heute up to date und höchst präsent. Umso erstaunlicher ist es, dass es bisher keine Überblicksdarstellung aller 7“- und/oder 12“-Märchenhörspiele gibt, die von 1958/59 bis 1990 auf Vinyl erscheinen. Dafür gibt es Gründe. Zum einen gelten die sogenannten Kindertonträger bereits in der DDR als „ein randständiges Segment“ (Heidtmann 1992, S. 150), das in der medialen, staatlich gelenkten Öffentlichkeit (Presse, TV, Radio) praktisch nicht auftaucht bzw. kritisch begleitet wird. Allenfalls gibt es in überregionalen Tageszeitungen hin und wieder eine Besprechung oder es wird über Neuerscheinungen berichtet. Auch Fachzeitschriften widmen sich sehr selten dem Thema. Eine intensive, künstlerisch-hörspielspezifische Auseinandersetzung mit dem Medium Märchenschallplatte findet nicht statt. Das steht allerdings in großem Widerspruch zur Anzahl der Schallplatten, die pro Jahr über – manchmal auch unter („Bückware“) – den Ladentisch gehen. So nennt Jürgen Schmidt, Chefredakteur im VEB Deutsche Schallplatten, in einem Interview mit der DDR-Fachzeitschrift „Beiträge zur Kinder- und Jugendliteratur“ die jährliche Verkaufszahl von „ca. 800.000 Litera-Schallplatten für Kinder und Jugendliche (Neuerscheinungen und Nachauflagen)“ (1980, S. 38). Freilich handelt es sich hierbei nicht nur um märchenspezifische Themen, dennoch stellt dieser Bereich einen wichtigen Grundstock dar.
Im Jahr 1987 setzt sich die westdeutsche Wissenschaft ausführlich mit dem Schallplatten- und Kassettenangebot für Kinder in der DDR auseinander. Der Verhaltens- und Sozialwissenschaftler Jan-Uwe Rogge analysiert dafür exemplarisch 34 Langspielplatten verschiedener Genres, die zwischen 1968 und 1982 bei LITERA erscheinen. Zwar stellt er fest, dass einige Märchenplatten so inszeniert seien, „als hätten Diskussionen über die Art und Weise medialer Märchenbearbeitungen nie stattgefunden, als wären nie Neuansätze medialer Gegenwartsmärchen versucht worden“ (Rogge 1987, S. 214), lobt aber zugleich kreative Erzählstrukturen, wenn in Der gestiefelte Kater (1975, R: Dieter Scharfenberg) nicht ein Erzähler, sondern die Titelfigur die Geschichte berichtet, oder die musikdramaturgische Umsetzung von Samuil Marschaks Das Tierhäuschen (1972, B: Ingeburg Kretzschmar) mit der Komposition von Joachim Thurm.
Seit Rogges Beitrag sind aber mehr als 35 Jahre vergangen. Nach 1990 bleibt eine inhaltliche, ästhetisch-dramaturgische, aber auch ideologische Auseinandersetzung mit LITERA-Märchenschallplatten weiter aus. Bestenfalls werden diese in Überblicksdarstellungen kurz beleuchtet (Heidtmann 1992, S. 150f.). In aktuelleren gesamtdeutschen Beiträgen über die Märchenschallplattenproduktion sind sie nur marginal (Rühr 2008, S. 77) oder gar nicht mehr erwähnt (Bastian 2003, S. 24–43; Stenzel 2008, S. 443–449; Wicke 2020, S. 277–282).
Die 7“-Schallplattenbearbeitungen von A bis W
Der vorliegende Band möchte deshalb in einem ersten Schritt die ETERNA- und LITERA-Produktionen auf 7“-Single vorstellen, die Märchenbearbeitungen enthalten, z. B. Tiermärchen, Zauber- und Wundermärchen sowie Schwank- und Lügenmärchen. Die Vorlagen gehen dabei auf die Brüder Grimm, Hans Christian Andersen, Theodor Storm, auf Geschichten aus Tausendundeiner Nacht sowie nord- und osteuropäische Volks- und Kunstmärchen sowie DDR-Autoren zurück. Zudem sind Geschichten mit Figuren aus dem DDR-Kinderfernsehen aufgenommen, wenn sich die Aufnahmen in Story, Motiven, Inszenierung an Märchen anlehnen. Kurzhörspiele, die sich an historischen Persönlichkeiten orientieren (Vom dicken Herrn Bell, der das Telefon erfunden hat, 1974, R: Horst Hawemann), in der Gegenwart spielen (Ein freier Tag mit Clown Ferdinand, 1967, R: Jiří Vršťala) oder nur Abzählreime und Kinderlieder enthalten (Gleich kommt unser Sandmännchen, 1985, R: [keine Angabe]), bleiben außen vor.
Da sich auf den 71 Tonträgern z. T. auf der A- und B-Seite zwei eigenständige Kurzhörspiele befinden, ergeben sich insgesamt 91 Schallplattenbearbeitungen. Diese werden alphabetisch vorgestellt: Dabei sind die 7“-Singles nach dem ersten Buchstaben des Titels unter Übergehung des bestimmten Artikels wie „Der“, „Die“, „Das“ geordnet, d. h. der Titel Der Bauer und der Krämer (1974) ist unter dem Buchstaben B wie Bauer zu finden. Die Präposition „Vom“/„Von“ oder der unbestimmte Artikel „Ein“ wird dagegen als zum Titel zugehörig aufgefasst, sodass z. B. Ein Sputnikmärchen (1961) unter dem Buchstaben E rangiert.
Für jede Schallplattenbearbeitung folgt auf Angaben zu Vorlage, Produktionsstab, Mitwirkenden, Länge, DDR-Bestellnummer, Veröffentlichungsjahr(en) und Covergestaltung eine kurze Zusammenfassung des Inhalts. Danach versucht ein Kommentar, zu dem das Cover der Schallplattenhülle abgedruckt ist, das Kurzhörspiel unter verschiedenen Aspekten einzuordnen: literarisch (Wie populär ist die Vorlage in der DDR? Welche Querverbindungen gibt es zu ähnlichen Erzählungen?), ästhetisch-dramaturgisch (Wie ist die Geschichte erzählt? Welche hörspielspezifischen Gestaltungsmittel, wie Musik, Geräusche etc., werden verwendet und was tragen diese zur Inszenierung bei?), ideologisch (Unterstützt die Bearbeitung tendenziell politisch-weltanschauliche Erziehungskonzepte?). Am Rande werden ebenso Hörspielbearbeitungen des DDR-Rundfunks und/oder weitere LITERA-Veröffentlichungen (12“) des jeweiligen Märchens erwähnt.
Adebar, der Klapperstorch (1984)
UT:
Gelesen von Walfriede Schmitt
LV:
„Adebar, der Klapperstorch“, Edith Bergner
R:
Karin Lorenz
B:
Karin Lorenz
T:
Karl Hans Rockstedt
S:
Walfriede Schmitt (Erzählerin)
M:
Uwe Hilprecht, Hermann Naehring
L:
00:14:22
LA:
LITERA
F:
7“, 45 RPM, Stereo
BN:
5 65 130. Auch auf LP (8 65 303).
VÖ:
1984
G:
Elinor Weise (Cover: © LITERA)
Kurzinhalt: Ein Klapperstorch namens Adebar kehrte zum Frühlingsbeginn aus Afrika zurück. Wie die anderen Tiere war auch er damit beschäftigt, alles für den Nachwuchs vorzubereiten. Er besserte sein Nest aus, das sich auf einem Scheunendach befand. Da bat ein kleiner Junge namens Tüdelmann den Storch, er solle ihm doch ein Geschwisterkind aus dem Teich bringen. Jedes Tier hätte ihm geantwortet, dass es das nicht könne. Doch dem eitlen Adebar schmeichelte es, dass der Junge gerade ihn fragte und sagte, er würde sehen, was sich machen lasse – obwohl er keine Ahnung hatte, wo er es hernehmen sollte. Da konnten sich die anderen Tiere, wie der Pirol, die Moorente, der Buschhase, die Waldmaus und der Igel, über den eingebildeten Storch nur lustig machen. Doch Adebar gab sich keine Blöße. Als der Storch ein Ei legte, wollte er es von einem anderen Tier ausbrüten lassen, um sich um das Baby des kleinen Tüdelmann zu kümmern. Indes winkten die Moorente, die Eidechse, der Igel, das Reh und die Waldmaus ab. Nur der Fuchs sagte ihm zu, dass er das Ei ausbrüten wolle. Ahnungslos überließ Adebar ihm es und flog davon. Insgeheim wollte der Fuchs das Ei aber fressen. Zum Glück hatte der Pirol alles mitangehört. Den anderen Tieren gelang es, dass Ei aus dem Fuchsbau zu holen, auf einen Mondstrahl zu legen und ins Storchennest zu rollen. Adebar freute sich und brütete sein Ei nun selbst aus. Und im Haus der Tüdelmanns kam zur gleichen Zeit ein Baby zur Welt – ganz ohne Klapperstorch.
Kommentar: Edith Bergner gilt bereits seit den 1950er-Jahren als eine der produktivsten Kinderbuchautorinnen der DDR. Ihre Bilderbücher, aber vor allem ihre Gegenwartserzählungen – sowohl fürs erste Lesealter als auch für Achtbis Zehnjährige – erreichen hohe Auflagen. Geschickt greift sie darin bekannte Figuren (Kasperle) und Motive (Marionettentheater) auf („Stups und Stippel“, 1956; „Kasperle im Kinderhaus“, 1958) oder stellt den Alltag in einer vorbildlichen, sozialistischen Gemeinschaft vor („Vitzendorfer Schulgeschichten“, 1960, alle: Kinderbuchverlag). 1967 erscheint im selben Verlag „Adebar, der Klapperstorch“ mit Illustrationen von Steffi Bluhm. Das Bilderbuch spielt mit dem bis heute tief verwurzelten Mythos, dass der Storch die Babys bringt. Zudem vermittelt die Geschichte auf amüsante Weise das Brut- und Aufzuchtverhalten heimischer Wildtiere. 1979 erscheint „Adebar“ bereits in der siebenten Auflage und ist damit außerordentlich populär in der DDR. Mitunter mag das ein Grund sein, dass LITERA die Storchenerzählung für seine LP Tier-Geschichten (1982) auswählt. Zwei Jahre später erscheint diese nochmals ausgekoppelt als 7“-Single. Dass darin Adebar als hochmütig, stolz und eingebildet, aber auch welterfahren beschrieben wird, geht auf seine tradierten Eigenschaften als Fabeltier zurück. Denn der Vogel – wie auch der Fuchs als sein Gegenspieler – tritt schon bei Äsop und Lessing (z. B. „Der Fuchs und der Storch“, 1759) auf. Für die Stereobearbeitung wird der Originaltext von Bergner nur behutsam gestrafft. Die Erzählerin, es ist Film- und Theaterschauspielerin Walfriede Schmitt, liest ihn lebendig und mitreißend vor, wobei die einzelnen Tiere bestimmte klangliche Stimmeigenschaften erhalten, die zu ihrem Charakter passen: der distinguiert-artikulierende Storch, die schnatternde Moorente, der schnüffelnd-grunzende Igel. Im Gegensatz zur Fabel, die am Ende eine Botschaft formuliert, kommt Adebar, der Klapperstorch ganz ohne erhobenen Zeigefinger aus. Die Moral ergibt sich vielmehr aus der Geschichte selbst, die im Übrigen nur zu Beginn und am Schluss mit Musikklängen begleitet wird. Darin ist, ganz im Sinne der Titelfigur, vor allem das Schnabelklappern herauszuhören.
Aladin und die Wunderlampe (1960)
UT:
Märchen von Wilhelm Hauff (1960), Ein Märchen aus den ‚Märchen aus 1001 Nacht’ (1965), Aus den Märchen aus 1001 Nacht (1969)
LV:
„Aladdin und die Wunderlampe“, 269. Märchen aus Tausendundeiner Nacht
R:
[keine Angabe]
S:
Joseph Offenbach (Erzähler), Norbert Hansing (Aladin), Rudolf Dobersch (Zauberer), Benno Gellenbeck (Sultan), Edda Bühner (Fatime)
M:
Henri Gruel (Musik- und Geräuscheffekte)
L:
00:15:35
LA:
ETERNA, ab 1964: LITERA (Übernahme von PHILIPS/BRD)
F:
7“, 45 RPM, Mono
BN:
5 60 044
VÖ:
1960, 1964, 1965, 1969
G:
Dehne (Cover: © ETERNA)
Kurzinhalt: Eine arme Witwe lebt mit ihrem nutzlosen Sohn Aladin in Bagdad. Als er sich bei einem afrikanischen Zauberer als Diener verdingt, soll er für ihn eine Öllampe aus einer Höhle holen, erhält aber einen Ring, der ihn vor jeder Gefahr schützt. Der Junge steigt in die Höhle hinab, findet die Lampe, lässt sich aber von Schätzen ablenken. Daraufhin schleudert der ungeduldig wartende Zauberer aus Zorn einen Stein auf den Höhleneingang, sodass Aladin gefangen ist, und segelt danach zurück nach Afrika. Der Junge gelangt jedoch mit Hilfe des Rings nach Hause zu seiner Mutter. Zufällig kommen beide hinter das Geheimnis der Lampe: Als die Witwe an ihr reibt, erscheint ein Geist und erfüllt jeden Wunsch. Aladin lebt mit seiner Mutter in Wohlstand, bis er sich eines Tages in die Sultanstochter Fatime verliebt und sie heiraten möchte. Mit Hilfe des Geistes, der Aladin Geschenke und einen Palast zaubert, willigt der Sultan ein. Davon erfährt auch der afrikanische Zauberer. Er verkleidet sich als Lampenhändler und jagt Fatime, die das Geheimnis nicht kennt, die Lampe ab. Der Geist versetzt auf Geheiß des Zauberers den Palast mit Fatime nach Afrika. Der Sultan, der mit Aladin gerade auf der Jagd war, wirft seinen Schwiegersohn ins Gefängnis und befiehlt ihm, die Tochter wieder zurückzubringen. Aladin gelangt mit Hilfe des Rings nach Afrika in seinen Palast, in dem er Fatime findet. Beide vergiften den Zauberer und bringen die Wunderlampe wieder in ihren Besitz.
Kommentar: Das im Untertitel fälschlicherweise Wilhelm Hauff zugeschriebene Märchen ist eine der bekanntesten „Geschichten aus Tausendundeiner Nacht“: Einst überliefert von anonymen Erzählerinnen und Erzählern in der islamischen Welt, treten die Märchen im 18. Jahrhundert ihren Siegeszug in Europa an. Dass diese Popularität in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch in der DDR anhält, beweist einerseits der Erzählband „Alaeddin und die Wunderlampe. Märchen aus Tausendundeiner Nacht“ (1959, Kinderbuchverlag) mit Illustrationen von Eva Johanna Rubin, nach einer Übersetzung aus dem Arabischen von Gustav Weil und für Kinder bearbeitet von Regina Hänsel. Andererseits ist es diese frühe 7“-Schallplattenbearbeitung von PHILIPS, die 1960 von ETERNA übernommen wird. Darin ist die ursprünglich komplexe Geschichte auf eine Kernhandlung und das Ensemble auf die wichtigsten Figuren begrenzt. Zudem werden für ein Kinderpublikum schwer verständliche Begriffe aus der Vorlage ersetzt. So ist der maghrebinische1 Zauberer ein afrikanischer, die Sultanstochter Badr al-Budûr heißt schlicht Fatime und der Dschinnî erfüllt einfach als Geist alle Wünsche. Orientalisch anmutende Musikklänge, wie sie Pungi oder Bendir erzeugen, bedienen zwar stereotype europäische Vorstellungsmuster, schaffen aber die passende Märchenatmosphäre aus Tausendundeiner Nacht. Überdies trägt ein Erzähler, es ist der westdeutsche Schauspieler und Hörspielsprecher Joseph Offenbach, die Geschichte vor. Damit spannt das Hörspiel zugleich einen Bogen zur Rahmenhandlung aus der Vorlage, obwohl dort eine junge Frau das Märchen erzählt.2 Trotzdem überzeugt diese Bearbeitung ästhetischdramaturgisch eher weniger. Denn dem Helden fallen, wie im Originalmärchen, ohne Zutun Wunderlampe, Sultanstochter und Palast wie von selbst zu. Keine neu aufgenommenen Prüfungen warten auf Aladin, die seine Entwicklung vom nutzlosen Tagedieb zum aktiven Helden hätten vorantreiben können. Zudem erinnern die Sprechakte einiger Figuren, wie Aladin, an blutleere Bühnenauftritte. Nur bei den technisch verfremdeten Stimmen von Zauberer und Geist werden die Vorteile des im Studio aufgenommenen Hörspiels genutzt.
Als Pittiplatsch den Regenbogenvogel fangen wollte (1984)
UT:
–
LV:
Ingeborg Feustel
R:
Jürgen Schmidt
T:
Karl Hans Rockstedt
S:
Heinz Schröder (Pittiplatsch), Friedgard Kurze (Schnatterinchen), Günter Puppe (Moppi)
M:
Werner Pauli (Blockflöte: Karl Butthof)
L:
00:12:23
LA:
LITERA
F:
7“, 45 RPM, Stereo
BN:
5 65 134
VÖ:
1984. Auch auf LP (8 65 292) und MC (0 65 292).
G:
Olthoff (Cover: © LITERA)
Kurzinhalt: Pittiplatsch pfeift auf seiner Flöte, um den Regenbogenvogel anzulocken und zu fangen. Hund Moppi hilft ihm dabei. Denn wer den Regenbogenvogel fängt, darf sich etwas von ihm wünschen. Pitti möchte einen fliegenden Schaukelstuhl haben, Moppi ganz viele Knackwürste. Doch Pitti lockt mit seinen schiefen Pfeiftönen nur eine Hundemeute, eine Schar Krähen und eine Kuh an. Vom Regenbogenvogel ist nichts zu sehen. Plötzlich erwidert eine singende Drossel Pittis Töne. Er nimmt sich vor, ein paar Tage Flöte zu üben, sodass ihm später auch andere Vögel mit ihrem schönen Gesang antworten. Dann möchte Pitti mit allen Vögeln in den Zirkus gehen, um dort ein Vogelkonzert abzuhalten. Dafür verzichtet er sogar auf den fliegenden Schaukelstuhl.
Kommentar: Kinderbuchautorin Ingeborg Feustel, die den TV-Kobold Pittiplatsch mit erdacht hat, nutzt für die Schallplattenbearbeitung klassische Märchenmotive, z. B. den Zaubervogel: Ist es in „Der goldene Vogel“ (KHM 57) oder in „Das Märchen von Iwan-Zarewitsch, dem Feuervogel und dem grauen Wolf“ (russisches Volksmärchen) die Aufgabe des Helden, das scheue Tier nur einzufangen, so soll es in Als Pittiplatsch den Regenbogenvogel fangen wollte zudem noch Wünsche erfüllen können. Doch Feustels Geschichte steht hörbar in der Tradition des modernen Kunstmärchens, in dem das Wünschen zwar der Erzählauslöser ist, aber die Erfüllung humorvoll ad absurdum geführt wird. Vielmehr soll dem (Vorschul-)Kinderpublikum sowohl Unterhaltung geboten als auch Wissen – ganz ohne erhobenen Zeigefinger – vermittelt werden. Dafür eignen sich Pittiplatsch und Moppi fraglos, weil sie von Beginn ihrer TV-Präsenz an nicht nur als Kontrast-, sondern auch als Parallelfiguren angelegt sind. Moppi, der am 3.4.1976 erstmals auf dem Fernsehbildschirm auftaucht, ist ebenso in diesem Kurzhörspiel ein wenig naiv, gutgläubig und denkt oft ans Fressen (Knackwürste mit Mostrich). Gleichzeitig ist er Pittis (TV-Premiere: 17.6.1962) bester Freund und Kumpel, der wiederum neunmalklug, pfiffig und immer zu Streichen aufgelegt ist. Dabei lernt das Publikum spielerisch, dass Hunde auf Pfeifen reagieren, Krähen auch mal Vogelküken fressen und Kühe auf Wiesen weiden. Natürliche Geräusche (z. B. Hundegebell, Krähenkrächzen, Kuhlaute) illustrieren das akustisch und/oder sind am Spannungsaufbau beteiligt. Daneben bringen Vogelgezwitscher und Hahnkrähen als Hintergrundgeräusche zusätzliche Atmosphäre. Der damals 54-jährige Musiker Karl Butthof, der schon beim Einspielen des „Sandmann“-Liedes für die TV-Sendung „Abendgruß“ mit der Oboe beteiligt ist, steckt hinter den z. T. absichtlich schief gespielten Flötentönen von Pitti. Ursprünglich wird Als Pittiplatsch den Regenbogenvogel fangen wollte für die LP Der Koboldsturm und andere Geschichten mit Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi (1980, R: Jürgen Schmidt) von LITERA produziert und erst vier Jahre später als 7“-Single ausgekoppelt.
Als Pittiplatsch die Freche Lippe war (1983)
UT:
–
LV:
Ingeborg Feustel
R:
Jürgen Schmidt
T:
Karl Hans Rockstedt
S:
Heinz Schröder (Pittiplatsch), Friedgard Kurze (Schnatterinchen), Günter Puppe (Moppi)
M:
Werner Pauli (auch Gitarre)
L:
00:09:20
LA:
LITERA
F:
7“, 45 RPM, Stereo
BN:
5 65 135
VÖ:
1983. Auch auf LP (8 65 292) und MC (0 65 292).
G:
Olthoff (Cover: © LITERA)
Kurzinhalt: Pittiplatsch, die Freche Lippe und Moppi, der Große Moppelkopf spielen Indianer. Schnatterinchen darf nicht mitmachen, weil es angeblich nicht mutig und darüber hinaus ein Mädchen sei. Pitti und Moppi gehen lieber allein auf die Jagd nach Truthähnen und Büffeln. Als sie im Wald nach Beeren suchen, hören sie plötzlich hinter der Weide eine Männerstimme. Pitti und Moppi glauben, dass jemand sie verhauen wolle, weil der Mann von Aufwärtshaken, Deckung und Schlag auf die Nase spricht. Moppi bekommt es mit der Angst zu tun und versteckt sich in seiner Hundehütte. Auch Pitti fürchtet sich sehr und schluchzt. Plötzlich kommt ihm Schnatterinchen entgegen. Es saß hinter der Weide und hat im Kofferradio einen Boxkampf gehört. Pitti sieht ein, dass er gar kein so tapferer und mutiger Indianer ist und schlägt Schnatterinchen vor, dass es morgen als Leises Watschelbein mitspielen darf.
Kommentar: Etwas Wildwest gibt es auch in der DDR: Im Kinderzimmer stehen Indianer- und Trapperfiguren aus dem VEB Spielzeugland Mengersgereuth-Hämmern. Im Kino laufen DEFA-Indianerfilme, wie Apachen (DDR 1973) mit dem deutsch-serbischen Schauspieler Gojko Mitić. Und sogar die Digedags, Haupthelden der DDR-Comiczeitschrift „Mosaik“ (1955– 1975), erleben als Adlerauge, Kluger Biber und Flinker Fuchs, Abenteuer im Wilden Westen. Da verwundert es kaum, wenn auch Pittiplatsch, Moppi und Schnatterinchen Indianer spielen, sich kostümieren und fantasievolle Beinamen zulegen. Die heutige Diskussion um den richtigen Umgang mit kultureller Aneignung, Rassismus und Begrifflichkeiten (‚Indianer’) ist zu dieser Zeit noch fern. Vielmehr nutzt Autorin Ingeborg Feustel in Als Pittiplatsch die Freche Lippe war eines der damals beliebtesten Kinderspiele für den Rahmen einer Geschichte, in der es im Kern um Vorurteile und Gleichberechtigung geht. Die Stereobearbeitung wird ursprünglich für die LP Der Koboldsturm und andere Geschichten mit Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi (1980, R: Jürgen Schmidt) von LITERA produziert und drei Jahre später als 7“-Single ausgekoppelt. Im Unterschied zu → Als Pittiplatsch den Regenbogenvogel fangen wollte (1984) gehört diesmal auch Schnatterinchen zum Figurenensemble: Darin spielt es als vermeintlich ängstliches ‚Mädchen’ den Gegenpart von Pittiplatsch, dem scheinbar tapferen ‚Jungen’ – und Moppi, seinem ebenso vorgeblich mutigen ‚Kumpel’. Feustel versteckt die erzieherische Lektion, wenngleich etwas konstruiert, hinter Witz und Humor (Boxkampf-Übertragung aus dem Radio) und zeigt, dass Ausgrenzung (‚Du darfst nicht mitspielen!’), die Kinder oft aus eigener Erfahrung kennen, Quatsch ist. Hörspielspezifische Mittel, wie natürliche Geräusche, unterstützen die Atmosphäre (Vogelgezwitscher, Spechtklopfen) oder stehen für die Tiere, die Pitti und Moppi begegnen (Hühnergegacker, Hahnenschrei, Kuhlaute). Der Komponist Werner Pauli (→ Ein Sputnikmärchen, 1961; → Das Märchen vom springenden, singenden Brunnen, 1966) begleitet Pitti und Schnatterinchen am Ende mit seiner Gitarre.
Als Pittiplatsch zum Knopfstern fliegen wollte (1984)
UT:
–
LV:
Ingeborg Feustel
R:
Jürgen Schmidt
T:
Karl Hans Rockstedt
S:
Heinz Schröder (Pittiplatsch), Friedgard Kurze (Schnatterinchen), Günter Puppe (Moppi)
M:
[Werner Pauli (auch Gitarre)]
L:
00:10:47
LA:
LITERA
F:
7“, 45 RPM, Stereo
BN:
5 65 133
VÖ:
1984. Auch auf LP (8 65 292) und MC (0 65 292).
G:
Tamara Sälzer (Cover: © LITERA)
Kurzinhalt: Pittiplatsch hat Schnatterinchens Batteriestaubsauger auf einen Handwagen gebunden und zu einer Rakete umfunktioniert. Damit will er ins Weltall bis zum Knopfstern fliegen. Als er auf dem Gartenweg starten möchte, überrascht ihn Moppi. Er will mitfliegen. Zwar kann ihn Pitti im Weltall überhaupt nicht gebrauchen, aber Moppi lässt sich nicht abwimmeln. Doch alle Startversuche mit der Handwagenrakete schlagen fehl. Unverhofft kommt Schnatterinchen hinzu. Es erklärt beiden, dass sie zu dick seien und ein Staubsauger keine Rakete wäre, weil ihr der Feuerstrahl fehle. Pitti sieht das schweren Herzens ein, obwohl er doch so gern um den Mond geflogen wäre.
Kommentar: Am 26. August 1978 um 15.51 Uhr (MEZ) startet der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn ins Weltall – an Bord der sowjetischen „Sojus 31“ zusammen mit seinem Kollegen Waleri Bykowski. Tags darauf überbieten sich die DDR-Zeitungen in den Sonntagsbzw. Sonderausgaben mit ihren Titelgeschichten: „Ein Bürger unserer Republik als erster Deutscher im Kosmos!“ (Berliner Zeitung, 27.8.1978) oder „Der erste Deutsche im All ein Bürger der DDR“ (Neues Deutschland, 27.8.1978). Wenngleich der Stolz über den Sieg im All-Wettlauf über die Bundesrepublik deutlich herauszulesen ist, so erfasst tatsächlich eine echte Euphorie die DDR. Es mag sein, dass sich später auch LITERA davon anstecken lässt, als das Label das Abenteuer um Möchtegern-Kosmonaut Pitti für die LP Der Koboldsturm und andere Geschichten mit Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi (1980, R: Jürgen Schmidt) produziert – so wie ETERNA mit → Ein Sputnikmärchen (1961) – und vier Jahre später als 7“-Single auskoppelt. Ingeborg Feustel, die das Manuskript für die Knopfstern-Geschichte verfasst, und ihr Mann Günther lassen den Helden bereits in der Gute-Nacht-Sendung „Abendgruß“ hin und wieder Weltraumluft schnuppern.3 Hier setzt die Stereobearbeitung allerdings auf die bewährte, klassische Figurenkonstellation: einerseits Erfinder Pitti und Flugbegleiter Moppi, andererseits Schnatterinchen, das als kluges Mädchen durchaus empathisch die hochfliegenden Weltall-Träume platzen lässt. Daneben wird dem (Kinder-)Publikum ganz nebenbei ein wenig Kosmonautenwissen vermittelt, z. B. dass eine Rakete mit Rückstoßantrieb und „Feuerstrahl“ (Treibstoff) funktioniert. Wie schon in den drei anderen Koboldsturm-Geschichten setzt das Kurzhörspiel zudem verstärkt auf atmosphärische und illustrierende Geräusche: die Vögel zwitschern im Garten, die Räder des Handwagens quietschen, die Hupe von Moppi dröhnt und die Rakete resp. der Staubsauger brummt. Und auch wie in → Als Pittiplatsch die Freche Lippe war (1983) beendet ein gemeinsames Lied von Pitti und Schnatterinchen, wieder begleitet von Werner Pauli, die Geschichte – auch wenn das auf dem Cover nicht vermerkt ist.
Aschenputtel (1978)
UT:
Ein Märchen der Brüder Grimm
LV:
„Aschenputtel“, KHM 21
R:
Mirjana Erceg
B:
Gerhardt Gröschke
T:
Karl Hans Rockstedt
S:
Günter Junghans (Erzähler), Barbara Schnitzler (Aschenputtel), Karin Reif (1. Stiefschwester), Helga Sasse (2. Stiefschwester), Gudrun Ritter (Stiefmutter), Joachim Konrad (Vater), Joachim Siebenschuh (Prinz)
M:
Hartmut Behrsing (auch Leitung Instrumentalgruppe)
L:
00:12:12
LA:
LITERA
F:
7“, 45 RPM, Stereo
BN:
5 65 123. Auch auf LP (8 65 261) und MC (0 65 261).
VÖ:
1978, 1979
G:
Jürgen Wirth (Cover: © LITERA)
Kurzinhalt: Ein Kaufmann, der eine Tochter hatte, heiratete nach dem Tod seiner Ehefrau wieder. Die neue Frau brachte zwei Töchter mit, die aber einen hässlichen Charakter hatten. Sie demütigten ihre Stiefschwester und nannten sie Aschenputtel. Von einer Messe brachte der Vater den Mädchen mit, was sie sich gewünscht hatten: schöne Kleider, Perlen und Edelsteine für die Stiefschwestern, für Aschenputtel ein Birkenreis, das auf dem Grab seiner Mutter zu einem Baum heranwuchs. Der König gab ein dreitägiges Fest, auf dem sich sein Sohn eine Braut wählen sollte. Alle schönen Mädchen waren eingeladen. Aschenputtel bat, mit aufs Schloss zu dürfen, wurde aber ausgelacht. Vielmehr schüttete ihm die Stiefmutter Linsen in die Asche, die es herauslesen sollte. Doch Tauben halfen Aschenputtel dabei. Am Grab seiner Mutter warf ihm die Birke Kleid und Schuhe herab, sodass es dreimal zum Ball gehen konnte. Auf dem Fest tanzte der Prinz nur mit Aschenputtel, das aber immer kurz vor Mitternacht verschwand. Am dritten Abend blieb sein Schuh an der mit Pech bestrichenen Treppe hängen. Der Prinz verkündete, das Mädchen zu heiraten, dem dieser Schuh passe. Die ältere Stieftochter haute sich dafür die große Zehe, die jüngere ein Stück Ferse ab. Doch beide Male verrieten die Tauben den Betrug. Als Aschenputtel ihn anzog, saß der Schuh perfekt.
Kommentar: Obwohl es zu den beliebtesten Märchen zählt, wird „Aschenputtel“ erst am Ende der 1970er-Jahre in der DDR als Hörspiel produziert. Das erstaunt wenig, haben sich doch Film (Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, DDR/ČSSR 1973) und TV (Aschenbrödel, DDR 1976) ebenso spät dieser Geschichte zugewendet. Ein Grund mag in den beiden Milieus des Märchens liegen, die den Hörspielverantwortlichen offenbar lange unpassend erscheinen: die bürgerlich-kaufmännische und königlich-höfische Umgebung. Zudem steht kein einfacher Mensch im Mittelpunkt, sondern ein gutsituiertes, wenngleich vorübergehend sozial herabgesetztes Mädchen, das am Ende einen Prinzen heiratet. Dabei zeigt das Märchenbuch weniger Berührungsängste, wie frühe Einzelausgaben (1956, 1963, Kinderbuchverlag) beweisen. Die 7“-Bearbeitung – vom Schauspieler Günter Junghans erzählt – hält sich an die 1812 erscheinende, 1819 leicht veränderte Vorlage, lässt aber allzu grausame Züge weg (Augen-Auspicken) und nimmt ideologische Änderungen vor: So ist Aschenputtels Vater nicht „reich“, sondern nur „wohlhabend“ und die religiös aufgeladene Mutter-Tochter-Szene am Sterbebett („bleib fromm und gut“) zu Beginn entfällt ganz. Vielmehr arbeitet das Kurzhörspiel die kontrastreichen Charaktere heraus. Hier sticht vor allem das lustvoll-böse, stereofonische Gebaren von Stiefmutter und Töchtern heraus, die die etwas zu passive Titelfigur verhöhnen. Zudem erfährt die Rolle des konfliktscheuen Vaters eine charakterliche Differenzierung: Als sich die Spur der Unbekannten in der Nähe seines Hauses verliert, „machte er sich Gedanken über seine Tochter und lächelte still“. Gleichwohl greift auch diese Bearbeitung auf die bekannten Formeln zurück, wenn Aschenputtel die Vögel herbeiruft, den Baum um Gold und Silber bittet oder die Tauben die rechte Braut erkennen. Die Musik der Instrumentalgruppe (Klavier, Holzbläser, Streicher, Schlagzeug, Mellotron) ist dabei nicht nur stimmige Untermalung, sondern wird als Erzählmittel genutzt: Instrumente entwickeln einen Hinweischarakter, wie die Maultrommel, deren besonderer Klang das Magische (Birkenreis) hörbar heraushebt und sich leitmotivisch durch die Handlung zieht.
Der Bauer und der Krämer (1974)
UT:
Ukrainische Schelmengeschichte
LV:
[unbekannt]
R:
Horst Hawemann
A:
Werner Schurbaum
B:
Ingeburg Kretzschmar
T:
Karl Hans Rockstedt
S:
Rolf Ludwig (Erzähler), Erhard Köster (Der Bauer), Wolfgang Greese (Der Krämer)
M:
Joachim Thurm (nach Volksliedern und Tänzen aus der Sowjetunion)
D:
Günther Herbig (Mitglieder des Berliner Sinfonie-Orchesters)
L:
00:01:35
LA:
LITERA
F:
7“, 45 RPM, Stereo
BN:
5 65 095. Auch auf LP (8 65 181). B-Seite von →
Die Geschichte vom klugen Schuhmacher
.
VÖ:
1974
G:
Gisela Kossatz (Cover: © LITERA)
Kurzinhalt: Ein Bauer kommt in einen Laden und möchte Bonbons kaufen. Das verwundert den misstrauischen Krämer, doch er zeigt ihm zwei Sorten. Der Bauer schnuppert an den Bonbons, doch jedes Mal behagt ihm der Geruch nicht. Ärgerlich reicht ihm der Krämer die dritte Sorte. Auch diese lehnt der Bauer ab und stellt sie auf den Ladentisch zurück. Als er danach das Geschäft verlassen will, ruft er dem Bauern laut hinterher, dass er fürs Riechen bezahlen solle. Dieser legt das Geld auch auf den Ladentisch, steckt es aber gleich wieder ein. Das verwundert den Krämer, worauf er den Bauern ebenso laut zur Rede stellt. Doch der erwidert: Wie der Kauf so die Bezahlung! Er habe an den Bonbons gerochen und der Krämer habe das Geld klingeln gehört. Somit wären sie quitt.
Kommentar: Als 1972 die LITERA-LP Ein Körnchen Wahrheit. Märchen und Schelmengeschichten der Sowjetvölker erscheint, koppelt das Label zwei Jahre später u. a. Der Bauer und der Krämer aus. Obwohl die in vielen Kulturkreisen bekannte Geschichte nicht in den DDR-Erzählbänden „Ukrainische Volksmärchen“ (1949, Verlag Kultur und Fortschritt; 1972, Akademie-Verlag) enthalten ist, ähnelt sie der 79. Legende über den deutschen Bauernsohn Till Eulenspiegel (wie er „den Wirt mit dem Klang von dem Geld bezahlt“) oder einer Anekdote über den türkischen Narren Hodscha Nasreddin („Wer den Duft des Essens verkauft“). Hier wie dort behauptet sich ein findiger Kerl mit Witz und Verstand gegenüber einem auf Bezahlung pochenden Verkäufer, wenngleich dieser keine Leistung erbracht hat. Die 7“-Schallplattenbearbeitung nimmt diesen Humor auf, wenn der populäre Schauspieler Rolf Ludwig als Erzähler am Anfang und Ende ein amüsantes „Bing-bong-bong“ zum Besten gibt: Einerseits ist es dem Klang einer Ladenglocke nachempfunden (und soll das Eintreten bzw. Verlassen des Geschäfts akustisch imitieren), andererseits erinnert es an den dreibzw. vierstufigen Gong in Kino und Theater. Konsequent ist diese Geräuschillusion aber nicht durchgehalten (echtes Geldklimpern auf dem Ladentisch). Inhaltlich werden – wie im Schelmenroman – auch hier gesellschaftliche Schichten kritisch betrachtet und lächerlich gemacht. Diesmal trifft es einen geizigen Krämer, der gegenüber einem schlagfertigen Bauern den Kürzeren zieht. Das verwundert kaum, bestimmen doch die Angehörigen niedriger sozialer Schichten – wie der Bauer – und nicht etwa der Händler (Krämer) die Perspektive des Märchens wie auch der Schelmengeschichte. Dieses Kontrastschema unterstützt das stimmliche Verhalten der beiden Protagonisten: Ein einnehmendes Lachen des Bauern beschreibt ihn als lebenslustigen Menschen, dem der Zuspruch des Publikums sicher ist. Dagegen verweist ein überlaut-drohender Rededuktus („Hej Bauer, du musst noch bezahlen!“) auf Unfreundlichkeit und Übellaunigkeit des Krämers. Die sinfonische Musik am Ende bedient mit Instrumentarium (u. a. Bajan) und Melodie konventionelle, vor allem sich an der Märchenherkunft orientierende Ideen.
Die Bremer Stadtmusikanten (1959)
UT:
Nach dem Märchen der Brüder Grimm
LV:
„Die Bremer Stadtmusikanten“, KHM 27
R:
Theodor Popp
B:
Brigitte Wicht
S:
Egon Wander (Erzähler), Erik S. Klein (Esel), Walter Richter-Reinick (Hund), Robert Assmann (Kater), Harald Grünert (Hahn), Rudolf Christoph (Müller), Hans-Edgar Stecher (Müllerbursche), Elfriede Née (Hausfrau), Ingeborg Chrobock (Köchin), Günther Polensen (1. Räuber), Heinz Pätzold (2. Räuber), Heinz Scholz (3. Räuber)
M:
Ernst-Peter Hoyer (Instrumentalgruppe des Staatlichen Rundfunkkomitees, Leitung: Siegfried Enders)
L:
00:13:50
LA:
ETERNA, ab 1962: LITERA
F:
7“, 45 RPM, Mono
BN:
5 60 002. Auch auf LP (8 60 072, 8 60 217) und MC (0 60 217).
VÖ:
1959, 1962, 1963, 1966, 1969, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978
G:
Lüdtke (ab 1959), Christoph Ehbets (ab 1973)
Kurzinhalt: Ein Müller trägt seinem Burschen auf, einen altgedienten Esel zu erschlagen, weil dessen Kräfte zu Ende gehen. Als das Tier davon erfährt, läuft es davon. Im Wald lauscht der Esel einem Vogel. Daraufhin beschließt er, nach Bremen zu ziehen und Stadtmusikant zu werden. Auf dem Weg dorthin trifft er einen müden Jagdhund, eine halbblinde Hauskatze und einen Hahn, der im Suppentopf landen soll. Allen drei droht der sichere Tod. Deshalb schließen sie sich dem Esel an. Weil der Weg nach Bremen aber weit ist, übernachten sie im Wald. Als sich der Hahn auf einer Baumspitze umschaut, erkennt er in der Ferne ein kleines Licht, das zu einem Haus gehört. Die Vier beschließen, dorthin zu gehen. Das Haus gehört aber drei Räubern, die am gedeckten Tisch sitzen. Um an die Leckereien zu kommen, stürzen sie singend und schreiend durch das Fenster. Die Räuber suchen vor Angst das Weite, die vier Musikanten essen sich satt und suchen sich einen Schlafplatz. Nachts kommt ein Räuber zurück, um nach dem Rechten zu sehen. Doch er wird von der Katze zerkratzt, vom Hund gebissen, vom Esel getreten und der Hahn kräht ihm hinterher. Die Räuber ziehen in einen anderen Wald. Den Musikanten gefällt es im Haus. Sie bleiben dort.
(1962)
(1973, Cover: © LITERA)
Kommentar: Gemessen an den Neuauflagen liegt das Kurzhörspiel mit an der Spitze der 7“-Schallplattenbearbeitungen. Daran hat neben der Bekanntheit des Tiermärchens – 1819 erstmals von den Grimms veröffentlicht und schon früh in der SBZ/DDR neu verlegt, z. B. bei Rütten & Loening (1947) sowie im Kinderbuchverlag (1955) – hier vor allem die lebendige Inszenierung ihren Anteil. Zwar halten sich sowohl der Erzähler (es ist der danach in die BRD übergesiedelte Schauspieler Egon Wander) als auch die vier Helden im Kern an den Wortlaut der Vorlage – wobei es nur wenige Ergänzungen gibt. So stellt z. B. ein neu in die Handlung aufgenommener, empathischer Müllerbursche das Verhalten des nur auf Profit schauenden Müllers („Ich brauche keine unnützen Fresser.“) infrage. Doch die guten sprecherischen Leistungen der Hauptakteure und ihr beschwingtes Wanderlied („Wir ziehen in die große Stadt“), das sie mehrmals intonieren, lassen eine konservative Dramaturgie schnell vergessen. Das volksliedhafte Gesangsstück, das an „Das Wandern ist des Müllers Lust“ (Text: Wilhelm Müller, Melodie: Carl Friedrich Zöllner) erinnert, verknüpft sich wiederholende Handlungsszenen. Zudem spricht das Lied mit seinem betonten Aufforderungscharakter gerade das kindliche Publikum an und animiert mit verwendetem Instrumentarium (Trompete, Trommel, Pauke etc.) zum Mitsingen. Der Idee, den Tieren zusätzlich verschiedene Instrumente zuzuordnen, wie zu Beginn beim Hufschlag des Esels, verschließt sich die Bearbeitung weitgehend. – Auch der DDR-Rundfunk bearbeitet das Märchen fürs Radio (1957, R: Dora König; 1987, R: Maritta Hübner) – letzteres frei nach den Grimms als Hörspiel in Versen.
Chodscha Faulpelz (1975)
UT:
Usbekisches Märchen
LV:
„Chodscha Faulpelz“, Volksmärchen
R:
Horst Hawemann
A:
Werner Schurbaum
B:
Ingeburg Kretzschmar
T:
Karl Hans Rockstedt
S:
Rolf Ludwig (Erzähler)
M:
Joachim Thurm (nach Volksliedern und Tänzen aus der Sowjetunion)
D:
Günther Herbig (Mitglieder des Berliner Sinfonie-Orchesters)
L:
00:02:35
LA:
LITERA
F:
7“, 45 RPM, Stereo
BN:
5 65 102. Auch auf LP (8 65 181). B-Seite von →
Meister Ali, oder die Gewalt der Töne
.
VÖ:
1975
G:
Dieter Heidenreich (Cover: © LITERA)
Kurzinhalt:





























