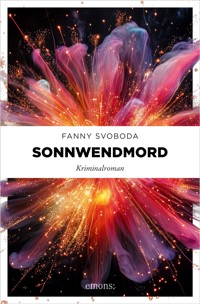Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schwarzhumorig, schräg und hochgradig politisch inkorrekt! Ein vergifteter Marillenknödel wird dem allseits verhassten Obstbauern Berti zum tödlichen Verhängnis. Blöd nur, dass die Polizei den Falschen verhaftet. Das ruft den erfolglosen Krimiautor Horvath auf den Plan, denn im Ermitteln kennt er sich aus – zumindest in der Theorie. Gemeinsam mit seiner Freundin und einem durchgeknallten Guru macht er sich in dem kleinen Wachauer Provinzdorf auf die Suche nach dem wahren Täter – und wirbelt dabei mächtig Staub auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fanny Svoboda ist das Krimi-Pseudonym von Andrea Walter. Die Autorin wurde 1980 in Melk geboren und ist ihrer Heimat, der Wachau, seither treu geblieben. Inspiriert von der Landschaft und den Menschen, schreibt sie regional angesiedelte Psychothriller und Kriminalromane.
Mehr Informationen zur Autorin unter www.diewalter.at.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Im Anhang befindet sich eine Zutatenliste für ein Marillenknödel-Rezept.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Westend61/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Julia Lorenzer
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-182-9
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Egal, wie viel Gift du in einen Marillenknödel mischst. Ein wahres Verbrechen ist es erst, wennst Vanillesoße dazu servierst.
Prolog
Der Berti dreht den Fernseher auf stumm und lauscht. Es klopft schon wieder an der Türe. Da hat er sich also nicht getäuscht.
»Mama!«, schreit er aus Gewohnheit, dann fällt ihm ein, dass die Mama seit zwei Tagen in Bad Deutsch-Altenburg auf Kur ist. Dabei hat er sich vor fünf Minuten noch darüber gefreut, in Ruhe Lisa Eckhart schauen zu können, ohne von ihr vorgeworfen zu bekommen, er würde die Show nur aufdrehen, weil sie so gerne obszöne Sachen sagt. Doch die Mama hat recht. Er mag es, wenn Frauen obszön reden.
Seine Mama könnte ruhig ein bisserl toleranter sein. Er muss schließlich auch so einiges erdulden, seit sein neuer HD-Fernseher im gemeinsamen Wohnzimmer steht, weil sie irgendwo gelesen hat, von der Strahlung im Schlafzimmer bekäme man Krebs. Die Verkaufssendungen am Morgen, die Karlich am Nachmittag, die Vera am Abend, und wenn er besonders großes Pech hat, hält die Mama bis zum Seitenblicke-Magazin durch. Das alles auf 55 Zoll in Dolby Surround. Ein Glück, dass die Mama noch nicht herausgefunden hat, dass es die TVthek gibt, sonst hätte der Jammer nie ein Ende.
Er beklagt sich nur selten, schließlich hat man ja nur eine Mutter, und schlechte Stimmung schlägt seiner sofort aufs Herz. Er beschwert sich nicht einmal darüber, dass sie ihn noch immer Berti nennt. Eigentlich würde er viel lieber Bert genannt werden, aber der Name Berti gehört zu ihm wie die Wampe, die ihm die Mama als Kind angefüttert hat, und mit siebenundvierzig wird sich das auch nicht mehr ändern.
Der Berti kämpft sich aus seinem Fernsehsessel und steigt in die Schlapfen. Für die Briefträgerin ist es noch zu früh, und die klopft normalerweise nur einmal, bevor sie die Post am Fensterbrett neben der Haustüre ablegt. Kann es sein, dass sie hier ist? Nein, er hat ihr gesagt, dass sie auf keinen Fall unangekündigt vorbeikommen soll, nicht einmal wenn die Mama weit genug weg ist. Die Nachbarn haben schließlich überall ihre Augen und Ohren. Es hätte ihm gerade noch gefehlt, dass die Leute im Dorf über ihn tratschen. Das Geschäft mit den Marillen läuft in den letzten zwei Jahren sowieso schlecht. Frost, Hagel, Billigimporteure aus Spanien, die den Handel überschwemmen, da kann er sich nicht auch noch einen schlechten Ruf leisten. Das würde die Mama ins Grab bringen.
Wieder klopft es.
»Ich komm ja schon!«, brüllt der Berti und ärgert sich, dass er wegen seiner Rückenschmerzen noch nicht beim Arzt war. Mit einem Ziehen in der Lendenwirbelgegend schleppt er sich zur Haustüre und reißt sie auf. Niemand ist zu sehen.
»Hallo?«, fragt der Berti und beugt sich hinaus. Kein Auto vor dem Hof, keine Person, die sich vom Haus entfernt.
Der Wind pfeift über das Dach und treibt den Geruch der Donau herüber. Der Himmel ist wolkenverhangen, und im Nordosten zucken Blitze. Sonst ist alles ruhig. Sogar der Bello hat zu kläffen aufgehört und streift träge am Zaun entlang. Offensichtlich hat er sich noch nicht an den Umstand gewöhnt, dass die beiden Grundstücke durch Maschendraht voneinander getrennt sind. Wenn der Berti ehrlich zu sich selber ist, muss er zugeben, dass er sich ebenfalls noch nicht damit arrangieren kann.
»Pst, pst, pst«, zischt er in Bellos Richtung. Der Hund hebt kurz seinen Kopf, schaut ihn an und trabt zurück zu seiner Hütte.
Wie kann es sein, dass gerade noch einer aufgeregt angeklopft hat und jetzt auf einmal verschwunden ist?
»Die depperten Hausierer«, schimpft der Berti in seinen Bart, der, seit die Mama weg ist, endlich so wachsen darf, wie er will.
Das Erste, was dem Berti auffällt, ist der süßliche Geruch, der ihm in die Nase steigt und ein reflexartiges Knurren in seinem Magen auslöst. Sein Blick driftet nach unten. Er lacht schallend. Da hat ihm tatsächlich jemand einen Marillenknödel gebracht. Berti bückt sich und legt den Zeigefinger darauf. Er ist noch heiß, und es ist viel Staubzucker drauf, so wie er es am liebsten hat.
Der Berti schleckt den Finger ab und schaut sich noch einmal um. Hat die Maria ihm den Knödel vor die Türe gestellt, als Friedensangebot für die Streitigkeiten der letzten Monate? Sie und der Rudi haben sich ganz schön aufgeführt bei der Grenzverhandlung im Juni. Seither hat ihn der Rudi nicht einmal mehr gegrüßt, und die Maria hat kaum zwei Worte mit ihm gewechselt. Aber wenn es die Maria war, muss sie heute ganz schön schnell unterwegs sein mit ihrem maroden Knie, das ihr seit Jahren Probleme macht. Oder er ist selber so langsam, durchfährt es ihn. Er sollte dringend zum Orthopäden gehen und was gegen die Rückenprobleme machen, bevor er sich mit der Mama den Rollator teilen muss.
Der Berti lauscht. Ihm ist, als hörte er ein leises Husten. Da, schon wieder. Ein Röcheln, das nicht menschlich klingt. Aber nein, draußen ist niemand. Wahrscheinlich raucht der Rudi wieder heimlich eine seiner Zigarren im Schuppen, die hat er noch nie vertragen, doch was kümmert ihn das. Es gibt Wichtigeres, diesen flaumigen, großen Marillenknödel zum Beispiel. Er ist nicht so perfekt rund wie die von der Mama, aber nach zwei Tagen Packerlsuppe und Dosengulasch tut das seiner Freude keinen Abbruch.
Kurz denkt der Berti darüber nach, ob er vielleicht eine Verehrerin im Dorf hat, und zieht den Bauch ein, für den Fall, dass sie ihn beobachtet. Ja, warum sollte er keine Verehrerin haben? Er ist zwar kein Adonis, mit seinen Marillengärten und dem BMW Cabrio, das er sich von seinem Ersparten geleistet hat, aber auch keine schlechte Partie. So richtig gefallen hat dem Berti allerdings nie eine Frau im Dorf. Sein Geschmack ist spezieller. Dieser spezielle Geschmack trifft jedoch nicht auf sein Essen zu. Da nimmt er, was er kriegt, und ist nicht wählerisch, schon gar nicht bei Mehlspeisen. Deshalb bückt er sich und hebt den Teller auf. Während er die Türe mit dem Fuß zustößt, drückt er die Zunge auf den Knödel und leckt am Zucker-Zimt-Gemisch. Die Mama würde nie so viel Zucker auf die Marillenknödel streuen. Seit die Maria mit dieser Ernährungsberaterin angekommen ist, ist er froh, wenn er überhaupt noch was Gescheites zu essen bekommt. Vorbei sind die Zeiten, in denen es am Sonntag Schweinsbraten und Sachertorte gab. Heute kocht die Mama Spargel mit Magerschinken und im besten Fall Krautfleckerl, wenn auch nach Weight-Watchers-Rezepten. Ständig muss der Berti heimlich auswärts essen, aber daheim kann er ja sowieso nichts machen, was ihm Freude bereitet. Jetzt nicht einmal mehr ordentlich essen. Während seiner Geschäftsreisen nach Wien gönnt er sich dann alles, was er in sich reinkriegt. Da gönnt er sich dann auch noch vieles andere, aber davon bleibt zum Glück nichts auf den Hüften hängen.
Berti stellt den Teller auf dem Küchentisch ab und durchsucht die Schubladen nach einer Gabel. Er findet keine saubere. Er sollte das dreckige Besteck, das im Spülbecken gammelt, abwaschen, aber er ist kein Mann für Hausarbeiten. Immerhin hat er bei den Kuraufenthalten der Mama gelernt, dass ein Ei explodiert, wenn man es zum Kochen in die Mikrowelle legt, und dass man Geschirrspülmittel nicht in den Geschirrspüler schütten sollte, weil es nach einer halben Stunde schäumend herausquillt.
Der Berti schaut zum Knödel, und ihm ist, als würde der Knödel zurückschauen. Dann schiebt er die leere Bestecklade zu und setzt sich an den Tisch. Er braucht ja nicht unbedingt Besteck zum Essen. Als er noch ein Kind war, hat die Mama die Knödel aus dem siedenden Wasser gefischt und ihm immer einen zum Abbeißen in die Hand gedrückt.
Wie schön und warm der Knödel in der Hand liegt, freut sich der Berti, drückt erneut die Zunge darauf und leckt die Brösel ab. Dann beißt er hinein und schlingt ihn mit zwei Bissen hinunter.
Irgendwas daran schmeckt komisch, aber zum Nachdenken bleibt dem Berti keine Zeit mehr.
1. Schritt
Ich stehe in der provisorischen Küche und sprühe vor Vorfreude. Das Rezept ist von meiner Großmutter und gelingt todsicher, habe ich mir sagen lassen. Das ist gut so, denn diese Marillenknödel müssen perfekt werden.
Ich ziehe die kurzen Vorhänge des Lichtschachtes zu und drehe das Radio auf. Der »Donauwalzer« hallt gerade so laut durch den Raum, dass ihn niemand außer mir hören kann.
Überschwänglich krame ich die Waage aus meinem Rucksack und wiege sorgfältig alle Zutaten ab.
Ein Topfenteig soll es werden, fluffig, weich und vor allem unwiderstehlich. Ich schlage die Butter zuerst händisch schaumig und rühre danach die Eier ein. Die Latexhandschuhe sitzen eng an meinen wulstigen Fingern, machen die Handgriffe mühsam, aber sie sind ebenso wichtig wie das Haarnetz, der Mundschutz und die Abdeckfolie über der gesamten Arbeitsfläche.
Ich mische Grieß und Salz in die klebrige Masse und drehe mich zum Takt der Musik mit der Schüssel im Kreis.
Nach der Zugabe von Mehl und Topfen entsteht allmählich ein glatter Teig. Ich bin versucht, den Finger hineinzustecken und ihn abzuschlecken, aber natürlich tue ich es nicht.
Dann kommt der schönste Teil. Na ja, der zweitschönste vor dem Servieren, wenn ich ehrlich bin. Ich forme den Teig zu einer Rolle mit sieben Zentimetern Durchmesser und wickle ihn in Frischhaltefolie.
***
Die ganze Fahrt lang hat der Horvath das Handyläuten ignoriert. Er hat Wichtigeres zu tun und bereits zwei Minuten an der roten Ampel und vier Minuten bei der Parkplatzsuche verloren. Von seiner Wohnung aus hätte er auch zu Fuß herkommen können, wahrscheinlich wäre er ohne Auto sogar schneller, aber zu Spaziergängen lässt er sich nur in Ausnahmefällen hinreißen. Am liebsten dann, wenn sein Bewegungseifer danach mit einer ordentlichen Brettljause honoriert wird. Solange er in seine Lieblingshose passt und die Mimi huckepack die letzten Meter zur Ruine Aggstein hochtragen kann, sieht er keinen Grund, etwas an seinen ungesunden Gewohnheiten zu ändern.
Zügig rennt er durch das Steinertor Parkhaus in Richtung Stiegenhaus. Wieder klingelt sein Handy. Auf dem ersten Treppenabsatz bleibt er stehen und starrt auf das Display. Was kann so wichtig sein, so einen Telefonterror zu veranstalten?
»Wos is denn?«, raunzt er, wischt sich die Schweißperlen von der Stirn und schleppt sich die Stufen hoch.
Am anderen Ende der Leitung hört er nichts als ein Schluchzen. Die Maria ist nahe am Wasser gebaut, seit sie auf die Wechseljahre zugeht, und dauernd ist alles ein Riesendrama. Er fragt sich, wie der Rudi das aushält, aber sein Bruder war schon immer bequem. Er war zu bequem, aus dem Elternhaus auszuziehen, zu bequem für die Matura, und er ist auch zu bequem für die Scheidung. Lieber betrügt er die Maria, wann auch immer sich die Gelegenheit ergibt. Nicht dass der Horvath das gutheißen würde, ganz im Gegenteil. Er selber hat schon ein schlechtes Gewissen, wenn er der Kellnerin in seinem Stammcafé heimlich auf den Busen schaut, obwohl seine Mimi kein Problem damit hat. Er hat Glück mit der Mimi, denkt der Horvath. Vielleicht sollte er ihr wieder einmal Blumen mitbringen oder sie in dieses schöne Restaurant in der Unteren Landstraße einladen, von dem sie beim Vorbeigehen immer so schwärmt. Dumm nur, dass es beim Horvath gerade für einen Einkauf beim Hofer reicht, solange er keinen neuen Job hat.
»Der Rudi … Er ist …«
Der Empfang im Stiegenhaus ist schlecht. Es kracht und knistert in der Leitung, und der Horvath versteht nur Bruchstücke von dem, was seine Schwägerin ins Telefon weint. Jetzt kommt sie ihm schon wieder mit ihren Eheproblemen. Als ob er nicht schon genug mit sich selber zu tun hätte.
Der Horvath wirft einen Blick auf seine Uhr. Nur noch fünf Minuten bis zum Termin am Arbeitsamt. Wie soll er sich jetzt eine Ausrede für die letzten versäumten Gespräche ausdenken, wenn er sich mit der Maria herumschlagen muss?
»Maria, ich bin in der Redaktion und hab gleich einen wichtigen –«
»Aber … Rudi … tot.«
»Der Rudi ist tot?«, fragt Horvath und merkt selber, wie teilnahmslos er sich anhört, aber er handelt sich Probleme ein, wenn er diesen Termin versäumt, und der Rudi ist in einer halben Stunde schließlich auch noch tot. Außerdem wundert es keinen, bei dem Lebenswandel, den sein Bruder geführt hat. Die Zigaretten, die Fast-Food-Eskapaden und die ständige Aufregung beim Fußballschauen hätten ihn schon mit Mitte zwanzig dahinraffen müssen. »Maria, ich muss jetzt dringend –«
»Im Gefängnis!«, brüllt die Maria. »Er ist nicht tot, er ist im Häfn! Eing’sperrt haben s’ ihn.«
Jetzt wird der Horvath neugierig. Eingesperrt ist spannender als tot, denn tot sind wir sowieso irgendwann alle. »Was hat er jetzt schon wieder g’macht?«
»Ja nix! Den Obstbauern Berti haben s’ vergiftet g’funden, und der Rudi soll ihn um’bracht haben!«
»Red keinen Schmafu. Der Rudi is doch viel zu faul für einen Mord, wenn du ihn net für ihn erledigst.«
»Horvath, des is kein Spaß. Des is purer Ernst. Dein Bruder sitzt in Stein in Untersuchungshaft!«
Der Horvath erinnert sich daran, wie sie als Kinder zusammen mit dem Berti »Tatort« gespielt haben. Zum Auslosen, wer welche Rolle bekam, haben sie Zündhölzer gezogen. Irgendwie schaffte es sein älterer Bruder jedes Mal, das längste zu ziehen, und war der Polizist, während der Berti mit dem zweitlängsten meistens der Verbrecher und er so gut wie immer das Opfer war. So ändern sich die Zeiten, denkt er.
Der Horvath schaut wieder auf die Uhr. Noch zwei Minuten bis zum Termin. Er ist schon im Foyer vom AMS, als er beschließt, umzudrehen und zurück ins Parkhaus zu gehen. Er wird ins Auto steigen, zur Maria fahren und sich danach überlegen, welche Ausrede er der Frau am Arbeitsamt auftischt. Wobei er mit einem Bruder, der den Nachbarn umgebracht hat, vielleicht nicht einmal eine Ausrede braucht.
»Entschuldig dich bei der Frau am Arbeitsamt, dann wird’s sicher nicht so schlimm.«
Keine zwei Minuten sitzt die Mimi neben ihm im Auto, und die Leier geht schon los. Horvath weiß, dass sie recht hat, aber das muss er ihr nicht auf die Nase binden. Sie hat ja sowieso ständig recht. Dass sie ihre Überlegenheit so gut wie nie heraushängen lässt, wurmt ihn, und wenn sie ihre Überlegenheit heraushängen lässt, wurmt es ihn auch.
»Einen Scheiß werd ich. Die ganzen Termine sind sowieso für den Hugo. Beim letzten Mal wollt sie mir eine Arbeit auf dem Geflügelhof vermitteln.« Horvath überholt einen Traktor und wirft der Mimi einen vorwurfsvollen Blick zu, nachdem er sich wieder rechts eingereiht hat. »Auf einem Geflügelhof«, wiederholt er mit Nachdruck.
»Du isst eh so gerne Brathenderl.«
Ja, so ist seine Mimi. In jeder Situation sieht sie etwas Positives. Dabei wäre es dem Horvath oft lieber, einen Grantscherm daheim zu haben, so wie der Rudi. Eine, neben der man einen halben Tag lang so richtig grundlos angefressen sein kann, ganz ohne schlechtes Gewissen. Aber die Mimi hört sich immer an wie eine Sektenführerin, die ihn rekrutieren will. Nicht einmal richtig schimpfen kann sie mit ihm. Alles, was die Mimi sagt, sagt sie achtsam. Und alles, was sie tut, muss vorher den Karma-Check bestehen.
»Ja, aber deshalb will ich ihnen nicht den Hals umdrehen müssen. Wenn ich ein Grillhendl will, möcht ich wie jeder normale Mensch zum Grillhendlstand im Gewerbepark fahren und mir eines einpacken lassen.«
»Sei nicht bös mit mir, Hase.«
»Ich bin nicht …« Horvath lässt den Rest des Satzes unausgesprochen. Er muss seine Energie für das Gespräch mit der Maria aufheben. Aber eine Sache gibt es doch noch, die er mit der Mimi klären muss, bevor sie im Dorf ankommen. »Du, Hasi, die Maria weiß nicht, dass ich nicht mehr bei der DonauWelt arbeite, und das soll auch so bleiben.«
Der Horvath begibt sich auf dünnes Eis. Wenn man eine Freundin hat, die nach jeder kleinen Lüge zwei Stunden mit Obertongesang und Räucherwerk durch die Wohnung tanzt, überlegt man sich genau, ob es das wert ist.
»Hase, das find ich gar nicht super. Die Maria auch noch anlügen, ausgerechnet jetzt, wo ihr Mann ein Mörder geworden ist.«
»Des wissma doch noch gar net. Alles, was wir wissen, ist, dass der Obstbauer tot ist und der Rudi in Untersuchungshaft sitzt.«
Der Horvath manövriert das Auto durch die enge Einfahrt vor Rudis Haus. Mord hin oder her. Lieber würde er jetzt im Piano sitzen und ein Bier trinken. Nach dem Regen der letzten Tage ist es endlich wieder sonnig, da würde sich auch ein Heurigenbesuch beim Schütz oder beim Pöchlinger anbieten, bevor alles von Urlaubern überrannt wird.
Er parkt seinen Chevy hinter Rudis Traktor und reißt die Handbremse so fest an, dass die Mimi zusammenzuckt.
»Darf ich bitte ausnahmsweis die Frau von meinem Bruder anlügen, um nicht als kompletter Trottel dazustehen?«
»Aber nur weil man arbeitslos ist, ist man nicht sofort ein Trottel, Hase.«
»Nicht sofort. Aber die Maria wird in zehn Minuten einen aus mir machen, da kannst du dir sicher sein.«
»Karma, Hase. Karma. Denk halt nicht so bös über sie, dann …«
»Dann denkt sie auch nicht bös über mich«, beendet der Horvath den Satz.
Für diese Erkenntnis hat er beim Achtsamkeitstraining mit Mimis Guru seine letzten dreihundertfünfzig Euro ausgegeben. Aber er kann ihr halt keinen Wunsch abschlagen, wenn sie ihn so anschaut mit ihren runden Augen und sich dabei die roten Stirnfransen aus der Stirn wischt. Trotzdem fällt es ihm schwer, aus dem Auto zu steigen. Bei seinem letzten Besuch bei der Maria und dem Rudi musste er sich zwei Stunden lang Gejammer über kaputte Haushaltsgeräte, gebrochene Achsen bei Traktoren und Rebmilben anhören. Das wäre nur halb so schlimm, wenn bei den beiden nicht jeder Satz wie ein Vorwurf in seine Richtung klingen würde. Dazu kommt der Hund, der Bello. Er ist ein Phänomen, wenn es darum geht, seine Notdurft zu kontrollieren. Der Horvath ist nur zweimal im Jahr in seinem alten Elternhaus, aber bei jedem Besuch platziert der kleine Wadenbeißer seinen Haufen genau vor der Fahrertüre seines Chevys, und natürlich steigt der Horvath jedes Mal rein.
»Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich bin doch der Letzte, den die Maria in so einer Situation sehen will. Und ich will sie, ehrlich gesagt, auch nicht sehen.«
»Komm, Hase«, sagt die Mimi. »Wir hören uns die Geschichte über den Mord an, und wenn wir daheim sind, gibt’s einen Matcha Latte und eine Fellatio, wennst magst.«
***
Die Maria schaut so schlecht aus, dass sie dem Horvath fast leidtut. Ihre Haare liegen wie zu lang gekochte Spaghetti auf den Schultern, und dunkle Krater rändern ihre müden Augen. Das dunkelbraune Kleid schlackert an ihrem Körper wie ein Tuch, das vom Wind herumgewirbelt und zufällig an ihr hängen geblieben ist. Sie steht da, zwinkert gegen die Sonne und sagt seit einer Minute nichts, was für ihre Verhältnisse sehr lange ist.
Von der Straße dröhnt unaufhörlich Motorenbrummen in den Hof. Marillentouristen von überallher haben es eilig, die ersten Früchte zu ergattern. Dem Horvath, der Obst nur hochprozentig schätzt, ist dieses Trara ein Rätsel. Als junger Bub hat er sich jedes Mal Hochwasser gewünscht, wenn die Marillenblüte anfing. Eine richtig schöne Jahrhundertflut, die die Deutschen, die Holländer und die Wiener wegschwemmt. Gesagt hat er das nie jemandem, aber Naturkatastrophen ziehen ihn auf eine morbide Weise an, seit er denken kann.
»Noch mal langsam und noch mal von vorne«, weist der Horvath die Maria an und blüht seltsam auf in dieser Situation. Sonst ist er in diesem Haus immer der Bruder, der nichts geschafft hat. Keinen ordentlichen Job, stattdessen eine kaputte Ehe, eine Singlewohnung, die er sich nicht mit der Mimi teilen will, weil er zu feige für eine feste Bindung ist, und haufenweise Schulden bei der Bank. Nicht zu vergessen seine gescheiterte Karriere als Krimiautor.
Maria nimmt das Häferl mit Kaffee, das die Mimi ihr in die Hand drückt. Sie trinkt einen Schluck und lässt sich in den Gartensessel neben dem Horvath fallen, sodass die dunkle Brühe herausschwappt. Dass es der Maria schlecht geht, bemerkt der Horvath vor allem daran, dass sie nicht sofort aufspringt, um einen Putzfetzen zu holen.
»Die Briefträgerin hat beim Obstbauern geklopft, weil sie einen eingeschriebenen Brief zustellen wollt. Der Obstbauer hat nicht aufgemacht, da hat die Briefträgerin durchs Fenster geschaut und ihn am Küchenboden liegen sehen. Dann hat sie die Rettung gerufen und die Scheibe eingeschlagen. Nach der Polizei ist dann die Kriminalpolizei gekommen, und am Abend haben s’ den Rudi geholt. Der Obstbauer is vergiftet worden, in unserem Dorf, des muss man sich einmal vorstellen. Unser ganzes Haus haben s’ abgesucht. Im Keller haben s’ Strychnin g’funden, aber des war doch für die Ratten, nicht für den Obstbauern. Meine Lebensmittel haben s’ auch mitgenommen, und erst gestern Abend hab ich wieder ins Haus dürfen. Und dann is auch noch der Bello verschwunden.«
»Und warum hast dich nicht schon früher gemeldet?«
»Ich hab geglaubt, dass sie den Rudi spätestens am nächsten Tag wieder freilassen. Außerdem weiß ich ja, dass du und der Rudi nicht so gut miteinander seid.«
Da hat die Maria ausnahmsweise einmal untertrieben. Trotzdem ärgert es ihn, dass das ganze Dorf vor ihm Bescheid gewusst hat.
»Ich hab mich eh gewundert, dass du dich nicht gemeldet hast, nachdem die Schlagzeile vom Berti auf der Internetseite der DonauWelt erschienen ist«, fügt die Maria hinzu, um ihm doch noch die Schuld aufzuladen.
»Wir lesen keine Nachrichten. Diese ganzen negativen Schlagzeilen sind Gift für die Seele«, erklärt die Mimi.
»Genau. Nach jeder ZIB-Sendung müssen wir zur Selbstreinigung bei Mondschein ›Looking for Freedom‹ singen und dabei in Einhornblut baden. Aber zurück zur Sache. Meinst, dass der Rudi unschuldig ist? Er und der Obstbauer haben sich seit Jahren gehasst. Bei jedem Feuerwehrfest haben sie sich eine in den Goschn g’haut, als sie noch jünger waren. Und ständig habts euch gegenseitig wegen irgendwas angezeigt.«
»Also, ich war in letzter Zeit gut mit dem Berti. Und der Rudi … Geh, der bringt doch keinen um wegen ein paar Streitigkeiten. Und schon gar nicht würd er dem Obstbauern vorher noch einen Marillenknödel kochen. Das passt nicht zum Rudi. Er hätt im Obstgarten mit dem Traktor über ihn drüberfahren können, das wär viel bequemer g’wesen und säh dem Rudi viel ähnlicher.«
»Ich hoffe, des hast der Polizei auch g’sagt.« Der Horvath verdreht die Augen, und die Maria nickt.
»Aber sicher hab ich das der Polizei g’sagt.«
»Ja, dürfen die den Rudi einfach so wegsperren? Hase, was sagst du dazu?« Die Mimi rennt aufgebracht über die Terrasse. Die plötzliche Eingebung ist in ihrem Gesicht abzulesen. Die hochgezogenen Augenbrauen und die rot gefärbten Wangen deuten darauf hin, dass sie etwas austüftelt. Der Horvath kennt die Mimi noch nicht sehr lange, aber lange genug, um zu wissen, dass sie ihn in wenigen Sekunden mit einer Idee überrumpeln wird. Und er hat recht.
»Hase, du musst dem Rudi helfen.«
»Wie soll ich denn bitte dem Rudi helfen?«
Die Mimi lässt sich auf Horvaths Schoß fallen, dass ihm die Oberschenkel brennen. Langsam merkt er, dass er zu alt für sie und ihre ungestüme Art ist. Wenigstens wird er im besten Fall irgendwann beim Sex den Löffel abgeben und nicht beim Marillenknödelessen.
»Du kennst dich aus mit Kriminalfällen. Du bist Journalist. Und jetzt, wo du arbeitslos bist, hast du Zeit dafür, selber zu ermitteln.«
»Du bist arbeitslos, Horvath?«
Der Horvath stöhnt. »Was die Mimi meint, ist, dass ich grad wenig zu tun hab in der Redaktion.«
»Wollen die Leute keine Anzeigen mehr schalten?«
Auf diesen Seitenhieb hat der Horvath gewartet, denn Journalist ist er schon lange keiner mehr. Er ist – nein, er war für den Anzeigenteil in der DonauWelt zuständig, bis er den miesen Job für sein nicht weniger mieses zweites Manuskript hingeschmissen hat.
In Marias Blick liegt nicht die Feindseligkeit, die der Horvath von ihr kennt. »Der Rudi hat den Berti nicht umgebracht«, sagt sie und macht nach jedem Wort eine Pause. »Das hätt er seiner Mutter niemals angetan. Horvath, du weißt, wie sehr er die Margarete schätzt. Die war immer wie eine Mutter für euch.«
Der Horvath reibt sich mit der Hand über das Kinn, wie immer, wenn er nachdenkt. Er kann sich auch nicht vorstellen, dass sein Bruder den Nachbarn umgebracht haben soll. Aber wer kann schon reinschauen in die anderen? Die größten Verbrecher sind immer die, von denen man es am wenigsten erwartet.
»Da war diese Frau, die sich manchmal nachts reingeschlichen hat zum Obstbauern. Der Rudi hat gemeint, dass das seine Geliebte ist. Einmal, da hat man die zwei in flagranti im Weingarten erwischt, heißt es. Oft hat sie Netzstrümpfe angehabt, wenn sie zu ihm gekommen ist. Eine ganz zwielichtige Gestalt, wennst mich fragst. Vielleicht sogar eine Gewerbliche, so wie die ausg’schaut hat.«
»Hast du das auch der Polizei erzählt?«
»Ja, aber das wollten die gar nicht hören. Die wollten den Rudi wegsperren, damit s’ sagen können, sie haben den Täter.«
Maria bricht in Tränen aus, und die Mimi sitzt augenblicklich nicht mehr auf Horvaths Schoß, sondern auf ihrem.
»Mah, du Arme. Hase, du musst was tun für deinen Bruder und die Maria, bei der Erfahrung, die du mit solchen Fällen hast.«
»Von welchen Erfahrungen redest du? Meinst du, ich soll für den Mörder vom Obstbauern eine Anzeige schalten und ihn bitten, sich bei mir zu melden?«
»Hase, jetzt mach dich nicht kleiner, als du bist. Ich red von deiner Erfahrung als Ermittler.«
»Kommissar Krüger ist eine Figur aus meinem Buch. Ein Protagonist, nicht mehr.« Ein Buch, das gefloppt ist, will der Horvath noch hinzufügen, aber er verkneift es sich.
»Du hast so viele Bücher verkauft, und sogar in der Zeitung haben s’ g’schrieben, wie super du recherchiert hast. Wenn einer Ahnung hat, dann du.«
Ihn aufbauen, das kann die Mimi gut. Das ist die Entschädigung für zehn Ehejahre mit einer Frau, deren größte Leidenschaft es war, ihn so richtig ausgiebig zur Sau zu machen. Das stimmt nicht ganz, denn mindestens genauso gerne hat sie Böden gewischt. »Bei uns kannst vom Boden essen«, hat sie immer gesagt. Dass die Mimi ganz anders ist, erkannte er spätestens beim ersten Besuch in ihrer Wohnung. Bei ihr konnte man auch vom Boden essen, und man wäre davon eine ganze Woche lang satt geworden.
»Du hast eh Zeit, Horvath. Du könntest dich ein bisserl umhören im Dorf. Vielleicht findest du irgendwas heraus.«
Dass die Maria ihm so etwas zutraut, wundert den Horvath. Ausgerechnet sie, die sein Buch auf Amazon komplett verrissen hat. »Eine unausgegorene, an den Haaren herbeigezogene Geschichte, deren chauvinistischer Hauptprotagonist jedes grausliche Klischee bedient«, hat sie geschrieben.
»Ich kann nicht zum toten Obstbauern spazieren, in seinen privaten Sachen schnüffeln und seine Bekannten auskundschaften.«
Der Horvath spricht die letzten Worte zwar aus, aber tief in ihm lodert ein Feuer. Es gibt einen verschwundenen Hund, einen toten Nachbarn und einen Bruder, der ihn ermordet haben soll. Wer ist diese Frau, die den Obstbauern besucht hat? Und wer hätte, abgesehen von seinem Bruder, die Gelegenheit gehabt und ein Motiv, ihn umzubringen? In dieser Gegend würde es auffallen, wenn ein Fremder daherkommt und dem Obstbauern am helllichten Tag einen vergifteten Marillenknödel serviert wie die böse Stiefmutter dem Schneewittchen. Es muss einer vom Dorf gewesen sein. Irgendwer, der nicht zu befürchten hatte, gesehen zu werden, weil er in die Wachau gehört wie die Weintrauben und die Marillen. Auf jeden Fall sollte der Horvath sich die ganze Sache einmal genauer anschauen, davon hat schließlich keiner einen Schaden.
***
Margarete wischt sich die Hände an der Kittelschürze ab und bittet den Horvath ins Haus. Schon lange war er nicht mehr hier. Früher als Kinder haben der Rudi und er gerne beim Berti und seiner Mutter Zeit verbracht, wenn die eigene Mutter zu sehr mit Männergeschichten beschäftigt war. Seit damals hat sich im Haus nicht viel verändert. Die Fichtenholzküche, die Häkelvorhänge, der Küchentisch, in den der Horvath beim Würfelpoker mit dem Feuerzeug seine Initialen geritzt hat – alles ist so wie damals. Nur eine Sache hat sich geändert. Den Berti gibt es jetzt nicht mehr.
Der Horvath schaut hinaus auf den Obstgarten. Die Äste der Marillenbäume stemmen sich gegen das Gewicht der Früchte. Es ist ein Meer aus Dunkelgrün und Orange. Da sollen die Obstbauern noch einmal behaupten, die Ernte sei nicht ertragreich, denkt er. Dahinter ein Feld aus kahlem Gehölz, das aussieht, als hätte es seinen Dienstbeginn verschlafen. Die Marillenblüte, die jedes Jahr scharenweise Menschen in die Wachau treibt, für vollgestopfte Straßen und überfüllte Heurigenlokale sorgt. Die ersten Fruchtansätze, die auf Instagram gepostet werden, und schließlich die ersten reifen Marillen, die allen Widrigkeiten zum Trotz in der Sonne leuchten und darauf warten, geerntet zu werden.
»Mah, Horvath. Schön, dass du gekommen bist. Gut schaust aus«, begrüßt ihn die Margarete, während er noch darüber nachdenkt, wem dieser armselige Obstgarten gehört.
Etwas widerwillig lässt er sich von der Margarete einen Kuss auf die Wange drücken, dann mustert er sie. Die Zeichen der Trauer sind deutlich schwächer, als er befürchtet hat. Das ist gut so, denn mit der Traurigkeit anderer Menschen kann er nur schlecht umgehen.
Eine Strähne ihres Haares lugt unter dem Kopftuch hervor. Im staubigen Licht der Küche lässt sich nicht erkennen, welche Farbe es aktuell hat.
Margarete ist eine Frau, an der die letzten beiden Jahrzehnte spurlos vorübergegangen sind, was daran liegt, dass sie in seiner Erinnerung nie wirklich jung war. Mit Blümchenschürzen und Händen, die wie rostige Schaufeln aus den Ärmeln ragen und mit denen sie so schnell Erdäpfel schält wie keine andere, war sie für ihn seit jeher der Inbegriff von Mütterlichkeit. Sie hat das Muttersein wie ein Abzeichen getragen. Und jetzt?, fragt sich der Horvath stumm. Wie viel Mutter bleibt übrig, wenn es den einzigen Sohn nicht mehr gibt?
Unbehaglich steigt er von einem Fuß auf den anderen. Er weiß nicht so recht, wie er mit so einer Situation umgehen soll. Kommissar Krüger hingegen weiß es ganz genau. Er ist der Hauptprotagonist in Horvaths Kopf, der ihm vieles voraushat. Er ist gerissen, scharfsinnig und – wenn es darauf ankommt – ganz schön durchtrieben.
»Margarete, es tut mir so leid, was dem Berti passiert ist«, sagt er und senkt den Blick. »Ich hab net g’wusst, ob ich vorbeikommen soll, wo der Rudi …«
»Aber geh, Horvath. Hör auf. Der Rudi ist der Letzte, der den Berti um’bracht hätt. Wen hätt er denn dann noch zum Streiten g’habt?«
Der Horvath hat mit vielem gerechnet. Damit, dass sie bei seinem Anblick in Tränen ausbricht, dass sie ihn rauswirft, aber nicht mit dieser Reaktion.
Kommissar Krüger wird hellhörig. Nicht einmal die Mutter des Ermordeten glaubt, dass der Rudi zu so einer Tat fähig ist. Der Horvath zieht die Augenbrauen hoch, vergräbt die Hände in den Hosentaschen und läuft durch die Küche, genau so, wie der Kommissar es auch macht. Krüger ist mehr als ein Protagonist. Er ist sein Mentor, sein Lehrmeister, sein Vorbild. Als er ihn vor drei Jahren erschaffen hat, wusste der Horvath, dass diese Verbindung eine ganz besondere sein würde.
»Da hat er gelegen, mein Berti«, sagt die Margarete und deutet mit dem Finger auf den Boden vor dem Küchentisch.
Horvath meint, ein paar Ränder und Flecken zu erkennen, bückt sich und fährt mit dem Handrücken darüber.
»So ein grausiger Mensch, dieser Mörder. Meinem Berti, der nie wem was getan hat, einen Teller mit einem vergifteten Knödel vor die Türe zu stellen. Wie ein Rattenköder …«
Horvath steht auf. »Woher weiß man, dass der Teller vor der Türe gestanden ist?«
»Die Kriminalpolizei hat einen Abdruck am Pflaster g’sehn, und Brösel sind dort auch gelegen.«
»Wieso isst der Berti was, was man ihm vor die Türe gestellt hat?«, spricht der Horvath laut aus, was er denkt.
»Der Berti war halt schon immer ein guter Esser. Hast auch Hunger?« Margarete deutet auf einen Topf mit kochendem Wasser, der auf dem Herd steht. Bitte lass es keine Marillenknödel sein, denkt er.
»Ich mach grad Grammelknödel. Jetzt, wo der Berti nicht mehr da ist, muss ich nimma so auf des Cholesterin aufpassen beim Kochen.«
Endlich keine Diätkost mehr kochen zu müssen. Das erscheint dem Horvath durchaus wie ein Mordmotiv. Er hat nicht nur einmal selber über Mord nachgedacht, wenn die Mimi mit einer neuen Tofusorte dahergekommen ist oder ihm erklärt hat, dass Erbsenprotein genauso schmeckt wie Faschiertes. Blödsinn, sagt Kommissar Krüger. Find lieber heraus, wer die Frau ist, die den Berti besucht hat.
»Hat der Berti in den letzten Tagen Besuch gehabt?«
»Das kann ich mir nicht vorstellen. Es war grad so viel zu tun im Obstgarten. Ich war ja in Bad Deutsch-Altenburg auf Kur, deshalb war der Bub auf sich allein gestellt.« Die Margarete legt die Hände wie beim Gebet aufeinander. »Ich hab schon beim Fortfahren so ein komisches Gefühl gehabt. Wär ich nur daheim geblieben …«
»Der Berti ist … war ein erwachsener Mann. Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen.«
»Er war aber auch ein Potscherl. Bei meiner letzten Reha hat er sich den Haxn verstaucht.« Die Margarete schnauft und schüttelt den Kopf. »Immer muss irgendwas sein.«
»Hat dich die Polizei nach Hause g’holt?«
»Wo denkst denn hin? Ich bin eine g’standene Frau. Als ich den Anruf bekommen hab, hab ich alles stehen und liegen lassen, mich ins Auto g’setzt und bin sofort heimgefahren.«
»Respekt«, würdigt der Horvath Margaretes Entschlossenheit. »Ich hab net g’wusst, dass du noch selber mobil bist.«
Die Margarete sieht gleichermaßen beleidigt wie triumphierend aus. »Unterschätz nie ein altes Weib, Horvath.«
»Apropos«, leitet er zu einer wichtigen Sache über. »Von der Maria weiß ich, dass es wegen dem geplanten Zubau im letzten Jahr immer wieder Probleme zwischen dem Rudi und dem Berti gegeben hat. Wieso bist du so felsenfest davon überzeugt, dass der Rudi ihn nicht doch …?« Der Horvath schafft es nicht, den Rest des Satzes auszusprechen. Jetzt, wo er so dasteht in Margaretes Haus und der Berti nicht in seiner gewohnten Ecke am Küchentisch sitzt, wird ihm bewusst, dass seine Ermordung real ist, dass die Ereignisse nicht nur Tratschereien sind, die man im Dorf herumerzählt. Untermauert wird diese Erkenntnis von den Schlagzeilen, die im Minutentakt auf Horvaths Handy aufploppen, seit er wider Mimis Empfehlung den Google-Newsfeed aktiviert hat.
Wachauer Obstbauer vergiftet in seinem Haus gefunden
Nach Giftanschlag: Nachbar in Untersuchungshaft
Mordfall in der Wachau – die Polizei ermittelt auf Hochtouren
Hinterlistiger Anschlag auf 47-jährigen Obstbauern
Nächster Mordalarm in Niederösterreich: Nachbar steht im Verdacht, seinen Rivalen mit Rattengift ermordet zu haben
Jetzt meldet sich die Briefträgerin zu Wort: »Den Anblick des toten Mannes werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen!«
Tödlicher Marillenknödel – alles, was wir über den Wachauer Nachbarschaftsmord wissen
»Du und der Rudi, ihr seids quasi bei mir aufg’wachsen. Er ist ein Schlitzohr, aber doch kein Mörder. Geh, magst net du ermitteln, Horvath? Mir bricht des Herz, wenn ich mir vorstell, dass er eing’sperrt ist. Des hab ich auch der Polizei g’sagt, aber angeblich haben s’ Rattengift bei ihm und der Maria g’funden. Genau des Rattengift, mit dem mein Berti –«
»Da kannst dich drauf verlassen«, unterbricht der Horvath. Der alte Horvath ist nicht ernst genommen worden, aber mit Kommissar Krüger an seiner Seite ist er ein neuer Horvath. Es ist seine Gelegenheit, den Leuten zu zeigen, was in ihm steckt, wer der wahre Horvath ist.
»Darf ich mich ein bisserl umschauen im Zimmer vom Berti?«
»Aber sicher, Horvath. Du kennst dich ja aus bei uns.«
Das Erste, was dem Horvath in Bertis Zimmer auffällt, ist der Mief. Er drückt sich die Hand auf die Nase und reißt das Fenster auf. Das Zimmer sieht fast so aus wie früher. Dasselbe Bett, derselbe Fichtenholzkasten mit Spuren von abgerissenem Tixoband, mit dem der Berti damals Pamela-Anderson-Poster so befestigte, dass er sie vom Bett aus sehen konnte. Das Plüsch-Herzkissen von der Susi, Bertis erster Liebschaft, ist inzwischen zerrupft und prangt wie ein Relikt auf dem gemusterten Zweisitzsofa.
Zögerlich zieht der Horvath Schubladen auf und erwartet die Stimme seines alten Freundes hinter sich zu hören, gefolgt von einer Kopfnuss. Finger weg, du Wichser! Mein Zeug geht dich gar nix an. Nichts dergleichen passiert. Er kriecht unter Bertis Bett und greift zwischen die gestapelten Hosen und Leiberl im Kleiderkasten. Was soll ich finden, was die Kriminalpolizei nicht längst selber gefunden hat?, denkt er. Erinnere dich an das Brettl im Boden, das nicht fest ist, wo ihr als Buben früher Zigaretten und das ÖKM versteckt habt, mahnt Kommissar Krüger, als der Horvath das Zimmer verlassen will.