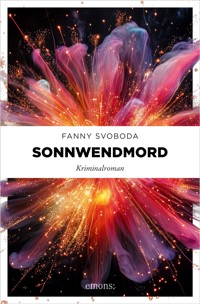
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Krimiautor Horvath ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine liebenswerte Krimikomödie mit Spannung und Schmäh. Der Kult geht weiter! Beim Sonnwenden in der Wachau wird die Leiche der Arzthelferin Christel Hulatsch im Feuer entdeckt. Krimiautor Horvath will der Sache auf den Grund gehen – nur ist das gar nicht so leicht, denn kaum jemandem war die Hulatsch lebendig lieber als tot. Gemeinsam mit seiner Freundin Mimi vertritt er die Tote undercover in Dr. Freilichs Praxis und katapultiert sich damit von einer Katastrophe in die nächste. Dem Mörder rückt er dabei stetig näher ... vielleicht ein bisschen zu nah.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fanny Svoboda ist das Pseudonym von Andrea A. Walter. Sie wurde 1980 in Melk geboren, lebte seitdem in Krems und in München. 2011 zog die ausgebildete Sozialpädagogin mit ihrer Familie zurück in die Wachau. Inspiriert von der Landschaft und den Menschen, schreibt sie schwarzhumorige, regional angesiedelte Kriminalromane und als Andrea A. Walter fesselnde Psychothriller.
https://www.diewalter.at
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2025 Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Julia Lorenzer
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-268-0
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Prolog
Christel Hulatsch ist nicht blöd. Sie weiß, dass man sie hinter ihrem Rücken »die Lulatsch« nennt, was nicht besonders originell ist. Nicht dass die Leute über sie tratschen, stört sie. Es stört sie, dass die Leute wissen, dass sie es mitbekommt, und es trotzdem tun, denn Tratschereien gehören zum Dorfleben wie das Maikranzbinden und der Kirchenchor.
Bald wird sie es ihnen zeigen. Dann werden sie sich still und heimlich dafür schämen, wie sie zu ihr waren.
Die Christel atmet tief durch. Jetzt ja nicht aufregen, der Tag war schon unangenehm genug nach zwei unfreiwilligen Überstunden und dem Warten darauf, dass er sich endlich meldet.
Er. Seit Tagen kann sie an nichts anderes denken als an ihn. Er und das Leben, das sie miteinander planen, sind ein Lichtblick in diesem Alltag, der der Christel neuerdings regelrecht auf den Magen schlägt. Wenn da nur nicht sie wäre, dieses elende Luder, das ihr im schlimmsten Fall alles zerstört, worauf sie hingearbeitet hat.
Die Donau schimmert im Mondlicht, als wäre sie mit Blattgold überzogen, und der Radweg liegt in fast vollständiger Dunkelheit. Die Christel kramt ihr Handy aus dem Rucksack und schaltet die Taschenlampe ein, um den Weg auszuleuchten. Seit den Regengüssen der letzten Tage sind viele Nacktschnecken unterwegs, und sie will keinesfalls auf eine draufsteigen. Schon als Kind hatte sie panische Angst davor, versehentlich eine zu zertreten. Nur einmal ist es ihr tatsächlich passiert. Daraufhin brachte sie die glitschige, halb tote Masse ins Haus, legte sie auf den Küchentisch und begann, sie mit Nadel und Zwirn zusammenzunähen. Tot wäre sie ja sowieso bald gewesen, und auf diese Weise konnte die Christel wieder etwas dazulernen. Ihre Mutter fand das krank und grauslich, aber die war ein kaltherziges Weib. Wäre die Christel auf sie draufgestiegen, hätte sie bestimmt nicht versucht, sie wieder zusammenzunähen.
Die Christel lässt den Lichtstrahl hin- und herpendeln. Holzhaufen, die bald angezündet werden, säumen das Donauufer. Morgen um die Zeit werden sich Menschenmassen darum scharen, werden sich die Wachau entlangwälzen, sich betrinken und den Höhepunkt des Tages darin finden, auf den Himmel zu starren, wo ein Feuerwerk nach dem anderen abgeschossen wird.
All das wird ohne die Christel stattfinden. Sie wird ihren Katzen den Bauch kraulen und beruhigend auf sie einreden, während es draußen kracht und blitzt und sie dankbar dafür sein wird, keinem von den Einheimischen zu begegnen.
Mit Menschen hat die Christel es nicht so. Ihr sind die Katzen lieber oder die Auwälder um die Donau, wenn sie so dunkel daliegen wie jetzt gerade und sie sich sicher sein kann, keinem über den Weg zu rennen.
Die Christel zuckt zusammen. Was war das? Sie dreht sich um und richtet den Lichtstrahl zuerst auf den Weg und dann auf die Weiden, deren träge Äste wie überlange Greifarme bis zum Boden ragen. Da, schon wieder ein Knacken. Aber zum Glück ist keiner zu sehen. Es hätte ihr gerade noch gefehlt, wenn ein Patient sie beim abendlichen Spaziergang verfolgen würde. Sie ist schon genervt genug von denen, die kurz nach Ordinationsschluss daherkommen. Oder von denen, die eine halbe Stunde davor daherkommen. Oder von denen, die überhaupt in die Ordination kommen. Immer die gleiche Leier von denselben Leuten. Wobei die Netten schlimmer sind als die Unguten, denn an ihnen verpufft ihre Bissigkeit wie eine fehlgezündete Rakete.
Und immer ist sie diejenige, die sich von den Patienten blöd angehen lassen muss. Wäre sie Ärztin, wäre das anders. Ihr Chef muss sich schließlich nie anschnauzen lassen. Ihm bringen die Patienten ein Flascherl Veltliner und manchmal Mannerschnitten mit, und das bei seiner Wampe, von seinem Alkoholproblem ganz zu schweigen. Sie sitzt hinter Milchglas in ihrem stickigen Kammerl, rennt zwischen Telefon, schlechten Venen und Brunzbechern hin und her und muss es allen recht machen. Nach fünfzehn Jahren als Ordinationshelferin verbucht sie es als einen guten Tag, wenn ihr niemand vor die Füße speibt und sie die Hubschraubermamis mit ihrem ergoogelten Halbwissen über Impfungen in Ruhe lassen. Aber wehe, sie kann sich das Schreien einmal nicht verkneifen, dann kommen die Patienten mit ihren Ein-Stern-Bewertungen bei Google daher oder beschweren sich bei der Ärztekammer über sie. Diese Minute des Triumphs sei ihnen gegönnt. Auf dem längeren Ast sitzt sowieso die Christel, die aus ihrem Zweitjob im Labor gelegentlich virulentes Material entwendet. Am liebsten Noroviren, die sie wie unsichtbare Schätze hortet. Und sie scheut sich auch nicht, sie auf den E-Cards der größten Querulanten zu verteilen, um ihnen so richtig schönen Dünnpfiff zu bescheren.
Wieder ein Geräusch. Sie könnte schwören, Schritte zu hören. Ein leises Quietschen von Gummisohlen, dazu ein Schlurfen, als würden Hosenbeine aneinanderreiben.
»Hallo?«, fragt die Christel und dreht sich um. Ihre Lampe ist zu schwach, um jemanden einzufangen. Sie starrt in die Schwärze, lauscht kurz und setzt sich wieder in Bewegung. Sie läuft ein bisschen schneller als zuvor und ist froh, bald wieder daheim zu sein. Sie ist kein ängstlicher Mensch, aber seit dem Einbruch in ihr Haus trägt sie ein stetiges Unbehagen mit sich herum. In Zukunft sollte sie lieber dort spazieren gehen, wo Straßenlaternen stehen.
Sie vernimmt ein Hüsteln und fährt herum. Also doch. Jemand verfolgt sie, schält sich aus dem Schatten wie der Schauspieler einer »Aktenzeichen XY«-Episode. Das Gesicht ist unter der schwarzen Kapuze zunächst kaum auszumachen. Erst nach und nach setzen sich Lippen, Nase und Augen zu einem Ganzen zusammen.
»Was schleichst ’n so deppert hinter mir nach?«, empört sie sich, als sie erkennt, wer vor ihr steht. Sie will es ihrem Gegenüber so richtig reinsagen, aber dazu bleibt der Christel keine Zeit mehr.
1
Das Letzte, was der Horvath jetzt braucht, ist ein klingelndes Handy. Nach tagelanger Schreibblockade konnte er sich endlich dazu überwinden, sein Manuskript zu öffnen, und jetzt das. Ein penetranter Anrufer, der sich nicht abwimmeln lässt.
»Hallo.« Das Wort fühlt sich an wie die Niederlage gegen einen unbekannten Gegner.
»Servus, Horvath. Da spricht der Stöger Heinzi. Hast ein Minuterl für mich?«
Der Horvath schaut auf die Uhr. Was will der Bürgermeister um diese Zeit von ihm? Noch dazu an einem Freitag. Manchmal wünscht er sich zurück in seine alte Wohnung mit den dicken Mauern und den Funklöchern, auf die er sich ausreden konnte, wenn er keine Lust zu telefonieren hatte.
»Horvath«, sagt der Stöger, als der Horvath nichts erwidert. »Ich brauch deine Hilfe. Seit Beginn meiner Amtszeit hab ich einen Bahö nach dem anderen. Die Dauerbaustelle auf dem Dorfplatz, der Spanner, und seit gestern Abend ist auch noch die Eva Bergmann abgängig. Das alles, acht Tage bevor das Fernsehen zum Drehen kommt.«
»Langsam, Heinrich. Was ist mit der Eva, und von welchem Spanner redest du?«
»Wenn ich das wüsst, hätt ich dich nicht ang’rufen. Alles, was ich weiß, ist, dass ich den Arsch aufg’rissen krieg, wenn so ein Tumult bei uns herrscht. Stell dir vor, was die Leut dem Kamerateam erzählen, wenn schon wieder was passiert ist.«
»Was gibt’s denn zu filmen im Dorf?«, fragt der Horvath, um Zeit zu gewinnen. Er muss sich eine Ausrede ausdenken, falls ihn der Stöger in diese Sache verstricken will.
»Die Babsi hat mich für diese neue Realityshow angemeldet, in der ich gegen andere Bürgermeister um den Titel des beliebtesten Bürgermeisters von Österreich kämpf. Außerdem ist am Samstag der Spatenstich für die Gondel auf die andere Donauseite. Da werden sicher wieder ein paar Wichtige herumstehen und der Presse Dorfg’schichtln aufs Aug drücken. Dann ist unsere Gastronomie endgültig am End, und wir können uns die Touristen von hinten beim Vorbeifahren anschauen.«
»Wozu braucht’s eine Gondel, wenn’s Fähren und Brücken gibt?«
Der Stöger lacht verlegen. »Horvath, du magst gerissen sein, aber von guter Politik hast du keine Ahnung. Das ist fürs Image. Abg’frorene Marillenbäume, Felssturz und eine hiniche Mauterner Brücke. Die Leut sollen wieder was Positives mit ihrer Heimat verbinden und sehen, wofür sie ihre Steuern zahlen. Deshalb passen ein Spanner und eine Vermisste grad gar net auf meine Timeline.«
Der Horvath steht auf, durchquert sein Schreibzimmer und reibt sich den Bart. »Wer soll dieser Spanner sein? Da gibt’s doch sicher schon eine paar Gerüchte.«
Der Bürgermeister hüstelt nervös. »Von mir hast das nicht, aber man erzählt sich, dass sich der Benny in der Nacht herumtreibt und in die Fenster schaut.«
Der Horvath bleibt abrupt stehen und zwickt die Augen zusammen. »Der Benny? So ein Blödsinn.« Er denkt daran, wie kindlich und schreckhaft der beim monatlichen Waldbaden mit der Mimi ist.
»Wenn ich’s dir sag, Horvath. Der spechtelt durch die Fenster von Frauen, sicher auch bei der Eva. Wer weiß, auf welche Ideen der dabei kommt.«
Der Horvath ertappt sich dabei, wie er ununterbrochen seinen Kopf schüttelt. Er geht in die Küche und schenkt sich den letzten Rest des Kaffees vom Nachmittag ein. Die Brühe ist schwarz, kalt und schmeckt widerlich, aber Koffein ist neuerdings sein einziges Laster, und im Moment braucht er nichts dringender als ein Laster. »Und was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun?«
»Also hilfst du mir?« Der Stöger atmet erleichtert auf. »Wir trinken morgen beim Sonnwenden ein Achterl und reden drüber. Bist eingeladen.«
Der Horvath kippt den Kaffee runter und verzieht angeekelt das Gesicht. »Ich trink nicht mehr.«
»Ah, versteh. Ich hab g’hört, dass du jetzt mit der Mimi z’ammwohnst. Da zeigt sich, wer die Hosen anhat, gell? Du, ich muss los. Ich treff mich gleich mit dem Mayr Rupert in Lengenfeld am Golfplatz.«
Nur mit viel Phantasie erkennt der Horvath die Mimi inmitten eines Strohhaufens auf dem Balkon.
»Ich hab glaubt, du schläfst schon.« Der Horvath zwickt die Augen zusammen, um sie zu fokussieren. »Was machst du denn mit dem ganzen Stroh, und warum bist du schon wieder nackert? Du weißt doch, dass die Leut da drüben immer mit dem Gucker rüberschauen.«
»Ich bastle Strohketten für die Sonnwendfeier morgen.«
»Hast du nicht gesagt, du lehnst Sonnwenden als touristische Massenveranstaltung ab?«
Der Horvath könnte schwören, dass sich im Häuserblock gegenüber der Vorhang in einem der oberen Fenster bewegt. Knallfrösche ziehen seinen Blick auf die Straße. Schuhsohlen der weglaufenden Kinder klatschen auf den Asphalt.
Die Mimi schält sich aus dem Stroh und streift Halme ab, die wie blonde Strähnen in ihren roten Haaren hängen. Sie faltet die Hände, als müsste sie sich zur Gelassenheit mahnen.
»Mit dem Fest zur Sonnwende wird die Zeit der Ernte und Fruchtbarkeit eingeläutet. Schon die Kelten haben an diesem Tag das Leben gefeiert«, erklärt sie betont ruhig und zieht die Silben in die Länge, so wie immer, wenn sie ihren Unmut vor ihm verbergen will. »Die Leute müssen Pachamama wieder fühlen lernen. Mit zehn G’spritzten und einer Bratwurst intus wird das schwierig.«
»Also ich muss da nicht hin«, wirft der Horvath, der seine Mimi gar nicht so scharfzüngig kennt, ein. »Wir können auch gern daheimbleiben und deine Fruchtbarkeit einläuten.«
»Wir haben es der Maria und dem Shaman versprochen. Sicher geh’n wir hin.«
Den Horvath schüttelt es noch immer, wenn »Maria und Shaman« so selbstverständlich ausgesprochen wird, als wären die beiden ein fester Begriff. Aber egal, wie sehr er sich innerlich dagegen sträubt, den Nachfolger seines Bruders an Marias Seite zu sehen, es hilft nicht. Stumm nimmt der Horvath die Situation an, solange der Guru nicht halb nackt durch sein Elternhaus tanzt oder dort Dschungeldrogen an spirituelle Junkies verteilt.
»Du erscheinst mir in letzter Zeit nicht im Gleichgewicht, Hase.« Die Mimi hüpft auf ihn zu. Sie stehen unter der Laterne, die über dem Eingang zum Wohnzimmer im Wind baumelt. Schnell schirmt der Horvath Mimis Brüste vor den Blicken des Gaffers von gegenüber ab. Sie hätten lieber die feuchte Wohnung in Stein mit Blick auf die Donau nehmen sollen, nicht diese hier, wo er sich ständig beobachtet fühlt. Aber diese Wohnung hat ein Zimmer mehr, und das soll demnächst mit Nachwuchs befüllt werden.
Die Mimi drückt dem Horvath einen Kuss auf den Mund und schnuppert danach an ihm. »Morgen steigst du besser wieder auf Matcha um. Du trinkst viel zu viel Kaffee.«
Der Horvath runzelt die Stirn. Seit die Mimi zur schamanischen Businessfrau geworden ist und sie ihre Wohnsitze zusammengelegt haben, kommt sie ihm viel bestimmter vor. Manchmal blitzt sogar so etwas wie Unzufriedenheit aus ihrem dritten Auge, wenn er seine Leberkässemmel neben ihr isst. Dann legt er sie lieber zurück in den Kühlschrank und tauscht sie gegen ayurvedisches Mondbrot und Erbsenwurst.
Kritisch mustert der Horvath die Mimi, und ihm wird ganz mulmig. Sie trägt zwar nie Hosen, aber ist das die Sache, die der Stöger gemeint hat?
2
Der Verkehr durch die Wachau ist stockend, und die Straße ist von parkenden Autos gesäumt. Die sommerlichen Abendtemperaturen locken Menschen aus ganz Niederösterreich und Wien zu den Sonnwendfeiern und in die umliegenden Heurigenlokale.
»Können wir nicht einfach zum Pulker-Heurigen gehen, uns eine Jause gönnen und wieder heimfahren?«, grantelt der Horvath, während er anhält und zwei Paare über die Straße winkt, die vom Ausg’steckt-Schild angezogen werden wie die Motten vom Licht. »Außerdem hab ich keine Lust, mitten in der Nacht im Stau zu stehen.«
Die Mimi schaut von ihrem Handy hoch. »Der Shaman hat gesagt, dass wir bei der Maria und ihm schlafen können. Dann kann dich der Shaman nach der Feier auf dem Moped zu ihnen bringen, wenn’s dir zu weit ist, und die Maria und ich gehen die anderthalb Kilometer zu Fuß.«
Erneut muss der Horvath scharf abbremsen. Ungläubig deutet er auf den Bus, der mitten auf der Straße hält und aus dessen Innerem eine Schar von Senioren strömt.
»Sind die deppert?«, schimpft er und schüttelt den Kopf. »Ich werd ganz sicher nicht bei der Maria und eurem Guru schlafen, und auf ein Moped setz ich mich auch nie wieder mit ihm«, fügt der Horvath noch hinzu und spürt, wie sein Grant so richtig in Fahrt kommt.
»Schau, wie viele Autos da vorne parken«, erwidert die Mimi im denkbar schlechtesten Moment.
Der Horvath hat das längst selbst gesehen und wirft der Mimi einen fragenden Seitenblick zu. Früher hätte sie so was nicht gesagt. Da hätte sie eine Bestellung ans Universum gemurmelt oder ihn mit einem Spruch wie »Wenn du aufhörst, danach zu suchen, kommt alles ganz von selbst – sogar ein Parkplatz« um den Verstand gebracht. Wann ist sie so weltlich geworden?
»Ich hab doch gesagt, wir müssen früher wegfahren. Am Nachmittag wär weniger los g’wesen«, setzt sie noch eins drauf.
»Entschuldige, dass ich das Kapitel fertig schreiben wollt. Ich hab im August Abgabetermin, und der Krüger hat noch nicht einmal die Leiche g’sehen.«
»Dass du alles auf den letzten Drücker machst, liegt daran, dass du überhaupt nicht mehr in deiner Mitte bist. Du chantest nicht mehr mit mir und boykottierst unsere Seelenreisen. Kein Wunder, dass du so bist.«
»Wir haben unseren Hauptwohnsitz in Krems, nicht in Fantasia, da muss zumindest einer von uns richtig arbeiten. Ich beug mich seit einem Jahr deinem spirituellen Regime, aber lass mich wenigstens meine Bücher auf die Weise schreiben, die ich für richtig erachte.«
Aus den Augenwinkeln sieht der Horvath, wie sich die Mimi Kopfhörer in die Ohren steckt und den Blick demonstrativ von ihm abwendet. Irgendwas läuft komplett falsch, denkt er und grübelt vor sich hin. Nicht einmal die Aussichtslosigkeit, einen Abstellplatz für das Auto zu finden, regt ihn jetzt noch auf. Stattdessen ruft er sich die letzten Jahre mit der Helga in Erinnerung. Hat der Anfang vom Ende mit ihr nicht ähnlich ausgesehen?
Nach zwanzig Minuten hat der Horvath eine Parkmöglichkeit nahe den Feierlichkeiten gefunden, dafür ist die Mimi, die er zuvor aussteigen hat lassen, im Sonnwendchaos verloren gegangen.
Inzwischen dämmert es, und im Westen zucken die ersten Blitze einzelner Raketen am Himmel. Dafür interessiert sich am Donauradweg, der an Sonnwenden zur Partymeile umfunktioniert wird, noch niemand. Hier brutzeln Bratwürste auf dem Grill, während Neunziger-Jahre-Radiohits aus einem blinkenden Lautsprecher dröhnen.
Der Horvath hat seit einem halben Jahr keinen Schluck Alkohol getrunken und spürt, wie ihm der Wein zügig in den Kopf steigt. Er schiebt sich durch die Menschenmassen, grüßt die Leute mit einem regelmäßigen Nicken in alle Richtungen und hält nach der Mimi Ausschau. Wahrscheinlich sitzt sie mit dem Shaman in einer verdrehten Meditationspose am Donauufer und singt ein Mantra. Der Shaman hat Glück. Er bekommt die Mimi in ihrer Werkseinstellung als freundliche schamanische Hohepriesterin, während sie in seiner Gegenwart zunehmend zum Hausdrachen mutiert.
Eine Hand klatscht auf Horvaths Rücken. Er zuckt zusammen und lässt beinahe seinen Getränkebecher fallen.
»Bei uns ist es halt am schönsten, gell?« Stögers Grinsen entblößt zwei falsche glänzende Zahnreihen. »Ich wett, im Nibelungengau haben s’ kommende Woche Regen.«
»Gehören Süffisanz und Egozentrik zum Parteiprogramm?«
»Du würdest dich wundern, was intern alles dazug’hört.« Der Stöger verpasst dem Horvath einen Schlag auf die Schulter, der schmerzhafter ist, als er ausschaut, und lacht schallend.
»Und wenn ich mir nicht selber der Nächste wär, wär ich nicht Bürgermeister.«
»Im Wein liegt die Wahrheit«, murmelt der Horvath, dem das Stück Langos, das er zuvor gegessen hat, ebenso unangenehm aufstößt wie die gesamte Situation.
»Können wir kurz allein reden?«, fragt der Stöger dann ernst und drängt sich vor dem Horvath durch die schmale Schleuse neben dem Getränkestand. Widerwillig folgt der Horvath ihm. Ach ja, es geht um die vermisste Eva Bergmann und um Benny Stahl, fällt ihm wieder ein. Da ihm Sonnwenden sowieso schon von der schlechten Stimmung zwischen der Mimi und ihm verdorben wurde, kann er sich auch das Palaver vom Bürgermeister anhören. Vielleicht schöpft er aus dem Gespräch eine Idee für den Kommissar-Krüger-Band, an dem er gerade arbeitet. Das Schreiben geht nur zähflüssig voran. Irgendwie fehlt ihm die zündende Idee, die den Plot zu etwas Besonderem macht. Der Druck auf ihn ist erhöht, seit er offiziell als der neue Krimi-Bestsellerautor Österreichs gilt, ohne dafür selbst Tausende Bücher kaufen zu müssen. Der große Reichtum blieb bisher dennoch aus, und wenn er daran denkt, dass er von seinen Tantiemen vielleicht bald eine Familie durchfüttern muss, wird ihm ganz flau. Das sind die Hormone, durchfährt es den Horvath, während er mit dem Stöger auf ein verlassenes Stück Donauufer zusteuert, wo er in seiner Jugend heimlich geraucht und seine ersten Petting-Erfahrungen gesammelt hat. Vielleicht ist die Mimi schwanger, und ihre seltsame Stimmung rührt daher? Der Horvath spürt das dümmlich-glückliche Lachen, das auf seinen Lippen liegt, während er dem Stöger ins Gesicht schaut, in dem er in diesem Moment nur die Mimi sieht.
»Kein Gegrapsche unter der Gürtellinie und Schmusen nur ohne Zunge«, erwidert der Stöger und hebt abwehrend seine Hände.
Der Horvath streicht sich mit der Hand über den Kopf. Sofort nach dem Gespräch wird er die Mimi suchen und mit ihr reden.
»Also«, fährt der Stöger fort, »die Eva ist weg, und keiner weiß, wo sie ist.«
»So weit waren wir schon am Telefon«, erklärt der Horvath und spürt Ungeduld in sich aufsteigen. Die Schiffe haben angelegt, was bedeutet, dass an beiden Donauufern bald die Feuerwerke abgeschossen werden. Er vernimmt den Drang, seine Mimi im Arm zu halten, wenn es losgeht. »Was heißt das, sie ist weg?«
»Sie ist gestern in der Früh nicht zur Arbeit erschienen. Der Bugl-Wirt ist rauf in ihr Zimmer, aber da war sie nicht. Ihr Auto parkt vor dem Haus, und auch sonst fehlt nix. Einen spontanen Urlaub kann man somit ausschließen.«
»Hat die nicht einmal ein Gspusi mit dem Freilich g’habt? Vielleicht weiß der was.«
»Das ist schon ein Weilerl her. Außerdem – mit wem hat die Eva kein Gspusi g’habt?«
Näher kommendes Stimmengewirr macht es dem Horvath schwer, zu verstehen, was der Stöger von sich gibt. Er denkt an Eva Bergmann, diese große, dürre Frau, die ihm beim letzten Besuch beim Bugl-Wirt leidenschaftslos das Bier vor die Nase gestellt hat. Wie der Dorfvamp ist sie ihm nicht erschienen mit ihrem gleichgültigen Blick und dem verhuschten Gehabe.
»Schau, gleich brennt die böse Hexe«, ruft eine Frau ihrem Sohn zu, der unbehelligt Steine ins Wasser schleudert und dabei »Fortnite, Fortnite, Fortnite« brüllt.
»Achtung, die Herren!«, tönt die Stimme eines Mannes in Feuerwehruniform. »Leg ma los?«
»Wir reden nachher weiter, Horvath«, schreit der Stöger, als unmittelbar neben ihnen das Feuer entzündet wird. Goldgelbe Flammen züngeln gierig um den Holzhaufen, als könnten sie es nicht erwarten, die Strohhexe zu verschlingen. Menschen drängeln sich bis an die Absperrung, und Handykameras werden – begleitet von »Ohs« und »Ahs« – auf das Geschehen gerichtet. Der Horvath spürt Hitze in seinem Gesicht und geht ein paar Schritte zurück.
Die plötzliche Stille ist die berüchtigte Ruhe vor dem Sturm. Als das Kreischen der Menschen einsetzt, hält der Horvath den Atem an. Aus dem aufgetürmten brennenden Holzhaufen ragt das Gesicht einer Frau, die ihm bekannt vorkommt. Die schulterlangen aschblonden Haare, das kantige, schmallippige Gesicht. Ist das Eva Bergmann? Nein, es ist Christel Hulatsch, wird ihm klar.
Die Sirenen ertönen so rasch, als hätte die Polizei um die Ecke auf diesen spektakulären Einsatz gewartet.
»Herrgott im Himmel, warum ausgerechnet jetzt?«, klagt der Stöger und zieht einen Flachmann aus der Innenseite seines olivgrünen Sakkos.
»Eine Frechheit von der Hulatsch, sich ausgerechnet in deiner Amtszeit umbringen zu lassen«, erwidert der Horvath, doch sein Sarkasmus prallt am Bürgermeister ab. Dieser nickt und nimmt einen Schluck Schnaps, dessen scharfes Aroma dem Horvath entgegenströmt.
»Halt, halt, halt!«, lallt der Stöger. »Wir wissen gar nicht, ob das Mord war. Die Wasserleiche letztes Jahr, wegen der dich der Altbürgermeister herzitiert hat, hat sich auch als Kajakunfall herausg’stellt.«
»Na, hineingestolpert in den Haufen und zufällig verbrannt wird die Hulatsch nicht sein.«
Der Stöger gibt ein verächtliches Schnaufen von sich. »Die Hulatsch, die alte Bissgurn. Das war kein Mord, das war eine Inquisition.«
Der Horvath erinnert sich an die letzte Begegnung mit der Hulatsch, als sie ihn wegen der vergessenen E-Card im Wartezimmer zusammengeputzt hat. Dabei sah sie exakt so aus wie die bösen Emojis mit den zusammengezogenen Augenbrauen und den nach unten geneigten Mundwinkeln.
Das Sonnwendfeuer wurde inzwischen gelöscht, und die Schaulustigen sind weitgehend von der Polizei gebändigt. Als Anhängsel des Bürgermeisters, der früher selbst Polizist war, den Dienst aber aus Gründen, die er für sich behält, quittieren musste, darf der Horvath das Geschehen aus nächster Nähe beobachten.
Christel Hulatschs Überreste werden aus dem qualmenden Haufen gezogen, um den sich eine Horde von Kriminalbeamten und Forensikern schart. Unter ihnen ploppt Kommissar Krüger auf und winkt dem Horvath zu, eher er sich wieder in Luft auflöst. Dann taucht etwas anderes auf. Eine schmale Silhouette, begleitet von einer aufgeregten Stimme.
»Lassen Sie mich vorbei, ich gehör zum Horvath.« Es ist die Mimi.
»Herkommen!«, ruft der Stöger, der seinen Flachmann geleert hat und keinen ordentlichen Satz mehr herausbringt.
»Endlich hab ich dich g’funden!« Die Mimi fällt dem Horvath um den Hals und drückt sich an ihn. Sie riecht nach Rauch und Hochprozentigem.
»Hast du getrunken?«, fragt der Horvath überrascht.
»Ausnahmsweise einen Marillenschnaps für die Nerven.«
Also doch keine Schwangerschaft. Wie auch? Er kann sich nicht daran erinnern, dass die Mimi im letzten Monat ihren Eisprungtanz zelebriert hätte. Er spürt Enttäuschung, doch die Mimi presst sich so innig an ihn wie schon lange nicht mehr, und die negativen Gefühle ebben ab.
»Sie suchen nach dem Benny. Sie glauben, er ist der Mörder von der Christel. Du musst was tun«, sprudelt es aus ihr heraus. Und dann: »Du musst wieder ermitteln!«
Indessen erhellen bunte Feuerwerkskörper, die auf der anderen Donauseite aufsteigen, den Nachthimmel. Ihr unbeirrtes Knallen wird begleitet von auf- und abklingender Musik, die von Windböen herübergetragen wird.
Die Mimi liegt noch immer in Horvaths Armen. Sie haben dem Geschehen rund um die verbrannte Hulatsch den Rücken zugekehrt und betrachten das Farbspiel am Himmel.
»Hase, ich lieb dich. Du bist mein Held«, flüstert die Mimi und hört sich dabei genauso an wie seine alte Mimi, die in den letzten Monaten nach und nach verblasst ist. Da dämmert es dem Horvath. Wo andere Paare Thermenurlaube und Plüschhandschellen brauchen, brauchen die Mimi und er einen Mord, um ihre Beziehung wieder in Wallung zu bringen.
3
Das Zischen des Wasserkochers dringt ins Wohnzimmer, wo die Mimi leise vor sich hin schnarcht. Ihr rotes Haar ist wie Herbstlaub um ihren Kopf drapiert.
Der Horvath ist seit fünf Uhr wach, sofern er überhaupt geschlafen hat. Mit dem Handy in der Hand liegt er halb unter der Mimi und durchforstet Benny Stahls Facebook-Account. Er weiß nicht, was er unter den schlechten Memes und geteilten Feuerwehreinsätzen zu entdecken hofft, aber eine Frau ist ermordet worden, eine andere verschwunden, und der mutmaßliche Täter ist unauffindbar. In einer derartigen Situation ist jede nutzlose Information besser als gar keine.
»Bruder«, zischt es aus dem Vorzimmer. Der Shaman hält seinen Kopf in den Raum und bedeutet dem Horvath, ihm zu folgen.
Vorsichtig rollt der Horvath die Mimi von sich runter und steht auf. Dass er sich überreden hat lassen, bei der Maria und dem Shaman zu schlafen, ist allein der Tatsache geschuldet, dass er nach dem zweiten Glas Wein am Abend zuvor nicht mehr in der Lage war, zu fahren. Barfuß betritt er die Küche und wird von Kaffeegeruch empfangen. Der Inhalt der Tasse, die der Shaman ihm vor die Nase hält, entpuppt sich jedoch als eine rötliche Brühe, die alles andere als Kaffee ist. Fragend hebt er die Augenbrauen und riecht an der Flüssigkeit.
»Hagebuttentee«, erklärt der Shaman. »Der Maria ist der Mord auf den Magen geschlagen. Sie hat schon zweimal g’spieben, und ihr hat so vor dem Kaffeegeruch gegraust, dass ich ihn weggeschüttet hab.«
Der Horvath rümpft die Nase und stellt die Tasse geräuschvoll auf dem Küchentisch ab. Er setzt sich und blickt sich um. Mit dem endgültigen Auszug seines Bruders Rudi sind auch die letzten Spuren von ihm verschwunden. Seine Espressomaschine und der Messerblock wurden durch Shamans Koch- und Räucherwerkzeuge ersetzt, die der Horvath nicht ohne ausgiebige Recherche benennen kann. Die gesamte Kühlschrankfront ist ein Teppich aus Fotos von Maria und dem Guru, als teilten die beiden seit Jahren ihr Leben miteinander und nicht erst seit zwölf Monaten.
»Wie wirst du vorgehen?«, fragt der Shaman an die Küchenzeile gelehnt, während Maria wortlos die Küche betritt. Ihr Gesicht hat eine gräuliche Farbe angenommen, und ihre Augen sind verquollen.
»Zu tief ins Glas g’schaut, Schwägerin?«, begrüßt der Horvath sie.
Maria fällt wie ein nasser Sack auf den Sessel neben ihm. Ihr scheint es tatsächlich schlecht zu gehen, denn sonst echauffiert sie sich bei jeder Gelegenheit lautstark darüber, wenn er sie »Schwägerin« nennt. »Ich vertrag die Schmerzpulverl für mein Knie nicht, aber ohne halt ich es bis zur Operation nicht aus.«
»Was meinst du damit?«, wendet sich der Horvath wieder dem Shaman zu.
»Na, wegen der Christel und der Eva.«
»Das ist Sache der Polizei. Da misch ich mich nicht ein. Außerdem steh ich kurz vor meinem Abgabetermin.«
»Bruder, unser Dorf braucht dich. Ohne dein Gespür und deinen Scharfsinn sind wir verloren.«
Der Horvath spürt es genau. Irgendwas ist im Busch, denn die Beweihräucherung des Gurus fällt selbst für seine Verhältnisse etwas zu euphorisch aus.
»Du hast die Frau von meinem Bruder geheiratet und besiedelst mein Elternhaus. Was kommt als Nächstes?«
Der Shaman zuckt mit den Schultern, nimmt zwischen ihm und der Maria Platz und setzt sein schmierigstes Grinsen auf. Also doch, denkt der Horvath.
»Die Mimi und ich wollen zum Gedenken an Elisabeth Plainacher und die anderen Frauen, die der Hexenverbrennung zum Opfer gefallen sind, Gedenkstätten besuchen und dort Zeremonien abhalten.«
»Ja und?«, fragt der Horvath, der sich noch nicht vorstellen kann, was an dieser Aktion schlimmer sein soll als an all den anderen Dingen, die seine Freundin und der Guru gemeinsam veranstalten.
»Wir wollen Anfang August zu Fuß bis nach Süddeutschland pilgern und werden am 27. September, das ist der Tag des letzten Hexenprozesses, in Wien ankommen.«
Das Magengrummeln übertönt den eingeschalteten Geschirrspüler. Kurz meint der Horvath, es sei sein eigener Magen, dann springt die Maria auf und stürmt mit auf den Mund gepresster Hand aus dem Raum.
»Da misch ich mich nicht ein«, wiederholt der Horvath den Satz, den er vorhin schon einmal ausgesprochen hat und den er nie so meint, wenn er ihn sagt. Es missfällt ihm, dass die Mimi mit dem Guru durch das Land ziehen will und es nicht einmal für nötig hält, ihm die Mitteilung selbst zu überbringen.
»Was ist denn mit der Maria los?« Die Mimi torkelt schlaftrunken in die Küche. »Shaman, gib mir die Ozeantrommel. Deine Frau speibt sich die Seele aus dem Leib.«
Dem Horvath wird auch schlecht, als er mit dem Shaman auf dessen Moped sitzt und sich zu seinem Auto bringen lässt, das noch immer dort steht, wo er es gestern Abend abgestellt hat. Der Shaman parkt das Moped knapp an der Stoßstange von Horvaths VW Buzz.
»Bruder, ich lieb dich dafür, dass ihr mit der Maria zum Schulmediziner fahrt. Der Tag meiner Geburt in dieser Dimension ist meinen Eltern so wichtig, dass ich die Einladung bei ihnen leider nicht absagen kann.«
»Happy Birthday, falls das übersetzt heißt, dass du heute Geburtstag hast«, murmelt der Horvath vor sich hin, ohne den Shaman anzuschauen.
Shamans Umarmung kommt prompt und dauert wie immer zu lange. Der Horvath schüttelt den Guru ab und flüchtet in sein Auto. Dort bleibt er noch eine Weile sitzen und lässt die Ereignisse des letzten Tages Revue passieren, bevor er den Motor startet und zurück zu Maria und Mimi fährt.
4
Dr.Freilich, der Dorfarzt, sieht nicht weniger schlecht aus als Maria, die kreidebleich mit einem Kübel vor der Brust im Wartezimmer der Ordination sitzt. Die Mimi klopft derweilen auf die Ozeantrommel, und der Horvath nutzt die Wartezeit, um durch das geöffnete Milchglasfenster auf Christel Hulatschs ehemaligen Arbeitsplatz zu spähen. Dorthin, wo nun Dr.Freilich unbeholfen in die Tastatur tippt, als würde er zum ersten Mal in seinem Leben einen Computer bedienen.
Christel Hulatschs Arbeitsplatz sieht aus wie immer, die Menschen zeigen sich betroffen, Dr.Freilich wirkt zerknirscht. Etwas anderes war nicht zu erwarten.
Dass der Arzt an diesem Wochenende Dienst hat, kommt der Neugier der Dorfbewohner zugute, denn die Patienten, die nacheinander in der Gruppenpraxis eintrudeln, sehen alles andere als krank aus. Unter ihnen ist auch Babsi Stöger, die Frau vom Bürgermeister, deren Blick hektisch durch das Wartezimmer kreist und alles genau in Augenschein nimmt. Der Horvath begleitet Mimi und Maria auch nur, um sich einen Überblick über die Gesamtsituation zu verschaffen.
»Was machen S’ denn da mit der Trommel?«, fragt die alte Frau, die dem Horvath zwar bekannt vorkommt, die er aber nicht einordnen kann. Wahrscheinlich ist sie eine der Seniorinnen vom neuen Wohnzentrum, das letztes Jahr feierlich im Dorf eröffnet worden ist.
»Ich heile die Maria mit göttlichen Klängen von der Speiberei«, antwortet die Mimi.
»Was heutzutag nicht alles möglich ist«, sagt die Alte und runzelt die ohnehin bereits faltige Stirn.
»Musik ist die natürlichste und schönste Form der Heilung, deshalb hätten wir gar nicht herkommen müssen. Ich hab eine große selbstheilende Kraft aus der Maria strömen sehen.«
»Das war keine große Kraft, das war ihr Frühstück«, grummelt der Horvath, dem die Warterei mittlerweile auf die Nerven geht.
»Als ich noch jung war, hab ich Ziehharmonika g’spielt«, schwelgt die alte Frau mit dem Pullover, der nicht in diese Jahreszeit passt, in Erinnerungen. »Ich hab der Frau Babsi die Fotos von meinen Konzerten gezeigt, als sie bei mir war.« Sie lehnt sich zu Babsi Stöger hinüber. »Jetzt waren S’ schon lange nicht mehr da. Wollen S’ mich nicht einmal wieder besuchen?«
Babsi Stöger nickt und lächelt förmlich. Dabei sieht sie genauso aus wie auf den offiziellen Fotos, die von ihr und dem Bürgermeister kursieren.
Das Wartezimmer füllt sich weiter. Die Luft wird stickig, und der Horvath spürt Beklemmung. Aus dem anschwellenden Stimmengewirr filtert er Bruchstücke von Sätzen heraus. Spekulationen über Christel Hulatsch, einen angeblichen Geliebten, über Benny, den Tatverdächtigen, sogar über die verschwundene Eva Bergmann, die in den Augen der Dorfbewohner nicht minder verdächtig ist, zumal sie noch immer abgängig ist.
»Maria«, ruft Dr.Freilich endlich.
Maria quält sich sichtbar angeschlagen hoch, gerät ins Schwanken und klammert sich an Mimis Arm.
»Hase, hilf mir, die Maria zu stützen. Ich denk, die Heilung setzt ein. Das verlangt ihr alle Kräfte ab.«
Marias Nägel bohren sich in Horvaths Unterarm. Gemeinsam schleppen sie seine ehemalige Schwägerin zur Tür, die ihnen von Dr.Freilich geöffnet wird.
»Geht schon wieder«, krächzt Maria, taumelt aber sofort wieder, als der Horvath Anstalten macht, sie loszulassen. »Könnts mich bitte reinbringen?«
Dr.Freilich bekräftigt Marias Worte mit einem Winken. »Kommts ruhig mit. Bei mir spielt sich eh alles obenherum ab. Die Frauenärztin ist eine Tür weiter.«
Der Horvath bemüht sich um einen diskreten Blick aus dem Fenster, als Dr.Freilich mit Maria smalltalkt, während er sie abhorcht und ihren Bauch abtastet. Etwas abseits von der Behandlungsliege stehend, lauscht der Horvath ihren Gesprächen, während er gleichzeitig die Diplome und Auszeichnungen an den Wänden beäugt. Auch Mimis skeptischer Blick entgeht ihm nicht. Er ist froh, dass sie sich bisher mit ihren kritischen Monologen über die »Schulmedizin«, wie sie sie nennt, zurückgehalten hat. Die Ozeantrommel in der Hand, sitzt sie da, als wartete sie auf ihren Einsatz. Er weiß genau, was in ihrem Kopf vorgeht, während sie den Arzt mustert, der nicht gerade als Vorzeigebeispiel eines funktionierenden Gesundheitswesens herhalten kann. Sein Körper quillt in der Mitte auseinander wie zu früh aus der Form gestürzter Pudding, seine Hände bewegen sich fahrig, und in seinen Augen verzweigen sich rote Äderchen wie von Schädlingen befallenes Geäst. Kein Wunder. Er lässt keine Gelegenheit aus, einen über den Durst zu trinken. Es gab kaum ein Fest im Dorf, bei dem der Arzt imstande war, den Heimweg allein anzutreten. Beim letzten Sturmheurigen konnte der Horvath, der ebenfalls schon ordentlich bedient war, ihn nur mühsam davon abhalten, sich ans Steuer seines Autos zu setzen.
Nach einer kurzen Anamnese diagnostiziert Dr.Freilich das, worauf auch der Horvath ganz ohne Medizinstudium gekommen ist. Maria hätten die Ereignisse auf den Magen geschlagen, sie solle sich schonen, dann werde es ihr bald besser gehen.
»Haben Sie die Hulatsch umgebracht?«, platzt es aus der Mimi heraus, als Dr.Freilich sich wieder an den Computer setzt, um seine Diagnose einzutippen.
Maria fällt zurück auf die Liege, von der sie sich gerade erst aufgerafft hat. »Mimi«, zischt sie vorwurfsvoll, und ihr bleiches Gesicht färbt sich rot.
Eine Minute lang herrscht peinliches Schweigen, das vom Ticken der Wanduhr dramaturgisch aufgebläht wird. Dr.Freilich sackt in sich zusammen und kippt nach vorne. Sein Kopf landet auf der Tastatur, wo eine zusammenhanglose Buchstabenreihe über den Bildschirm galoppiert.
»Horsti!«, ruft Maria. Sie springt auf und eilt auf den Arzt zu. In getauschten Rollen zieht sie ihn hoch und tätschelt ihm das schweißnasse Gesicht.
»Das ist eine Katastrophe«, klagt er und fährt sich über die rot geränderten Augen. »Nicht nur, dass die Christel tot ist – ich steh jetzt auch ohne Ordinationshelferin da.«
»Was ist denn mit der Brigitte?«
Dr.Freilich keucht. »Die ist nach ihrer Meniskusoperation noch mindestens bis Ende August im Krankenstand. Bis eine offizielle Ausschreibung raus ist und die Stelle besetzt wird, kann ich nicht warten.«
»Was muss man denn da können?«, fragt die Mimi, und dem Horvath schwant Böses.
»Vorerst wär’s schon eine Erleichterung, wenn jemand das Telefon übernehmen, die E-Cards der Patienten stecken und Medikamente ausgeben könnt.«
»Geh, Horvath – Ordinationshelferin, das wär doch was für dich.«
Der Horvath zuckt zusammen. »Für mich? Ich bin Schriftsteller und hab im August einen Abgabetermin.«
»Na, sag ich doch, dass das was für dich wär. Zwanzig Stunden in der Woche wirst wohl entbehren können, und das Geld kannst sicher auch brauchen.«
Als ob Marias Worte nicht schon dreist genug wären, stimmt die Mimi ihr auch noch zu. »Ja, Hase. Das wäre perfekt für dich. Die Tantiemen kommen grad eh nur so schleppend rein.«
»Was interessiert mich der Gesundheitszustand der Leut? Ich bin hauptberuflich dafür zuständig, sie in meinen Büchern ums Eck zu bringen«, versucht er sich aus der drohenden Misere zu retten.
Die Mimi tänzelt in Horvaths Richtung. Das Gesicht vom Arzt abgewandt, zwinkert sie ihm zu. Er weiß genau, was sie ihm damit zu verstehen geben will. Im Umfeld der Ermordeten zu sein, wäre hilfreich, um etwas über ihren Mörder herauszufinden. Doch der Horvath liegt falsch.
»Du bist gut im Tippen, und ich bin gut mit Menschen. Wir können uns den Job teilen, das wäre richtig super. Gemeinsam bringen wir Heilung ins Dorf, ist das nicht eine wundervolle Reise?«
Jetzt ist der Horvath kurz davor, von Marias Kübel Gebrauch zu machen. Er und die Mimi in einer Arztpraxis, das kann nicht gut gehen.
Kommissar Krüger erscheint so unvermittelt hinter der Mimi, dass der Horvath erschrocken zusammenfährt.
Herr Kollege, auf persönliche Befindlichkeiten kann man in unserem Job keine Rücksicht nehmen. Sei ein Profi, ich muss schließlich auch mit Bernadette zusammenarbeiten, nachdem du mich im letzten Kapitel zum One-Night-Stand mit ihr genötigt hast, obwohl wir beide wussten, was für eine Klette sie ist.
»Das Programm, mit dem wir arbeiten, könnt euch die Brigitte in ein paar Stunden erklären. Wir sperren morgen einfach ein bisserl später auf. Parallel würd ich mich um eine fixe Vertretung umschauen, dann seids bald wieder entbunden.« Dr.Freilich klingt dankbar, vielleicht etwas zu dankbar für Horvaths Geschmack, immerhin hat ihn seine potenzielle neue Ordinationshelferin wenige Minuten zuvor indirekt des Mordes an Christel Hulatsch bezichtigt.
»Die Mimi hat eine besondere Art, mit Problemen umzugehen. Da kann es eventuell passieren, dass einer mit einem abgetrennten Finger in die Ordi kommt und die Mimi den verbleibenden neun Fingern als Dankeschön etwas auf der Blockflöte vorspielt«, unternimmt der Horvath einen verzweifelten Versuch, sich aus der Affäre zu ziehen. Sosehr ihn dieser Mordfall auch reizt, seine Vormittage zwischen einem labilen Arzt, grantigen Patienten und einer Schamanin, die sich in feindlichem Gebiet wähnt, zu verbringen, ist nicht das, was der Horvath sich für den Sommerbeginn vorstellt.
Dr.
5
Im Dorf ist es geisterhaft still für einen frühsommerlichen Abend. Die Außenrollos vieler Ortsansässiger sind geschlossen, die Vorhänge zugezogen, die Gartentüren mit Scheibtruhen und Leitern verbarrikadiert.
Die Horden von Journalisten, die über den Fall Christel Hulatsch berichten, sind hinter ihre Schreibtische verschwunden, wo sie halbstündlich jedes noch so belanglose Detail rund um das Dorf in die Welt hinausspeien. Vor allem Benny Stahls Zuhause steht im Fokus der Sensationspresse. Das Foto vom verwilderten Vorgarten vor dem kleinen Haus mit den dreckigen Fenstern geht um die Welt. Die Fahndung nach Benny läuft laut DonauWelt auf Hochtouren.
Bennys Haus, wo er zusammen mit seinem Vater wohnt, ist auch Horvaths Ziel. Er weiß, dass sich dort nach wie vor Scharen von Kriminalbeamten herumtreiben, ebenso im Haus der Hulatsch. Trotzdem kann es nicht schaden, sich ein Bild zu machen, der Zündspur zu folgen, solange sie glüht.
Das Handy zum Fotografieren im Anschlag, streift der Horvath durch die Gassen. Am Dorfplatz blitzen die blauen Lichter zweier Polizeiautos. Zügig und mit gesenktem Kopf schleicht er an ihnen vorbei.
»Woher der plötzliche Bewegungsdrang?«, tönt eine kratzige Stimme. Der Horvath dreht sich um. Hinter dem aufgestellten Kragen einer Polizeijacke erkennt er Walter Simoner.
Demonstrativ fährt sich der Horvath über den Bauch, der flacher geworden ist, seit er das abendliche Dosenbier vor dem Fernseher aus seinem Leben gestrichen hat. »Dieser stählerne Körper kommt nicht von irgendwoher«, kontert er. Simoner beäugt ihn wie ein Wolf, in dessen Revier er eingedrungen ist.
»Vorsicht, Horvath. Wennst glaubst, dass du hier herumschnüffeln kannst und ich mir das gefallen lass, dann irrst dich gewaltig.«
Der Horvath zuckt langsam mit den Schultern. »Ich bereit mich mental auf meinen neuen Arbeitsplatz vor, check die Parkmöglichkeiten, wie sich das für einen ordentlichen Angestellten gehört.«
Simoners hochgezogene Augenbrauen stellen die stumme Frage, von welchem neuen Arbeitsplatz der Horvath spricht.
»Der Freilich hat mich in der Ordi eingestellt.«





























