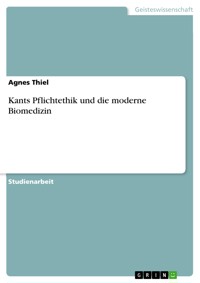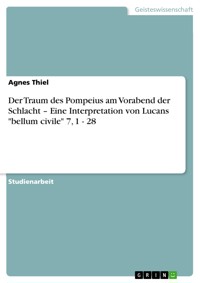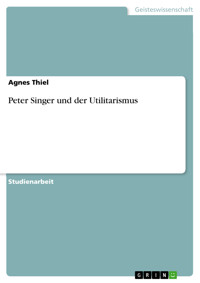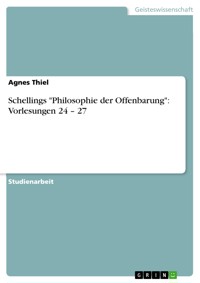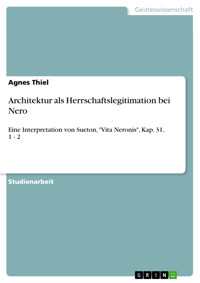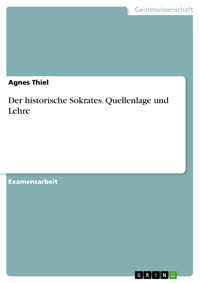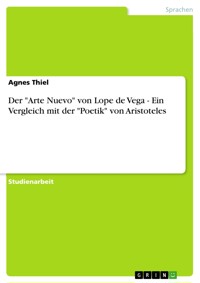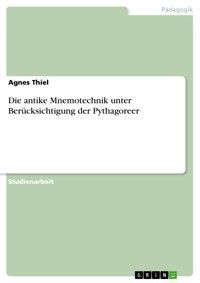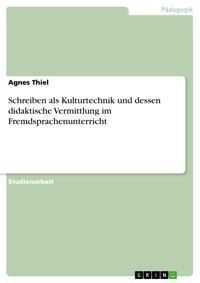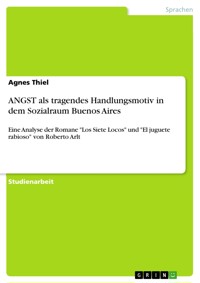15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Romanistik - Hispanistik, Note: 1,7, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Romanisches Seminar), Sprache: Deutsch, Abstract: Das "Grüne Haus" ist der wohl berühmteste Roman von Llosa. Interessant ist neben dem dualistischen Weltbild (Urwald/Zivilisation, Kultur/Natur etc.) die verwirrende Zeitstruktur, die sich nicht an die klassischen Regeln des Romanschreibens im Sinne Stanzels hält. Die Analyse war ein für eine Hauptseminararbeit anspruchvolles Unterfangen, das aber doch belohnt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Mario Vargas Llosa: Casa Verde –
eine Analyse der Zeitstruktur
Einleitung
Zeit in der Philosophie
1.1 Zeit in der Philosophie
1.2 Kants Konzept von Raum und Zeit in der KrV
2. Die Handlungsebene in casaverde
2.1 Vorbemerkungen zu casaverde
2.2 Die fünf Handlungsstränge in casaverde
3. Die Analyse der Zeitebenen in casaverde
3.1 Die Zeitachsen in casaverde
3.2 Analyse auf der Makroebene
3.3 Die Freilassung der Indiomädchen durch Bonifacia
eine Analyse auf der Mikroebene
3.4 Weitere Beispiele auf der Mikroebene
3.5 Weitere Aspekte der Zeitbetrachtung
4. Narrative Techniken und sprachliche Mittel in casaverde
Schlussbemerkungen
Literatur
Mario Vargas Llosa: Casa Verde –
eine Analyse der Zeitstruktur
Einleitung
Mario Vargas Llosa (28. März 1936) ist der wohl international bekannteste peruanische Schriftsteller überhaupt. Im Laufe 60er Jahre, die als Boom-Jahre der südamerikanischen Literatur gelten,[1] schrieb er drei Romane: die Stadt und die Hunde (La ciudad y los perros, 1963), Das grüne Haus (casa verde, 1965) und Gespräche in der Kathedrale (Conversaciones en La Catedral, 1969). Während der erste Roman auf Grund seiner heiklen Thematik in der Hauptstadt öffentlich verbrannt wurde und so für öffentliches Aufsehen sorgte, gründet der literarische Ruhm Llosas auf seinem Zweitwerk: casaverde. Mit diesem Roman gewann er 1967 den LiteraturpreisPremio Internacional de Novela Rómulo Gallegos; selbst von seinen Kritikern, wie zum Beispiel Gerald Martin, wird er zu den bedeutendsten Romanen Lateinamerikas gezählt.[2]
In diesem Roman versucht Llosa sein literarisches Ideal, den totalen Roman, zu verwirklichen. Der totale Roman will in Anlehnung an Aristoteles´ Vorgabe in seiner Poetik Mimesis der Wirklichkeit sein, und auch er hat wie Aristoteles ausführt, Anfang, Mitte und Ende.[3] Trotz des Aufbrechens der Wirklichkeit in der Moderne, im nachmetaphysischen Zeitalter,[4] der Unübersichtlichkeit und Fragmentarität und des fehlenden einheitsstiftenden Bandes, des allgemeinen Werteverlustes und der Orientierungslosigkeit des modernen Menschen versucht der totale Roman dieser neuen Realität gerecht zu werden, indem er ein breites Spektrum an literarischen Stilmitteln verwendet, wie z. B. die nahezu simultane Beschreibung der Ereignis. Hervorzuheben sind auch die Techniken der Zeitpermutation, die Zeitraffung und -streckung, das Ineinanderschachteln von Geschichten, die u. a. Gegenstand dieser Arbeit sein sollen. Llosa definiert eine novela total wie folgt:
„Una<novela total>.Novela de caballerías, fantástica, histórica, militar, social, erótica, psicologica: todas esas cosas a la vez y ninguna de ellas exclusivamente, ni más ni menos que la realidad. Múltiple, admite diferentes y antagónicas lecturas y su naturaleza varía según el punto de vista que se elija para ordenar su caos.“[5]
Um der Komplexität der modernen Realität mit literarischen Mitteln noch gerecht werden zu können, muss auch der Autor mit einer Mannigfaltigkeit an komplexen Elementen schriftstellerisch arbeiten. In dieser Richtung sah Llosa sein Vorbild vor allem in Flaubert und Sartre.[6] Nur dann, so Llosa, habe ein Roman nach Llosa Glaubwürdigkeit (verosimiltud).
In dieser Seminararbeit soll in einem ersten Schritt der Versuch unternommen werden, die Zeit von philosophischer Seite aus zu beleuchten. (= Kap.1) Wegweiser werden hier vor allem Kants Ausführungen in der transzendentalen Ästhetik innerhalb seiner Kritik der reinen Vernunft sein. Kant meinte im Vorwort zur 2. Auflage, seine Ausführungen glichen einer kopernikanischen Wende in der Erkenntnisphilosophie; dass diese Wende nicht ohne Einfluss auf das Schreiben von Romanen blieb, soll die Analyse verdeutlichen. Im Anschluss daran (= 2. Kap.) werden wir die Handlungsebenen in casa verde vorstellen, um so eine Basis zu geben, um die im Anschluss (= 3. Kap.) daran folgende Analyse der Zeitebenen in den Mittelpunkt zu rücken. Unser besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den auf der Makroebene beobachtbaren impliziten und expliziten Zeitpermutationen (Analepse und – eher selten – Prolepse) und auf den verschiedenen Arten der impliziten wie expliziten Zeitverflechtung. Wir werden darüber hinaus luzide zwischen der Makro- und der Mikroebene unterscheiden, um so in gleicher Weise einen Eindruck von Llosas Arbeitsweise auf beiden, sich wechselseitig ergänzenden Ebenen zu erhalten. Anhand einer Analyse konkreter Beispiele auf der Mikroebene soll nämlich das auf der Makroebene herausgearbeitete besser veranschaulicht werden. Im letzten Kapitel (= 4. Kap.) geben wir einen Überblick über die mannigfaltigen narrativen Techniken und sprachlichen Mittel geben, die Llosa in casa verde verwendet hat. Die Schlussbemerkungen fassen die Ergebnisse zusammen und ziehen ein Resümee.