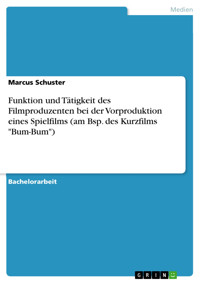0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Journalismus, Publizistik, Note: 2,3, Universität Hamburg (Institut für Journalistik), Sprache: Deutsch, Abstract: Wir leben heute in einer Konsumgesellschaft, die gekennzeichnet ist vom Überfluss an Waren und Dienstleistungen. Das Leben verläuft zu einem großen Teil in monetären Kategorien, wir lassen uns von materiellen Zielen leiten. Ökonomische Handlungsweisen von Unternehmen werden maßgeblicher und uns jeden Tag im Fernsehen und womöglich am eigenen Arbeitsplatz vor Augen geführt – ‚Rendite’ heißt eines ihrer Zauberworte. Ihre Verfechter kämpfen an immer mehr Fronten um Geld, das scheinbar immer weniger Menschen zur Verfügung haben. Attraktionen für Produkte und Dienstleistungen aller Art werden gesteigert, der Kampf um Aufmerksamkeit wird härter geführt – weil immer mehr Marktteilnehmer ein Stück vom schrumpfenden Kuchen haben wollen. Das alte ‚Lied’ vom Kapitalismus, es müsste heute eigentlich lauter erklingen denn je – wenn wir vor dem Fernseher, an plakatierten Bushaltestellen, im Internet und im Kaufhaus von Konsumangeboten umworben werden, wenn täglich neue und immer mehr Eindrücke, Werbebotschaften und Aufmerksamkeitsimpulse auf uns einwirken. Seltsam ist es, dass Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, was die genannten ökonomischen Handlungsweisen betrifft, eine Branche scheinbar nicht auf der Rechnung hatten: die Medien, oder – auf die vorliegende Arbeit bezogen – Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, die als Dienstleistung und Ware Journalismus verkaufen. Dabei müsste es sich von selbst verstehen, dass Produzenten und Anbieter journalistischer Leistungen nicht nur Beobachter und Kommentatoren ökonomischer Prinzipien sein können. Nein, sie müssen, im Sinne ihres Fortbestands, ebenso nach betriebswirtschaftlichen Kriterien funktionieren, wie z.B. ein Automobilhersteller oder eine Bank. Ob das Handeln, das sich aus dieser Erkenntnis ableitet, dem ursprünglichen Produkt der Medienhäuser - Information und Unterhaltung, also gleich Journalismus - schadet, oder vielleicht, im Sinne des Fortschritts, seine Zukunft sichert, will die vorliegende Arbeit untersuchen. Anhand von zahlreichen Beispielen aus den Verlagshäusern DIE ZEIT, FTD und Gruner+Jahr (wozu die FTD gehört) und Interviews mit Verlagsmanagern, Marketingstrategen und Wissenschaftlern wird dieser Frage nachgegangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
Universität Hamburg Fakultät für Sozialwissenschaften Institut für Journalistik & Kommunikationswissenschaft
Markenstrategien von Medienhäusern -Zukunftssicherung oder Risiko für den Journalismus?
Page 2
Page 3
Page 6
Abkürzungsverzeichnis
B2B Business-to-Business B2C Business-to-Consumer EyB Expand your Brand (Markenstrategie von G+J, primär für Online) FTD Financial Times Deutschland G+J Gruner + Jahr o.S. ohne Seitenangabe o.V. ohne Verfasser SZ Süddeutsche Zeitung
Page 7
Tabellenverzeichnis
Tab. 1 Aktionsfelder des Medienmarketings im Marketing-Mix 39
(selbst erstellte Tab. nach Heinrich 2001: 191f.)
56 Tab. 2 Funktionen von Medienmarken(selbst erstellte Tab. nach Siegert 2001: 121)
Page 8
VIII
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Verkaufte Auflage von Zeitungen/Zeitschriften 1998-2008 24
(Quelle: http://www.ivw.de/index.php?menuid=37&reporeid=10#tageszeitungen,
aufgerufen am 24.08.2008)
Werbekampagne derSüddeutschen Zeitung,2008 Abb. 2 27
(Quelle: http://www.horizont.net/aktuell/medien/pages/protected/pics/6780-
org.jpg, aufgerufen am 07.09.2008 & eigenes Foto von Zeitungsvorlage)
32 Abb. 3 Täglicher Medienkonsum in Deutschland(Quelle: ARD/ZDF, nach: Ridder/Engel 2005: 425)
Abb. 4 Strategieoptionen von Zeitschriftenverlagen 44
(selbst erstellte Abb. nach Sjurts 1996a: 132)
Abb. 5 Einflussfaktoren zur Bestimmung des Markenwertes 51
(selbst erstellte Abb. nach Leven 2004: 24)
52 Abb. 6 Produkt-Markt-Matrix nach Harry Igor Ansoff
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Produkt-Markt-Matrix, aufgerufen am
28.09.2008)
Abb. 7 Die Steigerung der Wertschöpfung durch Marken 53
(selbst erstellte Abb. nach Boltz 2004: 201)
55 Abb. 8 Abgrenzung der Markendehnungsstrategien in der Zeitungsbranche
(selbst erstellte Abb. nach Habann et al. 2008: 50)
Abb. 9FTD-Logound Claim 70(Quelle: o.V. 2008s)
72 Abb. 10Zeit-Logound Claim
(Quelle: http://shop.zeit.de/product/index/499-ZEIT-Becher-Geniessen-Sie-DIE-
ZEIT?search=true, aufgerufen am 14.09.2008)
75 Abb. 11 G+J: Unternehmerische Selbstdarstellung im Geschäftsbericht 2007(Quelle: GUJ 2008a: 25)
Abb. 12 Auswahl anFTD-Beilagen(eigenes Foto)78 79 Abb. 13 Auswahl vonFTD-Online-Angebotennach dem „One Brand -All Media“-Konzept(eigene Fotos nach Zeitungsvorlagen)Abb. 14 Online-Werbung fürFTD-Konferenz(Quelle:ftd.de)83
Abb. 15 Reisen und Weine:Zeit-Nebengeschäfte84
(eigene Fotos nach Zeitungsvorlagen)
Abb. 16GEO-Themenlexikon(Quelle:GEO-Shopaufgeo.de)85
Abb. 17BrigitteSchuhampel(Quelle:brigitte.de)87
Abb. 18 Langfristig und gesund abnehmen mit derZeit(Quelle: eigenes Foto)88
Page 9
IX
Page 10
Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist angesiedelt an der Schnittstelle von Ökonomie und Publizistik. Ihr wissenschaftlicher Ursprung liegt an einem alltäglichen Ort, an dem der bestehende Konflikt zwischen wirtschaftlichen und publizistischen Prinzipien von Medienanbietern jeden Tag zu besichtigen ist: In den riesigen Zeitschriftengeschäften am Flughafen oder am Hauptbahnhof. Diese Art von Fachgeschäft, von ihren Betreibern auch „Presse Center“ oder „Pressezentrum“ genannt, ist ein anschauliches Bild für die Ausführungen auf den folgenden Seiten.
Mir fällt es neuerdings immer schwerer, dort gezielt nach einem Produkt zur Befriedigung eines Informations- und/oder Unterhaltungsbedürfnisses zu suchen. Oft verlasse ich nach einer halben Stunde das Geschäft - mit einem Stapel Publikationen unter dem Arm, deren Kauf ich nicht geplant habe:Spiegel Special, Zeit Wissen,die aktuelleNeon...und für die Musestunden noch die neuesten Ausgaben der Edel-MagazineBrand EinsundCicero.Wenn ich Glück habe, klebt auf meiner Beute noch eine DVD als Beigabe drauf. Oder ich kaufe mir gleich einen DVD-Film aus derSZ-Edition.Unter Aufwendung eines nicht unwesentlichen Geldbetrags ist nun also das geschehen, wovon jeder Marketingexperte (und womöglich auch jeder Journalist) in einem Verlag träumt: Ich habe mich von den Medien verführen lassen. Ich war „shoppen“. Im Presse Center am Bahnhof.
Die beschriebene Szene, zugleich Entdeckungszusammenhang des vorliegenden Themas, spiegelt sich in den Gedanken und Ausführungen der folgenden Seiten wider. Medienproduzenten - dies gleich vorweg und auch nicht überraschend - betreiben heute, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und unter zunehmendem Konkurrenzdruck, immense Anstrengungen, ihr Angebot zu erweitern und auszudifferenzieren. Sie verfolgen dabei sowohl materielle als auch immaterielle Ziele. Oft ist es ein Spagat zwischen ökonomischen Notwendigkeiten und publizistischer (Selbst)Verpflichtung. Trotzdem, oder gerade deshalb, sind sie dabei kreativ wie nie zuvor. Unter dem gemeinsamen Nenner „Markenstrategien“ sollen in dieser Masterarbeit Aspekte der neuen Angebotspolitik von Medienhäusern mit Kerngeschäft Print, sprich: von Verlagen, untersucht werden - durchaus medienkritisch und unter besonderer Berücksichtigung des Hamburger Medienhauses Gruner + Jahr. Längst kann sich eine solche Untersuchung nicht mehr nur auf Zeitungen und Zeitschriften beschränken. Auch Nebengeschäfte aller Art, die ausführlich erläutert werden, sind einzubeziehen. Natür-
Page 11
lich verbreitert sich die Angebotspalette zeitgenössischer Medienhäuser zunehmend auch durch veränderte technische Möglichkeiten, virtuell im Internet. Doch das Presse Center am Hauptbahnhof bleibt (vorerst) erhalten - als begehbarer, erfahrbarer Ort, an dem der tägliche Kampf um Aufmerksamkeit, Marktanteile und Gewinne, den Medienanbieter unter der Erschwernis des angedeuteten Konflikts Ökonomie vs. Publizistik führen, ersichtlich ist. In Zeiten, in denen der kleine Kiosk an der Ecke (wo es ihn noch gibt) vielleicht auch wegen seines begrenzten Angebots ein wenig in die Jahre gekommen scheint, ist das große Presse Center heute mehr als nur Verkaufsstätte journalistischer Waren. Im Jahr 2008 finden wir dort ausdifferenzierte mediale Produktwelten vor, die in der Lage sind, beim Konsumenten Begehrlichkeiten zu wecken - wie jedes andere Kaufhaus, in dem Waren angeboten werden. Wo vor 20 Jahren Menschen nach In-formation bzw. Unterhaltung (oder einer Mischung aus beidem) suchten, eröffnet sich den Konsumenten heute ein „Gemischtwarenladen“ voller medialer Verheißungen, die äußerst verführerisch sind. Dort können zwar die genannten Bedürfnisse hinreichend befriedigt werden, genauso aber auch erst entstehen.
Ich werde im Folgenden erläutern, welche Faktoren meines Erachtens mit den von mir gemachten Beobachtungen zusammenhängen. Danken möchte ich den Menschen, die für die zu untersuchenden Phänomene mitverantwortlich sind bzw. sie kritisch, konstruktiv - manchmal auch visionär - begleitet haben und immer noch begleiten, und mir mit ihrer Sicht der Dinge in Interviews zur Verfügung standen: Hans-Peter Junker und Axel Korda aus dem Haus Gruner + Jahr, Thomas Frenzel von derFinancial Times Deutschland,Sandra Kreft von derZeit,dem Autor und Journalisten Michael Jürgs, sowie der Medienwissenschaftlerin Judith Gentz von derHamburg Media School.Darüber hinaus gebührt mein Dank Wiebke Loosen von der Universität Hamburg und Volker Lilienthal vonepd medien,die sich bereit erklärt haben, die vorliegende Masterarbeit zu betreuen.
Hamburg, im September 2008 Marcus Schuster
Page 1
1. Einleitung
1.1. Einführung ins Thema
Wir leben heute in einer Konsumgesellschaft, die gekennzeichnet ist vom Überfluss an Waren und Dienstleistungen. Das Leben verläuft zu einem großen Teil in monetären Kategorien, wir lassen uns von materiellen Zielen leiten. Ökonomische Handlungsweisen von Unternehmen werden maßgeblicher und uns jeden Tag im Fernsehen und womöglich am eigenen Arbeitsplatz vor Augen geführt - ‚Rendite’ heißt eines ihrer Zau-berworte. Ihre Verfechter kämpfen an immer mehr Fronten um Geld, das scheinbar immer weniger Menschen zur Verfügung haben. Attraktionen für Produkte und Dienstleistungen aller Art werden gesteigert, der Kampf um Aufmerksamkeit wird härter geführt - weil immer mehr Marktteilnehmer ein Stück vom schrumpfenden Kuchen haben wollen. Das alte ‚Lied’ vom Kapitalismus, es müsste heute eigentlich lauter erklingen denn je - wenn wir vor dem Fernseher, an plakatierten Bushaltestellen, im Internet und im Kaufhaus von Konsumangeboten umworben werden, wenn täglich neue und immer mehr Eindrücke, Werbebotschaften und Aufmerksamkeitsimpulse auf uns einwirken. Seltsam ist es, dass Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, was die genannten ökonomischen Handlungsweisen betrifft, eine Branche scheinbar nicht auf der Rechnung hatten: die Medien, oder - auf die vorliegende Arbeit bezogen - Zeitungs- und
Zeitschriftenverlage1, die als Dienstleistung und Ware Journalismus verkaufen. Dabei müsste es sich von selbst verstehen, dass Produzenten und Anbieter journalistischer Leistungen nicht nur Beobachter und Kommentatoren ökonomischer Prinzipien sein können. Nein, sie müssen, im Sinne ihres Fortbestands, ebenso nach betriebswirtschaftlichen Kriterien funktionieren, wie z.B. ein Automobilhersteller oder eine Bank. „Medienangebote (sind) Waren, deren gewinnorientierter Absatz über die Marktfähigkeit entscheidet“, deren Handhabung Merkmale ökonomischen Handelns trägt, durch Angebot und Nachfrage, durch Produktionskosten und Produktionspreise (Altmeppen 1996b: 257). Sicher lassen sich (mit viel Idealismus) öffentlich-rechtliche Medienangebote von einer generellen Gewinnorientierung ausnehmen; wirtschaftlich handeln und ein Publikum erreichen müssen sie trotzdem. Die folgende Definition dürfte Zweifel an der notwendigen wirtschaftlichen Orientierung von Medienunternehmen eigentlich gar nicht erst aufkommen lassen, denn diese sind
1Ein Verlag im Sinne der Medienökonomie „ist eine Unternehmung, die Produkte des Medienmarktes produziert und vertreibt, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, aber auch Musikalien und Bilder. Ein Presseverlag ist also eine Unternehmung, deren Schwerpunkt die Produktion und der Vertrieb von Zeitungen und Zeitschriften bildet“ (Heinrich 2001: 214).
Page 2
„(...) technische, soziale, wirtschaftliche und umweltbezogene Einheiten mit der
Aufgabe der Fremdbedarfsdeckung, mit selbständigen Entscheidungen und eige-
nen Risiken, deren Handeln gerichtet ist auf publizistische und ökonomische
Ziele. Dabei werden die Vorprodukte Information, Unterhaltung und Werbung
zu einem marktreifen Endprodukt, dem Medienprodukt, kombiniert“
(Sjurts 2002: 7).
Presseverlage gehören für Heinrich „nach dem Handelsrecht zu den Grundhandelsgewerben. Sie sind als Wirtschaftsunternehmen darauf angewiesen, einen Gewinn zu erzielen“ (2001: 214). Und Altmeppen/Karmasin erkennen, „dass die Medien nicht nur ihre eigene Organisation im Griff haben wollen, sondern dass sie strategisch handeln und über den Einsatz von Real-, Kultur- und Sozialkapital maßgeblich darüber mitbestimmen, welche Medien eine Gesellschaft beherbergt. Medienwirtschaftliches Handeln wird damit zu einer zentralen Kategorie bei der Frage, über was eine Gesellschaft wie kommuniziert“ (2004: 8).
Trotzdem haben Wissenschaftler und (Medien-)Journalisten - als diejenigen, die das hätten erkennen und thematisieren können -, und mit ihnen die Öffentlichkeit, „bis weit in die 90er Jahre hinein so getan, als würden sich Medien außerhalb der Ökonomie bewegen, (als hätten) TV-Sender, Zeitungshäuser oder Buchgiganten nichts damit zu tun“ (Siebenhaar/Karnitschnig 2005: 94). Das birgt einiges an Konfliktpotential. Zurückzuführen ist diese Wahrnehmung vor allem auf den oben bereits erwähnten ‚Verbundcharakter’ von Medien, nach dem sie auf zwei Märkten agieren: dem Vertriebs- und dem Anzeigenmarkt (vgl. z.B. auch Siegert 2001: 109, Heinrich 2001: 129) - und damit, anders als Konsumgüterproduzenten, gleichzeitig publizistische und ökonomische Ziele verfolgen (müssen), also gleichzeitig wirtschaftliche und publizistische Unternehmen sind. Diese beiden Seiten sind häufig schwer zu vereinen, müssen aber vereint werden, denn nur Profit oder nur Publizistik erhält auf Dauer kein Medienunternehmen (vgl. z.B. Altmeppen 1996a: 10, 18). Was passiert nun aber, wenn beide ins Ungleichgewicht geraten, zu Lasten des publizistischen Anspruchs (nach Baumgarth, 2004b: 9, z.B. definiert durch Aktualität, Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit)? Das besorgt nicht nur Journalisten und hasenfüßige Sozialwissenschaftler. Auch in der vorliegenden Arbeit, die im Bereich der oben als notwendig dargestellten Medienkritik anzusiedeln ist, soll es darum gehen. Die öffentliche Wahrnehmung hat die Medien also verklärt, indem sie eben nur auf jene publizistischen Ziele rekurrierte und in ihnen keine Wirtschaftsunternehmen sah.
Page 3
Doch auch das Selbstverständnis von Journalisten, Verlegern und Medienunternehmen war einzig getrieben von publizistischer Überzeugung (vgl. Heinrich 2001: 5), wenngleich „im Bewusstsein der Produzenten von Zeitschriften (...) in viel geringerem Maße als bei Produzenten von Zeitungen die Vorstellung verhaftet (war), Träger einer öffentlichen Aufgabe zu sein“ (Heinrich 2001: 327). Auch der Wissenschaft - speziell der Ökonomie (aber auch der Kommunikationswissenschaft) - wurde vorgeworfen, die Medienwirtschaft in ihren Analysen lange kaum, höchstens unter Regulierungsaspekten, und schon gar nicht unter den genannten Veränderungen, berücksichtigt zu haben (vgl. z.B. Altmeppen 1996a, Jenöffy-Lochau 1997, Siegert 2002, Sjurts 1996a). Dabei bewegt sich die Ökonomie doch, wenn es um wirtschaftliche Zusammenhänge und Funktionsweisen spezieller Märkte geht, auf ihrem ureigensten Gebiet. Dass Sozialwissenschaftler zugunsten der Publizistik aufschreien, dürfte klar gewesen sein. Was fehlte, war die sachliche Analyse des Status Quo unter ökonomischen Maßgaben. Zwar stellt die Betriebswirtschaft von Medienunternehmen mehr dar „als nur das ökonomische ABC des Gewinnemachens: Medienunternehmen nehmen eine öffentliche Aufgabe wahr und sind damit relevanter Bestandteil eines jeden politischen Systems“ (Ludwig 1996: 81). Als „privatwirtschaftliche Medienorganisationen (sind sie auch) nicht a priori auf den Vorzug des wirtschaftlichen gegenüber dem publizistischen Normensystem festgelegt, die institutionell gewährten Handlungsspielräume unterstützen jedoch die Gewinnmaximierung der Anbieter (...) gegenüber der gesellschaftlichen Nutzenmaximierung“ (Siegert 2001: 29). Ganz grundlegend formulieren die „Zweckrealisierung“ der Medien Saxer und Märki-Koepp: „(...) Kommunikationsangebote bereitzustellen, die für ihr Überleben - und Prosperieren - ausreichende Akzeptanz finden“ (1992: 43). Man sieht, es handelt sich bei der Beziehung zwischen Medien und ihren Nutzern um eine ganz normale Anbieter-Abnehmer-Konstellation im ökonomischen Sinne - wenngleich es Spezifika des Medienmarktes gibt, auf die einzugehen sein wird. Zeitungs- und Zeitschriftenverlage2bieten z.B. schon immer - und durch das Internet
2Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Begriffe Medium, Zeitschrift (bzw. Zeitung), Magazin, Publikation und Heft (und d. jew. Plural) in der vorliegenden Arbeit im Sinne der Lesbarkeit variabel, gleichberechtigt und ohne die Intention einer speziellen Kategorisierung verwendet werden (für eine Definition vgl. Heinrich 2001: 304). Gleiches gilt für die Begriffe Verlag, Verlagshaus, Medienhaus, Medienproduzent, Medienanbieter und Medienorganisation (und d. jew. Plural) - wenn auch vom Autor auf S. 7 eine Unterscheidung zwischen ‚Verlage’ und ‚Medienhäuser’ vorgenommen wird, die jedoch nur der Veranschaulichung des aufgezeigten Wandels im Selbstverständnis der Anbieter dient. Wegen des Titels der Arbeit überwiegen jedoch in der Darstellung die ‚Medienhäuser’. Der allg. Terminus ‚Medien’ wird vielseitig, aber so verwendet, dass er sich an den jeweiligen Stellen erschließt: Gemeint sein können entweder die Gesamtheit aller Mediengattungen, d.h. der gesamte Medienbetrieb, oder auch einzelne Medien(-Titel).
Page 4
zunehmend - eher immaterielle Leistungen an: auf dem Vertriebsmarkt Information und Unterhaltung und auf dem Anzeigenmarkt die Verbreitung von Werbebotschaften (vgl. z.B. Sjurts 1996a: 20), deren Wert nur schwer zu bemessen ist. Trotzdem müsse, so die Forderung aus Wissenschaft und Praxis, endlich erkannt werden, „dass mit immateriellen Waren höchst materielle Gewinne erzielt werden“ (Hickethier/Bleicher 2002: 1), dass den Unternehmen „die ökonomische Bilanz wichtiger ist als die journalistische“ (Altmeppen 1996b: 255). Der Journalismus bleibt also hiervon nicht unberührt:
„(Sein) Erfolg basierte lange Zeit auf einer idealistischen Illusion: dass er letzt-lich doch kein Geschäft ist, sondern von edlen Menschen betrieben wird, die
sich um offene Kommunikation, demokratische Öffentlichkeit, sogar um Kultur
kümmern, um Kritik und Kontrolle der Politik, um Orientierung - und damit ge-
rade noch eben auf ihre Kosten kommen. Der Grundwiderspruch zwischen ge-
sellschaftlichem Auftrag der Medien und ihrer Wirtschaftlichkeit wird durch das
Ethos der Verantwortlichen aufgelöst, lautete die frohe Botschaft“ (Weischen-
berg 2007b).
Das Ignorieren von Medienökonomie in Wissenschaft, Journalismus und öffentlichem Diskurs schien also gegenseitig bedingt - und unverständlich. In den Mittelpunkt des Interesses ist das Handeln von Medienproduzenten erst zur Jahrtausendwende gerückt, als viele Verlagshäuser mit massiven Schwierigkeiten zu kämpfen hatten (und teilweise bis heute haben): Hohe Einbußen im Anzeigengeschäft, wachsender Konkurrenzdruck durch andere Medien, wie das Fernsehen und vor allem das neue Massenmedium Internet, sinkende Verkaufszahlen (und damit Auflagen) auf ausgereiften, gesättigten Märkten3, aber auch eigene strategische Fehler der Verlage (vgl. o.V. 2008a, Hamann 2007b). Und im Gegenzug steigende und überzogene Renditeerwartungen von Finanzinvestoren, zu deren Investmentobjekt manche geschwächten Verlage geworden sind und die journalistische Inhalte vor allem als lukratives Geschäft erachten und weniger als ein publizistisches, Gesellschaft konstituierendes Gut. Besonders schlimm war der allgemeine Abwärtstrend für die betroffenen Unternehmen während der so genannten ‚Medienkrise’ von 2001 bis 2003, als das Geschäft vieler Verlage (nach dem Anzeigenrekordjahr 2000, vgl. Fürstner 2004: 9) regelrecht erodierte und z.B. dieSüddeutsche Zeitungwegen des Anzeigenschwunds (aber auch durch eigenes Verschulden) der Legende nach am Rande des Ruins stand (vgl. Hamann
3Ausnahmen bilden innovative Neuerscheinungen der vergangenen Jahre, z.B.NeonundCicero,die ihre verkaufte Auflage entgegen dem Trend steigern konnten.