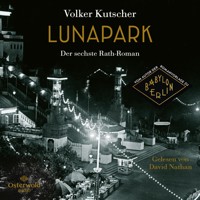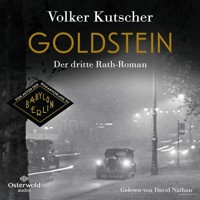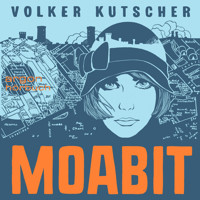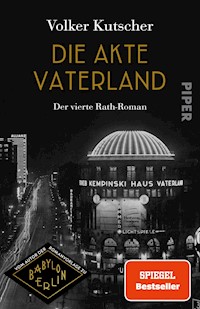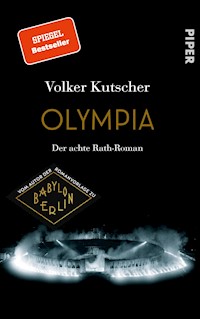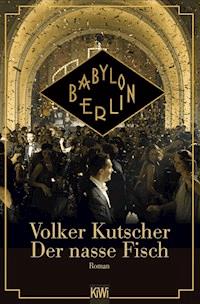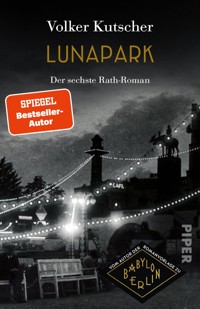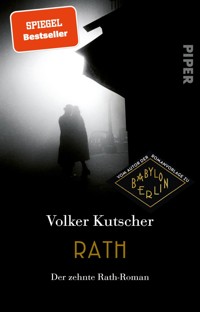10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin, Spätsommer 1935. In der Familie Rath geht jeder seiner Wege. Pflegesohn Fritz marschiert mit der HJ zum Nürnberger Reichsparteitag, Charly schlägt sich als Anwaltsgehilfin und Privatdetektivin durch, während sich Gereon Rath, mittlerweile zum Oberkommissar befördert, mit den Todesfällen befassen muss, die sonst niemand haben will. Ein tödlicher Verkehrsunfall weckt seinen Jagdinstinkt, obwohl seine Vorgesetzten ihm den Fall entziehen und ihn in eine andere Abteilung versetzen. Es geht um Hermann Göring, der erpresst werden soll, um geheime Akten, Morphium und schmutzige Politik. Und um Charlys Lebenstrauma, den Tod ihres Vaters. Und um den Mann, mit dem Rath nie wieder etwas zu tun haben wollte: den Unterweltkönig Johann Marlow.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 778
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
ISBN 978-3-492-99259-6© Piper Verlag GmbH, München 2018Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: Roman Vishniac (Interior of the Anhalter Bahnhof railway terminus near Potsdamer Platz, Berlin), 1929-early 1930s (c) Mara Vishniac Kohn, courtesy International Center of Photography Datenkonvertierung: Tobias Wantzen, Bremen
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
Eine andere Geschichte
Erster Teil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Eine andere Geschichte
Zweiter Teil
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Eine andere Geschichte
Dritter Teil
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Eine andere Geschichte
Vierter Teil
84
85
86
87
88
89
Eine andere Geschichte
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
I am quite sure that I have no race prejudices, and I think I have no colour prejudices nor caste prejudices nor creed prejudices. All that I care to know is that a man is a human being – that is enough for me; he can’t be any worse.
Mark Twain
Eine andere Geschichte
Marlow, Großherzogtum Mecklenburg-SchwerinSonntag, 28. Juli 1918
Das Gut liegt nicht allzu weit außerhalb der Stadt. Außerhalb von Marlow, einem kleinen, verschlafenen Nest im Mecklenburgischen, das sich nur deshalb Stadt nennen darf, weil es vor Hunderten von Jahren, aus Gründen, an die sich niemand mehr erinnert, irgendwann einmal die Stadtrechte erhalten hat. Das Meer ist nicht weit, doch die meisten Marlower haben es nie gesehen, die wenigsten sind überhaupt je aus ihrem Städtchen hinausgekommen. Bis der Krieg die jungen Männer in alle Himmelsrichtungen getrieben hat. Doch auch von den Soldaten, die Marlow dem Weltkrieg geopfert hat, haben nur die wenigsten das Meer sehen dürfen, der Großteil ist in Eisenbahnwaggons zur Front gekarrt worden, direkt in den Schlamm der Schützengräben, in dem die allermeisten dann auch verreckt sind.
So gesehen hast du Glück gehabt: Obwohl in Marlow geboren, bist du herausgekommen, hast einen großen Teil deiner Jugend am anderen Ende der Welt verbracht, die Zeit danach in der Schweiz, im Internat, und an der Universität. Dann kam der Krieg, auch für dich, doch du hast ihn überlebt, bislang, obwohl an der Ostfront, wohin es dich verschlagen hat, genauso gestorben wird wie an der Westfront.
Und nun hat ausgerechnet der Krieg dich wieder zurückgebracht; deine Sanitätskompanie ist von der Front ins Reservelazarett Pasewalk verlegt worden. Nicht Mecklenburg, sondern Pommern, aber nah genug, dass die Gerüchte dich erreichen konnten. Von der chinesischen Hure in Marlow und ihrem Bastard. Und dass Gott sie in seiner Gerechtigkeit gestraft habe mit einer schlimmen Krankheit.
Schon als du die Geschichte das erste Mal hörtest, hat sie dich elektrisiert, und als du dann nachgefragt hast, jedoch nichts Genaueres in Erfahrung bringen konntest, wusstest du, dass du hinfahren musst. Nach Marlow. Nach Altendorf.
Es ist bereits dunkel, als du das Gut erreichst. Du parkst vor dem Haupthaus und steigst aus dem Automobil. Während du wartest, dass jemand auf dein Klopfen reagiert, lässt du deinen Blick über den Hof wandern, der dir in den ersten Jahren deines Lebens so etwas wie Heimat gewesen ist und den du eigentlich niemals wiedersehen wolltest. So wenig wie du das Land hinter der Küste wiedersehen wolltest. Das Schicksal hält sich nicht immer an solche Pläne. Und der Krieg noch weniger.
Du hörst Schritte, und dann steht der alte Engelke in der Tür, eine Laterne in der Hand, und blinzelt den späten Besucher an. Engelke, der einzige, der Gut Altendorf immer treu geblieben ist, auch in den Jahren, als der Gutsherr in Tsingtau weilte, im Schutzgebiet Kiautschou.
Die Miene des Alten ist unergründlich, nur ein leichtes Zucken der Augenbrauen verrät dir, dass er dich erkannt haben muss, doch ob diese Regung Erschrecken ausdrückt, ob sie Überraschung zeigt oder etwas völlig anderes, vermagst du nicht zu sagen.
Für einen Moment glaubst du, Engelke werde die Tür sofort wieder zuschlagen. Dann aber macht der Alte den Mund auf.
»Der junge Herr! Welche Überraschung! Ich wusste gar nicht, dass Sie …«
»Ist sie hier?«
»Wie meinen?«
»Sie ist hier, nicht wahr? Er hat sie aus Tsingtau mitgebracht! Ich weiß es.«
»Sie sollten mit Ihrem Herrn Vater reden, junger Herr, ich werde …«
Du drängst dich an dem Alten, der vergeblich versucht, dich aufzuhalten, vorbei in die Halle.
»Sag mir, wo sie ist, Engelke! Bring mich zu ihr!«
»Nicht hier, Herr, nicht hier.«
Engelke zerrt dich am Ärmel wieder aus der Halle, ihr verlasst das Haus. Vor der Tür deutet der Diener mit seiner Laterne quer über den Hof, als wäre es ihm peinlich.
Nicht zu glauben. Vater hat sie mit nach Deutschland genommen, doch er lässt sie nicht im Herrenhaus wohnen. Nicht einmal jetzt, wo sie krank ist. Du nimmst dem Alten die Laterne ab und stiefelst zu den Gesindehäusern hinüber, die sich im Mondschatten des Herrenhauses ducken wie schüchterne Kinder. Bevor du das erste Haus erreichst, zerschneidet ein unmenschlich hoher Schrei die Nacht. Du erstarrst für einen Moment, dann läufst du umso schneller, läufst über den Hof, hinüber zu dem kleinen Häuschen, aus dem der Schrei gekommen ist, und stürzt hinein ohne anzuklopfen.
Sie liegt in der Schlafkammer, im Schein einer Petroleumlampe. Ihr Sohn, von dem du schon gehört, den du aber nie gesehen hast, sitzt neben dem Bett und hält ihre Hand, schaut auf, als du den Raum betrittst. Ihr Gesicht glänzt vor Schweiß und ist vom Schmerz gezeichnet. Kaum zu glauben, dass sie gerade einmal Mitte dreißig ist, so zerfurcht wirken ihre Züge, so tief haben sich die Falten in ihre Haut gegraben. Und doch schimmert ihre Schönheit durch all dieses Leid hindurch.
»Du bist es«, sagt sie, und es hört sich an, als traue sie ihren Sinnen nicht.
Ihr Deutsch ist makellos, ohne jeden Akzent, das hat dich früher schon erstaunt. Gleichwohl hat sie es nie geschafft, dir auch nur ein einigermaßen passables Mandarin beizubringen, obwohl genau das ihre Aufgabe war.
Du hast geglaubt, sie nie wiederzusehen, aber vergessen hast du sie nie.
»Chen-Lu«, sagst du und nimmst ihre Hand. »Was ist mit dir? Du bist krank.«
»Entschuldige. Aber manchmal tut es so weh!«
Und ihr schmerzzerfurchtes, schweißglänzendes Gesicht bringt tatsächlich ein Lächeln zustande. Sie schaut den Jungen an. »Geh schlafen, Kuen-Yao«, sagt sie. »Der Mann hier ist ein guter Freund.«
Der Junge schaut dich an, mit einer Mischung aus Misstrauen und Zuneigung. Über seine unergründlich dunklen Augen huscht ein kleiner Schimmer der Hoffnung. Dann steht er auf und verlässt den Raum.
»Dein Sohn?«
Sie nickt.
»Ein hübscher Junge.«
»Nicht wahr?« Sie lächelt. »Ach, Magnus! Ich mache mir Sorgen um ihn. Wer soll sich um ihn kümmern, wenn ich nicht mehr da bin? Er ist erst elf.«
»Red doch nicht so.«
»Doktor Erichsen sagt, man kann es nicht heilen. Es ist in der Leber. Es wuchert überall.«
Du lässt dir dein Erschrecken nicht anmerken. »Warum ist der Doktor nicht hier?«, fragst du. »Welche Medizin gibt er dir?«
Ihr Blick weist zum Nachttisch. Dort liegt ein Röhrchen Aspirin neben einem Wasserglas.
»Das ist ein Witz! Du brauchst stärkere Schmerzmittel.«
»Ach, es hilft doch eh nichts mehr.« Wieder lächelt sie. »Wie schön, dass du hier bist. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen.«
Du nimmst ihre Hand. »Ich bin Arzt«, sagst du. »Das heißt: Noch nicht ganz. Sanitätsfeldwebel, das Studium muss ruhen, wenn das Vaterland ruft. Aber ich weiß, was dir hilft. Ich … Warte!«
Du gehst hinaus zum Auto. In deiner Arzttasche, die du immer mit dir führst, muss noch eine Ampulle sein. Das wichtigste Medikament, das ihr im Krieg habt. Als du in die Stube zurückkehrst, merkst du, dass sie wieder Schmerzen leidet und den Schrei nur mit Mühe unterdrücken kann. Du beeilst dich, die Spritze aufzuziehen. Ihre Haut ist so dünn und durchscheinend, dass du nicht einmal nach der Vene tasten musst. Du kannst förmlich zusehen, wie das Morphin sich in ihrem Körper ausbreitet und den Schmerz vertreibt. Die verkrampften Muskeln lösen sich, die Anspannung weicht aus ihrem Gesicht.
»Es wird alles gut«, sagst du, obwohl du weißt, dass es nicht stimmt.
Sie nickt. Obwohl sie weiß, dass du lügst.
Ihre Gesichtszüge werden immer entspannter, ihr Lächeln so gelöst, dass man meinen könnte, sie sei auf dem Weg der Genesung. Aber das ist sie nicht. Sie spürt lediglich keine Schmerzen mehr.
Mehr kannst du nicht für sie tun. Kann niemand für sie tun. Und Doktor Erichsen, dieser Quacksalber, hat ihr selbst das verweigert. Vielleicht auch nur, weil es ihm niemand bezahlen will. Aspirin! Wie lächerlich! Dieser Dreckskerl hätte Chen-Lu einfach elendig und qualvoll verrecken lassen.
Du streichelst ihr die Stirn und bleibst am Bett sitzen, bis sie in den Schlaf fällt. Bevor du das Haus verlässt, schaust du noch nach dem Jungen. Auch der schläft tief und fest. Wieviel Schlaf die Krankheit den beiden wohl schon geraubt hat?
Du bringst die Arzttasche zurück ins Auto und gehst zum Herrenhaus. Diesmal klopfst du nicht, du öffnest die schwere Tür und gehst hinein, die Laterne leuchtet dir den Weg. Du findest deinen Vater im Salon, die Füße hochgelegt, derweil Engelke ihm gerade Wein nachschenkt.
»Magnus«, sagt er und richtet sich auf, »kommst du doch noch zu mir! Und ich dachte schon, die kleine Hure ist dir wichtiger als der eigene Vater.«
Du fragst dich, ob der Alte immer schon so zynisch und verbittert war oder ob ihn erst der Tod seiner Frau, nur wenige Monate nach eurem Eintreffen in China, zu dem misanthropischen Ekel gemacht hat, das jetzt vor dir sitzt. Das letzte Mal gesehen hast du ihn vor zehn Jahren ungefähr. Im Schutzgebiet, im Hafen von Tsingtau. Friedrich Larsen winkte nicht einmal, als sein Ältester an Bord des Dampfers ging, der ihn zurück nach Europa und ins Internat bringen sollte, weit weg von jeglicher Versuchung, weit weg von der jungen Frau, in die sich der Sechzehnjährige bis über beide Ohren verliebt hatte.
Vielleicht ist Vater tatsächlich beleidigt, dass sein Ältester ihn seither niemals besucht hat. Nicht einmal, als der kaiserliche Forstinspektor Friedrich Larsen wenige Monate nach Kriegsausbruch von japanischen Truppen aus dem Schutzgebiet vertrieben wurde und nach Mecklenburg zurückkehren musste. Das alles hast du erst viele Monate später aus einem knapp gehaltenen Feldpostbrief erfahren. Auch, dass deine Brüder inzwischen eingezogen waren. Nach wenigen Monaten gefallen sind. Aber dass sie Chen-Lu mit nach Deutschland genommen haben, das hat dir der Alte verschwiegen.
Und jetzt sitzt er da und trinkt, gibt unflätige Bemerkungen von sich, trinkt und lacht, während nebenan ein Mensch dem Tod entgegensieht.
»Warum bringt ihr sie nicht ins Herrenhaus? Warum ist Doktor Erichsen nicht hier? Sie hat Schmerzen!«
»Ins Herrenhaus? Mein Gott, Magnus, sie ist keine Larsen, sie ist eine Bedienstete. Natürlich bleibt sie im Gesindehaus. Ihr Geschrei ist auch so schon laut genug.«
»Sie liegt im Sterben, verdammt!«
»So ist das eben. Wenn der Herr beschlossen hat, eines seiner Schäfchen zu sich zu holen, was kann der Mensch da …«
»Halt deinen Mund, ich kann dein bigottes Gerede nicht ertragen! Redest du so auch über deine Söhne, die im Krieg geblieben sind?«
Friedrich Larsen erhebt sich aus seinem Sessel und greift zu einem Krückstock. Das Gehen fällt ihm schwer.
»Bigott?«, sagt er, als er vor seinem Ältesten steht. »Wer hat sich denn all die Jahre um sie gekümmert? Hat den Scherbenhaufen zusammengekittet, den der liebe Herr Sohn hinterlassen hat?«
»Du hast mich weggeschickt! Ans andere Ende der Welt!«
Der Alte tritt ganz nah an dich heran, so nah, dass du den Alkohol riechen kannst.
»Wenn dir immer noch so viel an der kleinen Hure liegt«, zischt Friedrich Larsen, »dann kümmere dich doch selbst um sie. Und ihren kleinen Bastard. Aber dieses Haus betrittst du nie wieder! Verstanden?« Und damit weist er zur Tür. »Geh! Verschwinde! Ich will dich nicht mehr sehen.«
Du drehst um und würdigst deinen Vater keines weiteren Blickes.
Du weißt, du wirst dein Elternhaus nie wieder betreten. Du weißt, du wirst wiederkommen.
Erster Teil
Samstag, 24. August, bis Samstag, 31. August 1935
1
Als Gerhard Brunner aus dem Bahnhof trat und in den wolkenbetupften Spätsommerhimmel blickte, fühlte er sich, als sei er gerade erst in der Stadt angekommen. Und ein bisschen so war es ja auch: Der Mann, der da auf dem Askanischen Platz stand, wie aus dem Ei gepellt in seinem sommerhellen Dreiteiler, sah völlig anders aus als der, der den Bahnhof gut zehn Minuten zuvor betreten hatte. Brunner genoss dieses Gefühl. Ein anderer zu sein. Vielleicht hatten sie ihn auch deshalb für diese Aufgabe ausgewählt. Weil er es liebte, in die Haut eines anderen zu schlüpfen, weil er es so glaubhaft erscheinen ließ, ein anderer zu sein. Dass er einen Schlag bei Frauen hatte, spielte natürlich auch eine Rolle. Aber das Entscheidende war die absolute Vertrauenswürdigkeit, die er ausstrahlte.
Auch Irene vertraute ihm, und das war das Wichtigste, wichtiger noch als ihre Liebe, die allein nichts ausgerichtet hätte. Liebe machte blind, aber sie löste niemandem die Zunge, das vermochte allein das Vertrauen. Brunner hatte viel Zeit und Geduld investiert, um Irenes Vertrauen zu gewinnen, und jetzt zahlte sich das endlich aus. Führte aber auch zu ungeahnten Schwierigkeiten. Bei ihrem letzten Treffen hatte sie tatsächlich das Thema Heirat angesprochen, vorsichtig zwar, aber unmissverständlich. So war das wohl in der heutigen Zeit, in der Frauen sich nicht schämten, auch selbst die Initiative zu ergreifen. Er war nicht darauf eingegangen, aber er hatte die Sache am nächsten Tag gleich mit seinem Vorgesetzten besprochen, und der hatte sich bereiterklärt, die nötige Summe für einen Verlobungsring bereitzustellen. Eine Investition, die sich auszahlen dürfte. Die Frage war nur, wie lange Brunner die Hochzeit würde hinauszögern können. Denn dazu war er, bei aller Liebe, nun doch nicht bereit.
Er kramte ein paar Münzen aus seinem Portemonnaie. Von einer der Blumenfrauen, die im Schatten der Vorhalle ihre Ware feilboten, erstand er einen hübschen Strauß roter Rosen, dann machte er sich, die Blumen in der Hand, die Aktentasche unterm Arm, auf den Weg zum Taxistand.
Der Lindwurm der wartenden Kraftdroschken glänzte in der Sonne. Brunner steuerte den ersten Wagen in der Reihe an, doch dessen Fahrer winkte ab, der zweite ebenso, der dritte wickelte gerade eine Stulle aus dem Butterbrotpapier und bedachte den an die Scheibe klopfenden Fahrgast mit einem Achselzucken. Berliner Taxifahrer waren eigen, diese Erfahrung hatte Brunner schon oft genug machen dürfen: Wenn sie eine Pause einlegen wollten, dann machten sie die und ließen sich dafür im Zweifel sogar eine Fuhre durch die Lappen gehen.
Weiter hinten in der Reihe stand ein Chauffeur neben seiner Kraftdroschke und winkte. Na also, dachte Brunner. Der Mann wirkte trotz seiner einladenden Geste zwar nicht gerade freundlich, doch war Freundlichkeit auch eine Gabe, die man von einem Berliner Taxifahrer nicht unbedingt erwarten durfte. Hilfsbereit war der Mann gleichwohl, er lüftete seine Chauffeursmütze und öffnete dem Fahrgast beflissen die Tür. Brunner warf die Aktentasche in den Fußraum und ließ sich in die Lederpolster fallen. Den Blumenstrauß legte er neben sich auf die Rückbank.
»Wilmersdorf«, sagte er, als der Taxifahrer hinter dem Steuer saß. »Rüdesheimer Platz.«
Der Fahrer nickte, startete den Motor und legte den Gang ein. Brunner lehnte sich zurück, nestelte eine Ernte 23 aus der Schachtel und steckte sie an.
Gemächlich zockelte das Taxi die Möckernstraße hinunter, in einem Schneckentempo, das Brunner nervös machte. Er hatte es wirklich nicht eilig, nicht sonderlich jedenfalls, doch ein solches Geschleiche konnte er einfach nicht ertragen. Normalerweise hetzten Berliner Taxifahrer durch die Straßen ihrer Stadt, als seien sie auf der Flucht, doch dieser hier fuhr, als wäre er auf dem Weg zu seinem Zahnarzt und wolle am liebsten niemals ankommen.
Brunner klopfte gegen die Trennscheibe. »Drücken Sie ruhig mal ein bisschen auf die Tube«, sagte er, im freundlichsten Tonfall, zu dem er trotz seiner Gereiztheit imstande war. »Soll Ihr Schaden nicht sein.«
Der Fahrer reagierte nicht. Weder sagte er etwas, noch fuhr er schneller. Mit sturem Blick unterquerte er die Hochbahn am Landwehrkanal. Die Fahrbahn der Möckernbrücke vor ihnen war völlig frei und bot keinerlei Anlass, sie mit höchstens zwanzig Stundenkilometern zu überqueren. Sie wurden so langsam, dass sie sogar von einem Radfahrer überholt wurden, dann von einer anderen Kraftdroschke, und Brunner wünschte sich, er säße im überholenden Taxi und nicht in diesem. Warum nur war er ausgerechnet an diesen Lahmarsch geraten? Irene konnte ruhig eine Weile warten, so etwas schadete nicht, er wusste, dass sie ihn umso inniger empfangen würde, wenn er sich ein wenig verspätete. Wichtiger war es, die Post noch rechtzeitig vor der nächsten Leerung am Rüdesheimer Platz einzuwerfen. Er nutzte den Briefkasten dort, so oft es ging; die Kästen in der Nähe des Büros und rund um den Anhalter Bahnhof waren nicht sicher. Das Forschungsamt hörte nicht nur Telefone ab.
»Haben Sie Petersilie in den Ohren, Mann?«, herrschte er den Fahrer an. »Nun fahren Sie schon schneller! Wofür bezahle ich Sie eigentlich?«
Der Fahrer drehte sich kurz um und schaute ihn an, wachsbleich im Gesicht, Schweißperlen auf der Stirn, dabei war es gar nicht mehr warm, die Sonne war hinter den Wolken verschwunden.
»Oder geht es Ihnen nicht gut?«, fragte Brunner.
»Wie?«
Die Stimme des Fahrers klang heiser und, ganz im Gegensatz zu seiner Fahrweise, seltsam gehetzt, fast hektisch.
»Sie sehen krank aus. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, fahren Sie doch rechts ran und ruhen sich aus. Ich finde schon eine andere Taxe.«
»Nein, nein!«
Der Fahrer schüttelte den Kopf, derart energisch, als könne er sich alles vorstellen, nur eines nicht: rechts ranzufahren und seinen Fahrgast wieder aussteigen zu lassen.
Und endlich, endlich gab er nun Gas. Das Taxi beschleunigte spürbar, Brunner wurde in den Sitz gedrückt. Sie wurden schneller und schneller. Der Taxifahrer schaltete hoch und trat das Gaspedal durch. In halsbrecherischem Tempo rasten sie die Möckernstraße hinunter, dass die Bäume am Straßenrand nur so an ihnen vorbeiflogen. Instinktiv hielt Brunner seinen Hut fest, obwohl das Verdeck geschlossen war. An was für einen Fahrer war er hier verdammt noch mal geraten? Schnecke oder Windhund, und dazwischen gab es nichts?
Die Ampel an der Yorckstraße kam in Sicht. Sie sprang gerade auf Rot um, doch der Fahrer machte keinerlei Anstalten, sein Tempo zu verringern.
»Bremsen Sie, Mann! Wir haben Rot!«
Brunner klang panischer, als er wollte, er war dabei, die Beherrschung zu verlieren. Er trat mit seinem Fuß auf eine Bremse, die gar nicht da war, als könne er den Wagen so zum Stehen bringen, doch der überfuhr die rote Ampel und bog auf die Yorckstraße. Autos hupten, es grenzte an ein Wunder, dass sie mit keinem anderen Fahrzeug kollidierten.
Brunners Erleichterung darüber währte nur kurz, denn sein Fahrer gab wieder Gas und raste auf die Yorckbrücken zu. Die Panik kehrte in dem Moment zurück, als Brunner merkte, dass sie die Rechtskurve niemals schaffen würden, die sie nehmen mussten, um dem Verlauf der Straße zu folgen. Der Fahrer machte nicht einmal Anstalten, die Kurve zu fahren, stattdessen steuerte er das Taxi quer über den Fahrdamm durch den Gegenverkehr, löste ein weiteres Hupkonzert aus und nötigte einen Passanten auf dem Gehweg zum Hechtsprung.
»Bremsen Sie doch, Mann! Sind Sie wahnsinnig?«
Brunners Stimme überschlug sich, doch der Fahrer antwortete nicht. Und er bremste nicht. Saß mit weit aufgerissenen Augen und verzerrtem Gesichtsausdruck hinter dem Lenkrad, das er festhielt wie im Krampf und keinen Millimeter bewegte. Bevor Brunner sich erklären konnte, was zum Teufel da gerade passierte, spürte er den Schlag, den der Bordstein ihrem Taxi versetzte, und dann sah er auch schon die Mauer auf sich zukommen, eine jener gelb-roten preußischen Klinkermauern, die er so hasste und von denen es in dieser Stadt so viele gab. Er öffnete die Tür, als gebe es noch irgendein Entkommen, obwohl er ahnte, dass es bereits zu spät war. Den Türgriff in der Hand wandte er den Blick von der heranrasenden Mauer im letzten Moment ab, als könne er das unerbittliche Schicksal durch Wegschauen doch noch besiegen. Das Letzte, was er in seinem Leben sehen sollte, war der Blumenstrauß auf dem Rücksitz, der ihm einen eigentümlichen Trost spendete.
2
Es war einfach nur ekelhaft.
Charly wollte eigentlich gar nicht hinsehen, aber der rote Schaukasten befand sich nun einmal direkt gegenüber der Volksbadeanstalt, und in der Spiegelung des Glases konnte sie unauffällig beobachten, was auf der anderen Straßenseite geschah.
Hinter dem Glas jedoch hing die aktuelle Ausgabe des Stürmer aus, und die dicken Buchstaben der Schlagzeilen und der antisemitischen Parolen sprangen sie an wie kleine Vampire, die ihre giftigen Zähne in ihre Gedanken schlagen wollten.
Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel!
Geht nur zu deutschen Ärzten und Rechtsanwälten!
Ohne Lösung der Judenfrage keine Erlösung des deutschen Volkes!
Es war wie bei einem schrecklichen Verkehrsunfall: Sie schaute hin, obwohl sie eigentlich nicht hinsehen wollte.
Las die Schlagzeile. Jud Rennert –Der Rassenschänder in Mannheim – Wie er die Notlage einer deutschen Frau ausnützen wollte – Vom Schäferstündchen ins Konzentrationslager
Und dann die Karikatur auf der Titelseite, die einen mit allen antisemitischen Klischees ausgestatteten unrasierten und offensichtlich wollüstigen Juden an der Hotelrezeption zeigte, in Begleitung einer deutlich jüngeren blonden Frau, und darunter den Text: Keine Angst, Kindchen, lass mer nur machen, a Hotel is schließlich ka Rasseforschungsinstitut, es genügt hinzuschreiben »verheiratet« und es Paradies steht uns offen.
Neben Charly standen Menschen, die diesen antisemitischen, pornographischen und denunziatorischen Schund wirklich lasen und offensichtlich ernst nahmen. Mit zustimmendem Nicken Artikel für Artikel lasen. Und das im roten Wedding.
Da endlich kam die Frau, auf die sie gewartet hatte. Pünktlich wie jeden Sonnabend. Dunkelblauer Rock, grüner Hut. Ging die backsteinerne Fassade entlang, deren strenge Architektur auf den ersten Blick an ein Gefängnis erinnerte, hinter der sich jedoch, wie die Buchstaben über den beiden Eingängen verrieten, die Volksbadeanstalt Wedding verbarg. Verschwand dann im Gebäude, nachdem sie sich noch einmal umgesehen hatte.
Charly wartete einen Moment, bevor sie hinüberging. Ganz wohl war ihr nicht bei der Sache, zu groß war die Gefahr entdeckt zu werden, doch ihr Klient bestand darauf. Nachdem sie im Stillen und mit geschlossenen Augen einmal bis hundert gezählt hatte, überquerte sie die Straße und betrat die Badeanstalt durch den rechten Eingang, den für die Damen. Eine unangenehme Schwüle und ein stechender Geruch empfingen sie. Und eine ganz in weiß gekleidete Frau, die im Kassenkabuff saß und ihr ebenso erwartungsvoll wie unfreundlich entgegenblickte.
»Einmal bitte«, sagte Charly und zückte ihr Portemonnaie.
»Einmal wat? Schwimmen? Baden? Brausen?«
Die Frau hinter der Glasscheibe erinnerte mit ihrer stämmigen Gestalt eher an eine Gefängniswärterin als an eine Bademeisterin. Und so hörte sie sich auch an.
»Muss ich das hier entscheiden?«, fragte Charly. »Kann ich nicht einfach rein?«
»Kommt drauf an, wieviel Jeld Sie ausjeben wollen. Schwimmhalle is teurer als Wannenbad, Wannenbad teurer als Brausebad. Aber bei Schwimmhalle is Brause inklusive. Ohne Abbrausen dürfen Se jar nich ins Wasser.«
»Soso.«
»Und? Wat darf’s denn sein?«
»Das ist mir jetzt irgendwie peinlich.« Charly schaute sich um, als sei sie noch nie in ihrem Leben in einer Badeanstalt gewesen. »Aber ich bin mit einer Freundin hier verabredet … Weiß nur nicht genau wo.«
Die Frau an der Kasse sagte nichts, sie guckte nur streng.
»Martha müsste vor wenigen Augenblicken erst gekommen sein«, fuhr Charly fort, »hab sie noch hier reingehen sehen. Hab auch gerufen, aber da war sie schon drinne.« Sie schaute sich um. »Und nun ist sie nirgends zu sehen.«
»Jerade eben hier rin?« Ein kleiner Schleier des Misstrauens huschte über das Gesicht der Frau; sie schaute Charly prüfend an, ehe sie antwortete. »Is Ihre Freundin so ’ne hübsche Blonde?«
Charly nickte und lächelte.
»Die kommt jeden Sonnabend.« Die Kassenfrau riss eine Karte von der Rolle. »Einmal Wannenbad also. Um zusammen zu baden, dafür sind Se aber zu spät. Ick könnte Ihnen die Kabine nebenan jeben.«
»Das wäre nett.«
»Brauchen Se ’n Handtuch?«
»Äh, ja … bitte.«
»Denn macht det dreißich Pfennije.«
»Bitte.« Charly legte die Münzen in die Durchreiche und bekam im Gegenzug ein weißes Handtuch, eine Eintrittskarte und einen Schlüssel, der mit einer Nummer versehen war.
»Kabine hundertfuffzehn, erstet Oberjeschoss. Die Kollegin zeicht Ihnen den Weg. Is direktemang neben Ihre Freundin. Da können Se sich wenigstens unterhalten, während Se im Wasser liegen.«
Mit dem Handtuch auf dem Arm war Charly schon unterwegs zum Treppenhaus, als sie noch einmal gerufen wurde.
»Frollein?«
»Ja?«. Sie drehte sich um.
»Kenn ick Sie nich irjendwoher?« Die Frau an der Kasse musterte sie eindringlich. »Na sicher, Sie sind bei Blum und Scherer, nich wahr? Anwaltsjehilfin, stimmt’s?«
Charly fühlte sich ertappt, aber sie ließ sich nichts anmerken. Sie nickte. Und lächelte.
»War mal bei Ihnen«, fuhr die Kassenfrau fort. »Wejen unsere Mieterhöhung. Wissen Se noch? Der Doktor Scherer hat uns da sehr jeholfen.«
»Freut mich.«
»Jrüßen Se man schön, den Herrn Doktor.«
»Gerne. Von Frau …«
»Schwaak. Else Schwaak.« Sie lächelte. »Kommen Se nächstes Mal zusammen mit Ihre Freundin, dann kriegen Se ’ne jemeinsame Kabine. Spart baret Jeld.«
Sie zwinkerte verschwörerisch, als habe sie gerade Geheimwissen verraten.
Charly drehte wieder um. Als sie die Treppen hochstieg, endlich außer Sichtweite der Kassenfrau, fluchte sie leise vor sich hin. Das war nur passiert, weil diese dämliche Observierung sie in die Nähe der Kanzlei führte! Ausgerechnet einer Mandantin von Blum & Scherer über den Weg zu laufen!
Die Bademeisterin, die sie oben empfing, die Karte kontrollierte und ihr die richtige Kabine zuwies, war weniger redselig. Dafür jünger und hübscher als ihre Kollegin an der Kasse.
»Ick klopfe, wenn Ihre Zeit abjeloofen is. Denn haben Se noch fünf Minuten.«
Das war alles, was sie sagte, als sie Kabine 115 öffnete.
Charly nickte und schloss ab. Während das Wasser in die Wanne lief, schaute sie sich um. Einfache Holzwände trennten die Badekabinen voneinander, Wände, die nicht zum Boden reichten, sondern aufgeständert waren und eine Lücke von einigen Zentimetern ließen, damit man den Fliesenboden besser wischen konnte.
Das einlaufende Wasser machte anständig Lärm. Charly hockte sich auf den Boden und lugte durch den Spalt zu ihrer Linken. Auf dem hölzernen Hocker neben der Wanne lagen ordentlich gefaltete Kleidungsstücke. Sie erkannte den dunkelblauen Rock wieder, den sie eben noch im spiegelnden Glas des Stürmerkastens gesehen hatte. Bis der Rock mit seiner Trägerin im Volksbad verschwunden war, wie jeden Sonnabend. Was Charly bereits gewusst hatte, bevor es die Kassenfrau ihr verraten hatte.
Die Sonnabendnachmittage waren die einzigen dunklen Flecken, die es im Leben von Martha Döring noch gab. Ansonsten wussten sie mehr oder weniger lückenlos Bescheid über den Alltag und die Gewohnheiten der Frau, einer hübschen Mitdreißigerin. Über eine Stunde verbrachte sie jeden Sonnabend in der Badeanstalt, und niemand wusste, was sie dort tat. Dass sie ausgerechnet dort den heimlichen Liebhaber traf, dessen Siegmund Döring, ihr Ehemann, sie verdächtigte und dessentwegen er die Detektei Böhm engagiert hatte, das hielten weder Charly noch ihr Chef Wilhelm Böhm für wahrscheinlich, so streng wurden die Geschlechter hier voneinander getrennt; es gab sogar zwei Schwimmhallen, eine große für die Herren, eine kleinere für die Damen. Deswegen hatten sie bei ihren bisherigen Observierungen immer geduldig im Café gegenüber gewartet, bis Martha Döring wieder aus der Badeanstalt gekommen war, und hatten die Beobachtung erst dann wieder aufgenommen.
Doch das reichte Siegmund Döring nicht. Bei seinem jüngsten Besuch hatte der eifersüchtige Ehemann darauf bestanden, seiner Frau ins Bad zu folgen, also hatte Charly diese Aufgabe übernommen.
Sie holte die kleine Kamera aus der Handtasche und ihren Schminkspiegel, legte den Spiegel auf den Boden und probierte so lange herum, bis der Winkel stimmte und sie die Nachbarkabine, den Stuhl mit der Kleidung und die Kabinentür im Blick hatte, ohne sich auf den Boden hocken zu müssen. Dann setzte sie sich auf den Wannenrand und spannte die Kamera.
Charly kam sich schäbig vor, aber was sollte sie tun? Sie hatte die Spesenrechnung um dreißig Pfennige erhöht, nun brauchte sie auch Beweismaterial. Und wenn es eben der Beweis wäre, dass Martha Döring sich einmal in der Woche ausgiebig ihrer Körperpflege widmete. Vielleicht gab ihr eifersüchtiger Klient dann endlich Ruhe. Charly fand den Kerl unerträglich, aber Männer wie Siegmund Döring brachten der Detektei Böhm nun einmal das Geld.
Die Wanne war beinahe voll, und Charly drehte den Wasserhahn zu. Das Nachplätschern der letzten Tropfen erinnerte sie daran, dass es ratsam wäre, ein paar Geräusche zu machen, die vortäuschten, dass auch in Kabine 115 jemand in der Wanne lag. Sie zog Schuhe und Strümpfe aus und planschte ein wenig herum. Danach musste sie erst einmal das Kameraobjektiv wieder freiwischen. Auch der Spiegel auf dem Boden war beschlagen.
Sie lauschte. Aus der linken Kabine war leises Plätschern zu hören und noch leiseres Summen. Martha Döring schien sich wohlzufühlen. Und Charly saß in der Kabine nebenan auf dem Wannenrand, in der Hand einen Fotoapparat, und fühlte sich völlig fehl am Platz. Vielleicht wäre es sinnvoller, die gut zwanzig Minuten, die ihr noch blieben, für ein Wannenbad zu nutzen und den Fotoapparat wieder einzupacken.
Die warme feuchte Luft machte sie schläfrig, bis ein Klopfen sie hochschrecken ließ. War ihre Zeit etwa schon abgelaufen? Nein, das kam von nebenan, in der Nachbarkabine regte sich etwas. Sie hörte ein Poltern und Plätschern: Martha Döring stieg aus der Wanne.
Charly schaute in den Schminkspiegel und konnte nasse nackte Beine sehen. Hörte, wie der Riegel zurückgeschoben wurde, sah, wie die Tür sich öffnete, dann ein weiteres Paar Beine, Stoffschuhe mit Gummisohle, den Saum eines weißen Kittels. Sie rutschte vom Wannenrand, versuchte, einen günstigeren Blickwinkel zu finden, um das Gesicht der Besucherin zu erkennen. Es war dieselbe Bademeisterin, die ihr die Kabine zugewiesen hatte.
Musste man hier nachlösen, wenn man zu lange badete? Das fragte sich Charly noch, da sah sie, wie die Bademeisterin die Kabinentür wieder zuzog und verriegelte. Von innen.
Die nackten Füße und die weiß beschuhten standen sich für eine Weile gegenüber. Charly lauschte angestrengt, doch kein Wort wurde gesprochen. Sie brachte die Kamera in Anschlag.
Und sah durch den Sucher, was die beiden Frauen machten.
Es war nicht das, was Charly erwartet hatte. Eigentlich hatte sie überhaupt nichts erwartet an diesem Ort. Hatte den Fall für abgeschlossen gehalten, die Eifersucht ihres Klienten für krankhaft und seinen Verdacht für Einbildung. Aber es war keine Einbildung. Martha Döring betrog ihren Siegmund tatsächlich. Allerdings nicht mit einem anderen Mann.
3
Draußen wurde eine Autotür zugeschlagen, und sie schob die Gardine beiseite und schaute hinaus. Zum wievielten Male jetzt eigentlich schon? Irene Schmeling kannte sich selbst nicht wieder. Verhielt sich schon wie die Paulus aus der zweiten Etage, die, ein Kissen unter die Ellbogen gelegt, den halben Tag aus dem Fenster glotzte, weil sie nichts Besseres zu tun hatte.
Die Straße war immer noch leer, bis auf den Kohlewagen, der vor dem Haus gegenüber entladen wurde, die Kinder, die an der Ecke Ahrweilerstraße Nachlaufen spielten, und Doktor Schröder aus der Dritten, der gerade seinen Wagen abschloss.
Weit und breit keine Kraftdroschke. Wo blieb Ferdi nur? Seit sie ihn kannte, war er immer pünktlich gewesen.
Sie wollte es sich nicht eingestehen, aber so langsam fragte sie sich, ob er überhaupt noch kommen würde. Ob sie womöglich zu weit gegangen war beim letzten Mal. Sie hatte das Thema Heirat angesprochen, vorsichtig natürlich und ganz allgemein, doch sein Blick hatte ihr gezeigt, dass er verstanden hatte. Er hatte genickt. Nachdenklich. So, als verstehe er ihre Gedanken. Als wisse er genau, was sie damit sagen wolle. Dass es nun ernst geworden war zwischen ihnen. Und er hatte nicht so ausgesehen, als habe ihn dieser Gedanke erschreckt. Ganz im Gegenteil.
Sie hatte nicht anders gekonnt. Nie hatte sie einen Mann so geliebt wie diesen Handlungsreisenden, den es ein- bis zweimal die Woche nach Berlin verschlug und den sie nun schon seit fast einem Jahr regelmäßig traf.
Und nun? Hatte sie ihn mit ihren unbedachten Worten in die Flucht getrieben? Sie konnte es sich einfach nicht vorstellen. Nicht nach dem Blick, den er ihr zum Abschied zugeworfen hatte. Aus irgendeinem Grund wusste sie, dass er Ringe besorgt hatte. Dass er ihr den ersehnten Antrag machen würde. Sie wusste es einfach.
Und gerade deshalb spürte sie einen Stich im Herzen, wenn sich der Gedanke nach vorne drängte, dass es vielleicht doch nicht so war. Dass er sie sitzengelassen hatte. Dass sie ihn mit ihren Worten, ihren viel zu forschen, einer Frau nicht zustehenden Worten in die Flucht getrieben hatte.
Sie stand am Fenster, schaute auf die Straße, auf der einfach kein Taxi halten wollte, und spürte, wie ihr die Tränen kamen.
Dumme Pute!
Was, wenn sein Zug ganz einfach Verspätung hatte? Sein Taxi im Verkehr steckengeblieben war? Wollte sie ihn dann mit verweinten Augen empfangen? Reiß dich zusammen, Heulsuse!
Eine innere Stimme sagte ihr, dass es nicht sein konnte, dass er sie nie und nimmer einfach so schnöde sitzen ließe. Und je mehr sich diese Zuversicht in ihr festsetzte, desto unbarmherziger wuchs die Sorge, ihm könne etwas zugestoßen sein. Und diese Sorge machte das Warten noch unerträglicher.
Verdammt, werde jetzt nicht hysterisch! Wie oft hat die Reichsbahn Verspätung? Manchmal fallen doch sogar ganze Züge aus! Habe einfach ein wenig Geduld! Er wird schon noch kommen, und dann wird sich alles aufklären! Und reiß dich verdammt nochmal zusammen!
Sie trat vom Fenster zurück und polierte noch einmal die Kaffeetassen, die nun seit über einer Stunde schon auf dem Tisch standen und darauf warteten, gefüllt zu werden.
Der Marmorkuchen, den sie gestern Abend gebacken und für den sie die letzte Ecke Butter geopfert hatte, wurde immer trockener.
4
Schwarzgraues Verdeck, dunkelgrünes Chassis, schwarz-weiße Karostreifen – ohne Frage eine Kraftdroschke. Von dem Wagen war allerdings nur das Heck zu sehen, die vordere Hälfte schien in der Mauer verschwunden zu sein. Als sie die Unfallstelle passierten, konnte Rath erkennen, dass die Kühlerhaube zusammengeschoben worden war, als sei sie aus Pappe.
»Muss ganz schön geknallt haben«, sagte er.
»Ich weiß schon, warum ich kein Taxi fahre«, erwiderte Czerwinski.
Der Kriminalsekretär saß auf dem Beifahrersitz und hielt den Fotoapparat zwischen den Knien. Einen Kofferraum besaß Raths Buick nicht, auch keine Rückbank.
»Na, in ’nem Taxi müsstest du wenigstens die Kamera nicht auf den Schoß nehmen.«
»In ’nem Dienstwagen auch nicht.«
Das Mordauto hätten sie ohnehin nicht bekommen, doch Rath hatte auch keinen anderen Dienstwagen nehmen wollen. Weil er nicht vorhatte, heute noch einmal in die Burg zurückzukehren. Eigentlich wäre er jetzt schon auf dem Weg nach Hause. Hätte er nicht den Fehler begangen, kurz vor Feierabend noch ans Telefon zu gehen. Czerwinski, den er dazu verdonnert hatte mitzukommen, hatte nicht die allerbeste Laune.
Die Kraftdroschke war frontal gegen die massive Backsteinmauer geprallt, die auf Kreuzberger Seite den Beginn der Yorckbrücken markierte, an jener Stelle, wo die breite Yorckstraße einen Rechtsknick machte und sich verjüngte, um auf den nächsten fünfhundert Metern mehr als vierzig stählerne Stege zu unterqueren, sämtliche Schienenstränge, die zum Anhalter und Potsdamer Bahnhof führten. Wie es aussah, war das Taxi, anstatt der Rechtskurve zu folgen, einfach geradeaus weitergefahren.
Rath parkte den Buick am Straßenrand und stieg aus. Rechts neben dem Wrack lagen zwei Leichen auf dem Asphalt, bedeckt von Leinentüchern. Vier, fünf Schupos sicherten die Unfallstelle, wimmelten Neugierige ab, leiteten den Verkehr um und lotsten Fußgänger auf die andere Straßenseite.
»Mach du schon mal ein paar Fotos«, sagte Rath zu Czerwinski, der sich gerade aus dem Beifahrersitz schälte, »ich rede mit den Blauen. Mit ein bisschen Glück sind wir in einer halben Stunde hier wieder weg.«
Der Kriminalsekretär nickte und schulterte die Kamera. Rath zündete sich eine Overstolz an, inhalierte einmal tief und ging hinüber. Ein Hauptwachtmeister, der neben den Leichen stand, schaute ihm erwartungsvoll entgegen. Freute sich wohl schon, den Fall endlich den Idioten von der Kripo zuschanzen zu dürfen. Rath bemerkte einige Blutflecken an der ansonsten blitzsauberen Uniform.
»Wer hat die denn da so ordentlich hingelegt?«, schnauzte er den Blauen an, bevor der den Arm zum Deutschen Gruß heben konnte, und zeigte auf die Leichen. »Schon mal davon gehört, dass bis zum Eintreffen der Kriminalpolizei nichts anzurühren ist?«
»Melde gehorsamst, Kommissar, aber …«
»Oberkommissar!«
»Melde gehorsamst, Oberkommissar, aber glauben Sie mir: Die Sauerei hätten Sie nicht sehen wollen. Der da …« Er wies auf eine der beiden Leichen, deren Leinentuch in der Mitte blutigrot glänzte. »… ist förmlich aufgespießt worden. Von der Lenksäule. Ohne Eisensäge hätten wir den nicht aus dem Wagen bekommen.«
»Und der andere?«
»Der lag schon ungefähr da, wo er jetzt liegt. Muss aus dem Wagen geschleudert worden sein, dann gegen die Mauer geprallt und schließlich auf den Asphalt.«
»Na, jetzt, wo Sie ihn so schön dort drapiert und zugedeckt haben, werden wir das wohl nicht mehr nachvollziehen können.«
»Es gibt einen Zeugen, der …«
»Die Zeugen werden wir schon noch befragen. Erzählen Sie mir lieber mal, warum Sie die Mordbereitschaft alarmiert haben, anstatt sich selbst um diesen Unfall zu kümmern.«
»Mit Verlaub, wir haben uns gekümmert. Laut übereinstimmender Aussage zweier Zeugen ist die Kraftdroschke ohne erkennbaren Grund gegen die Brückenmauer gefahren. Ungebremst.«
»Na, irgendeinen Grund wird es wohl gegeben haben.«
»Eben. Der Zeuge …« Der Blaue blätterte in seinem Notizbuch. »… Der Zeuge Doktor Gebhardt sagt aus, der Taxifahrer habe ihn überfahren wollen. Mit voller Absicht. Er spricht von Mordversuch.«
»Mordversuch? Wollen Sie mich veralbern?«
»Ich gebe nur wieder, was der Zeuge gesagt hat. Sagt, es habe nicht viel gefehlt, und er würde tot auf dem Gehweg liegen. Sagt, er habe sich nur mit einem beherzten Sprung retten können.«
»Hm. Und die Toten da? Schon identifiziert?«
»Nur den Fahrer, Oberkommissar. Hatte einen Ausweis in der Joppe. Und einen Führerschein. Hier.«
Rath nahm die Dokumente entgegen. Ein Lichtbildausweis der Vereinigten Kraftdroschkenbesitzer Groß-Berlins, ausgeschrieben auf den Namen Lehmann, Otto. Der Mann auf dem Foto trug eine Schirmmütze und mochte etwa vierzig Jahre alt sein. Auf dem Führerschein prangte ein Abzug desselben Fotos.
»Det is der da«, sagte der Schupo und zeigte auf die rechte Leiche. Die mit dem blutdurchtränkten Tuch.
»Und der andere?«, fragte Rath.
»Da ham wer noch nüscht. In seiner Brieftasche war nur Geld. Und ein Schlüssel.«
»Zeigen Se mal.«
Der Schupo reichte ihm ein Portemonnaie, in dem sich knapp dreißig Mark Kleingeld befanden und ein kleiner silbriger Schlüssel. In das Metall war die Nummer 57 eingraviert, sonst nichts.
»Haben Sie ’ne Ahnung von welchem Schließfach der sein könnte?«, fragte Rath.
Der Schupo betrachtete den Schlüssel und zuckte die Achseln. »Von überall und nirgends. Irgendein Bahnhof, irgendeine Bank. Vielleicht auch vom Flughafen.«
»Sonst noch was in den Taschen?«
»Ne Schachtel Zigaretten. Ein Feuerzeug. Und das hier.«
Der Hauptwachtmeister fummelte ein kleines Etui aus seiner Manteltasche und öffnete es.
»Ein Ring?«
Der Schupo nickte. »Wir vermuten, der Herr war unterwegs zu einer Dame. Haben auch Blumen im Taxi gefunden.«
»Überlassen Sie das Vermuten mal lieber der Kripo«, sagte Rath. »Und sorgen Sie dafür, dass die Asservate ordentlich eingetütet und beschriftet werden.«
»Auch die Zigaretten?«
»Natürlich. Alle.«
»Jawohl, Oberkommissar!«
Der Wachtmeister salutierte.
Rath hockte sich zu der unbekannten Leiche und schlug die Leinendecke zurück. Der Mann war Ende zwanzig, Anfang dreißig und hatte ein hübsches Gesicht, das bis auf eine hässliche Platzwunde nahezu unversehrt geblieben war. In dem feinen Sommermantel wirkte die Leiche sogar beinah elegant, war jedoch so bleich, wie das nur Tote sein können. Außerdem bildeten Kopf und Hals einen ungesund aussehenden Winkel. Genickbruch, vermutete Rath. Und ein paar innere Verletzungen: Aus Nase und Ohren waren kleine, dünne Rinnsale Blut geflossen. Er durchsuchte die Taschen des Toten, konnte jedoch nichts finden außer einem gebrauchten Taschentuch, das die Blauen entweder übersehen oder nicht hatten anfassen wollen. Auch Rath steckte es zurück in die Hosentasche, nachdem er es mit spitzen Fingern auf ein Monogramm oder ähnliche Auffälligkeiten untersucht hatte. Nichts dergleichen. Kaufhausware.
»Mach mal ’n Foto von den beiden hier«, rief er Czerwinski zu, der den Fotoapparat gerade aufs Stativ pflanzte, und zog die Decke von der anderen Leiche. Dieser Mann war wesentlich schlimmer zugerichtet, der Brustkorb, an dem das Leinentuch schon festzukleben begann, eine einzige schwarzrot blutige Masse, aus der vereinzelt das Weiß der Rippenknochen schimmerte. Die Sauerei hätten Sie nicht sehen wollen. Rath spürte, wie ihm übel wurde, und bedeckte den offenen Brustkorb, schaute sich das Gesicht des Toten an, das durch unzählige Schnittwunden entstellt war. Die Augen jedoch waren unverletzt geblieben und starrten ins Leere. Trotz der Verletzungen erkannte er den Mann vom Passfoto.
Er deckte die Leiche wieder zu, stand auf und wandte sich noch einmal dem Schupo zu. »Wo ist denn dieser Zeuge, den man angeblich ermorden wollte?«, fragte er.
»Doktor Gebhardt?« Der Hauptwachtmeister zeigte auf zwei Zivilisten, die bei einem Schupo unter der Brücke standen. »Da. Der mit der Brille.«
Rath schnippte seine Zigarette aufs Trottoir und ging hinüber. Er gab sich keine Mühe, seine schlechte Laune zu verbergen. Ein tödlicher Verkehrsunfall war normalerweise keine Sache für die Zentrale Mordinspektion. Wenn der Revierpolizei jedoch, die immer als erste vor Ort war, irgendetwas spanisch vorkam, schaltete sie die Kripo ein. In diesem Fall also ein abstruser Mordvorwurf.
Er trat zu den drei Männern und zückte seine Marke.
»Kriminalpolizei«, sagte er, ohne zu grüßen und sich vorzustellen. Er hasste den Deutschen Gruß, zu den ihn die Dienstvorschriften eigentlich verpflichteten. Da war er lieber unhöflich und grüßte gar nicht. Man musste ja nicht jeden Blödsinn mitmachen, der den Nazis so einfiel.
»Wer von Ihnen ist denn Herr Gebhardt?«, fragte er die Zeugen, obwohl er es bereits wusste.
»Doktor Gebhardt«, sagte der Brillenmann. »So viel Zeit muss sein.«
»Mediziner?«
»Wo denken Sie hin? Philologe.«
Gebhardt sagte das, als habe Rath ihn mit seiner Vermutung beleidigt.
»Herr Gebhardt, Sie haben den Kollegen gesagt, man habe Sie töten wollen?«
»So ist es! Ich bin um ein Haar einem Mordanschlag entgangen, Herr Kommissar.«
»Oberkommissar. So viel Zeit muss sein.«
Gebhardt stutzte, sagte aber nichts.
»Wer wollte Sie denn ermorden?«, fuhr Rath fort. »Und vor allem: wie?«
Gebhardt wies auf die Leiche des Taxifahrers. Er machte ein Gesicht, als verpetze er jemanden auf dem Schulhof.
»Dieser Mann dort«, sagte er, »ist mit seinem Kraftwagen mit voller Absicht auf den Gehweg gerast. Direkt auf mich zu. Ich konnte mich nur retten, indem ich zur Seite gehechtet bin. Möchte nicht wissen, wieviele blaue Flecken ich mir dabei geholt habe. Und hier – schauen Sie …«
Er zeigte auf seinen Mantel, dessen rechte Seite völlig verschmutzt war und feucht glänzte.
»Sie haben sich genau an der Stelle befunden, wo das Taxi den Gehweg gekreuzt hat, bevor es gegen die Mauer geprallt ist?«
Gebhardt nickte. »Ich bin sicher, der Mann wollte mich überfahren. Wie grimmig der mich angeschaut hat!«
»Grimmig?«
»Na, eben wie jemand, der einen töten will.«
Rath beherrschte sich. Da stand der Mann, der ihm den Feierabend mit hanebüchenen Mutmaßungen versaut hatte, aber er beherrschte sich.
»Zeigen Sie mir doch bitte, wo genau Sie sich befunden haben, als sich der Unfall ereignete«, sagte er.
»Na, eben dort.«
Gebhardt wies auf den Gehweg knapp neben dem Taxiwrack.
»Und Sie sind in diese Pfütze dort gehechtet?«
Der Zeuge nickte. »Und dann hat es auch schon geknallt.«
»Wenn ich das richtig verstehe, ist der Wagen in gerader Linie vom Fahrdamm über den Gehweg gefahren und dann gegen die Mauer geprallt.«
Gebhardt nickte.
»Vielleicht hat die Lenkung blockiert«, sagte Rath. »Und der Fahrer konnte gar nicht anders, als gegen die Mauer zu fahren.«
»Und warum«, sagte Gebhardt und hob seinen Zeigefinger, »hat er dann nicht gebremst? Sondern im Gegenteil sogar Gas gegeben?«
Rath wandte sich dem anderen Zeugen zu, der ein paar Jahre jünger war als der Doktor und weniger gut gekleidet.
»Können Sie das bestätigen, Herr …?«
»Brückner, Oberkommissar. Der Schutzmann hier hat meene Personalien bereits …«
»Nun, Herr Brückner, stimmt das? Hat der Fahrer wirklich Gas gegeben?«
»Jawohl, Oberkommissar. Man hat den Motor richtig aufheulen jehört.«
»Hm«, machte Rath und kratzte sich am Kinn. »Vielleicht hat er in Panik die Pedale verwechselt. Das kommt vor.«
»Nein, nein …« Gebhardt schüttelte den Kopf. »Herr Oberkommissar, ich bin mir völlig sicher: Der Taxifahrer hat nicht panisch geguckt, sondern grimmig. Der hatte es auf mich abgesehen! Der wollte mich umbringen!«
»Nur war er damit offensichtlich nicht sehr erfolgreich. Schließlich liegt er da tot auf dem Pflaster und kein Doktor Gebhardt.«
»Aber erlauben Sie!«
»Nehmen wir mal an, er hätte sich wirklich nur dumm angestellt: Warum hätte er Sie ermorden wollen? Was hatte er für ein Motiv?«
»Was fragen Sie mich? Sie sind der Polizist.«
»Kannten Sie den Taxifahrer denn?«
»Woher? Noch nie gesehen.«
»Und warum sollte es ein Mann, den Sie nicht kennen, auf Sie abgesehen haben?«
»Vielleicht waren das ja Kommunisten«, sagte Gebhardt und deutete auf sein Revers, an dem das Parteiabzeichen prangte.
»Ein Kommunist, der bei dem Versuch, ein verdientes Mitglied der Bewegung zu überfahren, sich selbst und auch noch seinen Fahrgast tötet – wollen Sie mir das wirklich erzählen? Wissen Sie eigentlich, welche Konsequenzen das hätte?«
Gebhardt wusste es offensichtlich nicht, er schaute Rath fragend an.
»Wenn Sie, lieber Doktor Gebhardt, allen Ernstes behaupten, dass dieser Verkehrsunfall eigentlich ein politischer Mordanschlag gewesen ist, wäre ich gezwungen, die Gestapo zu alarmieren. Dann müssten Sie den Kollegen in der Prinz-Albrecht-Straße erklären, warum Sie zum Ziel eines politischen Anschlages geworden sind.«
Gebhardt war beim Wort Gestapo zusammengezuckt. Auch ein linientreuer Nazi hatte mit der Geheimen Staatspolizei lieber nichts zu tun, wenn es denn irgendwie zu vermeiden war.
»Ich behaupte gar nichts«, sagte er und wirkte deutlich kleinlauter als zuvor, »ich weiß nur, dass der Mann mit Absicht auf den Gehweg gefahren ist. Das konnte man sehen.«
»Und was ist mit Ihnen, Herr Brückner? Konnten Sie das auch sehen?«
»Ick kam ja von da drüben, von der S-Bahn. Hab überhaupt keene Jesichter jesehen.« Der andere Zeuge zuckte die Achseln. »Aber eines kann ick bestätigen: Der hat nicht gebremst, sondern noch Gas gegeben. Is mit ’nem Affenzahn quer über die Straße auf den Gehweg gerast … Bevor ick verstand, wat da los is, kam ooch schon der Knall. So laut, det gloobt man gar nich. Icke sofort hin, dachte zuerst, diesen Herrn hier hätt’s ooch erwischt, aber der lebte ja. Hab noch versucht zu helfen, aber da war nüscht mehr zu machen. Der da auffem Trottoir lag, der war mausetot, is gegen die Mauer geflogen, das hat er wohl nich überlebt. Vom Taxifahrer jar nich zu sprechen, det war ein einzijet Massaker da uffem Fahrersitz. Hab ja ville jesehen im Weltkrieg, aber sowat … ne! Ja, und dann kam ooch schon die Polente – also: Ihre Kollegen. Und seitdem steh’n wer hier.«
»Vielen Dank erst einmal, die Herren.« Rath gab den Zeugen seine Karte. »Montag um elf erwarte ich Sie beide in meinem Büro. Wenn der Wachtmeister Ihre Personalien hat, können Sie jetzt gehen.«
»Danke, Oberkommissar.«
Brückner tippte an seine Schirmmütze und überquerte die Straße. Gebhardt, der promovierte Querulant, wirkte unschlüssig.
»Was ist denn noch?«, fragte Rath.
»Na, mein Mantel.«
»Wie?«
»Schauen Sie sich den doch mal an.«
»Das habe ich bereits. Der ist schmutzig. Und?«
»Und? Ja, wer zahlt mir denn da die Reinigung?«
»Wenn Sie keine anderen Sorgen haben, können Sie ja mal bei der Taxi-Innung nachfragen.«
Rath ließ den Mann stehen und ging zum Unfallwagen hinüber. Das Taxi, eigentlich ein stabiler Wagen, war durch den Aufprall auf wenig mehr als die Hälfte seiner Größe gestaucht, die Kühlerhaube eingedrückt, die Vorderachse verbogen und derart unter die Karosserie geschoben, dass von den Vorderrädern kaum noch etwas zu sehen war. Umso unheimlicher wirkte das Heck, das einen völlig unversehrten Eindruck machte. Bis auf die Tatsache, dass sämtliche Fenster zu Bruch gegangen waren.
Czerwinski war mit den Leichen durch und schon dabei, das Wrack von allen Seiten zu fotografieren. Mechanisch und in aller Gemütsruhe, ohne groß nachzudenken, so wie er jeder Arbeit nachging. Der Kriminalsekretär fotografierte auch weiter, als Rath zur Fahrertür ging, um einen Blick in den Wagen zu werfen.
»Mensch, Paul, du sollst nicht mich bei der Arbeit fotografieren, sondern den Tatort! Mach mal ’ne kleine Pause oder such dir ein anderes Motiv.«
Die Entscheidung fiel Czerwinski leicht. Der Kriminalsekretär kramte seine Zigaretten aus dem Mantel und ging zu den Schupos hinüber. Der Dicke liebte Zigarettenpausen.
Der Fahrersitz bot keinen schönen Anblick, er war voller Blut und voller Scherben. Auf dem Gehweg neben dem Auto lag eine blutbeschmierte Metallstange, die eine frische Sägekante aufwies. Rath spürte ein flaues Gefühl in der Magengegend, als er realisierte, dass dies das Stück der Lenkstange sein musste, das die Schupos aus dem Brustkorb von Otto Lehmann gezogen hatten.
Er wandte sich lieber dem Wagenfond zu, der nahezu unversehrt wirkte. Von außen jedenfalls. Vom Sitzpolster der Rückbank war allerdings vor lauter Glassplittern kaum noch etwas zu sehen. Langstielige Rosen verteilten sich im gesamten Fahrgastraum wie ein Mikadospiel. Einige waren auch neben dem Wagen gelandet. Im Fußraum entdeckte er eine schwarzlederne Aktentasche, die unter den Sitz gerutscht sein musste und dort festklemmte. Rath musste kräftig ziehen, um sie zu befreien. Sie sah so gut wie unversehrt aus. Wie zerbrechlich doch so ein Mensch ist, dachte er. Zwei Männer sterben, und diese Tasche bekommt nicht einmal einen Kratzer ab.
Er wischte die Scherben vom Leder und suchte nach einem Namensschild oder ähnlichem, doch alles, was er fand, waren eine Schachtel Asbachbohnen und ein großer brauner Briefumschlag, die sauber voneinander getrennt in der Tasche verstaut waren. Ein frankierter, aber nicht gestempelter Großbrief, adressiert an eine Familie E. Seitz, Schwabach, Nürnberger Straße 38. Er drehte den braunen Umschlag mehrfach um, doch nirgendwo war ein Absender vermerkt.
Natürlich durfte er das nicht, dennoch öffnete Rath den Brief kurzerhand. Sollte er dort den Namen des Absenders finden, könnte ihnen das viel Zeit sparen. Und was störte es einen Toten, wenn man dessen Postgeheimnis missachtete? Den Kollegen würde er einfach erzählen, der Umschlag sei durch die Gewalt des Unfalls zerrissen.
So dachte er, während er den Brief öffnete, doch keine Minute später verfluchte er seine Leichtfertigkeit.
Die erste Ahnung, etwas falsch gemacht zu haben, überkam ihn, als er den Aufdruck Geheime Reichssache auf den beiden Aktenmappen las, die er aus dem braunen Umschlag zog. Die Ahnung wurde zur Gewissheit, als er eine der Mappen aufschlug und schon beim ersten Überfliegen des Textes auf den Namen Hermann Göring stieß.
Verdammt!
Rath klappte die Akte wieder zu, als könne er seine Tat dadurch ungeschehen machen. Sein Atem ging schnell, das Blut schoss ihm in den Kopf, er fühlte sich, als sei er bei irgendetwas erwischt worden. Obwohl niemand sehen konnte, was er da tat und in der Hand hielt.
Geheimakten. Weiß Gott woher. Aber das spielte auch keine Rolle. Ebenso war es völlig unerheblich, dass Rath noch keinen zusammenhängenden Satz gelesen hatte und gar nicht wusste, worum es ging. Er hatte unbefugt geheimes Material geöffnet, das auf irgendeine Weise mit Hermann Göring zu tun hatte, seinem Dienstherrn, dem zweitmächtigsten Mann im Reich.
Am liebsten hätte er den aufgerissenen Umschlag mitsamt den Akten zurück in die Tasche gelegt und so getan, als sei nichts gewesen, aber der geöffnete Brief sprach Bände, und wer würde Rath glauben, dass nicht er den Umschlag geöffnet hatte? Und selbst wenn sie ihm das abnähmen, wer würde ihm glauben, dass er sich den Brief nicht angeschaut habe? Hier ging es nicht mehr um die Verletzung des Briefgeheimnisses, hier ging es um Staatsgeheimnisse. Er hatte eine Akte gesehen, die er niemals hätte sehen dürfen, und er mochte sich nicht vorstellen, was man im neuen Deutschland mit Unbefugten anstellte, die so etwas taten.
Für große Überlegungen war keine Zeit; Rath packte die Pralinenschachtel zurück in die Aktentasche, den Brief steckte er unter seine Weste und knöpfte den Mantel zu. Er war gerade fertig, da hörte er die Stimme von Czerwinski hinter sich.
»Und? Was gefunden, Chef?«
Rath drehte sich um. Der dicke Kriminalsekretär trat seine Zigarette aus und guckte neugierig. Hatte der ihn beobachtet? Unmöglich, Rath hatte sich die ganze Zeit über den Rücksitz gebeugt mit der Wagentür als Sichtschutz.
»Nichts Besonderes«, antwortete er. »Nur eine Aktentasche. Ist alles voller Blumen und Scherben. Fotografier das mal.«
Czerwinski nickte. »Und was is mit der Tasche?« Er zeigte auf den Rücksitz.
»Na, was wohl? Die stellst du sicher, sobald du sie fotografiert hast. Und schau nach, ob du weitere Beweismittel findest, bevor du das Wrack zum Alex bringen lässt.«
»Wie?«
»Mensch, muss ich dir alles erklären? Zur Kriminaltechnik. Die sollen den Wagen auf eventuelle technische Mängel untersuchen.«
Die Enttäuschung war Czerwinski anzusehen. Er hatte gehofft, nach dem Fotografieren in den Feierabend gehen zu können. Rath wusste, dass er sich bei dem Dicken nicht unbedingt beliebt machte, aber er musste ihn loswerden.
»Ich fahr dann schon mal«, fuhr er fort. »Die Familie des toten Taxifahrers informieren.«
»Aber …« Czerwinski deutete hilflos auf den Buick. »… wie soll ich denn zurück in die Burg kommen?«
»Im Abschleppwagen ist bestimmt noch ein Platz frei.«
Rath tippte an die Hutkrempe.
Czerwinski sagte nichts mehr. Er hob die rechte Hand, ohne Rath noch einmal anzuschauen, und machte sich am Fotoapparat zu schaffen.
Unter der Brücke hatte ein Leichenwagen gehalten, aus dem zwei Herren in Schwarz stiegen. Der Hauptwachtmeister empfing die beiden mit dem Deutschen Gruß, den sie zackig erwiderten. Dann aber schüttelten sich die Männer gegenseitig die Hände wie alte Freunde.
Rath ging hinüber.
»Was soll denn das hier werden?«, fragte er den Schupo.
»Na, kennen Se doch, Oberkommissar«, sagte der Blaue und deklamierte: »Traurichsein hat keenen Zweck, Grieneisen holt die Leiche weg.«
»Das können die Herren gerne tun. Aber die Leichen hier werden nicht zu Grieneisen gebracht, sondern in die Hannoversche Straße.«
»Wie?«
»Schwer von Begriff? In die Gerichtsmedizin. Die Unfallopfer müssen selbstverständlich obduziert werden. Schon vergessen? Das hier ist eine Todesfallermittlung! Das dauert noch etwas, bevor da ein Bestatter ran darf.«
Dem Schupo war anzusehen, wie sehr ihm das gegen den Strich ging, doch er salutierte brav.
»Jawohl, Oberkommissar!«
»Für Botendienste sind wir aber nicht herbestellt«, maulte einer der Bestatter.
»Ich weiß nicht, wer Sie wozu herbestellt hat«, raunzte Rath den Mann an, »aber hier haben Sie gefälligst den Anordnungen der Polizei Folge zu leisten.«
»Und wer bezahlt uns das?«
»Lassen Sie sich die Übergabe der Leichen in der Gerichtsmedizin quittieren, dann können Sie bei der Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Kostenübernahme stellen.«
Der Bestatter warf dem Schupo einen missmutigen Blick zu. Dann trottete er mit seinem Kollegen zum Leichenwagen. Die Männer öffneten die Hecktür und holten einen Zinksarg heraus.
Der Blaue schaute drein, als habe er Magenschmerzen. Wahrscheinlich hatte Raths Eingreifen ihn um eine kleine Provision gebracht. Dennoch stand er stramm, als Rath ihn anbellte wie auf dem Kasernenhof.
»Sie sind mir dafür verantwortlich, dass das ordnungsgemäß läuft, Hauptwachtmeister! Am besten, Sie fahren mit in die Hannoversche Straße und kümmern sich persönlich darum.«
»Jawohl, Oberkommissar!«
»Und dann möchte ich Montagmorgen den Unfallbericht der Schutzpolizei auf meinem Schreibtisch sehen. Kann ich mich da auf Sie verlassen?«
»Jawohl!«
»Gut, Hauptwachtmeister. Dann darf ich mich verabschieden. Kriminalsekretär Czerwinski übernimmt den Oberbefehl hier am Tatort.«
»Kriminalsekretär Czerwinski! Jawohl!« Der Schupo salutierte ein letztes Mal und warf dann seinen Arm in die Höhe. »Heil Hitler, Oberkommissar!«
Rath winkelte seinen rechten Arm kurz an und drehte sich wortlos um. Auf dem Weg zu seinem Auto zündete er sich eine Zigarette an. Das Papier unter seiner Weste knisterte so laut, dass er glaubte, jeder müsse es hören. Er war froh, als er endlich hinter dem Steuer saß. Niemand schaute zu ihm hinüber, alles ging seinen gewohnten Gang. Die Bestatter legten die erste Leiche in den Sarg, Czerwinski hatte den Fotoapparat zusammengefaltet und damit begonnen, die Schupos herumzukommandieren. Auf der Windschutzscheibe zerplatzten erste Regentropfen. Rath startete den Motor und warf den Scheibenwischer an.
Er fuhr ziellos durch die Gegend und wusste nicht wohin. Nur dass die Familie Lehmann noch würde warten müssen, bis sie vom tragischen Tod ihres Ernährers erfuhr. Erst einmal hatte er sein Problem zu lösen.
Er brauchte eine ganze Weile, bis er endlich wusste, was zu tun war. Ganz sicher war er sich seines Planes nicht, aber einen anderen hatte er nicht. Der rettende Einfall war ihm beim Anblick eines Postbeamten gekommen, der am Halleschen Tor einen Briefkasten leerte. Kurzerhand besorgte er sich in einem Schreibwarengeschäft in der Lindenstraße ein braunes Großkuvert und eine Briefmarke und fuhr zum Köllnischen Park.
Und da saß er nun. Saß in einer ruhigen Ecke am Parkrand in seinem Auto und starrte auf den zerknitterten, aufgerissenen Umschlag auf seinem Schoß. Der Transport unter der Weste war dem braunen Papier nicht gut bekommen, kein Vergleich zu dem neuen Umschlag, der auf dem Beifahrersitz lag, jungfräulich rein und glatt und leer.
Die Briefmarke klebte bereits, er musste nur noch die Adresse in einer möglichst ähnlichen Schrift auf den neuen Umschlag übertragen, die Geheimakten hineinstecken, das Ganze zukleben und in den Briefkasten dort hinten werfen. Das war sein Plan. Die einzige Möglichkeit, die er sah, um aus der Zwickmühle, in die ihn seine Neugier gebracht hatte, wieder herauszukommen: Nur wenn die Papiere dort ankämen, wo sie ursprünglich auch hatten hingehen sollen, würde niemand Verdacht schöpfen. Seinem ersten Impuls – den brisanten Aktenfund einfach wegzuwerfen, in den nächsten öffentlichen Papierkorb oder in die Spree – hatte er zum Glück nicht nachgegeben.
Er zückte den Tintenkuli, den Charly ihm zu Weihnachten geschenkt hatte, legte den neuen auf den alten Umschlag und wollte gerade ansetzen und die Anschrift kopieren, da nahm ihm ein Schatten das Licht, und der Schreck fuhr ihm in alle Glieder. Da stand ein Spaziergänger direkt neben der Fahrertür, ein Mann, der seinen Hund ausführte. Rath wusste nicht, ob der Hundebesitzer, der seinen Blick jetzt unbeteiligt durch den Park schweifen ließ, überhaupt in den Wagen geschaut hatte, gleichwohl fühlte er sich ertappt. Als sei man ihm jetzt schon auf der Spur.
Er wartete, bis der Mann, der sich noch ein paarmal umdrehte und tatsächlich durch die Autofenster zu schielen schien, im Park verschwunden war, dann steckte er den Stift ein, packte die Kuverts unter den Mantel und stieg aus. Das Backsteingebäude drüben im Park beherbergte eine öffentliche Bedürfnisanstalt, die steuerte er an, legte der Toilettenfrau einen Groschen hin und schloss sich in der nächstbesten Kabine ein. Erst als er saß, holte er die Umschläge wieder hervor.
Hier würde ihm niemand über die Schulter schauen.
Das Imitieren der fremden Schrift ging ihm leichter von der Hand als gedacht. Schwabach, wo das wohl lag? Na, hatte ihn nicht zu interessieren. Er verglich die beiden Adressen und war zufrieden. Einer graphologischen Untersuchung würde sein Werk nicht standhalten, aber das musste es ja auch nicht; Briefumschläge landeten doch immer sofort im Papierkorb. Wichtig war, dass der Inhalt dort ankam, wo er hinsollte.
Er holte die beiden grünen Mappen aus dem aufgerissenen Umschlag. Eigentlich hatte er die beiden Akten nur in den neuen Umschlag legen und den dann zukleben wollen, doch er konnte nicht. Die beiden dunkelgrünen Hefter lagen auf seinem Schoß, und er stierte sie an. Die bettelten doch förmlich darum, aufgeschlagen zu werden. Schritte schreckten ihn auf. Er hörte, wie in der Kabine nebenan die Tür verriegelt und der Klodeckel hochgeklappt wurde.
Hastig steckte er die Akten in den neuen Umschlag, ohne noch einmal hineinzusehen. Wissen ist Macht, der alte Wahlspruch seines Vaters kam ihm in den Sinn. Nein, manchmal war Wissen einfach nur gefährlich. Menschen, die zuviel wussten, starben früher. Er leckte die Gummierung an und klebte den Umschlag zu. Nur weg damit!
Rath zog die Kette der Toilettenspülung, steckte sich die Umschläge wieder unter den Mantel, während das Wasser rauschte, und verließ die Kabine. Er wusch sich die Hände wie jeder normale Toilettenbenutzer, bedachte die Toilettenfrau mit einem freundlichen Nicken und ging zurück in den Park. Er vergewisserte sich, dass der Briefkasten am Märkischen Museum auch sonntags geleert wurde, dann warf er den Umschlag ein.