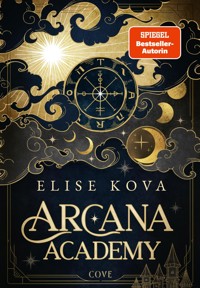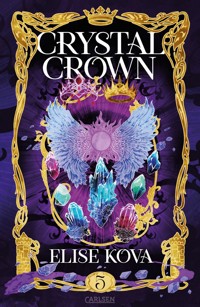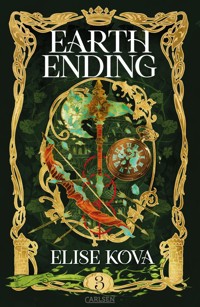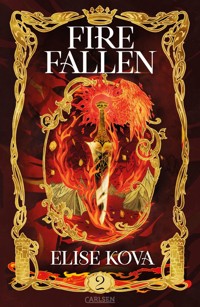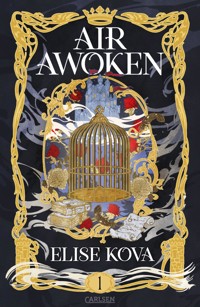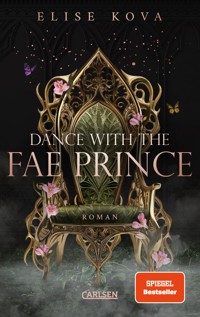
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In diesem Moment schwöre ich mir, dass ich mich weder von diesem neuen Ehemann noch von irgendjemand sonst jemals wieder kleinmachen lasse. Ich werde alles tun, um mit erhobenem Haupt durchs Leben zu gehen. An Liebe glaubt Katria nicht, dafür hat ihre Familie gesorgt. Und so erwartet sie wenig Gutes, als ihre Stiefmutter sie an den geheimnisvollen Lord Fenwood verschachert. Doch schon bald verspürt Katria eine starke Anziehung, obwohl ihr neues Leben an Fenwoods Seite voll seltsamer Regeln ist. Als sie ungewollt ein magisches Ritual beobachtet, wird Katria in die Fae-Welt entführt. Denn wie sich zeigt, ist ihr Ehemann ein Fae-Prinz – und der rechtmäßige Erbe des Thrones, auf dem ein grausamer König sitzt. Katria hat die Macht, die Fae und ihren Prinzen zu retten ... Aber zu welchem Preis? Eine gefühlvolle, prickelnde Slow-Burn-Romantasy über eine junge Frau, die ihr Herz - ohne es zu wissen - an einen Prinzen der Fae verliert. Und damit ihr Leben aufs Spiel setzt. Dance with the Fae Prince ist der zweite Band der Stand-Alone-Reihe Married into Magic. In jedem Buch steht ein anderes Paar im Mittelpunkt. Daher können die Bücher der magischen Romantasy-Reihe unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Elise Kova
Dance with the Fae Prince
Aus dem Englischen von Bettina Münch und Christiane Sipeer
An Liebe glaubt Katria nicht, dafür hat ihre Familie gesorgt. Und so erwartet sie wenig Gutes, als ihre Stiefmutter sie an den geheimnisvollen Lord Fenwood verschachert. Doch schon bald verspürt Katria eine starke Anziehung, obwohl ihr neues Leben an Fenwoods Seite voll seltsamer Regeln ist. Als sie ungewollt ein magisches Ritual beobachtet, wird Katria in die Fae-Welt entführt. Denn wie sich zeigt, ist ihr Ehemann ein Fae-Prinz – und der rechtmäßige Erbe des Thrones, auf dem ein grausamer König sitzt. Katria hat die Macht, die Fae und ihren Prinzen zu retten ... Aber zu welchem Preis?
Eine gefühlvolle, prickelnde Slow-Burn-Romantasy über eine junge Frau, die ihr Herz – ohne es zu wissen – an einen Prinzen der Fae verliert. Und damit ihr Leben aufs Spiel setzt.
Dance with the Fae Prince ist Band 2 der Stand-Alone-Reihe Married into Magic, die jeweils ein magisches Paar in den Mittelpunkt stellt.
Wohin soll es gehen?
Landkarte
Buch lesen
Danksagung
Viten
Für alle, die nachts wach bleibenund Bücher übers Küssen lesen
EINS
Als das Geld ausging, verkaufte Joyce die Gemälde, dann Vaters Silber, dann den Schmuck und die Kleider meiner Mutter und schließlich alles, was ich an Wertsachen besaß. Sie verkaufte und verkaufte, um ihre Feste und Ambitionen zu finanzieren. Verkaufte im Versuch, etwas von dem Ruhm zurückzugewinnen, der mit meinem Vater gestorben war.
Nun ist nichts mehr übrig.
Also verkauft sie heute mich an einen Ehemann.
Es wurde nicht offen ausgesprochen. Ich weiß es einfach. Ich weiß es schon über ein Jahr – ich spüre es, so wie ich einen aufziehenden Sturm spüren kann, wenn die Luft vor Erwartung knistert. Es begann mit kleinen Bemerkungen meiner Schwestern, Kleinigkeiten, hier und da. Und jedes Mal war es »unsinnig«, dass ich zwischen den Zeilen las.
Aber genau dort findet man doch die Wahrheit, im Ungesagten dazwischen.
Dann wurde es üblich, dass am Abendbrottisch vom Heiraten und von »passenden Arrangements für jemanden in meinem Alter« gesprochen wurde. Ich esse zu viel und tue zu wenig. Mich zu verheiraten, ist in geschäftlicher Hinsicht absolut sinnvoll, und Joyce ist vor allem eine Geschäftsfrau.
Die Gedanken sind so schwer und unausweichlich wie der Nebel, der über das hügelige Hochland zieht, das sich vom Anwesen meines Vaters bis hinunter zu den dichten Wäldern am Fuße des Schiefergebirges erstreckt. Seit Wochen schwebt diese Sorge über mir wie eine festhängende Wolke. Ich bewege Mistys Zügel. Sie schüttelt wiehernd den Kopf, und ich klopfe ihr den Hals. Sie kann meinen Unmut spüren.
»Ist schon gut«, versichere ich ihr. Aber ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, ob irgendetwas gut ist oder nicht. Heute wird Joyce den Mann treffen, der gegen Geld um meine Hand anhalten will. Alles steht und fällt mit den Gesprächen in einem Raum, zu dem ich keinen Zutritt habe. »Komm, Misty. Lass uns noch eine Runde durch den Wald reiten.«
Misty ist eine graue Stute, aber ich habe sie nicht nach ihrer Fellfarbe benannt. Sie wurde vor drei Jahren genau um diese Jahreszeit geboren, in den späten Herbstmonaten. Ich war die ganze Nacht bei ihrer Mutter im Stall geblieben und hatte auf sie gewartet, weil ich sichergehen wollte, dass ich der erste Mensch war, den sie sah.
Misty ist das Letzte, was ich von meinem Vater bekommen habe, ehe sein Schiff unterging.
Seitdem sind wir morgens unzertrennlich. Misty rennt mit einer Geschwindigkeit, dass es sich anfühlt, als würden meine Füße vom Boden abheben und ich mit den Vögeln durch die Lüfte sausen. Sie rennt, weil sie weiß, wie weh es tut, gefangen zu sein und tagtäglich eingeschirrt zu werden. Während wir über den nassen Untergrund fliegen und den Nebel wie ein Pfeil durchschneiden, denke ich nicht zum ersten Mal, dass wir vielleicht einfach immer weiterreiten sollten.
Vielleicht könnte ich uns beide befreien. Wir würden fortgehen … und nie mehr wiederkommen.
Wie aus dem Nichts tauchen die Bäume auf – eine dichte Reihe von Wächtern, mehr Mauer als Wald. Misty bäumt sich auf und wirft mich fast ab. Ich ziehe die Zügel an, kämpfe darum, die Kontrolle wiederzuerlangen. Dann traben wir an der Schwelle des dunklen Waldes entlang.
Mein Blick schweift suchend durch die Bäume, doch es gibt nicht viel zu sehen. Durch den Nebel und das dichte Blätterdach wirkt alles, was mehr als ein paar Schritte entfernt ist, pechschwarz. Mit leichtem Zug bringe ich Misty zum Stehen, um noch genauer hinsehen zu können, auch wenn ich gar nicht weiß, wonach ich eigentlich suche. Die Leute aus der Stadt erzählen, dass sie nachts im Wald Lichter sehen. Einige mutige Jäger, die die natürliche Grenze zwischen dem Reich der Menschen und dem der Magie zu überschreiten wagen, behaupten, sie hätten die bösen, wilden Wesen des Waldes gesehen – halb Mensch, halb Tier. Die Fae.
Ich habe den Wald natürlich noch nie betreten dürfen. Meine Handflächen sind schweißnass, ich reibe sie am dicken Baumwollstoff meiner Reithose trocken. Schon dem Wald so nah zu sein, erfüllt mich jedes Mal mit unruhiger Erwartung.
Ist es heute so weit? Niemand würde mir folgen, wenn ich in den Wald liefe. Man geht davon aus, dass Menschen, die den Wald betreten, nach weniger als einer Stunde tot sind.
Der laute Schrei unseres Hahns hallt über die sanft abfallenden Hügel. Ich schaue hinauf, in Richtung unseres Anwesens. Die Sonne reißt mit ihren schrecklich grellen Fingern den Nebel auseinander. Mein kurzer Augenblick der Freiheit ist vorüber … Es ist Zeit, mich meinem Schicksal zu stellen.
Der Rückweg dauert doppelt so lange wie der Hinweg. Es fällt mir von Tag zu Tag schwerer, mich von der belebenden Dämmerung, dem dichten Nebel und all den großen Geheimnissen, die dieser dunkle Wald birgt, zu lösen. Die Tatsache, dass unser Gut der letzte Ort ist, an den ich zurückkehren möchte, macht die Sache nicht leichter. Der Wald ist im Vergleich dazu wesentlich verlockender.
Auf halbem Weg zurück wird mir klar, dass ich heute vielleicht zum letzten Mal ausreite. Zweifellos werden die Freiheiten, die ich hier genieße – auch wenn sie auf die frühen Morgenstunden beschränkt sein mögen –, gänzlich aufhören, sobald man mich mit einem reichen Lordling verheiratet, um ihm als Zuchtstute zu dienen. Sobald ich gezwungen sein werde, sämtliche Misshandlungen zu erdulden, die er mir im Namen der elendigsten Sache der Welt zufügen wird: der »Liebe«.
»Katria! Joyce wird dir bei lebendigem Leib die Haut abziehen, weil du so lange unterwegs warst«, schimpft Cordella, die Stallgehilfin. »Sie war schon zweimal hier und hat dich gesucht.«
»Warum überrascht mich das nicht?« Ich steige ab.
Cordella gibt mir einen Klaps auf den Oberarm und zeigt mit dem Finger auf mich. »Dir bietet sich heute eine Chance, von der die meisten Mädchen nur träumen können. Die Hausherrin wird eine kluge, vernünftige Partie für dich arrangieren, mit einem Mann, der für den Rest deines Lebens für dich sorgen wird, und du musst nichts anderes tun, als zu lächeln und hübsch auszusehen.«
Für mich haben bereits so viele Leute »gesorgt«, dass es mir für alle Zeiten reicht. Doch ich erwidere nur: »Ich weiß. Ich wünschte bloß, ich hätte auch etwas dabei zu sagen, wer dieser Mann ist.«
»Es spielt keine Rolle, wer er ist.« Cordella schnallt den Sattel ab, während ich Misty das Zaumzeug abnehme. »Hauptsache, er ist reich.«
Wenn Cordella mich anschaut, sieht sie eine junge Erbin. Sie sieht das Haus, die Kleider, die Feste – all jene Präsentationen von Reichtum, von denen Joyce nicht lassen kann. Cordella sieht die glitzernde Fassade, die noch aus einer Zeit stammt, in der wir all diese schönen Dinge wirklich besessen haben, lange bevor alles hohl und schal wurde, vernichtet durch schlechte Entscheidungen und den Tod meines Vaters.
»Hoffen wir das Beste«, sage ich schließlich. Alles andere würde mich undankbar erscheinen lassen. Aus Cordellas Perspektive, einer Frau aus bescheidenen Verhältnissen und mit ebensolchen Möglichkeiten, habe ich keinen Grund, weniger als dankbar zu sein.
»Katria«, ruft meine jüngste Schwester von der Veranda, die sich um das ganze Haus zieht. Die Sonne ist kaum aufgegangen, aber sie hat sich bereits in Schale geworfen, als wäre sie diejenige, die heute einem Mann versprochen werden soll, und nicht ich in meiner abgenutzten und dreckverschmierten Kluft. »Mutter sucht dich.«
»Ich weiß.« Ich gebe Cordella das Zaumzeug. »Kümmerst du dich um den Rest?«
»Ausnahmsweise.« Sie zwinkert mir zu. Cordella hat solche »Ausnahmen« schon öfter gemacht. Misty war ein Geschenk meines Vaters, nicht der Hausherrin. Kurz nachdem er anfing, den Großteil seiner Zeit auf den Handelsrouten zu verbringen, beschloss Joyce, dass wir für Pferde keine weiteren Ausgaben mehr erübrigen könnten. Sie war ohnehin wütend, dass Vater ihr nicht erlaubt hatte, das Fohlen zu verkaufen. Wenn ich also ein Pferd besitzen wollte, dann hatte ich mich auch darum zu kümmern. Es spielt keine Rolle, dass meine beiden Schwestern jede einen Hengst haben, der seit Jahren im Stall steht und so gut wie nie bewegt wird. Ihre Ausgaben waren nie »zu hoch«.
»Danke«, sage ich aufrichtig und mache mich auf den Weg zum Herrenhaus.
»Du stinkst«, sagt Laura lachend, als ich auf sie zukomme. Sie hält sich die Nase zu, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen.
»Bist du sicher, dass du das nicht selber bist?« Ich schenke ihr ein verschmitztes Grinsen. »Ich glaube nicht, dass du heute Morgen gebadet hast.«
»Ich dufte so süß wie eine Rose«, erklärt Laura.
»Eine Rose?« Ich wackle mit den Fingern. »Und was sind das für stinkende Dornen?« Dann stürze ich mich auf sie, um sie zu kitzeln. Sie stößt mich schreiend weg.
»Lass das! Du … du machst meinen Rock dreckig!«
»Ich bin das Schlammmonster!«
»Nein, nein, zu Hilfe!« Sie brüllt vor Lachen.
»Das reicht.« Mit strengem Ton unterbricht Helen diesen kurzen fröhlichen Moment. Obwohl sie jünger ist als ich, führt sie sich auf, als wäre sie die Ältere. Sie ist diejenige von uns dreien, die das Sagen hat. Mutters Liebling. »Komm mit, Laura«, befiehlt sie unserer jüngeren Schwester.
Laura schaut zwischen Helen und mir hin und her, fügt sich aber der Stellvertreterin ihrer Mutter.
»Du kannst dich nicht immer so aufführen«, schilt Helen sie.
»Aber ich –«
»Was für ein kindisches Benehmen. Willst du denn keine richtige Dame sein?«
»Doch, schon, aber –«
»Dann solltest du auch anfangen, dich wie eine zu verhalten.« Helens kurz geschnittenes blondes Haar fällt ihr seitlich ins Gesicht. Sie ist ihr Leben lang verhätschelt worden und trotzdem fällt sie uns anderen immer wieder in den Rücken. Ständig lauert sie im Schatten – und in meinen Albträumen.
Irgendwann wird Laura aufwachen und genauso sein wie sie. Das süße Mädchen, das ich kenne, wird unter den Absätzen von Helen und Joyce endgültig zerquetscht worden sein.
»Was brauchst du, Helen?« Laura zuliebe versuche ich die Aufmerksamkeit wieder auf mich zu ziehen.
»Oh, ich habe eine Nachricht für dich.« Helen lächelt wie eine Schlange. Es ist das Lächeln ihrer Mutter. Das gleiche Lächeln, das auch Laura mit der Zeit lernen wird. Es gibt nur wenige Dinge, die ich an der Tatsache, dass mein Vater nach dem Tod meiner leiblichen Mutter wieder geheiratet hat, als Segen ansehe. Die Gewissheit, dass ich mit der Frau, die mich großgezogen hat, weder das Blut noch dieses schreckliche Lächeln teile, ist eines davon.
»Joyce möchte, dass du für unsere heutigen Gäste den Eingangsbereich wischst.«
Plötzlich steigt mir intensiver Rauchgeruch in die Nase. Ich unterdrücke den Impuls, sie zu reiben. Immer wenn jemand lügt, riecht die Luft für mich nach Rauch. Ich habe versucht, diese Empfindung zu erklären, und wurde dafür in mein Zimmer gesperrt, weil ich Unsinn rede. Also verschweige ich meine Gabe seitdem. Sie ist eine meiner wenigen kostbaren Überlebenshilfen geworden.
»Du meinst, ich soll gehen und auf deine wunderbare Gesellschaft verzichten? Wie soll ich das nur verkraften?« Als ich das Herrenhaus durch die Tür zu Lauras Rechten betreten will, packt Helen mich am Arm.
»Glaube ja nicht, dass du plötzlich etwas Besseres bist als wir, nur weil du heiratest. Du bist ein unehelicher Bastard und eine Schande für unsere Familie. Du wirst den Lord irgendeiner kleinen Klitsche von nirgendwo heiraten und den Rest deiner Tage in der Versenkung verbringen, auf die wir dich vorbereitet haben.«
Laura starrt auf ihre Zehenspitzen. Es gab eine Zeit, da hätte sie sich für mich eingesetzt. Aber diese Bereitschaft haben sie ihr ausgetrieben. So viel Liebreiz, so viel Licht verblasst direkt vor meinen Augen. Und ich bin zu schwach und zu traurig, um es aufzuhalten.
»Ich will Mutter nicht warten lassen.« Ich reiße mich los.
Egal, was sie sagt, ein bisschen Schadenfreude steht mir heute zu. Ich bin die Erste, die heiratet. Etwas, das Helen sich verzweifelt wünscht. Zum ersten Mal im Leben muss sie mit ansehen, dass ich vor ihr an der Reihe bin. Ironischerweise ist es das Letzte, was ich mir wünsche.
Ich betrete das Herrenhaus durch einen kurzen Flur, der in den großen Eingangsbereich führt. Verwelkte Blumen hängen über die Ränder von gesprungenen Vasen und verströmen einen torfigen, faulig süßen Duft. Die zarten Deckengemälde sind vom Ruß brennender Kerzen geschwärzt, weil sie nicht häufig genug gesäubert wurden. Kurz nachdem mein Vater das erste Mal mit einem seiner Schiffe auf Reisen gegangen war – und vor dem Vorfall auf dem Dach –, hat Joyce versucht, mich auf eine der klapprigen Leitern zu scheuchen, damit ich die Decke säubere. Wenn man bedenkt, wie jung ich damals war, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie mich umbringen wollte. »Wenn du uns in diesem Alter immer noch auf der Tasche liegst«, hatte sie gesagt, »kannst du wenigstens bei der Instandhaltung helfen. Du hast die Hände eines Mannes, aber die Arbeitsmoral eines Kindes.«
Als ob ich nicht ohnehin jede wache Stunde des Tages damit verbringen würde, dieses heruntergekommene Überbleibsel vergangener Tage irgendwie in Schuss zu halten. Das ist noch etwas, was mir an der ganzen Situation ein hämisches Vergnügen bereitet: Sie werden ihre wertvollste Bedienstete verlieren.
Aber so schnell, wie der böse Gedanke in mir aufgekeimt ist, verschwindet er auch wieder. Tief in meinem Gedächtnis habe ich immer noch vage Erinnerungen daran, wie wunderschön dieser Ort früher war. Und an sie, meine leibliche Mutter, jene geheimnisvolle Frau, der mein Vater als junger Kaufmann auf seinen Reisen begegnet war und die er mit nach Hause gebracht hatte, ohne sich um die Erwartungen an einen aufstrebenden jungen Lord zu scheren. Ich erinnere mich daran, wie die Sonne durch die nun verdreckten Fensterscheiben auf der Vorderseite des Hauses strömte. Wenn ich die Augen fest zusammenkneife, sehe ich fast noch ihr Gesicht über mir aufragen. Ein Fächer aus Farben breitet sich hinter ihr aus. Strahlend vor Freude und Liebe, singt sie eines ihrer Lieder, die sich in mein Herz eingebrannt haben. Ich weiß, dass diese Räume – und ich – einst von Lachen und Musik erfüllt waren. Aber hier und jetzt ist das fast nicht mehr zu glauben.
»Was tust du da?« Ich höre ein Seufzen im Zwischengeschoss. Als ich aufschaue, sehe ich die einzige »Mutter«, die ich kenne, die Frau, die mich großgezogen hat, in einem blutroten Samtkleid die Treppe herabschreiten. Ihr bleiches Haar ist hochgesteckt und wird von einem Diadem gehalten, was sie aussehen lässt wie die Prinzessin, die sie schon immer sein wollte. »Hier werden jeden Moment Männer eintreffen, und du stehst da und siehst aus, als hättest du dich den ganzen Morgen im Schweinestall gewälzt.«
So schlimm sieht meine Kleidung nun auch nicht aus, aber ich widerspreche ihr nicht. »Ich wollte mich gerade umziehen.« Auch Helens Lüge bezüglich des Wischens ignoriere ich. Ich frage mich, ob es Joyce ärgert, dass ich mich auf keine Diskussion mit ihr einlasse.
»Gut. Ich muss mich um die Freier kümmern.« Sie faltet die Hände über dem Bauch, ihre Nägel haben den gleichen Farbton wie ihr Kleid. »Putz dich heraus, so gut du kannst. Sonst merkt ein Mann womöglich noch, was er da heiratet, und läuft weg, bevor die Papiere unterschrieben sind.«
Was, nicht wen. Ich bin schon immer ihr kleines Monster gewesen. »Ich gebe mir Mühe.«
»Gut.« Joyce strafft die Schultern und nimmt eine aufrechtere Haltung ein. Immer, wenn sie das tut, muss ich an einen großen Vogel denken, der seine Federn sträubt. »Mit etwas Glück bist du noch vor Sonnenuntergang verheiratet.«
»Verheiratet? Nicht verlobt?« Ich wusste, dass es Gespräche gibt, aber ich hatte geglaubt, noch ein wenig mehr Zeit zu haben, den Mann vielleicht kennenlernen zu können, bevor wir heiraten. Das Ganze womöglich irgendwie verhindern zu können.
»Wir haben unzählige Male darüber gesprochen.«
»Das glaube ich nicht.« Wir haben nie darüber gesprochen. Das weiß ich genau. Dennoch erschüttert ihr tiefer Seufzer meine Gewissheit.
»Das hast du offensichtlich wieder mal falsch in Erinnerung. Aber keine Sorge, ich bin hier, um dir zu helfen.« Joyce schenkt mir ihr Schlangenlächeln und legt die Hände auf meine Schultern. Früher habe ich diese Lüge geglaubt. »Du wirst mir zuliebe also ein braves Mädchen sein und keinen deiner theatralischen Ausbrüche hinlegen, ja?«
Übersensibel. Theatralisch. Sie behandelt mich, als wäre ich ständig im Begriff, aus der Haut zu fahren. Als ob ich das jemals getan hätte.
Jedenfalls glaube ich nicht, dass ich das je getan habe …
»Ich werde brav sein«, höre ich mich sagen. Die Antwort ist ein Reflex. Das bin nicht ich. Es ist das, was sie mir beigebracht hat.
»Ausgezeichnet.«
Wir gehen auseinander und ich flüchte auf mein Zimmer.
Die Räume der Familie befinden sich traditionell im ersten Stock des Herrenhauses. Früher habe auch ich dort gewohnt. Doch als mein Vater immer häufiger verreiste, benötigte Helen plötzlich ein ganzes Zimmer als Atelier, und meines hatte das beste Licht.
Du wohnst jetzt hier, hallt mir Joyces Stimme noch im Ohr, als ich an der Schwelle des dunklen Korridors stehe, der zu meinem Zimmer führt. Ich zünde einen Kerzenstummel an, den ich eingesteckt habe, als ich in den Zimmern meiner Schwestern die Kerzen austauschte. Sein Licht fällt auf den bröckelnden Putz an den Wänden, die bröseligen Steine, die erzählen, wie es wirklich um das Herrenhaus steht.
Es ist einfach zu groß. Wir haben nicht genug Geld, um es instand zu halten, nicht wirklich. Ich tue mein Bestes, dem Andenken meiner Mutter zuliebe … und damit Vater, falls er jemals wiederkehren sollte, ein Zuhause hat, in das er zurückkommen kann. Joyce interessiert sich nur für die Gemeinschaftsräume und ihre eigenen Zimmer. Dafür ist genug Geld da. Für die Fassade. Alles andere würde sie abbrennen lassen, glaube ich.
In dem Zimmer am Ende des Korridors nimmt mein Bett den gesamten hinteren Teil ein, es reicht von einer Wand zur anderen. Mein altes Bücherregal, das für den Raum ebenfalls viel zu groß ist, steht fast leer, und die wenigen Gegenstände in den Fächern sind ausschließlich praktischer Natur. Mein wertvollster Besitz ist die Laute. Ich gehe hinüber und greife danach, überlege es mir aber anders. Wenn ich jetzt spiele, wird es sicher irgendjemand mitbekommen. Vor allem Helen reagiert empfindlich auf meine Musik, als hätte sie ihr Gehör darauf geeicht. Sie protestiert jedes Mal, wenn sie auch nur einen einzigen Ton »ertragen« muss.
Manchmal hört Laura mir zu. Ich werde die Abende vermissen, an denen sie ihren Mut zusammennimmt, sich zu mir herunterschleicht, um bei meinem Lautespiel mitzusummen. Sie ist seit Jahren die Einzige, die mich wirklich hat spielen hören.
Seufzend drehe ich mich zum Kleiderschrank um und bin überrascht, darin ein neues Kleid vorzufinden. Genau genommen ist es nicht »neu«. Helen hat das Kleid vor zwei Jahren auf dem Frühlingsball getragen. Aber da sie es nur dieses eine Mal anhatte, ist der Satinstoff immer noch in tadellosem Zustand. Ich streiche über die butterweiche Glätte, die sich so sehr von meiner normalen Kleidung unterscheidet. Der hohe Halsausschnitt verbirgt die Narben auf meinem Rücken. Zweifellos mit Absicht.
Ich wage es, das Badezimmer im Obergeschoss zu benutzen. Es ist eine schwache Geste des Protests. Aber sie fühlt sich besser an als das heiße Wasser, das auf meiner Haut brennt. Meistens bin ich diejenige, die für die anderen Wasser herbeiträgt und warm macht, damit sie ein Bad nehmen können. Wenn ich das geschafft habe, fehlt mir meist die Kraft, mein eigenes hochzuschleppen. Als ich mich gewaschen habe, wage ich sogar, Helens Schminksachen durchzusehen, und wähle ein zartes Rouge für die Wangen, das das dunkle Grau meiner Augen betont, und ein tiefes Rot für die Lippen, das die dunkleren Rosttöne meiner braunen Haare hervorhebt.
Am Ende habe ich mich in eine andere Frau verwandelt. Mein Haar ist gebürstet und zu einer Lockenkaskade aufgesteckt, auf die sogar Joyce stolz wäre. Ich frage mich, ob ich wohl jeden Tag so aussehen würde, hätte mein Vater diese Frau nicht geheiratet.
Joyce war verwitwet, als sie meinem Vater begegnete. Von außen betrachtet war es eine kluge Verbindung: Sie hatten beide junge Töchter, Helen und mich, und lebten in ähnlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Joyce hatte von ihrem früheren Ehemann ein ordentliches Vermögen in Form seltener Silberminen im Norden geerbt. Ebenjene Minen, die nur die Schiffe meines Vaters erreichen konnten.
Ich habe ihr Spiel früh durchschaut. Mein Vater dagegen nie. Bis zum Schluss nicht, als er das letzte Mal auf Reisen ging. Er liebte sie. Sie hatte ihn nach dem Tod meiner Mutter aus den Tiefen seiner Verzweiflung »gerettet«. Dann kam Laura in unsere problematische kleine Familie, ihrer beider Augenstern und »Klebstoff«, wie sie zu sagen pflegten.
Mit vorsichtigen Schritten überquere ich die knarzenden Stellen im Fußboden auf dem Weg in mein altes Zimmer. Es liegt auf der Vorderseite des Hauses und überblickt die Einfahrt, die zur Hauptstraße führt, unserer Verbindung zur Stadt. Tatsächlich stehen dort drei Kutschen. Ich sehe einen Mann mit Zylinder aus der Haustür treten. Er wechselt ein paar Worte mit seinem Kutscher und fährt davon.
Ich frage mich, wie er dazu steht, eine Frau zu heiraten, der er noch nie begegnet ist. Offensichtlich hat er kein Problem damit, herzukommen und ein Angebot zu machen.
Andererseits sind wir uns womöglich schon begegnet. Vielleicht ist mir der Mann, den ich heiraten werde, in der Stadt oder auf einem Ball schon über den Weg gelaufen. Mich schaudert, wenn ich an den lüsternen Earl Gravestone denke und daran, wie er meine Schwestern und mich in unserer ersten Saison in der Gesellschaft angesehen hat. Ich bete, dass er nicht kommt und um meine Hand anhält – oder um ihre, wenn sie an der Reihe sind. Es gibt Scheußlichkeiten, die ich nicht einmal Helen wünsche.
Bevor ich entdeckt werden kann, schleiche ich mich wieder aus Helens Atelier. Statt über die Haupttreppe hinunterzugehen, nehme ich die Stiege zwischen dem großen Schlafzimmer und der Wand. Sie wird von den Dienstboten genutzt und führt in die Küche. Von dort aus husche ich über andere versteckte Gänge durch das Haus. Indem sie von mir verlangt haben, dass ich mich wie ihre Dienerin verhalte, haben meine Stiefmutter und Helen mir auch ermöglicht, all die Gänge zu erforschen, die vor langer Zeit in diesem uralten Haus eingebaut wurden. Das haben die beiden nie verstanden.
Die Tapetenwand des kleinen Salons, der an das Arbeitszimmer meines Vaters angrenzt, lässt sich mittels versteckter Scharniere lautlos öffnen. Ich schleiche durch den Raum, der Teppich dämpft meine Schritte. Auf der gegenüberliegenden Seite presse ich mit angehaltenem Atem das Ohr an die Wand. Sie ist so dünn, dass ich die Gespräche im Arbeitszimmer klar und deutlich verstehen kann.
»… und ihre Mitgift sind die Nordrouten-Schiffe der Handelskompanie Applegate«, sagt Joyce gerade.
Ich beiße mir auf die Lippe. Es gibt keine Nordrouten-Schiffe, jedenfalls nicht mehr. Diese Gewässer sind tückisch, und nur wenige verfügen über den Mut und das Geschick, sie zu befahren. Einer dieser Menschen stand im Dienste meines Vaters, eine unglaubliche Frau. Ich bin der Kapitänin nur ein Mal begegnet, aber ich war während unseres kurzen Gesprächs völlig fasziniert. Obwohl sie kaum älter war als ich, arbeitete sie schon seit zwei Jahren als Schiffsführerin. Vielleicht war es die Unbekümmertheit ihrer Jugend, die sie befähigte, in diesen Gewässern einen Kurs zu einer seltenen Silberader zu finden, den nicht einmal die raubeinigsten Seeleute einschlagen würden.
Aber auch sie wurde irgendwann vom Glück verlassen, so wie es uns allen früher oder später ergeht. Sie versank mit ihrem Schiff und mein Vater ebenso. Mir war nicht klar gewesen, dass Joyce das Verschwinden meines Vaters geheim gehalten hat. Sie versucht, die Handelskompanie vollständig unter ihre Kontrolle zu bekommen, begreife ich nun. Ich grabe die Fingernägel in die Wand. Und da mein Vater verschwunden ist, aber nicht für tot erklärt wurde, stellt ihr niemand unangenehme Fragen.
»Das ist ein sehr interessanter Vorschlag«, sagt eine verwitterte alte Stimme.
Ich hoffe, er ist nicht zu interessant für diesen Mann, wer immer er auch sein mag. Wenn er mich wegen der Schiffe heiratet und dann herausfindet, dass es sie gar nicht gibt, werde ich diejenige sein, die dafür leiden muss. Ich habe keinen Zweifel, dass Joyce mit einer raffinierten Lüge aufwarten wird, indem sie zum Beispiel behauptet, die Schiffe seien erst kurz nach der Hochzeit gesunken. Beruhigen Sie sich, jeder hat mal Pech, höre ich sie schon sagen.
»In der Tat«, sagt Joyce. »Sie sehen also, dass es sich hierbei nicht um das handelt, was man unter einer normalen Eheschließung versteht. Ich weiß natürlich, dass es für eine Braut üblich ist, eine Mitgift mitzubringen. Aber als gewiefte Geschäftsfrau kenne ich den Wert meiner Tochter und dessen, was ich hier anbiete. Daher bitte ich alle potenziellen Freier, offenzulegen, was sie mir im Gegenzug für die Gunst ihrer Hand geben würden.«
Es folgt eine lange Pause. »Mein Herr hat kein Interesse an Schiffen«, sagt die raue Stimme. »Ihr könnt sie behalten.«
Mein Herr? Soll das heißen, der Mann, der dort spricht, ist gar nicht mein zukünftiger Ehemann? Welche Art Mann schickt seinen Diener, damit dieser um mich verhandelt? Ich wollte zwar keine Liebe, aber ich habe durchaus auf Würde gehofft. Wenn dieser Mann sich nicht einmal jetzt herzukommen bemüht, wie wird er mich erst behandeln, wenn ich in seiner Obhut bin?
»Was möchte Ihr Herr dann als Mitgift?« Joyce scheint verblüfft zu sein, dass jemand die Schiffe ablehnen würde. Doch ich kann hören, dass ihre Stimme vor Freude zittert.
»Der Lord ist Sammler einer bestimmten Art von Rarität. Ihm ist zu Ohren gekommen, dass Ihr im Besitz eines ganz besonderen Buches seid, das er schon lange sucht.«
»Ein Buch?« Pause. »Oh, Sie dienen ihm.« Joyces Stimme wird schärfer. »Ich weiß, dass Covolt sich immer geweigert hat, es zu verkaufen, aber in mir finden Sie eine wesentlich zugänglichere Geschäftsfrau.«
Das Buch …? Sie können unmöglich von diesem Buch sprechen, oder?
Als Joyce in unser Leben trat, befahl sie, dass sämtliche Spuren meiner leiblichen Mutter im Haus getilgt werden sollten. Ich hatte versucht zu widersprechen, aber mein Vater meinte, es sei für eine neue Ehefrau ganz normal, so zu handeln. Eine neue Liebe könne nicht im Schatten der alten erblühen. Eines Abends ging ich zutiefst unglücklich zu ihm. Ich flehte ihn an, etwas von meiner Mutter zu retten, irgendetwas, nur einen einzigen Gegenstand. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mich bereits nicht mehr an ihr Gesicht erinnern. Ich wollte nicht noch mehr verlieren.
Da zeigte er mir das Buch. Es war ein altes, kleines Ding. Was auch immer in das Leder eingestanzt worden war, hatte sich mit der Zeit abgewetzt. Lediglich ein achtzackiger Stern auf der Spitze eines Berges war auf dem Buchrücken noch zu erkennen. Die Schrift im Inneren war verblasst, sodass nur unleserliche Geister zurückgeblieben waren, die auf den meist leeren Seiten herumspukten.
Mein Vater schwor, dass meiner Mutter nichts so sehr am Herzen gelegen hatte wie dieses Buch. Es war das, was ich bekommen und bewahren sollte – mein Geburtsrecht. Er würde es mir geben, sobald ich erwachsen war. Doch bis dahin müsse ich die Bedeutung des Büchleins geheim halten. Bestimmt wollte er Joyce davon abhalten, es zu vernichten, so wie sie alles von meiner Mutter vernichtet hatte.
Irgendwann hatte ich solche Angst, dass Joyce das Buch entdecken könnte, dass ich Vater erklärte, ich wolle nicht länger darauf warten. Lass mich es verstecken, beschwor ich ihn. Aber er meinte, ich sei noch nicht bereit dafür. Stattdessen schenkte er mir die Laute, damit ich wenigstens etwas von meiner Mutter besaß. Mit ihr hatte sie mir Kinder- und Schlaflieder vorgespielt.
»Mein Herr hatte gehofft, dass dies der Fall sein würde«, sagt der Mann im Arbeitszimmer jetzt. »Er hat mich bevollmächtigt, Euch folgendes Angebot zu unterbreiten: Er wird die junge Frau heiraten, und für den Rest ihrer oder seiner Tage in dieser Welt der Sterblichen – je nachdem, wessen Zeit zuerst endet – soll es ihr an nichts fehlen. Als Mitgift erbittet er lediglich das Buch. Darüber hinaus wird er, als Zeichen seines guten Willens gegenüber Eurer Familie, viertausend Geldstücke zahlen, sobald die Heiratspapiere unterzeichnet sind.«
Mein Schicksal ist besiegelt. Viertausend Geldstücke sind mehr, als dieses ganze Anwesen wert ist. Sie sind der Jahresumsatz der Handelsgesellschaft meines Vaters zu ihren besten Zeiten. Als mir klar wird, dass der mysteriöse Mann, der sich nicht einmal die Mühe gemacht hat, persönlich zu erscheinen, mein Ehemann werden wird, sacke ich an der Wand langsam auf den Boden.
»Das ist wirklich ein äußerst großzügiges Angebot.« Joyces Stimme zittert ein wenig. Ich stelle mir vor, dass sie Schaum in den Mundwinkeln hat. »Ich werde die Papiere aufsetzen, um die Vereinbarung festzuhalten und die Ehe zu besiegeln. Kann der Lord morgen zur Unterzeichnung kommen?«
»Es besteht kein Grund, zu warten.«
»Ach?«
»Wie ich schon sagte, bin ich befugt, solche Entscheidungen im Namen meines Herrn zu treffen. Ich darf an seiner statt unterzeichnen und trage sein Siegel bei mir. Solltet Ihr mit unseren Bedingungen einverstanden sein, bin ich gehalten, das Geschäft sofort abzuschließen.«
»Also dann.«
Irgendwo zwischen ihrem Gemurmel über die besten Formulierungen der Vereinbarung und dem Geraschel von Papier höre ich auf zu lauschen. Mit zitternden Händen lehne ich an der Wand und ringe nach Luft. Die Welt dreht sich entsetzlich schnell. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste es. Aber jetzt ist es real und geschieht mit rasender Geschwindigkeit. Ich dachte … ich dachte, ich hätte mehr Zeit …
»So, es ist vollbracht«, erklärt Joyce, die höchstwahrscheinlich gerade in meinem Namen unterschrieben hat.
»Gut. Sagt Eurer Tochter, dass sie ihre Sachen packen soll, während Ihr das Buch holt.« Ich höre Stühle scharren. »Wir werden innerhalb der nächsten Stunde aufbrechen.«
Und plötzlich bin ich verheiratet und verlasse das einzige Zuhause, das ich je hatte … für einen Mann, von dem ich nicht einmal den Namen weiß.
ZWEI
»Der geheimnisvolle Lord Fenwood.« Laura lehnt im Türrahmen, während ich meine wenigen Habseligkeiten zusammenpacke. Die Nachricht hat sich erwartungsgemäß schnell herumgesprochen, schließlich sind nie mehr als eine Handvoll Leute im Haus. »Ich glaube nicht, dass ich diesen Lord schon einmal bei irgendeiner Veranstaltung gesehen habe.«
»Ich glaube, er ist ein Einsiedler.« Helen steht ihrer Schwester gegenüber. Sie ist so gut wie noch nie in meinem Zimmer aufgetaucht. Es ist ebenso merkwürdig wie unangenehm, sie hier zu sehen. »Ich habe immer nur von ihm gehört. Es heißt, er wohnt nördlich der Stadt, und dass sein Anwesen direkt an den Wald grenzt.«
»Ach, der!« Laura klatscht in die Hände. »Ich habe Leute in der Stadt sagen hören, dass er ein alter Zauberer ist.« Sie wirbelt zu mir herum, als wäre das die beste Nachricht seit Monaten. »Wenn er dich das Zaubern lehrt, versprichst du, es mir auch beizubringen?«
»Er wird mich nicht zaubern lehren.« Trotzdem muss ich angesichts des Optimismus meiner kleinen Schwester ein wenig lächeln, zumindest bis Helen sich alle Mühe gibt, jegliche Fröhlichkeit zwischen uns zunichtezumachen.
»Sie wird Zauberei nicht gelehrt, sondern davon verzehrt werden. Wie ich höre, trinken Zauberer nichts anderes als das Blut frisch getöteter Jungfrauen, und sie tanzen mit gehörnten Fae im Mondlicht.«
»Wenn der Lord nur das Blut frisch getöteter Jungfrauen trinken würde, gäbe es im Dorf längst keine jungen Frauen mehr.« Ich verdrehe die Augen und versuche mir nicht anmerken zu lassen, dass es mich schon ein wenig beunruhigt, dass keine meiner Schwestern etwas Genaueres über den Mann weiß. Sie sind so eingebunden in die gesellschaftlichen Kreise der ganzen Gegend, dass, wenn sie ihn nicht kennen, ihn niemand kennt. Dabei hatte ich auf ein paar Informationen über meine neuen Lebensumstände gehofft. »Und niemand tanzt mit Fae im Mondlicht. Wenn man den Fae so nahekommt, ist man tot.«
»Vorausgesetzt, es gibt sie überhaupt.« Helen glaubt nicht an die alten Geschichten. Sie ist zu praktisch veranlagt, denn sie ist weiter im Landesinneren und näher an den Minen ihrer Mutter aufgewachsen, weit weg von den Wäldern und ihren Geschichten. Sie findet Laura und mich lächerlich, weil wir unsere Zweifel haben. Trotzdem weigert sie sich vehement, in den Wald zu gehen. »Es ist viel wahrscheinlicher, dass er ein runzliger alter Einsiedler ist, der eine junge Frau sucht.«
»Er ist bestimmt ganz wunderbar.« Laura lässt sich nicht beirren. »Und wir kommen dich und deinen neuen Ehemann noch diesen Monat besuchen. Ich habe gehört, dass Mutter eine neue Kutsche kaufen und einen Kutscher einstellen will, und drei neue Lakaien für das Herrenhaus – und das ist erst der Anfang! Du musst wiederkommen und dir anschauen, was uns deine Hochzeit eingebracht hat.«
Laura meint es gut, sie merkt nicht, wie sehr mich ihre Worte treffen.
Ich bin nicht mehr als ein preisgekröntes Hausschwein. Aber wenigstens konnte ich ihr endlich von Nutzen sein.
»Es wird schön sein, endlich richtige Hilfe im Haus zu haben«, sagt Helen mit einem Blick in meine Richtung.
Ich habe für sie getan, was ich konnte, und mehr als das. Als Helen und Joyce bei uns einzogen, gab ich mir alle Mühe, sie zu meiner Familie zu machen. Ich tat, was sie von mir verlangten und wie sie es verlangten, weil ich eine »gute Tochter« sein wollte. Als ich endlich begriff, dass ich dadurch zu ihrer persönlichen Dienerin wurde, ging es schon viel zu lange so, um dem noch ein Ende zu machen. Dann begann Joyce, meinen Vater zu drängen, mehr Zeit auf seinen Schiffen zu verbringen. Und nach dem Vorfall auf dem Dach war es mir unvorstellbar, ihnen je wieder zu widersprechen.
»Ich bin sicher, ihr beide werdet hier noch viele Jahre glücklich sein«, sage ich.
»Bis zu unserer eigenen Hochzeit«, betont Laura. Sie kann es kaum erwarten, mit irgendeinem charmanten Lord verheiratet zu werden. Als Jüngste und mit Abstand Schönste von uns wird sie die freie Wahl haben.
»Komm jetzt, Katria, du willst deinen neuen Ehemann doch nicht warten lassen.« Joyce taucht hinter ihren Töchtern auf und beäugt den Koffer, den sie mir gegeben hat. »Oh, gut. Ich dachte mir, dass alles in den kleinen Koffer passen würde.« Sie schaut sich verächtlich im Zimmer um, einem kleinen Raum mit einer kleinen Anzahl von Dingen, für eine junge Frau, die sie ihr Leben lang kleinzuhalten versucht hat.
In diesem Moment schwöre ich mir, dass ich mich weder von diesem neuen Ehemann noch von irgendjemand sonst jemals wieder kleinmachen lasse. Ich werde alles tun, um mit erhobenem Haupt durchs Leben zu gehen. Ich will mich nie wieder ducken müssen.
»Gehen wir.« Ich schnalle mir meine Laute auf den Rücken und nehme meinen Koffer.
Zu viert betreten wir die große Veranda auf der Vorderseite des Hauses. Dort sehe ich zum ersten Mal den Butler, der mein Schicksal ausgehandelt hat. Trotz eines leichten Buckels ist er groß und drahtig, mit glänzenden schwarzen Augen und zurückgekämmtem grauem Haar. Seine Kleidung ist edel, zwar nicht übermäßig verziert, aber eindeutig von guter Qualität. Der Art von Reichtum, die sich nicht aufdrängt, sondern gelassenes Selbstbewusstsein demonstriert. Joyce könnte sich ein paar Scheiben davon abschneiden.
»Ihr müsst Lady Katria sein«, sagt er mit einer Verbeugung. Dann schaut er zu Joyce und deutet auf die Kiste neben sich. »Hier sind die viertausend Geldstücke, wie versprochen.«
»Das ist Katria, wie Sie bereits bemerkt haben. Und hier ihre Mitgift.« Joyce hält ihm ein kleines, in Seide eingeschlagenes Päckchen hin. Der Butler wickelt es aus, prüft den Inhalt und schlägt den Band dann ehrfürchtig wieder ein. Meine Hände zittern, so sehr muss ich dagegen ankämpfen, ihm das Buch zu entreißen.
»Ausgezeichnet, es ist alles in Ordnung. Wenn Ihr mir bitte folgen würdet, Lady Katria.«
Als ich die Haupttreppe hinabsteige, die von der Veranda zur Einfahrt führt, wird mir bewusst, dass ich diesen Weg vielleicht zum letzten Mal gehe. Ich weiß nicht, ob ich in dieses Haus oder zu den Menschen, die darin leben, zurückkehren möchte. Ich wende mich um, schaue zu ihnen hinauf und über sie hinweg, um einen letzten Blick auf die verblassten Deckengemälde im Eingang zu werfen.
Es war deiner Mutter nicht bestimmt, hier lange zu leben, hat mein Vater oft gesagt. Vielleicht galt das auch für mich. Vielleicht erfülle ich einfach nur mein Schicksal, indem ich diesen Ort ein bisschen zu spät verlasse.
Ich bin fast bei der Kutsche angelangt, als mich Hufgetrappel ablenkt. Cordella führt Misty zur Einfahrt. Sie winkt mir zu.
»Ich habe mir gedacht, dass du sicher nicht ohne die hier abreisen willst.«
Ich atme erleichtert auf. Es geht alles so schnell, dass ich mich frage, was ich wohl noch alles übersehen habe. Oder wovon ich angenommen habe, dass es sich von selbst regeln würde.
»Cordella.« Joyces Stimme fährt wie ein Peitschenhieb durch die kühle Luft. »Bring das Pferd in den Stall zurück.«
»Was? Aber Misty gehört mir.«
»Ich bin sicher, dein Ehemann wird dir mit Freuden ein neues Pferd schenken, ein besseres Pferd, als Hochzeitsgabe. Sei nicht so selbstsüchtig, ihm das zu verweigern«, schilt sie mich.
»Ich will aber kein … ich will Misty.« Ich schaue den Butler an. »Sie ist ein gutes Pferd und schon ihr Leben lang bei mir. Es würde doch sicher keine Mühe bereiten, oder?«
»In den Ställen meines Herrn ist Platz genug«, bestätigt der Mann.
Joyce legt kopfschüttelnd die Hand vor den Mund. »Ich fasse es nicht. Ich dachte, ich hätte dich besser erzogen.«
Ich beiße mir auf die Lippen. Jahrelange Erfahrung hat mich gelehrt, lieber zu schweigen, wenn sie sich so verhält.
»Sich vorzustellen, dass du deinen neuen Ehemann missachten und deiner Familie unnötigerweise etwas wegnehmen willst. Und das nur wegen eines dummen Pferdes.«
»Dumm? Da siehst du’s. Keine von euch interessiert sich für das Pferd!«
»Du bist eine Lady, Katria Applegate. Es gehört sich nicht, zu schreien.« Joyce ist ganz leise geworden. »Cordella, bitte bring das Pferd in den Stall zurück.«
Cordella schaut zwischen Joyce und mir hin und her. Aber ich weiß, was sie tun wird, noch ehe sie es weiß. Sie kann sich Joyces Befehlen nicht widersetzen und wendet sich ab.
»Nein! Bitte! Tu das nicht!« Ich laufe zu Cordella.
»Katria.« Mein Name aus Joyces Mund ist wie ein Peitschenhieb. Allein der Laut lässt mich zusammenzucken und erstarren. »Du regst dich wegen nichts auf und machst dich lächerlich.«
Ich würde sie am liebsten anbrüllen. Sie hat das, was vom Geschäft meines Vaters übrig ist, für sich allein. Sie hat ihre viertausend Geldstücke, mit denen sie eine ganze Pferdeherde kaufen könnten. Lass mich Misty haben, will ich schreien. Aber ich kann nicht. Denn genau wie Misty wurde ich dressiert, wurde zum Schweigen gebracht von einem unsichtbaren Zaumzeug, das mir meine Stiefmutter vor langer Zeit zwischen die Zähne geschoben hat.
Eine sanfte Berührung an der Schulter lässt mich aufschrecken. Als ich aufschaue, sehe ich, dass der Butler zu mir getreten ist. Sein Blick ist erstaunlich sanft und mitfühlend.
»Ich werde dafür sorgen, dass Lord Fenwood Euch ein neues Pferd zur Verfügung stellt.«
Es wird ihr nie an etwas fehlen. Das sei das Versprechen seines Herrn, hatte er gesagt. Ich könnte erbitten, was ich will, aber es würde dennoch nichts bedeuten. Eine nichtssagende Gefälligkeit aus Pflichterfüllung, von Leuten, die sich mehr für ein Buch interessieren als für mich.
Ich zucke zurück. »Ich will seine Pferde nicht.« Ich will seine mitleidige oder pflichtbewusste Freundlichkeit nicht. Ich will überhaupt nichts, was in dieser Ehe wie Nähe wirken könnte.
»Irgendetwas hast du immer auszusetzen, nicht wahr?«, murmelt Joyce laut genug, dass alle es hören können. »Beruhige dich und beginne diesen neuen Lebensabschnitt mit Anstand.« Sie lässt es klingen, als hätte ich mir das alles ausgesucht. Als hätte ich es gewollt. Ich werfe ihr einen zornigen Blick zu und steige in die Kutsche.
Als der Butler sich auf den Kutschbock setzt, stürmt Laura vor.
»Laura!« Joyce ist am Ende ihrer Geduld.
»Geh zurück zu deiner Mutter«, zische ich meiner Schwester zu. Ich schaudere bei der Vorstellung, was sie sich gleich wird anhören müssen. Laura ignoriert mich ebenso wie Joyce, sie packt die Tür und hält mich davon ab, sie zu schließen.
»Ich werde dich vermissen«, ruft sie mit Tränen in den Augen. Meine süße Schwester. Kaum vierzehn. Die Beste von uns allen. »Du hast diesen Ort erträglich gemacht.«
»Nein, das warst nur du.« Ich umarme sie hastig. Der Butler drängt uns nicht. »Bewahre dir deine Herzlichkeit und Güte, Laura, bitte. Halte sie mit aller Kraft fest, bis du von hier wegkannst.«
»Und du ebenfalls.« Sie zieht sich zurück, und ich spreche nicht aus, was ich denke: dass ich beides vor sehr langer Zeit verloren habe. »Ich kümmere mich um Misty, das schwöre ich. Cordella wird es mir beibringen. Vielleicht kannst du sie mitnehmen, wenn du das nächste Mal kommst. Ich will versuchen, mit Mutter zu reden.«
»Ziehe meinetwegen nicht ihren Zorn auf dich; du weißt doch, was das bedeutet.« Als ich ihr sanft eine Haarsträhne aus dem Gesicht streiche, bemerke ich hinter ihr eine Bewegung. »Und jetzt geh, bevor deine Mutter dich holen kommt.« Ich schiebe sie sanft fort und schließe die Kutschentür. Joyce scheucht Laura mit ein paar knappen, verärgerten Worten die Treppe hinauf.
Die Kutsche fährt ruckartig an, und ich verliere ihre Gestalten schnell aus den Augen. Egal, was Laura sagt – ich bezweifle, dass ich jemals zurückkommen werde.
Helen hatte gesagt, Lord Fenwood würde nördlich der Stadt leben. In meiner Vorstellung bedeutet das »ein kleines Stück nördlich«, so wie unser Gut gerade südlich der Stadt liegt. Aber wie sich herausstellt, lebt Lord Fenwood viel weiter weg. Es ist schon spät, als wir bei meinem zukünftigen Zuhause eintreffen.
Eine hohe Steinmauer, die gut und gern doppelt so hoch ist wie ich, ist das erste Anzeichen dafür, dass wir am Ziel sind. Den Großteil des Tages gab es auf der rechten Wegseite nichts zu sehen als sanfte Hügel und den allgegenwärtigen Wald. Dann bogen wir vor einer Stunde auf einen kleinen Weg ab, kaum mehr als ein Paar Radspuren im Gras, die sich in Richtung Wald schlängeln. Dann sah ich die Mauer, die sich zwischen den Bäumen entlangzieht wie die bröckelnden Überreste eines Schlosses aus längst vergangener Zeit.
Ranken winden sich um das verschnörkelte Gitter des Eisentors. Kleine weiße Blüten verströmen einen angenehmen Duft. Das Tor fällt mit feierlichem Klang hinter uns zu. Es gibt keinen Hinweis darauf, wer oder was es geschlossen hat. Das Geräusch hat etwas Endgültiges, wie ein Vorhang, der nach einer Aufführung zufällt.
Zwischen Hecken und kleinen Bäumen hindurch rollen wir über einen gewundenen Weg. Der Hain ist wie eine Miniaturausgabe des alten Waldes, aber ohne die bedrückende Atmosphäre, die von diesem ausgeht. In der Ferne sehe ich einen Hirsch sein fürstliches Haupt erheben. Sein mächtiges Geweih hat so viele Enden, dass die meisten Adelsmänner buchstäblich dafür töten würden, es an ihre Wand zu hängen. Was sagt es über diesen Lord Fenwood aus, dass er einem solchen Tier erlaubt, ungefährdet auf seinem Land zu leben?
Schließlich macht das Buschwerk einer kreisrunden Kiesfläche Platz, und die Kutsche hält an. Der Butler öffnet die Tür und hilft mir beim Aussteigen. Zum ersten Mal erblicke ich das Haus von Lord Fenwood.
Von einem zentralen Turm in der Mitte ausgehend, erstrecken sich zwei Flügel bogenförmig um die runde Zufahrt. Hier ist das Schloss, das die Mauer versprochen hat. Das Mauerwerk ist alt, aber gut erhalten. Nachdem ich das Haus meiner Familie viele Male mehr schlecht als recht geflickt habe, habe ich ein Auge dafür. Das Strohdach scheint frisch gedeckt zu sein.
Obwohl der Anblick nichts Abweisendes hat, richten sich die Härchen auf meinen Armen auf. Die Luft ist wie aufgeladen. Das Herrenhaus liegt buchstäblich am Rand jenes Waldes, den ich nach dem Willen meines Vater niemals betreten sollte. Das musste ich ihm als kleines Mädchen schwören. Daher schrecke ich regelrecht zusammen, als der Butler meinen Koffer mit Schwung auf den Kies stellt.
Hüte dich vor den alten Wäldern, Katria. Betritt sie nie. Schwöre mir bei dem Leben deiner Mutter, dass du es nicht tun wirst. Es war ihr letzter Wunsch, dich vor ihnen zu bewahren.
»Entschuldigt, Lady Katria.« Der Butler reißt mich aus meinen Gedanken.
»Sie müssen sich nicht entschuldigen.« Ich zwinge mich zu einem Lächeln und rücke die Laute auf meiner Schulter zurecht. Dieser Mann ist für meine missliche Lage nicht verantwortlich, und das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, mir möglichst viele Verbündete zu suchen. »Und Katria reicht völlig.«
»Gern, Katria.«
»Darf ich Ihren Namen erfahren?« Er scheint über meine Frage erschrocken zu sein und denkt viel zu lange über die Antwort nach, wie ich finde. »Oren.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Oren.«
»Kommt, Katria, es wird Nacht, und Ihr solltet Euch vor dem Abendessen einrichten können.« Mit überraschender Leichtigkeit für einen Mann seines Alters hebt er meinen Koffer auf und führt mich drei Stufen hinauf in die große Eingangshalle des zentralen Turms.
Die kunstfertige Ausstattung des Hauses beeindruckt mich sofort. Links vom Eingang führt eine geschwungene Holztreppe nach oben. Ihr Geländer ist voller Schnitzereien in Form von Lilien und Blätterranken. Zwischen den Türen auf beiden Seiten befinden sich Fenster mit Buntglasscheiben, auf denen detaillierte Landschaften mit Feldern und Bergen zu sehen sind. Ich fahre mit den Fingern die dunklen Konturen nach und spüre die metallenen Erhebungen, die sie verbinden.
»Ist alles in Ordnung?«, erkundigt sich Oren.
»Ja. Ich habe solche Fenster bisher nur im Rathaus gesehen.« Die Glaskunst ist ein vergessenes Handwerk. Es gibt nur noch wenige, die die alten Techniken beherrschen, und sie sind meist in den größeren Städten zu finden. Sie verirren sich nur selten in so abgelegene Gegenden. Dieses Haus muss uralt sein. Es ist ein Wunder, dass die Fenster so lange überdauert haben. Vielleicht kann der Lord es sich auch leisten, jemanden für solche Arbeiten auf dem Anwesen zu beschäftigen. Soweit ich es bisher beurteilen kann, muss Lord Fenwood ungeheuer reich sein.
»Sie sind wirklich selten.«
Oren führt mich in den linken Flügel des Hauses. Bevor wir durch die Rundbogentür gehen, versuche ich, im Turm einen Blick nach oben zu werfen, kann aber nur bis zur Biegung der Treppe am ersten Treppenabsatz sehen. »Wohnt der Hausherr dort oben?«
»Lord Fenwood kommt und geht, wie es ihm gefällt«, erwidert der Butler geheimnisvoll. Ich frage mich, wohin er wohl geht. Die letzten Ausläufer der Zivilisation sind mehr als zwei Stunden entfernt. Vielleicht ist er ein Jäger, der unerwartet zu Reichtum gekommen ist und nun den Nervenkitzel sucht, indem er tief in die Wälder eindringt.
»Er hat ein wunderschönes Heim«, sage ich, statt darauf hinzuweisen, dass Orens Erwiderung keine Antwort auf meine Frage ist. »Ich kann mir nicht vorstellen, warum er hier nicht mehr Zeit verbringen möchte.«
Der Butler bleibt stehen. Zu unserer Linken blicken Fenster auf die runde Einfahrt hinaus, rechts von uns befinden sich Türen. Sein Schweigen lässt mich befürchten, dass ich ihn mit dieser Bemerkung irgendwie beleidigt habe.
»Es gibt einige Regeln, die Ihr kennen solltet«, sagt er und setzt sich wieder in Bewegung. Ich hatte erwartet, dass meine neue Lage mit Regeln einhergehen würde, und wappne mich. »Die erste ist, dass Ihr, wenn Ihr irgendetwas benötigt, es mir einfach nur sagen müsst. Ich werde Euch so weit wie möglich zur Verfügung stehen. Allerdings bin ich hier für alle Arbeiten verantwortlich und daher oft anderweitig beschäftigt. Ich werde Euch jeden Abend das Abendessen servieren und an den meisten Tagen auch das Frühstück zubereiten, daher wären diese Zeiten die beste Gelegenheit, mir zu sagen, wenn Ihr irgendetwas braucht.«
»Das ist sehr großzügig.«
Er redet weiter, als hätte ich nichts gesagt. »Die nächste Regel lautet, dass Ihr Euch nur im vorderen Teil des Anwesens aufhalten dürft – entlang des Wegs, auf dem wir gekommen sind. Ihr dürft unter keinen Umständen den Wald betreten.«
»Das ist kein Problem«, erwidere ich leichthin. »Diese Regel hat mir mein Vater ebenfalls auferlegt.«
»Die letzte und wichtigste Regel ist, dass Ihr – was auch immer Ihr hören oder sehen mögt – diesen Flügel des Hauses nur bei Tag verlassen dürft.«
»Wie bitte?«
»Diese Regeln dienen Eurem Schutz«, sagt er mit einem Blick über die Schulter. »Wir sind weit weg von der Stadt und nahe am Wald. Der Nebel ist hier dichter und birgt die alte Magie in sich. Es ist für Menschen nicht sicher, nachts draußen zu sein.«
Ich versuche ein wenig von Helens Mut aufzubringen, als ich sage: »Sie reden doch sicher nicht von Fae, oder? Das sind nichts als Ammenmärchen.«
Er gluckst, als wäre ich ein dummes Mädchen, als hätte er Fae schon mit eigenen Augen gesehen und könnte Geschichten über sie erzählen. »Nun gut. Dann fürchtet Euch eben nur vor den wilden Tieren des Waldes. Solange Ihr Euch innerhalb dieser Mauern befindet, seid Ihr geschützt. Aber dort, wo die Mauern enden, endet auch der Schutz meines Herrn. Versteht Ihr das?«
»Das tue ich.« Aber ich weiß nicht, was ich von alldem halten soll. Wahrscheinlich sind die Regeln nicht dumm. Außerdem habe ich den Gedanken, den Wald zu betreten, schon vor langer Zeit aufgegeben. Ich frage mich, wie Vater wohl reagieren würde, käme er auf wundersame Weise zurück und müsste feststellen, dass Joyce mich verheiratet hat. Und dass mein neues Zuhause unmittelbar an die dunklen Bäume grenzt, die zusammen mit der Bergkette dahinter unseren Winkel der Welt umschließen. Ich hatte damit gerechnet, dass meine Freiheiten nach der Heirat eingeschränkt werden würden, stattdessen scheinen sie größer geworden zu sein.
Alles in allem könnte dieses neue Arrangement weitaus schlimmer sein.
Vor der letzten Tür im Gang bleiben wir stehen. Als der Butler sie aufstoßen will, verkanten sich die Scharniere mit lautem Quietschen. Er muss sich mit der Schulter gegen das Holz stemmen.
»Tut mir leid«, murmelt er. »Dieser Flügel des Hauses wird nur selten benutzt. Ich bringe das in Ordnung, während Ihr zu Abend esst.«
»Sagen Sie mir einfach, wo das Werkzeug ist, dann kann ich es auch selbst reparieren.«
Er wirkt geschockt über meine Antwort.
»Lassen Sie sich von dem Kleid nicht täuschen, Oren. Ich bin eher an Arbeitshosen als an Satin gewöhnt.«
»Mein Herr hat geschworen, dass es Euch an nichts fehlen wird; er wird in allem für Euch sorgen. Ich repariere das, während Ihr esst«, sagt Oren ein wenig widerstrebend. Ich frage mich, ob sein Herr ihn bestrafen würde, wenn er mir erlaubte, etwas zu arbeiten.
Ich kann auch weiterhin nur darüber spekulieren, wer mein Ehemann tatsächlich ist.
Oren führt mich in das Zimmer, stellt meinen Koffer auf eine gepolsterte Bank am Fuße eines mit Vorhängen versehenen Himmelbetts. Es befindet sich direkt gegenüber eines großen gemauerten Kamins, in dem bereits ein Feuer knistert. Wie alles in diesem schlossähnlichen Haus wirkt auch das Mobiliar edel und gepflegt.
»Das Abendessen wird in einer Stunde serviert. Ich hoffe, es ist Euch recht, so früh zu essen, damit Ihr bei Sonnenuntergang wieder in Euren Gemächern sein könnt.«
»Das ist in Ordnung. Ich bin ohnehin jemand, die früh zu Bett geht und auch früh aufsteht.« Ich lächle.
Oren nickt nur und geht. Erst als er fort ist, wird mir klar, dass ich ihn nicht gefragt habe, was ich zum Essen anziehen soll. Und … ob ich dabei endlich den Mann kennenlernen werde, den ich geheiratet habe.
DREI
Das Speisezimmer ist ein Anbau auf der Rückseite des Turms und gleicht eher einem Wintergarten. Spitzbögen umrahmen die großen, kostbaren Scheiben, die den Blick auf die dunkler werdenden Wälder hinter dem Anwesen freigeben. Ich fühle mich wie ein Schmetterling, der in einem Glaskasten gefangen ist und in eine unnatürliche Umgebung gebracht wurde. Innerhalb dieser Wände bin ich sicher, aber mich trennt nur eine dünne Scheibe von den Monstern, die in diesem Wald leben.
Ich hefte meinen Blick auf die hinteren Fenster, schaue an meinem Spiegelbild vorbei in die Tiefe des Waldes. Die Bäume hier wirken älter als zu Hause. Nein, korrigiere ich mich, dieser Ort ist jetzt mein Zuhause.
»Was haltet Ihr von gebratenem Wildschwein und Wildgemüse?« Oren tritt mit einem Tablett aus einem Seiteneingang.
»Ich bin nicht wählerisch, was Essen angeht«, sage ich mit einem Lächeln. Ich habe zu viele Abende erlebt, an denen Hunger meine einzige Mahlzeit war, um mich über ein warmes Gericht zu beschweren.
»Gut«, sagt Oren. »Der Speiseplan hier draußen ist nicht sehr beständig.« Er hält inne, um den Teller ans Kopfende des Tisches zu stellen. »Das heißt nicht, dass es nichts zu essen gibt. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber auf den Tisch kommt eben das, was der Wald und die Vorratskammer hergeben.«
»Ich helfe gern mit bei der Suche nach Essbarem«, sage ich, als ich mich setze.
Er macht ein bestürztes Gesicht. »Wir sind keine Bettler, die im Schlamm nach Nahrung wühlen.«
»Natürlich nicht.« Ich lache, als wäre ich noch nie in dieser Lage gewesen. Die Notwendigkeit, nach Essbarem zu suchen, war der Grund, warum ich die Bibliothek meines Vaters nach Büchern über die Umgebung durchforstet habe. Nur deshalb kann ich einen essbaren Pilz von einem giftigen unterscheiden. »Aber ich finde Wildpilze einfach köstlich. Und ich mag es, nach ihnen zu suchen.«
Er schenkt mir aus zwei separaten Karaffen Wasser und Wein ein. »Gut zu wissen.« Aber daraus wird nichts werden, kann ich seinem Tonfall entnehmen.
»Wird der Herr des Hauses mit mir zu Abend essen?«, erkundige ich mich.
»Nein, er isst in seinen Gemächern.«
Ich beiße mir auf die Lippen. »Werde ich ihn denn nach dem Abendessen treffen?«
»Dann wird die Sonne bereits untergehen.«
»Er kann mich in meinen Gemächern auch besuchen, wenn es spät wird.«
»Das wäre nicht schicklich.«
Ich verschlucke mich fast an meinem Wein. »Nicht schicklich? Bin ich denn nicht seine Ehefrau?«
»Auf dem Papier und nach den Gesetzen dieses Landes schon.«
»Dann ist es wohl auch in Ordnung, wenn er mich in meinen Gemächern besucht.« Ich stelle das Glas langsam ab und bin froh, dass meine Hand ruhig genug ist, um nichts zu verschütten.
»Der Lord ist sehr beschäftigt.«
Womit?, würde ich gern fragen. Ich bemühe mich seit Stunden, mit dieser Situation so würdevoll wie möglich umzugehen. Aber ich weiß immer noch nicht, wer der Mann ist, den ich geheiratet habe. Ich habe keine Ahnung, wie er zu seinem Vermögen gekommen ist, woher er stammt, was er will und warum er ein Buch so sehr braucht, dass er bereit ist, für eine Ehefrau zu zahlen, nur um es zu besitzen.
»Könnten Sie ihm bitte ausrichten, dass seine Ehefrau froh wäre, wenn er vor Sonnenuntergang ein paar Minuten mit ihr verbringen würde?« Ich schaue in die runden schwarzen Augen des Butlers, als ich diese Bitte vorbringe.
»Ich werde es ausrichten.« Er verschwindet unverzüglich.
Ich esse allein. Für manche Leute mag das unangenehm sein, aber ich bin an Einsamkeit und das Für-mich-Sein gewöhnt. In gewisser Weise ist es mir sogar lieber. Stille ist beständig und Einsamkeit sicher. Es ist niemand da, der versucht, mir mein Essen wegzunehmen. Niemand, der verlangt, dass ich mich um ihn kümmere. Niemand, der mich von meinem Platz am Tisch vertreibt, damit ich mit dem Abwasch beginne.
Ehe ich michs versehe, ist der Teller leer und mein Magen unangenehm voll. Ich habe zu schnell gegessen. Außerdem ist das Essen üppiger, als ich es gewohnt bin. Ich lehne mich wenig damenhaft auf meinem Stuhl zurück und streiche über die Wölbung meines Bauches. Es ist lange her, dass ich mich so satt gefühlt habe.
Es könnte schlimmer sein, kehre ich zu meinen früheren Gedanken zurück. Mein Mann scheint kein wirkliches Interesse an mir zu haben. Das ist besser als ein Mann, der von mir erwartet, heute Abend in sein Bett zu kommen, damit ich anfangen kann, meine »Pflicht« zu erfüllen und ihm einen Erben zu schenken. Und ich scheine ebenso viele, nein, mehr Freiheiten zu haben als zu Hause. Zudem wird mir hier niemand zusetzen.
Oren kehrt zurück und reißt mich abermals aus meinen Gedanken.
»Seid Ihr fertig?«
»Ja.«
»War es genug?« Er sammelt meinen leeren Teller ein.
»Mehr als das.« Ich setze mich aufrechter hin. »Bitte richten Sie dem Koch aus, dass es wunderbar geschmeckt hat.«
Er wirft mir ein verschmitztes Lächeln zu und nickt. »Das mache ich.«
»Gibt es etwas Neues von meinem Ehemann?«, frage ich.
Der Butler seufzt. Wieder einmal lässt er sich für eine einfache Antwort viel zu lange Zeit. »Ich denke, er kann es sich einrichten, fünf oder zehn Minuten vielleicht. Ich werde in Eurem Arbeitszimmer Feuer machen. Dort könnt Ihr auf ihn warten.«
Mit schnellen Schritten trägt Oren das Geschirr ab. Ich stehe auf und gehe eine Runde um den Esstisch. Plötzlich tut es mir leid, darum gebeten zu haben, Lord Fenwood zu treffen. Was, wenn ihn die Bitte verärgert hat? Wenn er lieber in Ruhe gelassen werden will und ich seinen Zorn geweckt habe? Kopfschüttelnd bleibe ich stehen.
Nein, wenn ich hier leben und mit diesem Mann verheiratet sein soll, habe ich ein Recht darauf, ihn wenigstens einmal zu treffen. Und seinen Namen zu erfahren. Dass wir im Weiteren nichts mehr miteinander zu tun haben, kann ich aushalten. Aber wir sollten die Anwesenheit des anderen zumindest zur Kenntnis nehmen.
Nachdem ich mir auf diese Art Mut zugesprochen habe, kehre ich in meinen Flur zurück. Dort führt eine offene Tür in das Arbeitszimmer. Im Kamin knistert ein Feuer. Die Bücherregale an den Wänden sind fast leer. An der Seite steht ein kleiner Tisch, von dem ich annehme, dass er eigentlich zwischen die beiden Sessel gehört, die nun Rücken an Rücken vor dem Feuer platziert sind.
Ich gehe hinüber und streiche mit den Fingerspitzen über das Leder. Was für eine merkwürdige Sitzordnung, denke ich. Doch schon einen Moment später finde ich heraus, warum die Sessel auf diese Weise angeordnet sind. Denn plötzlich durchschneidet eine Stimme die Stille und hallt in meinem Inneren wider. Sie klingt wie das tiefe Knurren eines Wolfes und weckt den Instinkt eines Beutetiers in mir. Lauf, drängt mich meine Vernunft sofort. Lauf, so weit du kannst, das hier ist kein Ort für dich.
»Nicht umdrehen«, sagt er.
Mehr oder weniger instinktiv werfe ich dennoch einen Blick über die Schulter. Wenn jemand spricht, schaue ich hin. Es war nicht meine Absicht, ungehorsam zu sein … Zumindest nicht dieses Mal.
»Ich sagte, nicht umdrehen.«
Mein Kopf schnellt wieder nach vorne. »Ich habe nur Eure Schulter gesehen. Es tut mir leid, ich wollte nicht …«
»Oren ist die Regeln mit Euch durchgegangen, oder nicht?«
»Ja.« Der Mann, mit dem ich spreche, ist von großer Statur. Aber das ist auch schon alles, was mir der kurze Blick verraten hat. Er lehnt an der Wand neben der Tür, als hätte er gewusst, dass ich trotz seiner Anweisung zu ihm sehen würde.
»Dies hier ist die letzte Regel, die Ihr kennen müsst«, sagt er. »Ihr dürft mich unter keinen Umständen jemals ansehen.«
»Was?«, flüstere ich und kämpfe gegen den Drang an, noch einmal zu ihm zu schauen.
»Oren hat mir mitgeteilt, dass Ihr mich zu treffen wünscht. Dem komme ich nach, wie es nun meine Pflicht ist. Aber nur, wenn Ihr mir schwört, mich niemals anzusehen.«
Jetzt ergeben die Sessel einen Sinn. Ich frage mich, ob er womöglich schrecklich entstellt ist. Oder vielleicht ist er auch nur krankhaft schüchtern. Was immer der Grund ist, er soll sich nicht unwohl fühlen.
»Das ist mir recht.« Ich setze mich in den Ohrensessel mit Blick zum Fenster, mein Rücken ist der Tür zugewandt. »Ich bin froh, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt, mich zu treffen.«
Ich höre ihn das Zimmer durchqueren. Er geht mit ausgreifendem Schritt, eine weitere Bestätigung dafür, dass er sehr groß ist. Seine Bewegungen sind fast lautlos. Er geht wie ich, schießt es mir durch den Kopf, als versuche er, kein Geräusch zu machen. Ich glaube nicht, dass er sehr muskulös ist. Nein, ich stelle ihn mir eher drahtig vor. Nicht viel älter als ich, seiner kräftigen Stimme nach zu urteilen. Ich versuche, in der verschwommenen Spiegelung im Fenster einen weiteren Blick auf ihn zu erhaschen, aber es ist bereits zu dunkel im Zimmer. Er ist kaum mehr als ein verschwommener Schatten, der sich hinter mir bewegt.
Der Sessel in meinem Rücken seufzt leise unter seinem Gewicht. Die winzigen Härchen in meinem Nacken stellen sich auf. Noch nie war ich mir der Anwesenheit eines anderen Menschen so bewusst. Und noch nie habe ich mir etwas so dringend gewünscht, wie mich umzudrehen und nachzusehen, ob meine Einschätzung von ihm richtig ist.