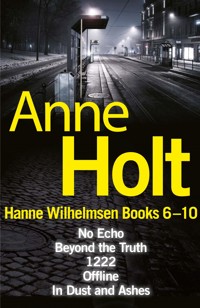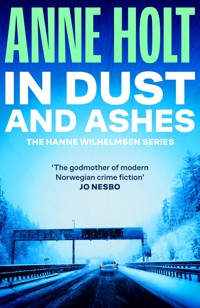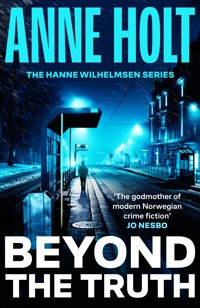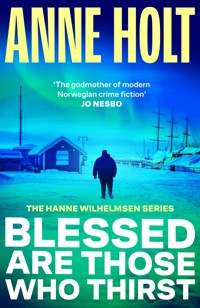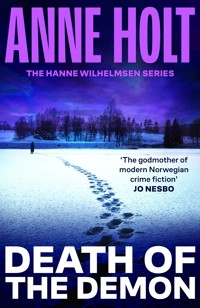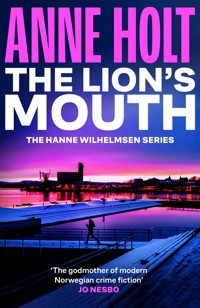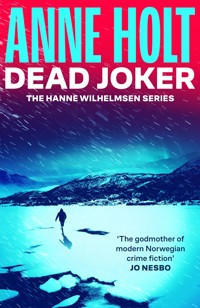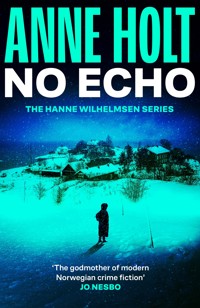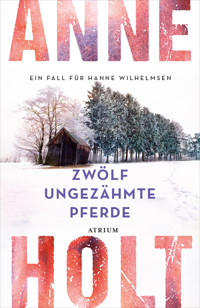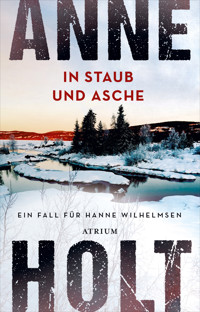8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Synne zum ersten Mal ihre neue Chefin sieht, verliebt sie sich Hals über Kopf. Doch die 15 Jahre ältere Rebecca ist verheiratet und hat vier Kinder, die sie über alles in der Welt liebt. Die beiden Frauen beginnen eine leidenschaftliche Affäre. Als Rebeccas Mann schließlich ihr Verhältnis entdeckt, zerbricht die Ehe. Auch nach vielen Jahren können Rebeccas Kinder nicht akzeptieren, dass ihre Mutter eine Frau liebt, und es kommt zur tragischen Katastrophe … Glaubwürdig und berührend erzählt Anne Holt von der Liebe zweier gegensätzlicher Frauen, von Schuld und Verantwortung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Anmerkung der Übersetzerin: Im Norwegischen werden die Anredeformen »du« und »Sie« etwas anders verwendet als im Deutschen. Die Übersetzung hält sich der Einfachheit halber an den Sprachgebrauch des Originals.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
4. Auflage November 2010
ISBN 978-3-492-95242-2
Piper Verlag GmbH, München 2010
© 1997 J. W. Cappelens Forlag A S, Oslo
Titel der norwegischen Originalausgabe: »Mea culpa«
© der deutschsprachigen Ausgabe:
2003 Orlanda Frauenverlag, Berlin
Umschlagkonzept: semper smile, München
Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin
Umschlagmotiv: plainpicture
Datenkonvertierung: CPI - Clausen & Bosse, Leck
Vorwort
Durch Schaden klug geworden – oder vielleicht sollte ich eher sagen, durch Erfahrung vorsichtig –, sehe ich jetzt Grund genug, mir die leicht variierten Worte meines spanischen Kollegen, des Krimiautors Manuel Vázquez Montalbán, zu Eigen zu machen:
Da gewisse Menschen beim Lesen immer versuchen, die Personen des Romans zu identifizieren, möchte die Autorin klarstellen, dass sie sich auf die Verwendung von Archetypen beschränkt hat, auch wenn sie zugeben muss, dass wir wirklichen Menschen uns bisweilen eben so aufführen.
Ich danke Eva Grøner und Lars Saabye Christensen.
Anne Holt
Archetypen: … auf der ganzen Welt verbreitete seelische »Urbilder«, die ihrem Wesen nach immer unbewusst bleiben werden, […], die Urform, von der alle Tier- und Pflanzenarten ihre gemeinsame Grundform haben.
(Aschehougs og Gyldendals Store Norske Leksikon)
Teil 1
1
Die Sache ging mir mit einer seltsamen Gewissheit auf, die ich mir nicht ganz erklären konnte. Ich musste einfach dorthin fahren. Fliehen. Verschwinden. Durchbrennen. Ich koste diese Wörter aus, lasse sie in einer schiefen kleinen Kuhle in meiner Zunge ruhen. Ich finde nichts, was mir schmeckt. Aber jedenfalls buchte ich den Flug und setzte mich in die Maschine.
Als ich meinen Entschluss fasste, wusste ich nichts über diese Gegend. Ich hatte mir eine Art Südseeinsel vorgestellt, irgendwo im Stillen Ozean. Wo die Südseeinseln eben liegen. Sie ist sicher platt, überlegte ich mir; eine Inselgruppe vielleicht, eine Gruppe Fliegenschiss auf der Karte, von der Art, die einem ungewissen Schicksal entgegenblickt, weil das Meer höher steigen und sie dann brutal verschlingen wird, da der reiche Teil der Welt sich beim Autofahren nicht einschränken will. Aus irgendeinem Grund stellte ich mir Polynesierinnen mit Blumenketten um den Hals und glücklichem Lächeln vor. Es ist schon seltsam, dass ich es nicht besser wusste, Mauritius war schließlich mein Samarkand. Der Ort, von dem ich immer geträumt hatte. Schon als Kind, meine ich. Und da war es doch auffällig, dass ich nie, kein einziges Mal in meinem Leben, diese Insel in einem Lexikon oder in einem Atlas nachgeschlagen und dass ich auch niemals irgendwen danach gefragt hatte. Ich wusste nur, dass Mauritius weit weg lag, dass es dort schön war, dass die Sonne den ganzen Tag schien und dass die Nacht dunkel und bestimmt vom Zirpen der Grillen erfüllt war.
Ich musste nach Mauritius. Es stellte sich heraus, dass diese Insel zu Afrika gehörte. Sie lag gleich rechts von Madagaskar, zwei Zentimeter weiter nur, in meinem alten, nach Volksschule riechenden Atlas, und sie ist wirklich ein Fliegenschiss. Aber nur einer. Eine ovale, fast tropfenförmige Insel, von Norden bis Süden an die hundert Kilometer lang, im Durchmesser vielleicht sechzig. Und es ist hier durchaus nicht platt. Im Gegenteil, seltsame scharf geschliffene Berge ragen in den Himmel, sie sehen karg und beängstigend aus. Für diese Insel besteht keine Gefahr, nein, sie wird nicht so schnell verschwinden. Und nicht nur die Berge scheinen ihre Zähne zu zeigen. Fast jeder Fleck bebaubaren Bodens ist von Zuckerrüben besetzt. Das ist eine wütend aussehende Pflanze, stechend und übellaunig, und die riesigen Felder, wenn sie denn so genannt werden, die kilometerlangen Flächen mit Zuckerrohmaterie, zwingen die meisten der etwa eine Million Menschen, die hier leben, dazu, sich an der Küste und entlang der Straße von Port Louis nach Curapine zusammenzudrängen. Am Meer dagegen ist es wirklich so schön, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Das Wasser ist grüner als an jedem anderen Ort, den ich je gesehen habe, und jetzt meine ich wirklich grün, nicht türkis wie in Südfrankreich, nicht dunkles Blaugrün wie vor der südnorwegischen Küste, wenn ein Sturm wütet. Nein, es ist grün wie der Frühling, hell und optimistisch, fast, als habe jemand Farbe ins Wasser gegossen und die Sache danach bereut. Es ist zu grün. Und die Strände sind weiß. Palmen beugen sich über das Wasser und streuen Samenkörner und Rindenstückchen aus, nach denen kleine Fische schnappen, synchron, eine ganze kleine Armada von winzigen Mäulern, als habe irgendein General den Befehl erteilt: Achtung, fertig, los! Schwupp, schon sind sie allesamt wieder verschwunden. Wie haben sie das gemacht? Wovon werden sie angetrieben?
Ich bin jetzt seit drei Monaten hier. Ohne irgend etwas zu tun, jedenfalls nichts Planmäßiges, nichts, was der Erwähnung wert wäre. Abgesehen davon, dass ich mich über die Organisation der Fische wundere. Ich schwitze mich schlafend durch die Tage. Nachts ersticke ich fast, abgesehen davon, wenn ich, sehr selten, eine Art Ruhe darin finde, dass ich den fremden Sternenhimmel betrachte, mit seinem unbekannten Gesicht (der Orion, zum Beispiel, steht fast auf dem Kopf, jedenfalls hängt er arg schräg und ganz woanders als zu Hause, außerdem kann ich ihn hier besser sehen; das Schwert, das in Oslo oft nicht einmal sichtbar ist, zeichnet sich hier so deutlich ab, so handgreiflich, dass ich fast erwarte, dass er es in einer schönen Nacht einmal ziehen wird). Der Himmel ist so schwarz und dermaßen übervoll von Lichtpunkten, dass ich mir einbilde, die Galaxien sehen zu können; ich spüre für blitzschnelle, wohltuende Momente, dass wir so klein und unbedeutend sind, dass ich mir um nichts Sorgen zu machen brauche. Ich brauche nichts zu empfinden. Nichts zu denken. Nicht zu weinen. Vielleicht nicht einmal zu existieren.
Darin liegt ein gewisser Trost.
Sogar für eine wie mich.
2
An dem Tag, an dem alles anfing, fanden zwei außergewöhnliche Ereignisse statt. Das eine hätte eigentlich allgemeine Bestürzung auslösen müssen, was es aber nicht tat. Im Nachhinein, wann immer sie versuchte, diese Episode Sekunde für Sekunde erneut zu erleben, was seltsamerweise immer leichter fiel, ging ihr auf, wie offensichtlich die Chronologie der ganzen Angelegenheit war: Sie hatte sie zuerst gesehen. Normalerweise hätte sie sich so erschrocken, dass sie Alarm geschlagen hätte; aller Wahrscheinlichkeit nach hätte sie irgendeine kompetente Instanz angerufen. Das Meteorologische Institut vielleicht, oder die Universität, wo es Menschen gibt, die Ahnung von diesen Dingen haben. Es war doch überaus eigentümlich, dass es nur ihr aufgefallen war. Aber sie musste sich einfach mit der Tatsache abfinden, dass in den Zeitungen kein Wort darüber stand und dass es auch in Radio und Fernsehen unerwähnt blieb. Also hatte sie es wirklich als Einzige gesehen.
Es geschah an einem Freitag im Juni vor etlichen Jahren, als das Jahrhundert seinem Tod noch nicht so bedrohlich nahe gerückt war. Es war in dem Jahrzehnt, in dem Gro Harlem Brundtland und Mammon um die Wette herrschten, und nicht beide würden das neue Jahrzehnt erleben. Die Menschen in Norwegen entdeckten Allradantrieb und Champagner, und sie näherten sich einem weiteren leichtsinnigen Mittsommerfest. Der Sommer hatte lange mit dem Frühling Verstecken gespielt, aber die Lunte brannte, und plötzlich war die Temperatur gestiegen.
Sie arbeitete im Ministerium, und zwar seit drei Jahren. Immer in derselben Position. Als Sachbearbeiterin. Ohne jemals in den häufigen Diskussionen über mögliche Beförderungen aufzutauchen, die jeden Arbeitsplatz mit Fluktuation prägen. Sie bewarb sich nicht einmal um einen besseren Posten. Dahinter steckte keine Faulheit, wie ihre Umgebung in boshaften Momenten leise und laut denken konnte. Jedenfalls nicht nur. Sie selbst betonte hartnäckig, sie habe ganz einfach praktische Gründe. Ein langweiliger und übersichtlicher Job gab ihr nämlich Zeit für das, womit sie ihr Leben wirklich verbringen wollte.
Synne Nielsen arbeitete jeden Tag bis kurz nach halb vier und tat genau das, was von ihr erwartet wurde. Niemals mehr. Aber auch nicht weniger, sie war keine Drückebergerin. Die Arbeit wurde erledigt, routinemäßig und phantasielos, na gut, aber ihr Büro war aufgeräumt und der Stapel der unerledigten Post nie so hoch, dass er nicht mit einem energischen Krafteinsatz zum Verschwinden gebracht werden konnte.
Dieser Freitagnachmittag war überaus schön und warm. Im Vorzimmer saßen fünf kaffeetrinkende Menschen, in einem von Rauch und sommerlichen Erwartungen geschwängerten Raum. Die meisten redeten wild durcheinander, niemand hörte wirklich zu, und alle schauten regelmäßig auf die Uhr. Synne Nielsen hatte der Tür den Rücken gekehrt und registrierte deshalb als Letzte, dass sie dort stand.
Rebecca Dorothea Faber Lange Schultz. Obwohl sie den Namen Schultz durch ihre Eheschließung erworben hatte, bestand doch Grund zu der Frage, welche Eltern wohl auf solche Ideen verfielen. Natürlich konnte es sich um kleinbürgerliche Snobs gehandelt haben, die in dem Irrglauben schwebten, der Name mache die Frau. Es war aber auch möglich, dass die Eltern an der Wiege gestanden und gesehen hatten, dass dieses Kind – dieses wunderbare Kind – etwas so Besonderes war, so schön und so hinreißend, dass es eine solche Perlenkette aus Namen ertragen könnte. Abgesehen davon, dass Rebecca Dorothea Faber Lange Schultz vermutlich niemals in einer Wiege gelegen hatte und bei ihrer Taufe wohl schon einige Jahre alt gewesen war. Denn getauft war sie bestimmt, so sah sie einfach aus, sie hatte etwas Zartes, Heiliges, das ihren Kopf umgab, es war natürlich ein Ring aus dunklem Licht, was Synne bei genauerem Nachdenken hätte erkennen können, es konnte aber auch von ihrem Haarshampoo herstammen.
Vernünftigerweise nannte sie sich einfach Rebecca Schultz.
Sie war Abteilungsleiterin.
Alle setzten sich gerade, als wollten sie aufspringen und davonstürzen. Alle, außer Synne Nielsen.
Langsam und gemessen hob sie die Arme über den Kopf. Eine schlaftrunkene Fliege brummte vor ihr herum. Cyclorapha diptera. Sie lächelte bei dieser Erinnerung. Fliegenaugen. Facetten, eigentlich Dutzende von weitwinkligen Linsen. Wie sah sie wohl aus dem Blickwinkel eines Insekts aus? Lag in jeder Facette ein Bild von ihr? Oder wurde ihr Gesicht zu einem kolossalen Weitwinkeleffekt verzerrt, der die Fliege verwirrte und sie ziellos hin und her, auf und ab irren ließ? Synne Nielsen schlug in die Luft, traf aber daneben. Dann wandte sie ihren Kopf langsam zur Tür.
Etwas explodierte. Etwas in ihrem Kopf. Alles wurde blank und weiß, als habe sie in ein altmodisches Blitzlicht gestarrt. Eine Phosphorbombe, sie kniff die Augen zusammen, es tat weh. Mitten in dem vielen Weiß lag ein Gedanke. Er war unpassend. Er war alles überschattend. Statt sich Gedanken zu machen wie »Das ist die Frau meines Lebens«, oder, vielleicht noch besser: »Für diese Frau werde ich alles tun, sogar mein Leben würde ich für sie opfern«, erlebte sie, dass etwas anderes und viel weniger Edles sich ausbreitete und alles andere beiseite schob; ein einziger Gedanke pflanzte sich durch ihren ganzen Leib fort, wanderte durch ihren Hals nach unten und dann in alle Glieder; sie spürte ein Prickeln in den Fingerspitzen, wie nach einem langen Aufenthalt in der Kälte, oder wie durch ein tiefes Schuldgefühl.
Weil die Vorstellung so allüberschattend und so weit jenseits aller Moral war, packte die Schuld sie schon an diesem Junitag. Nicht in der Weise, dass sie da und dort ihre Anwesenheit gespürt hätte, dafür war kein Platz; aber später, viel später, in allen Rückblicken, allen selbsterforschenden, selbstüberführenden, schmerzhaften retrospektiven Momenten, begriff sie, dass die Schuld vorhanden gewesen war, schon von Anfang an.
Als ihre Augen einander trafen, und noch ehe Synne Nielsen etwas anderes registrieren konnte als eben die Augen der Frau in der Tür (nicht einmal ihre Kleidung; in den folgenden Jahren gelang es ihr trotz großer Anstrengungen nie, sich daran zu erinnern, was Rebecca an diesem ersten Tag angehabt hatte), dachte sie genau dieses, nicht mehr und nicht weniger:
»Mit dieser Frau will ich ins Bett.«
Innerhalb von zwei Zehntelsekunden, vielleicht sogar noch rascher, berechnete Synne Nielsen die Lage und stellte fest, dass es um ihre Chancen katastrophal schlecht bestellt war. Und sie gelangte zu einer Entscheidung: Sie wollte es versuchen.
Als sie das gedacht hatte, entließ sie Rebecca Schultzens Gesicht aus ihrem Blick, und dann ließ sie diesen zum Fenster in der gegenüberliegenden Wand wandern.
Obwohl es erst drei Uhr nachmittags war, warf die Sonne ihre bleichorangenen Strahlen auf ein verschmutztes, staatliches Fenster, aber das von einer Stellung gleich oberhalb des Horizontes aus. Synne Nielsen streckte langsam den Arm aus, ballte die Faust, hob den Daumen und kniff das eine Auge wieder zu. Die Entfernung von den niedrigen Hausdächern, die den eigentlichen Horizont verbargen, die jedoch absolut nicht als Hochhäuser bezeichnet werden konnten, diese Entfernung, die nur einige Fingerlängen hätte betragen dürfen – angesichts der Uhrzeit eben –, diese Entfernung bestand aus einer Daumennagelbreite. Das war unbegreiflich.
War die Erde dabei, aus ihrer Jahrmilliarden alten Bahn zu fallen? Lag dort draußen in Wirklichkeit eine riesige Supernova, eine entfernte Verwandte der Sonne, die damit drohte, den ganzen Erdball zu versengen und alles Leben auszurotten, ohne Vorwarnung, jählings, allen modernen wissenschaftlichen Berechnungsmodellen zum Trotz? Die Position dieser glühenden Scheibe wäre um acht Uhr abends ganz normal erschienen, vielleicht auch noch um neun, aber jetzt? Eine halbe Stunde vor Feierabend? So mitten im Sommer, wie es überhaupt nur möglich war! Es war dermaßen erschütternd, dass sie zweifellos nur deshalb keinen Alarm schlug, weil sie sie zuerst gesehen hatte. Sie ließ statt dessen den Arm sinken und erbrach sich. Ehe Synne Nielsen sich ausgekotzt hatte, war die Frau wieder verschwunden.
An diesem Tag hatten zwei außergewöhnliche Ereignisse stattgefunden. Sie war der Frau ihres Lebens begegnet, und die Sonne schickte sich zum Absturz an.
3
Ich blute. Wie ein Schwein. Es tut weh und ist außerdem verdammt unpraktisch. Bei dieser Hitze kann ich keine Jeans tragen, und nur in Jeans liegen die klobigen, hoffnungslosen Binden wirklich so, wie sie sollen. Meine Shorts sind alle hell. Jetzt sind sie gefleckt, mit pfannkuchengroßen Schandflecken besudelt; ich verstecke sie, damit das Zimmermädchen sie nicht findet. Ich muss Chlor auftreiben.
Damit ruiniere ich die Shorts, aber sie werden doch immerhin sauber.
Ich habe keine Medikamente. Ich habe nichts Schmerzstillendes. Ich kenne hier keinen Arzt. Und da ich mich alle halbe Stunde umziehen muss, kann ich auch nicht in den Ort fahren und einen suchen.
Es dauert schon viel zu lange, schon zehn Tage.
Ich krümme mich im Schatten zusammen und spüre, wie alles aus mir herausfließt. Wenn aus meinen Unterhosen grüne Kröten und furchterregende Schlangen kröchen, würde mich das nicht im Geringsten überraschen.
Vielleicht ist es Gott, der mir da einen Streich spielt.
Ich presse mich auf den Boden und wünschte, ich könnte mich losreißen. Könnte ich doch nur die Schwerkraft umkehren, sie so verdrehen, dass Massen einander abstoßen, nur hier, nur an diesem Ort, nur für einen kurzen Moment, für den Moment, den ich brauchen würde, um Anlauf zu nehmen, weg vom Strand, weg von Mauritius, weg von der Erde und hinaus in die unendliche Dunkelheit, die so segensreich riesig und schwarz wirkt, dann könnte ich den schrägen Orion umarmen und würde nur eine dünne Blutspur hinterlassen, und sonst gar nichts, rein gar nichts.
4
Rebecca Schultz wollte bereits im August aufhören.
Am Montagmorgen, als diese Tatsache ihr durch einen Zufall zu Ohren kam, geriet Synne Nielsen in Panik. Sie konnte nicht begreifen, warum jemand nach drei Jahren Mutterschaftsurlaub nur für wenige Wochen zurückkam, und das noch dazu mitten im Sommer, wo Urlaub und Feiertage die meiste Zeit verschlangen, aber sie vermutete den Grund für diesen Schritt in engstirnigen staatlichen Vorschriften.
Die Sonne war im Laufe des Wochenendes zwar in ihre ursprüngliche Bahn zurückgekehrt (und zwar schon am Freitagnachmittag; Synne hatte nach der Arbeit den Himmel angestarrt, war mitten auf der Grubbegata stehen geblieben und dabei fast von einem Taxi überfahren worden, denn sie hatte es erst bemerkt, als der Fahrer sie durch das heruntergekurbelte Fenster angebrüllt hatte; sie war unbeschreiblich erleichtert darüber, dass die Sonne ihren angestammten Platz wieder eingenommen hatte, doch zugleich stellte sich die Angst ein, sie könne an einer akuten Psychose erkrankt sein, sich alles unter Umständen nur eingebildet haben; andererseits fühlte sie sich nicht nur gesünder als seit langer Zeit, sondern fast schon glücklich, es konnte also nicht so gefährlich sein, und deshalb verdrängte sie jeden Gedanken an das bizarre Verhalten der Sonne mit einem breiten Lächeln und einer obszönen Geste, die dem Taxifahrer galt), aber die Nachricht von Rebeccas (in Gedanken nannte sie sie schon beim Vornamen) baldigem Ausscheiden aus dem Ministerium erregte ihr neuerlich Übelkeit und zwang sie auf die Toilette, wo sie ihr Gesicht so lange unter fließendes kaltes Wasser halten musste, dass sie sich danach nur noch mit Mühe aufrichten konnte.
Sie schleppte sich ins Vorzimmer. Über einem Tischkopierer hing ein Stück Millimeterpapier mit grünen und roten Markierungen und den Namen aller Angestellten, die in diesem Stockwerk arbeiteten. Synne starrte das Blatt so lange an, bis das Rot und Grün in die hauchdünnen orangenen Streifen auf dem Papier schwamm, bis alles zu einem bunten Brei verlief. Sie kniff die Augen zusammen und rieb sich das Gesicht.
Rebecca würde verschwinden. Am 5. August. Das war mit einem brutalen schwarzen Schlussstrich auf dem Papier vermerkt. Wie ein erwarteter und unvermeidlicher Todesfall, dachte Synne verzweifelt, als sei es ein Verbrechen, das Ministerium zu verlassen, und als könne dieses Verbrechen nur mit einem hässlichen jähen Ende bestraft werden; die Sekretärin hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, ein Lineal zu benutzen, der schwarze Strich unterschied sich in vielfacher Hinsicht von seinen zierlichen, rot-grünen Kollegen, die munter von den Plänen erzählten, die die anderen Angestellten bis in den September hinein hegten.
Rebecca würde im August aufhören. Und bis dahin wollte sie noch Urlaub machen. Das hatte auch Synne vor, doch ihre zwei Wochen an der Südküste lagen hinter den drei Wochen, die Rebecca irgendwo verbringen würde. In Cannes vielleicht, oder auf den Malediven. Oder vielleicht in einem eigenen riesigen Ferienhaus in Grimstad, mit Mann und Kindern und Schwiegereltern. Ab Mittwoch.
Drei plus zwei macht fünf. Der siebte August lag nur knappe sieben Wochen in der Zukunft. Sieben minus fünf macht zwei. Zwei kurze Sommerwochen am gemeinsamen Arbeitsplatz. Zehn Arbeitstage. Das reichte nicht.
Sie musste ihre Pläne ändern. Sie musste sofort Urlaub nehmen. Sie konnte nicht warten. Sie musste zur selben Zeit Urlaub haben wie Rebecca.
Die staatliche Urlaubsplanung kam ihr vor wie ein Flugzeugträger, der sich im März auf einen Kurs festlegte und von diesem danach durch keine Erschütterung zum Abweichen zu bewegen war.
Plötzlich erkrankte Synnes Mutter schwer. Eigentlich war sie kerngesund, aber sie lebte so weit entfernt, dass niemand ihr jemals auf die Schliche kommen würde. Synnes Gewissen versetzte ihr einen Stich, als sie eine Lungenentzündung erfand, die einfach nicht weichen wollte und in der die Ärzte einen beginnenden Krebs mutmaßten, vor allem unter dem mitleidigen Blick der Sekretärin, der sich für einen Moment mit Tränen zu füllen schien. Dann zwang sie sich, daran zu denken, was eine Freundin einst unternommen hatte, um ihnen einen Flug zu besorgen, zu Studienzeiten, als sie sich nur ein Stand-by-Ticket hatten leisten können, und der Versuch allein war mitten in der schlimmsten Urlaubszeit ja fast schon ein Auswuchs purer Idiotie gewesen. Als sie vom dritten überfüllten Flugzeug abgewiesen wurden, brach die Freundin vor der Frau am Ausgang in bitterliches Weinen aus. Synne starrte rot und verlegen den Boden an, als die Freundin mit fabelhaftem Talent von ihrer verstorbenen Mutter erzählte, die am nächsten Tag beigesetzt werden sollte, und wie schrecklich es doch wäre, wenn sie (als einzige Anverwandte) und ihre Freundin (ihre Stütze in dieser harten Zeit) nicht rechtzeitig einträfen. Sie durften auf den Notsitzen mitfliegen. Eine tote Mutter war eine ärgere Lüge als eine kranke. Und das hier war eine viel schlimmere Krise als damals.
Die Sache konnte geklärt werden.
Und sie schämte sich nicht einmal.
Ihr blieben zwei Tage und vier Wochen, um Rebecca Schultz kennen zu lernen.
Das Hundebaby war zwölf Wochen alt und bot einen unwiderstehlichen Anblick. Es war aus einem Impuls heraus angeschafft worden, in der Verliebtheit eines Augenblicks, und es ließ sich unmöglich als etwas anderes bezeichnen als eben als Hund. Die Pfoten waren eine Nummer zu groß, die Beine zwei zu kurz. Das eine Ohr war geknickt, das andere war eine bewegliche Radarantenne, die über einen braunen, seidenweichen Schädel zu tanzen schien. Der Nachbar, sein Besitzer, hatte ihm und seinen fünf Geschwistern ein düsteres Schicksal prophezeit, falls sich nicht bald jemand dieser Tiere erbarmte. Die Hündin – die Mutter der bedauernswerten Kleinen – hatte Synne einen bis zum Bersten mit Kummer erfüllten Blick zugeworfen. Und damit legte Synne sich auf eine Weise einen Hund zu, von der wirklich nur abzuraten war, sie las ihn von der Straße auf und ging. Schon im Treppenhaus bereute sie diese spontane Tat, als das Kleine in der verzweifelten Angst der Trennung auf sie pisste, während es wimmerte und fiepte und zu Mama zurückwollte.
Natürlich hatten Hunde keinen Zutritt zum Ministerium. Nur für den Blindenhund der Telefonistin galt eine Ausnahme, aber der sah auch eher aus wie ein vollgefressenes Schwein als wie ein Exemplar der Gattung Canaris familiaris. Leider war am Geruchssinn des Schweinehundes nichts auszusetzen, und dumm war er auch nicht. Da aber Synne auf dem Weg zum Büro zwangsläufig an diesem Wachschwein vorübermusste, hatte sie das Hundebaby in eine große Tasche gestopft und es zuvor einer ausgiebigen Dusche mit »Shalimar« unterzogen. Ob das wirkte, oder ob der Blindenhund diesen Besuch einfach nicht gefährlich fand, konnte sie nachher nicht sagen. Jedenfalls erreichte sie mitsamt dem Hundebaby ihr Büro, ohne dass irgendwer Alarm geschlagen hätte. Doch als das Kleine dann aus der Tasche befreit war, lief es Amok.
Die kleine Hündin wand sich aus Synnes Armen, rannte über den Linoleumboden, legte vor dem Fenster eine ansehnliche Wurst ab und nagte dann das Schreibtischbein an. Der Schaden war schon unwiderruflich geschehen, als Synne sich endlich zusammenriss und das Tier wieder auf den Arm nahm. Das Hundeverbot kam ihr plötzlich gar nicht mehr so unbegreiflich vor.
Synne Nielsen wusste nicht, was sie machen sollte. Bei dieser törichten Schmuggelaktion hatte sie einen Hintergedanken gehabt, einen sonnenklaren Hintergedanken, der sich jetzt aber ganz und gar verdüstert hatte. Sie hielt einen Hund in den Armen und kam sich vor wie ein Schaf.
Rebecca Schultzens Büro lag am entgegengesetzten Ende eines endlos langen Ganges. Synne wusste nicht, ob Rebecca sich in ihrem Büro aufhielt. Wie bei den meisten in ihrer Position bestand ihr Arbeitstag vor allem aus Besprechungen. Synne war sich nicht einmal sicher, dass Rebecca sich überhaupt im Haus aufhielt. Und daran hatte sie nicht gedacht.
Außerdem war Rebecca viel älter als sie. Auch daran hatte sie nicht gedacht.
In den Jahren, die auf diese Geschehnisse folgten, versuchte Synne Nielsen oft, festzustellen, wann und wo sie die Grenze überschritten hatten, hinter der es keine Wiederkehr gab. Doch wie sie die Sache auch drehte und wendete, immer landete sie bei diesem Montag Ende Juni. Alles, was später passiert war, war unvermeidlich gewesen, wie ein Lauf über einen Weg, der hinter uns einstürzt, oder vielleicht wie eine Szene aus einem Actionfilm, in der die Heldin über eine am einen Ende sich lösende Hängebrücke jagt, ein Wettlauf mit dem Tod, in Zeitlupe und vor fünf Kameras. Aber als sie dort in ihrem Büro stand und die Hundekacke auf dem Boden anstarrte, handlungsunfähig und mit der plötzlichen Erkenntnis, dass Rebecca sicher zwölf oder dreizehn Jahre älter war als sie (warum sie sich gerade in diesem Moment in die Altersfrage verbiss, sollte ein Rätsel bleiben; denn von allen Abgründen, die zwischen ihnen lagen, war der Altersunterschied doch nur ein kleiner, seichter Riss im Boden), und mit dem starken Gefühl, dass sie sich jetzt gerade lächerlich machte – wenn nicht in den Augen der anderen, dann doch in ihren eigenen –, hätte sie umkehren können. Sie hätte den Hund in die Tasche stopfen, ihre Mutter gesundmelden, Ende Juli Urlaub machen und innerhalb einiger Monate die ganze Geschichte vergessen können. Später ging ihr auf, dass das alles möglich gewesen wäre. Damals. An jenem Montag.
Synne Nielsen war versessen auf Tage. Sie behielt sie im Gedächtnis. Es gab kein Erlebnis von einer gewissen Größe, das sie nicht in den sieben Archivfächern der Woche hätte unterbringen können. Oft konnte sie sich auch an das Datum erinnern; in vieler Hinsicht war Synne Nielsen ein zeitfixierter Mensch. Sie konnte sich unter anderem auf die Sekunde genau an den Verlust ihrer Unschuld erinnern, und obwohl das seine natürliche Erklärung darin fand, dass an der Wand des Klassenzimmers, in dem es passiert war, eine riesige Uhr gehangen hatte (ein schwarzweißes Monstrum, das vom Rektor ferngesteuert wurde und deshalb peinlich korrekt ging und dessen Sekundenzeiger so laut tickte, dass er fast die Entzückensschreie von Synnes Klassenkameraden übertönte), so war es doch bezeichnend, dass sie sich so viele Jahre später noch immer daran erinnern konnte. Nachmittags um zwanzig vor vier Uhr. Dienstags. Wenn sie sich selbst gegenüber ehrlich war, so erinnerte sie sich an die Uhrzeit besser als an den eigentlichen Vorgang.
Synne Nielsens Gehirn war erfüllt von Daten, Tagen, Stunden und Sekunden, so sehr, dass ihr oft alles durcheinander geriet, in einer Art Gehirnkatarrh, der sich vor allem nachts einstellte, doch es dauerte niemals lange, bis alles sich wieder zusammenfügte, wie zu einem geistigen Filofax. Die meisten ihrer Bekannten hielten ihre detaillierten Auskünfte über Ort und Zeit in allen Anekdoten für die Würze, mit der sie die Glaubwürdigkeit einer Geschichte von zweifelhaftem Wahrheitsgehalt steigern wollte, doch Tatsache war, dass sie einfach auf eine anstrengende Unsitte konstruktive Wechsel zog.
Trotz dieser Zeitversessenheit konnte sie sich später nicht mehr daran erinnern, wie lange sie mit dem Hundebaby auf dem Arm und mit offenen Rücktrittsmöglichkeiten dort gestanden hatte. Mit Sicherheit konnte sie nur sagen, dass sie die Kacke nicht aufgehoben, sondern stattdessen energisch die Tür hinter sich geschlossen hatte und durch den langen Gang gewandert war. Sie machte nicht einmal den Versuch, zu verbergen, was sie da in den Armen hielt.
Weit vor sich konnte Synne sehen, wie Rebecca Schultz auf ihr eigenes Büro zuwogte.
Rebecca Schultz wogte wirklich. Sie war eine kräftige Frau, durchaus nicht mollig, in keiner Hinsicht, aber sie wies dort Kurven auf, wo Frauen eben Kurven aufweisen sollten; der abgegriffene Vergleich mit der Eieruhr fiel Synne ein, als sie für einen Moment stehen blieb und einfach nur noch starrte. Rebeccas Aussehen widersprach auf erstaunliche Weise ihrer ethnischen Herkunft; sie hätte kleiner sein müssen, viel kleiner, doch sie war von einer hochgewachsenen nordischen Gestalt. Synne Nielsen hatte die gleichen Vorurteile wie die meisten anderen, davon ging sie aus, und laut diesen waren Asiatinnen entweder mager (und dann waren sie konturlos und hatten flache Brüste) oder dick (und dann waren sie kugelrund). Doch Rebecca hatte schwingende Formen, sie trug einen Rock und halbhohe Absätze, und sie wogte.
In ihr eigenes Büro!
Synne setzte das Hundebaby auf den Boden und hoffte aufs Beste. Dann überkam sie die Angst, dass Rebecca Hunde vielleicht verabscheute. Sie konnte doch ein Katzenmensch sein. Oder allergisch. Oder eine Paragraphenreiterin, die zutiefst empört darauf reagieren würde, dass eine Angestellte in einem staatseigenen Gebäude den offiziell anerkannten Vorschriften eine solche Missachtung entgegenbrachte.
Doch Rebecca war sofort erobert. Als Synne den Kopf durch ihre Tür steckte und eine verzweifelte Miene aufsetzte, weil ihr der kleine Hund entwischt war, war Rebecca Schultz schon in die Hocke gegangen, und das Hundebaby hatte ihr zwei Pfoten aufs Knie gelegt und leckte ihr das Gesicht. Dieser Erfolg war fast nicht zu ertragen, und Synne Nielsen brach in einen Schluckauf aus.
»Wie heißt denn dieser kleine Wicht?«
Die Stimme war wunderschön. Sie sang.
»Cetacea. Das bedeutet Wal. Hick.«
»Was hast du gesagt?«
»Der Hund. Er heißt – hick – Cetacea. Das ist Latein. Bedeutet Wal.«
Synne Nielsen verachtete Menschen, die nicht in ganzen Sätzen reden konnten; Menschen, die mit einer Menge loser Wörter ohne Bedeutung dahinstolperten – irgendwie und gewissermaßen waren das die Schlimmsten – und die noch als Erwachsene nicht begriffen hatten, dass auch mündlich vorgetragene Sätze Subjekt, Prädikat und Objekt enthalten sollten.
Aber ihr Schluckauf setzte ihr dermaßen zu, dass sie mit einer ihr überaus fremden Wortkargheit geschlagen war. Immer wenn Rebecca Schultz auf den Hund hinunterblickte, hielt Synne den Atem an und presste Luft in ihr Zwerchfell, aber das sorgte bei ihr nur für Watte in den Ohren. Außerdem merkte sie, dass ihr Gesicht rot anlief.
»Ist dir noch immer schlecht?«, fragte Rebecca Schultz plötzlich.
»Nur ein wenig Schluckauf«, erwiderte Synne Nielsen und schwenkte die eine Hand vor dem Gesicht, in der Hoffnung, die unnatürliche Röte vertreiben zu können.
»Ich meine, wie am Freitag«, sagte Rebecca lächelnd. »Da ging es dir doch so schlecht.«
Sie konnte sich an sie erinnern. Theoretisch wäre alles andere natürlich ein Skandal gewesen. Erst vor drei Tagen hatte sie sich vor Rebeccas Augen erbrochen, und Rebecca hätte doch an übermäßigem Stumpfsinn leiden müssen, wenn diese Szene hei ihr nicht einen gewissen Eindruck hinterlassen hätte. Aber dennoch … Rebecca Schultzens Erinnerung zeigte, dass Synne etwas erreichen könnte, dass sie etwas an sich hatte, das Rebecca aufgefallen war und das sie vielleicht gern etwas genauer untersuchen wollte.
Die Art, wie sie in die Hände klatschte … Synne sah sich Rebeccas Hände an. Sie waren groß, etwas zu groß für diesen weiblichen Körper; breite Handrücken mit einem trockenen, feinen Hautmuster, die vier Kindern die Windeln gewechselt hatten. Synne wusste, dass Rebecca vier Kinder hatte. Darüber hatte eine Illustrierte berichtet. Mit Bildern. Die Kinder waren eher niedlich als schön, und die Bilder hatten gezeigt, dass sie lieber nicht fotografiert werden wollten.
Rebeccas Finger waren nicht lang, sie waren eigentlich gerade richtig, mit der dazupassenden Nagellänge und ohne Ringe. Keine Ringe! Gab es bei ihr vielleicht Eheprobleme?
Ihre Hände waren überaus anziehend. Sie strich damit in langen, langsamen Zügen über den Hundeleib, genau in der richtigen Stärke, so wie es nur eine kann, die Hunde liebt und kennt.
»Eigentlich bin ich ein Katzenmensch«, erklärte sie. »Und wie ein Wal sieht sie nun nicht gerade aus. Witziger Name! Schön.«
»Darin gibt es zwei S«, sagte Synne. »Oder eher zwei C. Aber das kommt ja aufs Selbe raus. Das S ist ein Laut, den Hunde leicht registrieren. In einem Hundenamen sollte immer mindestens ein S vorkommen.«
Der Schluckauf war verflogen.
»Interessant«, sagte Rebecca, ohne einen Hauch von Ironie.
Dann setzte sie Cetaceas Pfoten auf den Boden, richtete sich auf, strich mit den Händen (sie waren wirklich ungeheuer anziehend, sie sahen weich und fest zugleich aus, sie wirkten so zielstrebig, es war fast unmöglich, nicht an Sex zu denken, wenn sie sie so vor sich sah) über ihren Rock, um sich von Hundehaaren zu befreien, dann trat sie zwei Schritte auf Synne zu und streckte ihr die rechte Hand hin.
»Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt«, sagte sie mit einer darin enthaltenen vorsichtigen Frage.
»Nein, das haben wir nicht«, bestätigte Synne und verfluchte den Schweiß, der dick und zäh in ihren Handflächen klebte.
So diskret wie möglich rieb sie ihre Hand über ihre Hose, ehe sie den Gruß erwiderte. Das half nichts. Aber ihre Hände waren wie erwartet. Trocken, warm. Ihr Händedruck war fest, aber nicht eisern, so wie Synne ihren eigenen kannte; sie konnte nichts dafür, sie hatte solche Angst davor, schlaff zu wirken, dass sie übertrieb, ja, sie übertrieb dermaßen, dass zarter gebaute Menschen schmerzlich das Gesicht verzogen, wenn sie sie begrüßten. Jedenfalls war das schon einige Male passiert.
»Rebecca Schultz«, sagte sie.
»Sehr erfreut«, sagte Synne Nielsen und wollte die Hand nicht loslassen.
Sie starrten einander an, dann fiel es ihr ein.
»Synne Nielsen«, sagte sie dann endlich, sehr schnell, es klang wie ein kräftiges Niesen, ungefähr wie Synne Nissen.
Dann wiederholte sie es, laut und deutlich:
»Synne Nielsen.«
In den folgenden Jahren versuchte sie ab und zu, herauszukitzeln, wie Rebecca das alles erlebt hatte. Während Synne jedes Detail schildern konnte (diesmal registrierte sie zum Beispiel, wie Rebecca gekleidet war, vom Rockmuster bis zu der kleinen weißen Stickerei auf dem Blusenkragen), schüttelte diese nur den Kopf, überlegte und fragte dann endlich:
»Cetacea war damals noch ziemlich klein, oder?«
Ob es die Art war, wie Rebecca mit dem Hund umging, ob es ihr Händedruck war, der Blick oder die Tatsache, dass sich jetzt unter die glänzenden rabenschwarzen auch graue Haare mischten, ohne dass sie versucht hätte, etwas daran zu ändern – Synne konnte jedenfalls niemals erklären, was den entscheidenden Eindruck gemacht hatte.
Aber ihr Entschluss stand fest.
Sie wollte Rebecca mit beiden Händen packen.
Sie war glücklich und lachte in Gedanken über ihren eigenen Optimismus.
5
Ich finde es sehr schwer, meine anstrengende Wanderung zu ihrem Herzen zu beschreiben. Die Geschichte verwirrt mich, auch wenn mein Gedächtnis mir dabei hilft, alle Episoden am Leben zu erhalten, detailliert und korrekt, falls es im Leben eines Menschen überhaupt etwas gibt, das sich zuverlässig und in allen Einzelheiten wiedergeben lässt. Statt sich in eine Geschichte mit Anfang und Ende und etwas in der Mitte einzufügen, springen die Details wie störende Elemente hin und her und zerstören Chronologie und Logik, und immer wieder stehe ich dann vor einem Flickenteppich aus heftigen Bildern, die sich gegenseitig zunichte machen.
Ende der Leseprobe