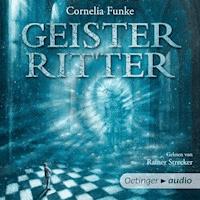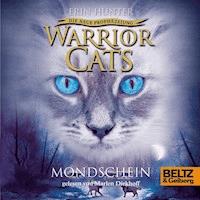4
Hinreichende mathematische Kompeten-
zen sind heutzutage unabdingbar, um am
schulischen, beruflichen und gesellschaft-
lichen Leben erfolgreich teilnehmen zu
können. Rechnen löst jedoch bei vielen
Kindern, wie bei Mea in dieser Geschichte,
Angst aus – in Lern- und Leistungssituatio-
nen, aber auch im Alltag. Sie behindert das
Lernen und Lösen von Rechenaufgaben zu-
sätzlich. Man weiß heute, dass etwa 6% der
Kinder unter einer spezifischen Rechenstö-
rung leiden. Dies bedeutet, dass Mea kein
Einzelfall ist, sondern in jedem Klassenzim-
mer ein bis zwei betroffene Kinder sitzen.
Mädchen sind etwa gleich häufig oder häu-
figer von einer Rechenstörung betroffen als
Jungen.
Die Rechenstörung wird auch Dyskalkulie
genannt und ist definiert als spezifische
Lernschwierigkeit im Bereich Rechnen.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
erkennt die Dyskalkulie als eine Entwick-
lungsstörung schulischer Fertigkeiten an.
Die Rechenprobleme sind nicht durch eine
allgemeine Intelligenzminderung erklär-
bar. Sie treten meist ab Beginn des Rech-
nenlernens auf und bleiben über einen
längeren Zeitraum durchgehend bestehen,
unbehandelt bis ins Erwachsenenalter. Das
heißt, eine Dyskalkulie wächst sich nicht
einfach aus.
Kinder mit einer Dyskalkulie erkennt man
oft daran, dass sie Mühe haben, Mengen ab-
zuschätzen oder zu vergleichen, sie zeigen
Zählschwierigkeiten, insbesondere beim
Rückwärtszählen, nehmen selbst nach Jah-
ren beim Rechnen noch ihre Finger zu Hil-
fe, können Ergebnisse nicht automatisch
aus ihrem Gedächtnis abrufen, verstehen
Rechenoperationen oder das Dezimalstel-
lensystem nicht, entschlüsseln mathemati-
sche Textaufgaben falsch, haben kein Ver-
ständnis für Zeit, Längen, Gewichte und
Geld sowie teilweise Mühe beim Zeichnen
von Figuren, dem Erkennen von Symmet-
rie oder dem mentalen Rotieren von Objek-
ten. Grundsätzlich werden mathematische
Inhalte nur sehr mühselig erlernt und sind
dann oft am nächsten Tag bereits wieder
vergessen.
Zudem ist Dyskalkulie häufig mit zusätz-
lichen Störungen assoziiert. Die zwei häu-
figsten sind die Lese-Rechtschreibstörung
und die Aufmerksamkeitsstörung. Die Zah-
len, wie häufig diese Störungen gemeinsam
mit einer Dyskalkulie auftreten, schwan-
ken zwar zwischen 22–40%, verdeutli-
chen jedoch, dass Dyskalkulie gemeinsam
mit diesen Defiziten auftreten kann.
Nicht selten entwickeln Kinder als Folge
der Dyskalkulie psychische Probleme. Diese
psychischen Auffälligkeiten können vielfäl-
tig sein und beeinflussen das Kind in seiner
gesamten Entwicklung. Häufig sind Angst-
störungen, welche von einfacher Schul-
unlust zu spezifischer Mathematikangst,
genereller Prüfungsangst und bis hin zu
generalisierter Schulangst und Schulver-
weigerung reichen können. Damit können
depressive Symptome (Traurigkeit, sozialer
Rückzug) und psychosomatische Sympto-
me (Kopf- und Bauchschmerzen, Übelkeit,
Geleitwort:
Wenn der Umgang mit Zahlen schwerfällt
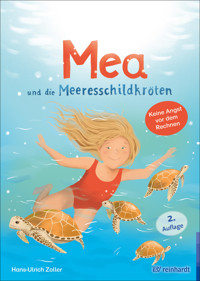














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)