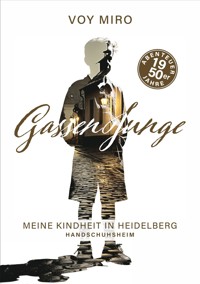4,99 €
Mehr erfahren.
Mechthild ist eine Hexe, sagen die Leute. Sie ist vom Teufel besessen, heuchelt der Pfarrer – und treibt es mit ihr. Einem Alten in Frack und Zylinder ist sie hörig. Für seine Katzenfelle erduldet sie alles. Ein Dorfdrama mit Menschen in Schweiß und Wut: nah am Zeitgeist der düsteren Fünfziger: literarisch inszeniert im Licht flackernder Gaslaternen. Ein Stück deutsche Geschichte vor dem Bühnenbild traumatisierender Geschehnisse ... Mechthild im Spiegel der Presse: REISE IN DIE NACHKRIEGSZEIT Dicht und spannend erzählt am Damals der Leidensjahre; keine grausame Geschichte - viel mehr die heimliche Gucklochsicht eines kleinen Jungen, in dessen kindlicher Phantasie sich Unglaubliches abspielte. (Stuttgarter Nachrichten) WO IST NUR DIE LEICHE?! Die Geschichte spielt in Heidelberg: dort, wo der Autor Kindheit und Jugend verbrachte. Mit "Mechthild" ist ihm ein Kabinettstück gelungen, ein Krimi, der sich lesen lassen kann. (Ludwigsburger Kreiszeitung) EIN HEIDELBERG-KRIMI WIE ER IM BUCHE STEHT!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Voy Miro
Mechthild
Ohne Leiche kein Mord
Copyright: © 2023 Manfred Poisel
Umschlag: Felix Baumgartner / freie-grafik-frankfurt.de
Titelfoto: Reveriesian
Verlag und Druck:
tredition GmbH
An der Strusbek 10
22926 Ahrensburg
Softcover
978-3-347-86903-5
Hardcover
978-3-347-86904-2
E-Book
978-3-347-86905-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Pseudonym Voy Miro …
findet seine Entsprechung im Namen des Autors, abgeleitet aus der tschechischen Sprache für „Manfred“. Aus Voymir (Vojmir) entstand das vorliegende Pseudonym.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit „Mechthild“!
Manfred Poisel
Der Friederich, der Friederich,
Das war ein arger Wütherich!
Er fing die Fliegen in dem Haus
Und riß ihnen die Flügel aus.
Er schlug die Stühl’ und Vögel todt
Die Katzen litten große Noth.
Und höre nur wie bös er war:
Er peitschte seine Gretchen gar!
Aus dem Struwwelpeter …
Klassiker der Weltliteratur.
Erstausgabe 1854.
Gehörte auch zu meinen Kinderbüchern.
Für Mechthild
Hoch droben wird ein Licht geboren,
das als Kind herunter fällt – hast du
doch nur dein JETZT verloren, in
der Wiederkehr der Welt.
M.P.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
Editorial
Die Rückkehr
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Mechthild im Spiegel der Presse (2000)
Mechthild
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
1. Kapitel
7. Kapitel
Mechthild
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
EDITORIAL
Liebe Leserin,
lieber Leser,
die Mechthild ist, seitdem sie erstmals anno 2000 erschien, von nicht wenigen Lesern und Leserinnen hautnah vor deren innerem Auge zum Leben erweckt worden. Mehr noch: Diese mysteriöse Frau ist weit in der Welt herumgekommen. So schrieb mir meine frühere Schulkameradin Sigrid eine Karte aus Indien, in der sie mir unter anderem mitteilte …
“…die „Mechthild“ ist inzwischen eine weitgereiste Frau! Du wirst es nicht glauben, ich hatte sie nämlich bei meiner großen Indien-Reise dabei – und: sie hat mich durch Sikkim, ein wunderschönes Land mit riesigen Schnee-Bergen, gewaltigen Wasserfällen, heilige Seen und vielem Wunderbarem mehr begleitet.“
Ein Freund der Berge, der das Büchlein auf einem seiner Gipfel-Trips dabei hatte, berichtete mir nach seiner Rückkehr, dass die Mechthild die ganze Reise über im Rucksack dabei war, er das Büchlein in himmlischen Höhen mit Vergnügen gelesen habe.
Klaus W., Ex-Kollege und Freund spannender Geschichten mit psychologischem Hintergrund soll hier nicht fehlen; Der Belesene teilte mir nach seinem ganz persönlichen Vergnügen mit MECHTHILD in einem Brief seine Begeisterung wie folgt mit …
…“vertiefte mich in das unglaubliche Dorfdrama ohne Pause bis der Vorhang fiel … in einem Zug gelesen … mich ganz schön in Bann geschlagen … auch sehr vergnüglich, musste oft Schmunzeln … luftig-leichte Dialoge … Erotik mit >Charme der 1950er Jahre< … einfach köstlich, prickelnd. Die Geschichte hat mich gefesselt … in der Tat ein gutes Buch.
Kompliment und volle Bewunderung für solch ein labyrinthisches Spinnennetz, das zuerst einmal geknüpft sein will: gedanklich – und für die Klarheit der Fadenwege, die den Leser, die Leserin, führen – aber auch für den Mut, solche Ungeheuerlichkeit zu veröffentlichen. Ein Drama auch voller Symbole und Metaphern, Träumen und Psycho – also … ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Schreiben Sie weiter so!
Ihr Klaus W.
Die Rückkehr
Heute bin ich zurückgekehrt; möchte mich in den verwehten Spuren von einst wiederfinden. Dort, wo alles begann. Mein Erwachen. Meine Bewusstwerdung. Meine Kindheitsdramen. Jahre sind vergangen. Damals noch Kind, heute im Herbst des Lebens. Es hat mich an die Ursprünge meines Werdens gezogen – da wo die Dreharbeiten für all die realitätsfernen Illusionen und seelischen Verletzungen ihren Lauf nahmen. Ich habe den Wunsch, das Drama meines Lebens auf der Bühne von damals zu sehen. Mit den Requisiten von einst. An den Originalschauplätzen. Ich werde Vieles davon nicht mehr vorfinden. Es werden nur noch kümmerliche Reste, geschrumpfte Häuflein Leben in versteckten Winkeln und Mauerritzen überdauert haben. Was fehlt, fülle ich auf. Mit Erinnerung. Mit Phantasie. Der Film spielt in den Anfängen der schummrigen Tage am Beginn der Fünfzigerjahre. Jahre der Strenge. Jahre der Strafen. Jahre der unbegrenzten Abenteuer. Die Zeit, als Deutschland aus dem Dunkel seiner Kriegstraumata gleich einer nachlassenden Betäubung langsam erwachte.
Heidelberg wurde nicht bombardiert. Die Amerikaner hatten dieses schöne Fleckchen Erde für sich auserwählt. Es sollte ihre Stadt werden wenn alles vorbei ist. In Heidelberg wollten sie ihr Hauptquartier als Siegermacht aufschlagen. Sie haben es getan.
Meine Lebenssonne beginnt mit den flimmernden Bildern eines kleinen, blassen Jungen, der, als deutsches Flüchtlingskind aus dem Osten vertrieben, mit seinen Eltern in der schönen Stadt, Juwel der Deutschen Romantik, gestrandet war: im Jahre 1946.
Während ich allein, tief in mich versunken, auf den verwehten Spuren meiner Kindheit durch die erinnerungsschweren Gassen von damals wandle, da und dort von goldschimmernden Stolpersteinen, den Vor-Ort-Ankern meiner kleinen Dramen, zum Verweilen aufgefordert stehen bleibe, ja, da geht in diesen Sekunden der große, nostalgische Vorhang auf: behäbig und elegisch zugleich beginnt sich dieses majestätische Abendrot, dieses Meer aus wallendem Samt in der Mitte zu teilen und gibt mehr und mehr den Blick auf die Bühne frei, auf der meine ersten Jahre sich in ein staunendes Menschenkleines verwandelten.
Aus den Nebeln dieser fernen Tage steigen jetzt vor mir Wege auf mit ihren Winkeln und Höfen, erfüllt von den metallenen Schlägen des Schmieds, die mein Gehör mit akustischer Strenge malträtierten. Phonetische Geschosse, zugleich auch optisch explodierend auf vergilbten, randgezackten Schwarz-Weiß-Fotografien, in denen ich den aufsteigenden Rauch von verdampfendem Horn beim Aufbrennen der Hufeisen mit scheuen Blicken, geblendeten Kinderaugen erahne.
Und während ich von meinem Logenplatz aus mich selber dort auf der großen Leinwand als Akteur in diesem Drama erlebe, wird mir heiß von den gleißenden Flammen des Schweißbrenners, der eruptierenden Glut der lodernden Esse. Ich reibe meine Augen in der Hitze rotglühender Eisen inmitten dröhnender Hammerschläge, die bis tief in meinen Körper donnern wie eine achtunggebietende Fanfare – erregte Töne gleich wiehernder Trompetenstöße aus dem dampfenden Maul von in Panik sich aufbäumender Pferde.
Immer tiefer dringe ich ein in die Gassen, in verborgene Hinterhöfe, vorbei an bröckelnden und aufgerissenen Mauern, an denen vorbeieilende Fuhrwerke streiften und wehe Narben hinterließen. Und weiter laufen die Bilder, ziehen mich dorthin wo meine Augen und Ohren hinter Spalten und Ritzen von morschen Toren auf ungeschminktes Leben stoßen: auf unverständliche Urlaute aus stinkenden Ställen und bitterarmen Behausungen.
Dann wieder blitzen Bilder auf von forschen Erkundungen, die ihre Schärfe bis heute bewahrten und in deren Erleben mir damals meine eigene Existenz gleich einer aufgehenden Sonne in der Helligkeit des Tages zu Bewusstsein kam. Da ist es!, hier an dieser Stelle – in meinem Kino der Erinnerungen: das Fenster! Nur wenige Zentimeter über den aschgrauen, abgeschliffenen Pflastersteinen! Ich sehe einen Mann, tief unten in einem Gewölbekeller im matten Licht einer einzelnen nackten Glühbirne, geisterhaft von der Decke baumelnd, ein steifes Etwas zurechtschneiden, etwas, das ich bei konzentriertem Hinsehen als braunes Leder zu erkennen glaube.
Ich versinke in des Mannes rätselhaftem Tun: am Rand der Gasse, auf den kaltnackten Steinen kniend, spicke ich durch das bodennahe geöffnete Fenster, hefte mich an den hämmernden Arm, führe in Gedanken mit ihm gezielte Schläge aus in einer dem Dunstschweiß des Schuhmachers ergebenen Werkstatt mit ihren seltsamen Maschinen und ihren mir angstmachenden Werkzeugen, unförmigen Gebilden – diffusen Traumbildern gleich; und ich spüre jetzt einen seltsamen, sich über mich ausbreitenden Frieden: Ehrfurcht im Angesicht meisterlichem Tuns.
Und weiter ziehe ich meine Kreise, weiter über die tausend und abertausend schwarzgrauen gleichförmigen Mosaiken, über nichtendenwollendes Kopfsteinpflaster. Wo kommt das her?, dieser seltsame Geruch, den ich jetzt in der Nase spüre? Mit Freude sauge ich den süßlichen Duft von frisch gebackenem Brot in mich hinein und meine Brust atmet Wärme und Lust. Vor freudiger Erwartung nehme ich hüpfend die drei Stufen, drücke mein ganzes kindliches Körpergewicht gegen die schwere Holztüre; ich trete ein und der kleine Laden füllt sich kirchenglockenlaut mit dem Alarmton der Glocke, der eintretende Kundschaft bis in die hintersten Räume hinein ankündigt. Und gleich darauf nehme ich sie wahr: diese schleifende Schritte, den schlurfenden Gang der dickleibigen Bäckersfrau und ich recke mich jetzt hoch zur Theke, deren obere Kante mich an der Nase kitzelt; und auf diesem Altar thronend, direkt vor meinen Augen, da strahlt mir das Wunder entgegen, das Füllhorn des Süßen, vollgestopft mit rosaroten Leckereien mit denen ich gleich meinen Hunger stillen werde. Hinter der Theke, in den überquellenden Regalen, lachen knusprige Laiber zu mir herüber und ich beiße meine lechzenden Blicke lustvoll in sie hinein. Ängstlich und begehrend zugleich spiele ich mit meinen nervösen Fingern an bauchigen Gläsern, die jeden Moment zu platzen drohen – so prall gefüllt sind sie mit Gutseln, mit rosaroten Himbeerbonbons.
Meine Augen wandern weiter, gleiten hastig: hüpfen von einem zum andern, sekundenschnell, denn gleich wird sie da sein! Ich muss mich beeilen, muss schnell noch da und dort mit Augen und Nase naschen, bevor sie sich breit und säulenhoch vor mir aufbauen, ihre gebieterische Stimme im kleinen Bäckerladen ertönen lassen wird. Eine Stimme, die mich zu einem tief nach unten beugenden Diener auffordern, mich zu unterwürfigem Äußern meines Wunsches demütigen wird.
Und als die Frau, die Frau des Bäckers vor mir steht, beginnt sich meine Angst langsam zu entkrampfen, beginnen sich die Beuger in meinen Fingern zu entspannen, denn meine Hand ist jetzt bereit einzuwilligen, bereit, ihr mein kostbares Pfennigopfer auf dem profanen Altar, der weißbestäubten Holztheke, darzubringen: Kupferne Münzen, kleine Schätze, sicher verwahrt in drecksteifen Hosentaschen und jetzt hervorgeholt zum Tausch gegen einige dieser köstlichen Lutschdiamanten.
Die weichen Glockentöne beim Verlassen des Ladens heben mich sanft empor, tragen mich im süßen Klang ihrer verzauberten Melodie hinaus aus dem mehligen Dunst und übergeben mich draußen auf der Gasse einer rosaroten Welt, hinter deren Schleier ich, jetzt, in diesen Momenten, meine verwehten Spuren ertaste, in dem laufenden Film meines Lebens meinen Pulsschlag von damals erfühle, die wärmende Glut in meiner Kinderbrust mich wohltuend in Geborgenheit umschließt. Und mit frohem Herzen hüpfe ich weiter, springe ich mitten hinein in die vielen Leute, die da vor einem Haus versammelt stehen. Ich stelle mich frech dazu. Mehr noch: ich drücke mich in diese fleischige Masse flegelhaft hinein!
Was mag hier vor sich gehen? Ich muss es erkunden, muss es mitbekommen. Gezogen von lebenserwachender Neugier drücke ich mich durch die verklumpten Körper, quetsche ich mich durch schweißausdünstende Leiber wobei strenge Blicke mich strafen, boxende Ellenbogen mir den Durchgang zum Zentrum des Bebens verwehren. Ich ducke mich, husche unter ihnen hindurch, unterlaufe ihre Macht, nehme sie kurz darauf nicht einmal mehr zur Kenntnis. Die in sich Verwachsenen wehren sich, sind wütend auf einen tobenden Rotzlöffel, denn das waren wir in ihren Augen. Jetzt versuchen sie, mich mit stoßfesten Gebärden in ihre Gewalt zu bringen, zischende Laute schlagen ein in meinen Ohren: Ausgespucktes, das ich als „Lümmel“, als „Rotznase!“ identifiziere. Ich habe meinen Logenplatz erreicht. Ganz vorn. In der ersten Reihe. Ich stehe jetzt still. Bewege mich nicht. In meinem seidenen Haar spielt der abflauende Wind verpuffender Atemstöße, der krepierte Hauch nicht ausgesprochener, unterdrückter verbaler Ohrfeigen. Mir wird plötzlich schwarz vor Augen. Ganz langsam fährt das große schwarze Auto an mir vorüber. Ich könnte es sogar berühren. Es ist ein Kombiwagen, keiner, wie ich ihn bisher gesehen habe. Auf dem schwarzen Lack entdecke ich eigenartige weiße filigrane Verzierungen, die ich mir nicht erklären kann. Das große weiße Kreuz jedoch, das kenne ich schon; vom Friedhof. Und von der Kirche. Das hier hat etwas mit Tod zu tun.
Zwei Männer in schwarzen Anzügen und schwarzen Schuhen kommen aus dem Haus gegenüber und meine Blicke fallen auf den schwarzen Sarg, den die Männer jetzt behutsam in das große schwarze Auto schieben; direkt vor mir. Ein Wimpernschlag lang blitzt jetzt in mir ein Wunsch auf; ein Verlangen, vor dem ich erschrecke, ein Gedanke, der nicht zu mir gehört: ich will den Toten sehen! Will spüren, was der Tod mit einem Menschen macht. Will sehen, warum man einen Verstorbenen verschließt, den Blicken und der Wärme seiner Nächsten entzieht, ihn einfach stiehlt aus dem Haus, aus seinem Leben. Ich wollte. Wollte aber auch nicht. Durfte nicht wollen, weil ich dafür keine Rechtfertigung in mir fand: Angst schüttelt mich, Angst vor dem, was ich mir da wünschte. Und diese Angst war in diesem Moment größer, als mein Michfürchten vor dem Ende. Den Tod kannte ich nicht, der war nicht greifbar; nicht spürbar; der war in meinem noch jungen Leben ganz weit weg. Warum sollte ich mich vor ihm verstecken?! Wovor ich mich fürchtete, das war ich. Wie konnte ich mir nur so etwas wünschen: dem Tod ins gespenstische Gesicht zu blicken!
Und das hier in diesen so respektgebietenden Momenten; unter freiem Himmel, unter den Augen Gottes! Mitten unter den Trauernden und Gaffenden, bei dem die einen dem Geschehen ihre Achtung darboten, andere nur schiere Neugierde zu befriedigen suchten.
Ich bemühte meine Phantasie, um mir die schlimmsten Strafen auszudenken, wenn ich es wirklich gewagt hätte, wenn ich zu den Männern in den schwarzen Anzügen in kindlicher Angst gestottert hätte …Sie, könnten … sie … vielleicht den … Sargdeckel … kurz abnehmen, ich möchte … mal – nur kurz! – einen Toten … sehen? Nur schnell einen … Blick hinein …werfen?
Ohrfeigen wären auf mich niedergeprasselt, hinrichtende Blicke hätten mir den Strick an den Hals gewünscht, eine Akte über mich wäre angelegt worden, ein Protokoll über ein krankes, verwirrtes Kind. Verachtung hätte man mir ins Gesicht gespuckt, Hohn und Spott über mich ausgegossen, der Bürgermeister hätte meine Eltern öffentlich an den Pranger gestellt, ein Spießrutenlaufen initiiert, unserer Familie das sofortige Verlassen der Stadt nahegelegt, meine Einweisung in eine Irrenanstalt anbefohlen. Der Pfarrer wäre höchstpersönlich gekommen zu uns nach Hause, hätte die Beichte zelebriert, Salbungen erteilt, mit heiligen Sakramenten gottesfürchtig um sich geworfen und den Herrn leibhaftig zu seinem Strafgericht hier auf Erden hinzugerufen. Trotz alledem – ich konnte nicht anders. Ich öffnete den Sarg! Heimlich, im Verborgenen, irgendwo weit hinten in meinem Kopf tat ich es; einen Spalt breit hob ich den Deckel, gerade so weit, dass ich in die Totenkammer spähen konnte. Was ich sah, würgte mich, nahm mir den Atem, ließ mich zu Stein erstarren.
So sehr also hatte ich mich schon in meinen teuflischen Phantasien verstrickt, mich im Netz des profanen, sündigen Erdendaseins verfangen. Ich hatte mich einer mir fremden Macht ergeben, war schon einer von ihnen in der Gemeinde der Sünder, welche der Labsal der Strafe bedurften. Ich blieb mit meinem Frevel allein. Allein und einsam. Etwas in mir schrie laut: Du bist verdorben, du bist böse, du bist niederträchtig. Und niemand, dem ich das Schreckliche, das mich Verstörende mitteilen, meine lasterhaften Verlockungen zu offenbaren vermochte.
Und wenn später, in trauter Atmosphäre, sich liebkosende Arme nach mir streckten, süßliche Worte meine Ohren umspielten, empfand ich den Schmerz der Isolation, die Schmach des Ausgestoßenseins; denn ich wusste: diese Arme liebkosen nicht mich, diese Arme drücken das liebe, das fügsame Kind. Diese Liebe galt nicht mir. Sie herzten das brave, das sich bereitwillig anpassende Kind. Das Kind, das ich nicht war, und das ich nicht sein wollte. Sie wussten es nicht. Sie wollten es auch nicht wissen. In der Güte und Reinheit ihrer Häuser gab es keinen Platz für das Schmutzige, keinen Raum für das Niedere, gab es keinen Eintritt für die Regungen der dunklen Kinderseele. Was sie liebten, was sie forderten, das war unsere Folgsamkeit, war unsere Angepasstheit, waren Leistungen, die sie uns abverlangten, die sie aus uns herauspressten. Das, was in uns zum Licht strebte, was durch unsere Adern floss, was in uns nach Leben schrie, was in der Kammer unseres Herzens tobte, was sich aus uns heraus ins Tun drängte,das musste sterben.
Hand in Hand mit der Angst ging die Strafe, ging der große Bruder der Angst. Wir atmeten Strafe, Strafe war unsere Luft, sie war unser Stallgeruch. Wir sogen sie ein in unser Innerstes, so tief, dass sie ein Teil von uns selber wurde. Mit der Allgegenwärtigkeit von Strafe und Angst nahmen sie uns unser Bestes, nahmen sie uns unsere Unbekümmertheit. An deren Stelle setzten sie Befremden, pflanzten sie Widerwille, erzeugten sie Ekel, säten sie Hass, zwangen sie uns, das Gute vom Bösen, das Hässliche vom Schönen, das Richtige vom Falschen in i h r e m Sinne zu unterscheiden.
Wenn ich mich jetzt in die Dramen meiner Kindheit versenke, gelange ich auch zu einem Mann, der erste Prägungen in mich brannte – Prägungen wie Brandzeichen in Pferdehaut. Davon möchte ich jetzt berichten, möchte so überleiten zu der Kriminalgeschichte meines Lebens. Ein Mann, ich nenne ihn hier den Alten. Er ist es, der mich zu meiner teuflischen Geschichte rund um die MECHTHILD inspiriert hat.
Unser Lustobjekt, der Kirschbaum des Alten, war gut geschützt: Eiserne Speere waren auf alle die gerichtet, die sich seiner süßen Frucht zu nahe begaben. Eiserne Speere, die uns Kinder fernhalten sollten von der Versuchung, auch nur ein einziges süßes Fruchtherz zu stehlen. Es war unser Baum der Erkenntnis, in dem wir dem Bösen um uns herum gewahr wurden. Es waren himmelwärts gerichtete Spitzeisen, zusammengeschweißt zu einem mörderischen Zaun, der den Vorgarten des Alten zur Gasse hin abtrennte.
Ein kleines, hockerhohes Mäuerchen davor lud uns Kinder ein, diesen als Ausgangspunkt zu unserem frevlerischen Tun, zum Pflücken der süßen Versuchung zu besteigen. Von da war es nur noch ein kurzes Armrecken zu unseren lachenden Herzen, die wir nur mittels dieser bedrohlichen Akrobatik zu berühren vermochten. Und während wir mit begehrenden Blicken uns die süße Frucht zu Eigen machten, lauerte es nah bei uns, verschlossen im Unhörbaren: das mordbrünstige Strafgericht! Ein ausrutschender Fehltritt – und der uns vernichtende Fall in die auf uns gerichteten Speerspitzen wäre erfolgt. Und während wir die fleischigen, blutroten Kirschen über dieser Todeszone vom Zweig zupften, wanderten hasserfüllte Augen, das Entsetzliche herbeisehnend, das Geschehen lasergleich ab; verborgen aus einem unsichtbaren Hinterhalt zu uns herüber. Zum Glück hatten wir einen Schutzengel, der uns vor schrecklichem Unglück bewahrte.
An Tagen, wenn die Jungs von Gegenüber mit dem Fußball aus dem Hause stürmten, um auf der Gasse vor dem Garten des Alten ein Spiel auszutragen, konnte es geschehen, dass der Ball im Eifer in das heilige Reich des Alten hineinschoss. Es war der Schuss, der alles zum Stillstand brachte: die Zeit verschwand, gebannt verharrten wir in unserem brennenden Ungestüm, die Herzen rasten. Bevor der Ball im Heiligsten des Alten niederging, hüpfte das Leder noch ein paarmal auf und nieder und rollte dann unbefangen ins Unglück, in die Todeszone: bis vor das Gebüsch, hinter dem der Unheimliche der Vollstreckung seines längst gefällten Urteils harrte.
Aus den hitzigen Bewegungen von uns Buben war schlagartig vereiste Resignation geworden. Die Szene war zu einem Still gefroren. Keiner traute sich, den Ball zu holen, das Minenfeld des Alten zu betreten. Das war meine Chance. Die Chance dazuzugehören. Ich wagte es, betrat das Sperrgebiet. Ich drückte die Messingklinke der gusseisernen Tür, begab mich mühselig auf dem Bauch robbend in die Höhle des Löwen. Ein schneller Blick hin zu den Zurückgebliebenen: versteinerte Gesichter, in denen ich lesen konnte, was sie dachten: Seht nur, der Wahnsinnige, er wagt es …! Auch die Mädchen hatten in ihrem Hüpfspiel innegehalten. Eine von ihnen war auf einem Bein stehengeblieben in einem der Felder, die sie vorher mit weißer Kreide auf die Steine geritzt hatte; sie war nicht weitergehüpft, setzte erst jetzt, von dem Geschehen gebremst, den zweiten Fuß auf, um ihr Gleichgewicht zu finden. Einige wenige aus der Mädchengruppe hatten sich jetzt mutig zu den Buben gesellt, standen in deren Schutz. Sie alle starrten jetzt gebannt auf den Neuling, sahen auf mich, den Verrückten, den Lebensmüden. Es lag etwas Bedrohliches in der Luft, keiner sprach ein Wort.
Verängstigte Augen wanderten das Schreckensterritorium ab, leuchteten alle Ecken und Winkel aus wie die Taschenlampe eines Verirrten in der Nacht. Und immer wieder legten sich die starren Blicke auf den bedrohten Ball, auf das so kostbare Rund, das wir Kinder so schnell nicht wieder unseren Besitz werden nennen können; unser Kostbarstes, das dort vor dem Unheimlichen lag, dort, wo er Weg in einem rechten Winkel in den Hinterhof führte, wo hohe Sträucher die Einsicht verwehrten. Und der Ball lag genau an diesem Gefahrenpunkt, der sich nicht berechnen ließ, in den man einbrechen konnte wie in zu dünnes Eis, wenn man ihm zu nahe kam.
Ich wusste jetzt, dass ich mich in große Gefahr begab. Es gab kein Zurück. Ich war am Abgrund des Geschehens angelangt, weiter ging es nicht; der plötzliche Anblick des Monsters erschlug meinen heroischen Mut. Trotzdem wagte ich es: Ich bückte mich, nahm den Ball auf, hielt ihn schon in Händen. Der gleich darauf erfolgte Peitschenknall ließ uns alle erneut in die Knie gehen. Der Schmerz brannte sich in meine Haut. Der Alte war vor mir aufgesprungen einer Wildkatze gleich. In seiner rechten Hand, drohend der Lederriemen. Der Alte ließ die Peitsche erneut knallen: kräftiger, vernichtender. Er hatte mich jetzt ganz in seiner Gewalt. Der Schmerz explodierte in mir zu einem apokalyptischen Bombenschlag. Ich schrie auf – und auf der Gasse spritzte ein erstarrter Kinderhaufen auseinander. Ein jedes rannte seinem Haus zu, wo es sich hinter Gemäuer duckte, hinter einem Vorsprung unsichtbar machte, um aus sicherer Entfernung das weitere Tribunal zu verfolgen. Ich war aufgesprungen, war aus dem Machtbereich des Alten geflüchtet, hinaus auf die sichere Gasse. Den Ball hatte ich nicht retten können.