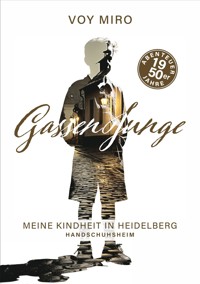
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Voy Miro*, unter Fliegeralarm im Bombenhagel der letzten Kriegsmonate 1944 im Werksspital der Eisenwerke von Mährisch Ostrau (Tschechien) als Kind deutscher Eltern geboren, verlebte nach der Vertreibung aus der Heimat Kindheit und Jugend in Heidelberg, Handschuhsheim. *Autoren-Pseudonym "Eine bewegende, spannende Lebensgeschichte, in welcher der Leser sich, sein Schicksal und unsere Welt wiedererleben kann. Dadurch treibt uns dieses Buch zu neuem inneren Wachstum." Prof. Dr. Arno Gruen / Psychologe/ Psychoanalytiker/ Autor "Beeindruckend Ihr sprachliches Vermögen, das die Rückkehr in die Kindheit zu einer literarischen Evokation werden lässt. Hier wird ganz deutlich, dass Sie sich dank der Sprache aus der eisigen Nacht hinübergerettet haben." LKM / Literaturbetreuung Klaus Middendorf, München "Voy Miro: wahrlich ein starker Erzähler!" Jürgen Mette, Theologe, Spiegel-Bestseller-Autor Entdecken Sie mehr auf meiner homepage: manfred-poisel.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Voy Miro
GASSENJUNGE
Meine Kindheit in HeidelbergHandschuhsheim
Copyright: © 2023 Manfred Poisel / [email protected]
Umschlag: Felix Baumgartner / freie-grafik-frankfurt.de
Titelfoto: Voy Miro
Verlag und Druck:
tredition GmbH
An der Strusbek 10
22926 Ahrensburg
Softcover
978-3-384-02526-5
Hardcover
978-3-384-02527-2
E-Book
978-3-384-02528-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
für …
Anne-Catherine,
Philipp,
Linnea
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
KOMM ICH ZURÜCK…
Am Anfang war der Tod
DIE JAHRE VERGINGEN …
Rhein-Neckar-Zeitung, Heidelberg, 26. Juni 1998:
WIE WAR OSTRAU WIRKLICH?
Vita
VOY MIRO
Gassenjunge
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
KOMM ICH ZURÜCK…
VOY MIRO
Gassenjunge
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
KOMM ICH ZURÜCK…
Komm ich zurück
In meine Gassen Sie sind leer
Es lebt der frohe Geist
Und das Entzücken
Aus Kindertagen nimmermehr
Ich lasse meine Seele fliegen
Über Baum und Hof und Stein
Und auf einmal spür ichs:
Lachen, Weinen, Kind zu sein
Kinderherz in meiner Brust
Klopft wie in vergangnen Tagen
Schaukel – schwing in froher Lust
Mich himmelwärts
Zum Großen Wagen!
(aus „und stürzen ins Paradies“ / Gedichte)Manfred Poisel
Am Anfang war der Tod
Die letzten Kriegsmonate: Mai 1944 – eine Geburt im Alarm der Sirenen. Die Heimat meiner Eltern in Flammen: vor den Toren der Stadt drohend die Panzer der einrückenden Russen, in der Nachbarschaft, „gleich um die Ecke“, der aufgeblähte Hass der Tschechen auf alles, was Deutsch ist. „Tiere“ über Nacht!, – Menschen, die gestern noch Freunde waren. Die Flieger jetzt über uns: Der Bombenhagel bringt Mutters Herz aus dem Takt. Die Wehen sind da! Ein Junge kommt auf die Welt: Im Werksspital der Eisenwerke. Ein Achtmonatskind. Es ist ein Sonntag.
Ein Sonntag, der auch ein Muttertag ist.
Wenn ich heute, mitten im Leben, die für mich so magischen zwei Worte Mährisch Ostrau höre, lese, dann fällt auf meine Seele Licht und Schatten zugleich. Und dann ist sie wieder da – diese bleierne Zeit. Die Vertreibung, die Hinrichtungen, diese unzähligen Exekutionen der Tschechen an den Deutschen, die Selbstmorde der Alten, die nicht mehr zu fliehen vermochten und sich auf den Speichern ihrer Häuser erhängten, weil dieser Tod als „erträglicher“ empfunden wurde, als die Qual einer sadistischen Hinrichtung durch die schon auf der Lauer liegenden Freunde und Nachbarn, die über Nacht zu mordenden Bestien geworden waren.
Kriege töten auch heute. Jeden Tag. Die Wunden jedoch an Vater, Mutter, Geschwistern mussten wir, die Kriegskinder, als Traumata später in Friedenszeiten mit und in uns tragen; als bleierne Last, als Kriegs-Erbe, das wir nicht einfach ausschlagen konnten, dem wir uns in schmerzhafter Trauerarbeit stellten, uns bei bewusster Reflexion nicht zu entziehen vermochten. Es erscheint mir deshalb unabdingbar, dieses Furchtbare nicht einfach einem bloßen Vergessen anheim fallen zu lassen, einer flüchtigen „Leichtigkeit des Seins“ zu opfern.
Im Wandel der Jahre vermochte ich im Herzen Frieden mit dieser, meiner, Vergangenheit zu schließen – habe ich mit Freuden meine Glücksräume gefunden: in der Liebe, in der Poesie, in der Musik, in der Literatur, in den verwehten Spuren lebendiger Kindheitserinnerungen – für immer geborgen in meinen Gassen von Heidelberg – Handschuhsheim.
Voy Miro
Ludwigsburg, 2023
Es geschah 1995 als mich die Sinnkrise packte. Und da war sie ganz überraschend wieder da: meine Kindheit, meine Eltern, die Gassen von Handschuhsheim: seelischer Trost in jenen Tagen. Etwas in mir war aufgebrochen, führte mich zurück zu meinen ersten Lebensjahren. Dreißig Jahre waren vergangen, ein halbes Leben fast, dass ich schon nicht mehr zu Hause, daheim in „meiner“ Gasse lebte, nicht mehr in meiner Stadt Heidelberg, nicht mehr in meinem Elternhaus, dem geborgenen Nest, in dem ich Kindheit und frühe Jugend verbrachte; dies bis zu dem Tag, da ich mit einundzwanzig hinauszog in die große, weite Welt. Und kaum war ich ausgezogen, damals, im jugendlichen Eifer, den Koffer voller Hoffnung auf das langersehnte freie Leben, fern der familiären Enge, starb meine Mutter. Mein Vater heiratete erneut. Und als er mit stolzen Zweiundachtzig mit seiner um viele Jahre jüngeren Braut vor dem Standesbeamten stand, und wir, meine Frau, meine Tochter und ich, in respektablem Abstand daneben, überfielen mich Fragen, auf die ich bis heute keine Antwort fand. Heute, 1995, wo ich dies schreibe, ist Vater siebenundneunzig. Hundert will er werden! Und seine zweite Frau, meine Stiefmutter, ist auch schon müde geworden obwohl sie viele Lenze jünger ist; und würde sie jetzt, in diesen Tagen, die Augen zumachen, würde man in der Nachbarschaft sagen: ein schönes Alter hat sie erreicht. Doch Vater müsste wieder mal einer Beerdigung beiwohnen, einer Bestattung, von der er auch bei längerem Nachdenken nicht sagen könnte, die wievielte es in seinem langen Leben bereits ist. Es wäre für ihn einer der schwersten Heimgänge, weil er wüsste, dass es dann mit ihm schneller gehen würde, weil ihm seine letzte Lebensaufgabe genommen wäre, die Aufgabe, für jemanden da zu sein, zu leben, dem er seine Lebensweisheiten, seine schmerzhaft erworbene Überlebenspraxis des täglichen Kaltwasserns, Massierens, Bürstens, Gehens, gesunden Ernährens angedeihen lassen könnte.
Seit vielen Jahren besuchte ich ihn wieder einmal, allein, nur ich, sein Sohn, der zu seinem Vater kam, nach einer langen Lebensreise, um ihn zu sehen, ihm ins Herz zu blicken, ihm von Mann zu Mann nahe zu kommen, letzte Geheimnisse in ihm auszugraben: ein erstes und letztes Mal vielleicht, rechtzeitig noch, bevor es mit ihm zu Ende ist. Dieser Besuch war nicht einer der all die Jahre erfolgten Sonntagsbesuche mit Frau und Kindern, diente nicht dem Vorzeigen seiner artigen Enkel, diente nicht der Befriedigung des leibhaftigen Anblicks seiner heranwachsenden Nachkommen, diente nicht dem Vorführen einer heilen Familienwelt. Nein, dieser Besuch war eine Attacke, sollte eine längst fällige Abrechnung mit friedlichen Mitteln sein, mit dem Ziel, eine Annahmeerklärung auf Gegenseitigkeit zu erreichen, eine seelische Umarmung von Gleichgestellten, einer Verbrüderung von Vater und Sohn. Von der Straßenbahnhaltestelle in Handschuhsheim trug ich meinen alten, verbeulten, Koffer, derselbe, mit dem ich vor dreißig Jahren nach München auszog, das Fürchten zu lernen. Drinnen, in alte Decken gehüllt, barg dieser Koffer ein Kassettentonbandgerät plus einen metallenen Gelenkarm mit Federzügen, an dem ursprünglich eine Tischleuchte angebracht war und an deren Stelle ich ein Mikrofon befestigte, in das Vater sein Leben sprechen sollte; es war schon lang mein Wunsch, denn erzählen konnte er noch recht gut in seinem hohen Alter, während es mit dem Schreiben nicht mehr zum Besten stand. Über Monate hinweg hatte er sich krakelige Notizen gemacht von seinem Leben, um vorbereitet zu sein für diesen Tag, an dem es galt, ein Erbe, ganz anderer Art, Gestalt annehmen zu lassen: ein Erbe in Worten, aufgeschrieben auf einem Magnetband. Worte, von ihm gesprochen, die Worte eines langen, schweren Lebens.
So ging ich durch die schmalen Gassen meiner Anfänge, und in der Luft lag nicht mehr das Süße, auch nicht das Bittere aus jenen Kindertagen, erbebte die dörfliche Idylle nicht mehr unter dem Wiehern eines Pferdes, unter dem Trompetenstoß einer nach dem Melker brüllenden Kuh, erzitterte das Kopfsteinpflaster nicht mehr unter eisenbeschlagenen Holzrädern, vernahm man nicht mehr das Quieken eines Schweines, nachdem es kurz zuvor mit archaischem Schmatzen und Grunzen auf sich aufmerksam machte. Auch das rege Huschen von drolligen Fellbündeln belebte nicht mehr Gassen und Höfe: keine Katzenfamilien mehr, die einem schnurrend um die Beine schmusten. Und auch das wilde, aufgeheizte, Gebell der Hunde erschreckte nicht mehr am nahen Vorübergehen der bäuerlichen Hoftore, hinter denen jetzt städtisch-kultiviertes Wohnen eingezogen war. Ein Wohnen, das efeuumrankt Altes erhielt, während , wo früher die gute Stube war, Antikes und Modernes eine neuzeitliche Symbiose eingingen.
Von der Unteren Büttengasse bog ich jetzt nach links in die Obere und ging die letzten Schritte zu meinem Vaterhaus unauffällig, drehte meinen Kopf nicht wie sonst nach den Fenstern: mein Kommen sollte unbemerkt erfolgen, sollte neugierigen Blicken verborgen bleiben: denen, die mich viele Jahre meines jungen Lebens begleitet haben. Was hätten sie sich wohl zurechtgesponnen, mich hier gehen zu sehen, allein, mit einem großen Koffer. Gerüchte wären aufgekommen: Haben Sie schon gesehen, der Manfred, er ist ganz allein gekommen, nur mit einem Koffer, nicht mit dem Auto wie sonst, nicht mit Frau und den Kindern – nein, ganz allein! Ob er wohl seine Familie verlassen hat und jetzt zum Vater zieht, wieder zurück in sein Elternhaus?
Nein, Gerüchte dieser Art wollte ich nicht aufkommen lassen, hätte dies (mühsam!) nach einem münchnerisch willkommenen „Grüß Gott!, und dem darauf erfolgten nordbadischen, zurückhaltenden, „Guten Tag!“ von Aug-zu-Aug zurechtrücken, hätte womöglich erklären müssen … in dem Koffer? Ach was!, nicht, was Sie denken!, nein, nein, da war ein Cassettengerät drin… Audio-Technik…mein Vater…verstehen Sie?, sein Leben…ich werde es aufzeichnen…auf ein Tonband… seine Stimme! Ohne den Kopf auch nur im Geringsten zu den, in den vielen Jahren matt gewordenen, Fenstern zu drehen, ging ich flotten Schrittes die letzten Meter. Kein wehender Vorhang, den ich bei einem raschen Blick dahin, dorthin, bemerkte, kein Schemen, hinter dem sich Menschliches hätte bestimmen lassen. Ich werde also keine „Erklärungen“ abgeben müssen bei einem späteren Spaziergang durch die heimatlichen Gassen, beim „Hallo, wie gehts?!“ sagen, beim Schütteln von Händen; dabei nicht wenige, die mich schon vor einer gefühlten Ewigkeit als Kind mal sanft, mal streng betütelten.
In dem von allerlei Zierrat überladenen Möbeln, staubigen Winkeln, des Wohnzimmers begab ich mich, vorsichtig tastend, auf die Suche nach einer mir günstig gelegenen Steckdose wobei mir sorgfältig und liebevoll ausgelegte Stickdeckchen zu Boden rutschten und ich millimetergenau platzierte Döschen, Schälchen, Standfigürchen aus ihrem eingestaubten Dornröschenschlaf unsanft aufwirbelte. Ich fühlte mich als Eindringling, als Störenfried. Ich störte den häuslichen Frieden, die Grabesruhe, die über allem lag. Ich störte, so wie ich schon als Kind störte, einfach durch meine Lebendigkeit, die sich für meinen Vater, meine Mutter, nur schwer in die häusliche Statik der getragenen Lebenslast einfügen ließ. Du bist hier nur geduldet! Diese Worte aus dem Mund meines Vaters musste ich oft über mich ergehen lassen. Du bist hier nur geduldet. Schläge, die in mein kindliches Seelenhaus eindrangen wie Pfeile und Wunden hinterließen. Und ich verstand, dass ich nur Gast war, dass ich in diesem Haus nur Anrecht hatte auf den Erhalt von Nahrung und Unterkunft, auf Schutz vor Aggressionen einer feindlichen Welt, die uns, den „Flüchtlingen", den Eindringlingen in dieser vom Krieg verschonten Stadt, allgegenwärtig gegenübertraten. So wurde dieses Haus, das Vater und Mutter im Schweiße ihres Angesichts erbauten, unsere Trutzburg, die uns vor der Feindseligkeit der Eingeborenen schützte. Als wir in dieses Haus einzogen, war ich sechs, ließ die ersten Jahre meines Lebens, in denen ich aus mythologischem Dunkel zu erstem kindlichen Bewusstsein erwachte, in einem fernen Land zurück; der Abschied war begleitet von Krieg, vom Heulen der Sirenen, von Vertreibung und Flucht. Wenn ich, in Momenten innerster Versenkung, Spuren erster Pulsschläge meines Lebens zu erahnen meine, wird, gleichsam wie durch einen sich lichtenden Nebel, blass, verschwommen, die Nähe meiner Mutter vor mir wieder lebendig, spüre ich ihre Wärme, ihre mich liebkosenden Hände.
Das Haus, dort, in der Heimat, zurückgelassen, in Mährisch Ostrau, in Ostrava, es weist blinde Flecken auf, vermag es als verblassten Schemen nur noch zu ertasten, ahne Stufen, vermeine jetzt gar den nackten, kalten, Steinfußboden zu erspüren, auf dem ich mich, verpackt in Windeln, plärrend fortbewege; mich beißt Hunger, schreie nach Mutter, sehne ich mich nach dem, mich beruhigenden, Klang ihrer Stimme. Doch dann wird es Licht: Vertraute Töne besänftigten, erlösen mich, spüre ich doch die Nähe von Mutter, von Vater, die jetzt zu mir kommen, mich in ihre Arme nehmen, behutsam in mein Bettchen legen, von dem aus ich gleich darauf hektisches Treiben wahrnehme: Ein wirbelndes Durcheinander, – alles war anders als sonst. Was ich unbewusst in mir aufnehme wühlt mich auf. Wäre ich älter gewesen, hätte ich mitbekommen, dass da in großer Eile Koffer und Säcke gepackt, Hausrat aus allen Winkeln und Ecken herbeigeschafft, Schränke in panischer Hast geleert, Geldscheine gezählt, Zierrat versteckt, Brot in Manteltaschen verstaut wurde.
So aber steigen aus dem Nebel meiner Anfänge nur Fragmente empor. Im Laufe des weiteren Geschehens ahne ich Mutters hastigen Atem, zwickt mich eisige Winterluft in Nase und Augen, vernehme ich fernes Donnern. Mutters zielgerichtete Schritte verschaffen mir nicht wie sonst dieses angenehme Schaukelgefühl, die Harmonie, die mich friedlich mit der Welt vereint – nein, sie wühlen mich auf, übertragen sich auf mich bis tief in meine Seele. Wieder steigen Bilder auf… ich vermeine jetzt menschliche Gestalten eilenden Schrittes zu erkennen, Flüchtende, wie ich Jahre später erfahre, an Händen und Rücken voll beladen, auf klappernden Wägen, ihr bisschen gerettetes Hab und Gut mühsam mit sich ziehend.
Wenn ich weiter in das Labyrinth meines Erwachens tauche, kommt mir dröhnender Motorenlärm in die Ohren, trifft mich der Schmerz menschlichen Leids, erschreckt mich Gejammer und Gestöhne, Schluchzen und entmenschlichtes Sterben allerorten. Heute weiß ich: Der endlose Flüchtlingstreck quälte sich mühsam durch sumpfigen Morast, durch Bombenlärm, begleitet von ständiger Vernichtung; vorbei an Schwerverletzten, in der Gosse einsam Verblutenden. Die mondbeschienenen Gipfel der Karpaten, der Beskiden und der Sudeten spiegelten melancholisches, mattes, Schneelicht in die tränenmüden Augen der Abschiednehmenden; in das weinende Herz derer, die ihre Heimat, ihr Hab und Gut, für immer verlassen mussten. Die Druckwalzen der Rotationsmaschinen stempelten die Jahreszahl 1945 in die Köpfe der Zeitungen.
***
Der Netzstecker meines Tonbandgerätes fand in der Dose keinen Halt. Löcher und Kontakte hatten sich im Laufe der Jahre geweitet, waren überdehnt durch hundertmaliges einführen, ausstecken. Das Metall in der Steckdose war träge geworden. Nach mehreren vergeblichen Kontaktversuchen beschloss ich, dem Stecker Gewalt anzutun; ich bog die Stifte etwas auseinander, grätschte sie mit der Zange, so dass sie sich beim Einstecken an das stromführende Metall drückten. Der Stecker hatte seinen Halt gefunden. Weißt du noch wie gern du als kleiner Junge an den Steckdosen spieltest? Das war, als wir noch bei der alten Frau Nägele wohnten, in der Wethgasse, damals, Ende 1946: wir alle in einem Zimmer, als wir endlich wieder beisammen waren, du, die Hilde, Mutti und ich. Zwei Jahre ungefähr hatte ich euch nicht mehr gesehen. Es war ja so, dass Du, die „Anschi“ (meine Mutter Anni) und die Hilde – dass ihr in den letzten Kriegstagen zu Eurer Sicherheit ausgelagert wurdet: von Mährisch-Ostrau nach Komotau (Chomutov) in ein Frauenlager mit dem Zug verschickt. Ich erinnere mich noch gut an den schweren Abschied am Bahnhof in Ostrau. Ich musste ja dableiben, musste in den Krieg, erlebte Furchtbares überall, kämpfte unter Partisanen, schleppte mich in endlosen Todesmärschen Tag-und-Nacht durch unwegsames, sumpfiges Gelände, war schon am Verhungern in russischer Gefangenschaft. Jeschisch! (Jesus), war das ein Wiedersehen damals – hier im schönen Handschuhsheim!
Und während Vater nach weiteren Worten suchte, fragte ich mich, was wohl meine ersten Worte waren, als ich ihn damals in Heidelberg mit meinen zwei Jahren wiedersah. Die Worte, mit denen man mich in meinem ungestümen Lauf durch die Gassen meines neuen Lebens von Hundert auf Null ausbremste, gleich einer stinkenden Brühe verbal vor mir auskippte, die habe ich noch im Ohr. „Wemm kehrschn Duu?!" Und ich, angewurzelt, festgemauert, bewegunglos; ich, der Gassenjunge, in seiner speckigen Kleidung, der munter laufenden Rotznase, dem marmeladeverklebten Gesicht. „Wemm kehrschn Duu?!" Erst später, als ich in diese Sprache hineinwuchs und diese Sprache in mich, verstand ich dieses phonetische Ritual der ersten Kontaktaufnahme eines Erwachsenen mit einem Kind. Wem ich gehöre? Ich wusste es nicht. Ich konnte die Antwort darauf nicht geben, blickte verschämt nach unten.Und wäre nicht bald darauf ein weiterer Satz gefolgt, der mich aus meiner Versteinerung erlöst hätte, wäre ich noch lange so gestanden, wer weiß wie lange. „Machsch, dass foattkummsch!" Der Losungsspruch war erklungen. Ich durfte abtreten. War nicht mehr gefangen in meinem schuldbeladenen Schweigen, in der Pflicht einer Antwort, die ich selbst in den Ritzen des Kopfsteinpflasters nicht zu finden vermochte.
Gleich darauf vernehme ich eiserne Schläge, den schnellen Trab eines Pferdes, erspähe einen Reitersmann. Und dieser, so wild in mein Leben Hineinstürmende, ein Kurier, wie man mir später sagte, schwenkt eine Glocke in der Hand, und der Ton der Glocke ist laut, lässt (in meiner kindlichen Wahrnehmung) das angrenzende Gemäuer erzittern. Menschen eilen aus ihren Häusern, stürzen auf die Gasse: alte, junge, gebrechliche, versammeln sich vor der großen Scheune: in angemessenem Rund vor dem Reiter, hoch zu Pferde, der jetzt ein hochamtliches Pergament zu entrollen beginnt. Und die Augen der Lauschenden sind auf diesen Abgesandten gerichtet. Alles in höchster Erwartung. Es ist kalt, ein Frösteln geht durch die Menge. Frauen, leicht bekleidet, häuslich, in Schürzen, Männer hüsteln, in Hemden, keine Schuhe, Pantoffel, Kinder tuscheln aufgeregt. Jetzt ist es still. Auf einmal ganz still. Der Ausrufer richtet sich auf, wird mächtiger, wirft hehre Worte in den niederträchtigen Pöbel, er, der Abgesandte der Regierung: verliest feierlich, was geschrieben steht – das Dekret über Rattenvernichtung, Gift aus dem Mund des Ausrufers.
Ein widerlicher Geruch zieht mir ätzend in die Nase, beißend bis tief in den Magen. Ich sehe mich um, halte mein Gesicht in den Wind, und da entdecke ich an einem Hoftor einen Mann. Langsam gehe ich auf ihn zu, bleibe in sicherer Entfernung stehen: am Tor hängt ein längliches Wesen, und dieses Wesen…ohne Fell?!, schimmert lila und rot. Der Schlächter macht an diesem Wesen herum, schneidet, zieht Haut ab, Stück für Stück. Ich aber muss jetzt und hier an dem Grauen vorbei; ätzender Geruch betäubt mich: ein Hase, das arme Tier! Möchte Weglaufen!, – kann nicht hinschauen auf das, was da an das Tor genagelt ist. Und das ungestraft verbrochen von diesem schändlichen Totmacher, der jetzt dem Kadaver das restlich verbliebene Fell über den geschundenen Körper zieht: lange, graue, eklige Fetzen. Und das nackte Fleisch des Tieres schimmert lila und rot.
Der ist tot, tröstet er mich, der spürt nichts mehr, kannst beruhigt nach Haus gehen.
Und ich gehe, langsam, einmal noch drehe ich mich um. Schmal und eingeklemmt zwischen den feindlichen Nachbarn: unser Haus!, umgeben von einer seltsamen Konstruktion aus Balken, Dielen, Brettern, Eisenstangen, geduldig darauf wartend, verputzt zu werden. Das Gerüst war eine Zeitlang mein Spielplatz, auf dem ich die sprichwörtlich hohe Kunst des Kletterns erlernte, erprobte, auf dem ich mir Mut, erste männliche Tatkraft und Geschicklichkeit beweisen durfte. Ich war ein freies Spielkind, unbeaufsichtigt, unkontrolliert, durfte mich der Gefahr eines versehentlichen Absturzes nach eigenem Belieben aussetzen. Und wenn ich auf den schmalen Dielen, oben auf der höchsten Stelle des Gerüsts, übermütig balancierte, und Dach und Kamin zum Greifen nahe waren, hielt ich oft für wenige Minuten inne, ließ meine Blicke über die Giebel der Nachbarhäuser schweifen.
Schwebte weit fort in eine mir bis dahin fremde Weite, unendlich, bis hin zum Horizont, wo sich Wolkenriesen (gleich mächtig ausgestoßenem Lokomotivendampf) zusammenballten und die untergehende Sonne mein Fernweh mit sich nahm. Einmal befand ich mich, ganz unerwartet, Mutter gegenüber; das, als sie drinnen gerade zum Fenster ging, im Wohnzimmer, und ich, die Hände gleich Scheuklappen, an meine Schläfen haltend, mir die Nase am Fensterglas plattdrückte, um in diesem heiligen Raum, jetzt aus einer ganz anderen Perspektive, mit meinen Blicken umherzugehen. Und hinter dem Glas sehe ich Mutter wild und aufgeregt gestikulieren und ich deute ihre Gebärden als einen Hilferuf vor meinem nahenden Tod, der mich sogleich ereilen wird, wenn ich nicht auf der Stelle das gefährliche Gerüst verlasse und mich auf sicheren Boden begebe.
Und da taucht nun plötzlich dieses Schwimmbassin vor meinem inneren Auge auf, gleich hinter dem Haus, das an der Bergstraße! Und durch mein Fernglas erkenne ich Mutter Arbeiten verrichten. Ein Haus, das Deutschen gehört, in jenen Tagen aber das Haus des Amerikaners ist. Im Garten ein Schwimmbassin. Ich balanciere über gefrorenes Wasser. Es ist ja so toll, so aufregend, über das Eis zu rutschen! Ich hüpfe, springe, vor Übermut, stampfe meine Füße auf das harte, kristallene Silber, ziehe glitzernde Kreise. Und ich bin glücklich – die Welt voller Sonnenschein. Mutter ist im Haus und macht etwas an einem großen Tier, es ist ein Hirsch, den der Amerikaner geschossen hat. Jetzt höre ich etwas, das ich nicht kenne: das Eis unter mir knackt, und das ist lustig wie es knackt, und es knackt immer lauter. Ich verliere meinen Halt, breche ein, ich strample und schreie, schlage um mich; und meine panische Hektik krepiert zu einem Still in der Tiefe dieser Naturgewalt.
Als ich wieder zu Bewusstsein komme, spüre ich heftiges Rubbeln auf meiner Haut, taucht aus fernen Schatten die Gestalt meiner Mutter vor mir auf, reiben und kneten mich ihre Hände, massieren Tücher meinen Körper, beginnt ein Hauch von Wärme mein zitterndes Etwas zu durchströmen. Und jetzt weiß ich es: weiß, dass ich lebe, dass ich nicht tot bin. Ich fühle mich schwach, bin müde, und Mutters Stimme ist erregt, und ich ahne, dass ich etwas getan habe, das ich hätte nicht tun sollen: ja mehr noch – dass ich dem Tod nahe war und dass ich Gott danken soll, dass ich nicht ertrunken bin.
Später, unter einem Berg von wärmenden Decken, bin ich dann doch noch ertrunken: ganz still, unbemerkt, als in meinem Kopf das Schreckliche in imaginären Bildern ablief; dies gleich einem Film, dessen suggestive Kraft mich erneut auf das Eis führte und ich so unter der Schwere meiner sich verselbständigenden Phantasie einbrach. Ein Akt, gegen den ich mich heftig wehrte, mich aufbäumte: ein heimtückischer Mord an einem unschuldigen Kind, den irgend so ein dahergelaufener Regisseur in meinem Kopf inszenierte, mich als Protagonist seines Dramas mit Gewalt in die Pflicht nahm. Und so musste ich dann doch noch ertrinken, musste ich den bereits nahenden Tod nun bis zum bitteren Ende erleiden, in einem Stück, dem ich doch gerade erst entkommen war.
Ich sehnte mich zurück in meine vertraute Spielecke, zu meinen Bauklötzen auf dem abgetretenen Spielboden, in die schützende Geborgenheit: dort im Hause am Kapellenweg, hoch oben am Waldrand wo wir erste Herberge in der Fremde gefunden hatten. Bald wird Mutter mit der Arbeit fertig sein, mit der Mühe an dem großen Tier. Ich wusste es, klammerte mich an dieser Vorfreude fest. Und als die Dunkelheit einbrach, verließen wir dieses Haus, das Haus, das meiner Mutter Arbeit gab und Brot, manchmal auch Schokolade, Kaugummi. Und: Coca-Cola! Alles aus dem tollen Land des Amerikaners. Wenn ich Mutter fragte, wo denn Amerika liegt, sagte sie immer nur, Amerika? — das ist weit, weit weg von uns hier, am anderen Ende der Welt.
Ich hatte es gut bei meinen Eltern, hatte ein eigenes Bett, ein Feldbett. Eines, aus amerikanischen Armeebeständen. Wer weiß, wer alles schon darauf geschlafen hat? Vater sagte es zu mir, und im Klang seiner Stimme bebte ein eigentümlicher Unterton, in dem fernes Donnergrollen kriegerischer Schlachten verwoben war, eine verborgene Ehrfurcht, ein wehmütiger, ein kalter Hauch von Verwundung und Tod. Das Feldbett war aber auch ein lustiges Bett, weil man damit spielen konnte. Es ließ sich auf kleinstem Raum zusammenfalten. Ich habe lange gebraucht, um es herauszubekommen. Die Falttechnik dieses Bettes hatte es in sich. Und wenn Mutter es aus Platzgründen zusammengelegt hatte, dann staunte man über ein kurioses Bündel aus Zeltstoff, Holzfüßen und Metallbeschlägen, das mir Ähnlichkeit mit einer schlafenden, in ihrem Körperumfang reduzieten, Riesenspinne zu haben schien.
Einmal war ich an einem frühen Morgen den steilen Kiesweg hinunter auf die Straße gelaufen, um Mutter zu suchen. Mutter war nicht da, als ich erwachte; ich hatte sie überall gesucht, nirgends konnte ich sie finden, durch alle Zimmer bin ich gelaufen: Mutti, Mutti, wo bist du?, erst leise, kläglich, mein Rufen, dann lauter werdend, fordernd. Wie ein verwundetes Tier, ein orientierungslos gewordenes Insekt, bin ich durch die Räume geschwirrt, in dunklen Winkeln blind angestoßen. Im Garten habe ich nach ihr gerufen: Mutti, Mutti, wo bist du?! Nirgendwo konnte ich sie erspähen, nicht im entferntesten ihre Gestalt erahnen. Ich lief den langen, steilen, Kiesweg, stolperte auf die Straße, den so steilen, abschüssigen, Kapellenweg, lief ohne Ziel, verharrte, ging wieder, blieb wieder stehen. Wie ein verängstigtes Reh äugte ich in die Ferne, lauschte ich nach vertrauten Geräuschen, die mir die tröstende Nähe von Mutter hätten anzeigen können. Meine Angst wurde zur quälenden Gewissheit: Mutter hatte mich verlassen, sie ist fortgegangen, weit fort, fort für immer. Nie mehr würde sie zu mir zurückkommen – ich hatte keine Mutter mehr. Tränchen kullerten, und vor Kälte schlotternd, kauerte ich mich in den Winkel eines fremden Hauseingangs: ich, ein mutterloses Kind, verlassen, frierend, ausgesetzt, bösen Menschen ausgeliefert. Meine Lebensretter erschienen in Menschengestalt: lieb und tröstend sprachen sie auf mich ein. Und fremde, sanfte Hände, trockneten meine Tränen, streichelten mich, schenkten mir Trost. Und zwischen diesen fremden Gesichtern erstrahlte plötzlich ein leuchtender Stern, nein, zwei leuchtende Sterne: die Augen meiner Mutter. Und es wurde mir mit einem Male warm, der Himmel wurde licht, und die Sonne schien, schien heller als jemals zuvor.
Ich flog zu dieser Sonne empor, gehoben von ihren Armen, die alles für mich taten, die ohne Unterlass in Bewegung waren, die mich trugen, die mich führten, die mich hielten, die mich stießen, die mich umklammerten, die mich beschützten. Wenn Mutter mich in ihren Armen hielt, so wie damals, in meiner großen Not des Verlassenseins, vergrub ich mich in ihrem Gesicht, drückte ich meinen Kopf in das sanfte Kissen ihrer fleischigen Wangen, versank ich in der Wärme ihrer Haut, sog ich die Ausdünstung ihres Wesens in mich hinein — und mit all dem zugleich die Trauer, die Wehmut in ihrer Seele, das Weh der verlorenen Heimat. Dessen nicht genug: immer im Herzen pochend, die Sehnsucht nach ihrer Tochter, der Hilde, meiner um zweiundzwanzig Jahre älteren Schwester, die nicht bei ihr sein, ihr nicht zur Hand gehen konnte, da sie in einem weit entfernten Lungenheilsanatorium weilte. So waren wir, Mutter und ich, zu einer Schicksalsgemeinschaft verurteilt, zu einer untrennbaren Symbiose verschweißt. Ich lieferte mich ihr aus mit meiner kindlichen Unschuld, unterwarf mich ihr mit meinem von allem Bösen noch ungetrübten Licht meiner Augen, die sie mit Melancholie besetzte. Meine Mutter war der Stern in der Finsternis meiner Welt, dessen Licht mich beschien, dessen Strahlen mir den Weg durch die Dunkelheit des um mich herum erwachenden Lebens wiesen. Wie unter einem magischen Zwang trieb es mich ständig zu ihr, zog mich ein unerklärlicher Sog unablässig in ihre Nähe.
Wie ein Tierjunges trollte ich hinter ihr her, bemüht, sie immer in der Nase, im Blick zu behalten. Und es erschien mir als eine Ewigkeit, wenn sie mal für wenige Minuten von mir fort war.
Als ich Mutter, bereits schon als Schulkind, einmal fragte, wie lang die Ewigkeit





























