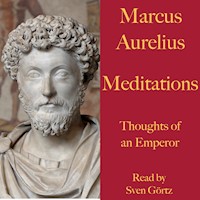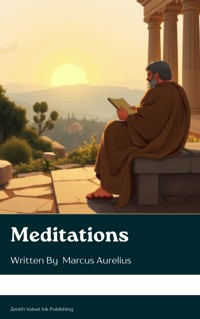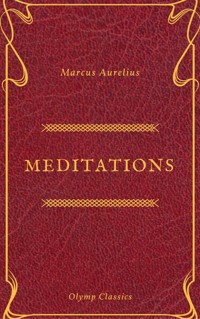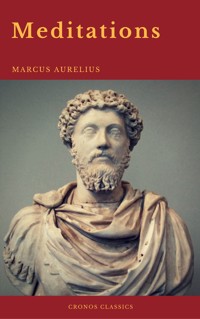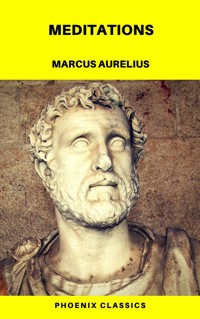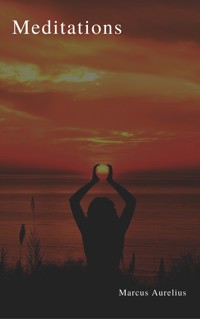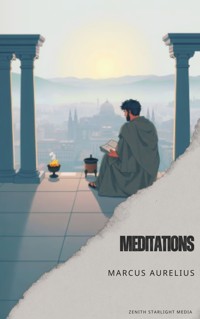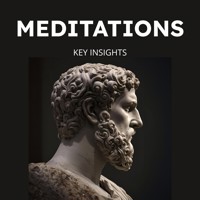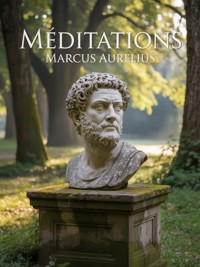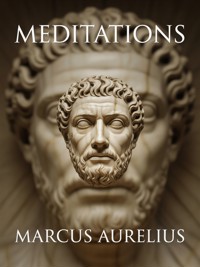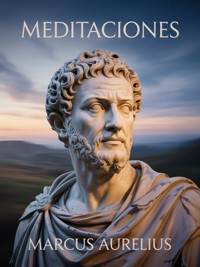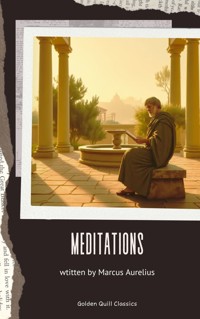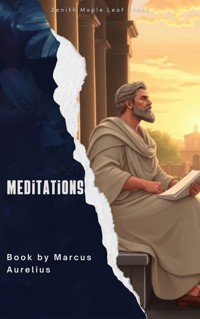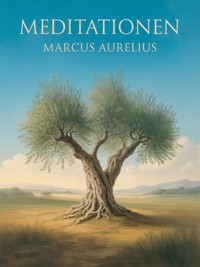
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Meditationen“ von Marcus Aurelius ist ein philosophisches Werk, das im 2. Jahrhundert n. Chr. verfasst wurde. Diese Sammlung persönlicher Schriften bietet Einblicke in die stoische Philosophie und spiegelt die inneren Gedanken und Reflexionen des römischen Kaisers wider, während er sich mit den Komplexitäten der Führung und der persönlichen Tugend auseinandersetzt. Der Schwerpunkt des Textes liegt auf Selbstreflexion, ethischen Prinzipien und der Bedeutung, inmitten der Herausforderungen des Lebens einen rationalen Geist zu bewahren. Der Anfang von „Meditationen“ stellt den Hintergrund von Marcus Aurelius vor und beschreibt detailliert seine Erziehung, Ausbildung und philosophischen Einflüsse. Er hebt seinen tiefen Respekt für seine Familie und Mentoren hervor, die seinen Charakter geprägt und ihm Werte wie Sanftmut, Mäßigung und Pflichtbewusstsein vermittelt haben. Im weiteren Verlauf des Textes skizziert Marcus seine zahlreichen Dankesschulden gegenüber denjenigen, die ihn beeinflusst haben, und betont ein Leben der Mäßigung und der Hingabe an die Philosophie. Er legt den Grundstein für seine Meditationen über die Natur des Universums, die conditio humana und die Tugenden des Mitgefühls und der Selbstdisziplin, die alle seine Erforschung des Stoizismus im gesamten Werk prägen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
SEIN ERSTES BUCH
über SICH SELBST:
DAS ERSTE BUCH
DAS ZWEITE BUCH
DAS DRITTE BUCH
DAS VIERTE BUCH
DAS FÜNFTE BUCH
DAS SECHSTE BUCH
DAS SIEBTE BUCH
DAS ACHTE BUCH
DAS NEUNTE BUCH
DAS ZEHNTE BUCH
DAS ELFTE BUCH
DAS ZWÖLFTE BUCH
Meditationen
Kaiser von Rom Marcus Aurelius
EINLEITUNG
MARCUS AURELIUS ANTONINUS wurde am 26. April 121 n. Chr. geboren. Sein richtiger Name war M. Annius Verus, und er stammte aus einer Adelsfamilie, die sich auf Numa, den zweiten König von Rom, als Vorfahren berief. So stammte der frommste aller Kaiser aus dem Geschlecht der gottesfürchtigsten frühen Könige. Sein Vater, Annius Verus, hatte ein hohes Amt in Rom inne, und sein Großvater, der denselben Namen trug, war dreimal Konsul gewesen. Beide Eltern starben früh, aber Marcus behielt sie in liebevoller Erinnerung. Nach dem Tod seines Vaters wurde Marcus von seinem Großvater, dem Konsul Annius Verus, adoptiert, und zwischen den beiden bestand eine tiefe Liebe. Auf der ersten Seite seines Buches erklärt Marcus dankbar, wie er von seinem Großvater gelernt hatte, sanftmütig und demütig zu sein und sich von jeglichem Zorn und jeder Leidenschaft fernzuhalten. Kaiser Hadrian erkannte den guten Charakter des Jungen, den er nicht Verus, sondern Verissimus nannte, wahrhaftiger als sein eigener Name. Er erhob Marcus im Alter von sechs Jahren in den Ritterstand und machte ihn mit acht Jahren zum Mitglied des alten salischen Priestertums. Die Tante des Jungen, Annia Galeria Faustina, war mit Antoninus Pius verheiratet, dem späteren Kaiser. Da Antoninus keinen Sohn hatte, adoptierte er Marcus, gab ihm seinen Namen und verlobte ihn mit seiner Tochter Faustina. Seine Erziehung wurde mit größter Sorgfalt durchgeführt. Die fähigsten Lehrer wurden für ihn engagiert, und er wurde in der strengen Lehre der stoischen Philosophie unterrichtet, die ihm große Freude bereitete. Man lehrte ihn, sich schlicht zu kleiden und einfach zu leben, jede Weichheit und jeden Luxus zu vermeiden. Sein Körper wurde durch Ringen, Jagen und Spiele im Freien zu Robustheit trainiert, und obwohl er von schwacher Konstitution war, zeigte er großen persönlichen Mut, sich den wildesten Wildschweinen zu stellen. Gleichzeitig wurde er von den Extravaganzen seiner Zeit ferngehalten. Die große Aufregung in Rom war der Streit der sogenannten Fraktionen im Zirkus. Die Rennfahrer nahmen eine von vier Farben an – rot, blau, weiß oder grün – und ihre Anhänger zeigten eine Begeisterung, sie zu unterstützen, die nichts übertreffen konnte. Aufruhr und Korruption folgten den Rennwagen, und von all diesen Dingen hielt sich Marcus streng fern.
Im Jahr 140 wurde Marcus zum Konsul ernannt, und 145 wurde seine Verlobung durch die Heirat vollzogen. Zwei Jahre später schenkte Faustina ihm eine Tochter, und bald darauf wurden ihm das Tribunat und andere kaiserliche Ehren verliehen.
Antoninus Pius starb 161, und Marcus übernahm die kaiserliche Herrschaft. Er verband sich sofort mit L. Ceionius Commodus, den Antoninus zur gleichen Zeit wie Marcus als jüngeren Sohn adoptiert und ihm den Namen Lucius Aurelius Verus gegeben hatte. Von nun an waren die beiden Kollegen im Reich, wobei der Jüngere sozusagen zum Nachfolger ausgebildet wurde. Kaum hatte Marcus den Thron bestiegen, brachen überall Kriege aus. Im Osten begann Vologeses III. von Parthien einen lange geplanten Aufstand, indem er eine ganze römische Legion vernichtete und in Syrien einfiel (162). Verus wurde in aller Eile ausgesandt, um diesen Aufstand niederzuschlagen, und er erfüllte sein Amt, indem er sich dem Alkohol und der Ausschweifung hingab, während er den Krieg seinen Offizieren überließ. Bald darauf musste Marcus sich einer ernsteren Gefahr im eigenen Land stellen, nämlich dem Bündnis mehrerer mächtiger Stämme an der Nordgrenze. Zu den wichtigsten gehörten die Markomannen, die Quaden (in diesem Buch erwähnt), die Sarmaten, die Catti und die Jazyg . In Rom selbst herrschten Pest und Hungersnot, die eine von den Legionen des Verus aus dem Osten eingeschleppt, die andere durch Überschwemmungen verursacht, die große Mengen Getreide vernichtet hatten. Nachdem alles getan worden war, um die Hungersnot zu lindern und die dringendsten Bedürfnisse zu stillen – Marcus war sogar gezwungen, die kaiserlichen Juwelen zu verkaufen, um Geld zu beschaffen –, machten sich beide Kaiser auf zu einem Kampf, der mehr oder weniger während der gesamten restlichen Regierungszeit des Marcus andauern sollte. Während dieser Kriege starb Verus im Jahr 169. Wir haben keine Möglichkeit, die Feldzüge im Detail nachzuvollziehen, aber so viel ist sicher, dass es den Römern am Ende gelang, die barbarischen Stämme zu vernichten und eine Regelung zu erzielen, die das Reich sicherer machte. Marcus war selbst Oberbefehlshaber, und der Sieg war nicht weniger seiner eigenen Fähigkeit zu verdanken als seiner Weisheit bei der Auswahl seiner Leutnants, die im Fall von Pertinax besonders deutlich wurde. In diesen Feldzügen wurden mehrere wichtige Schlachten geschlagen, von denen eine durch die Legende der Donnernden Legion berühmt wurde. In einer Schlacht gegen die Quaden im Jahr 174 schien der Tag zugunsten des Feindes zu verlaufen, als plötzlich ein gewaltiger Sturm mit Donner und Regen aufkam und der Blitz die Barbaren in Schrecken versetzte, sodass sie die Flucht ergriffen. Später wurde behauptet, dieser Sturm sei als Antwort auf die Gebete einer Legion gesandt worden, in der viele Christen dienten, und aus diesem Grund sollte ihr der Name „donnernde Legion” gegeben werden. Der Titel „donnernde Legion” ist jedoch schon aus früherer Zeit bekannt, sodass zumindest dieser Teil der Geschichte nicht wahr sein kann; die Hilfe des Sturms wird jedoch durch eine der Szenen bestätigt, die auf der Antoninussäule in Rom, die an diese Kriege erinnert, eingemeißelt sind.
Die nach diesen Unruhen erzielte Einigung hätte zufriedenstellender sein können, wäre es nicht zu einem unerwarteten Aufstand im Osten gekommen. Avidius Cassius, ein fähiger Feldherr, der sich in den Partherkriegen einen Namen gemacht hatte, war zu dieser Zeit oberster Statthalter der östlichen Provinzen. Aus welchen Gründen auch immer, er hatte den Plan gefasst, sich selbst zum Kaiser auszurufen, sobald Marcus, der zu dieser Zeit bei schwacher Gesundheit war, sterben würde; und als ihm die Nachricht vom Tod Marcuses überbracht wurde, tat Cassius, was er geplant hatte. Als Marcus die Nachricht hörte, schloss er sofort einen Friedensvertrag und kehrte nach Hause zurück, um sich dieser neuen Gefahr zu stellen. Der Kaiser war sehr betrübt darüber, dass er sich auf die Schrecken eines Bürgerkriegs einlassen musste. Er lobte die Qualitäten von Cassius und äußerte den herzlichen Wunsch, dass Cassius nicht dazu getrieben werde, sich selbst zu verletzen, bevor er die Gelegenheit habe, ihm eine vollständige Begnadigung zu gewähren. Doch bevor er in den Osten gelangen konnte, erreichte Cassius die Nachricht, dass der Kaiser noch lebte; seine Anhänger wandten sich von ihm ab, und er wurde ermordet. Marcus begab sich nun in den Osten, und während er dort war, brachten ihm die Mörder den Kopf von Cassius; doch der Kaiser lehnte ihr Geschenk empört ab und wollte die Männer nicht in seine Gegenwart lassen.
Auf dieser Reise starb seine Frau Faustina. Nach seiner Rückkehr feierte der Kaiser einen Triumphzug (176). Unmittelbar danach begab er sich nach Germanien und nahm erneut die Last des Krieges auf sich. Seine Operationen waren von vollem Erfolg gekrönt, aber die Unruhen der letzten Jahre hatten seiner Konstitution, die nie robust gewesen war, zu sehr zugesetzt, und am 17. März 180 starb er in Pannonien.
Auch der gute Kaiser blieb von familiären Problemen nicht verschont. Faustina hatte ihm mehrere Kinder geboren, die er leidenschaftlich liebte. Ihre unschuldigen Gesichter sind noch heute in vielen Skulpturengalerien zu sehen und erinnern auf seltsame Weise an das verträumte Antlitz ihres Vaters. Aber sie starben einer nach dem anderen, und als Marcus selbst starb, lebte nur noch einer seiner Söhne – der schwache und wertlose Commodus. Nach dem Tod seines Vaters machte Commodus, der seine Nachfolge antrat, die Arbeit vieler Feldzüge durch einen übereilten und unklugen Frieden zunichte; und seine zwölfjährige Herrschaft ( ) erwies sich als die eines grausamen und blutrünstigen Tyrannen. Skandale haben den Namen Faustinas selbst in Verruf gebracht, die nicht nur der Untreue beschuldigt wird, sondern auch der Intrige mit Cassius und der Anstiftung zu seiner fatalen Rebellion. Es muss jedoch eingeräumt werden, dass diese Anschuldigungen auf keinen sicheren Beweisen beruhen; und der Kaiser liebte sie auf jeden Fall von ganzem Herzen und hegte nie den geringsten Verdacht.
Als Soldat haben wir gesehen, dass Marcus sowohl fähig als auch erfolgreich war; als Verwalter war er umsichtig und gewissenhaft. Obwohl er von den Lehren der Philosophie durchdrungen war, versuchte er nicht, die Welt nach einem vorgefassten Plan umzugestalten. Er beschritt den von seinen Vorgängern eingeschlagenen Weg und versuchte nur, seine Pflicht so gut wie möglich zu erfüllen und Korruption zu verhindern. Es stimmt, dass er einige unkluge Dinge getan hat. Die Schaffung eines Mitregenten im Reich, wie er es mit Verus tat, war eine gefährliche Neuerung, die nur dann Erfolg haben konnte, wenn einer der beiden sich zurücknahm; und unter Diokletian führte genau dieser Präzedenzfall zur Spaltung des Römischen Reiches in zwei Hälften. Er beging Fehler in seiner Zivilverwaltung, indem er zu sehr zentralisierte. Die Stärke seiner Herrschaft lag jedoch in der Rechtspflege. Marcus bemühte sich um Gesetze zum Schutz der Schwachen, um das Los der Sklaven zu erleichtern und um den Vaterlosen einen Vater zu geben. Es wurden Wohltätigkeitsstiftungen zur Erziehung und Ausbildung armer Kinder gegründet. Die Provinzen wurden vor Unterdrückung geschützt, und Städte oder Bezirke, die von Katastrophen heimgesucht wurden, erhielten öffentliche Hilfe. Der große Makel an seinem Namen, der in der Tat schwer zu erklären ist, ist seine Behandlung der Christen. Während seiner Herrschaft wurden Justin in Rom und Polykarp in Smyrna zu Märtyrern ihres Glaubens, und wir wissen von vielen Ausbrüchen von Fanatismus in den Provinzen, die den Tod von Gläubigen zur Folge hatten. Es ist keine Entschuldigung zu behaupten, er habe nichts von den Gräueltaten gewusst, die in seinem Namen begangen wurden: Es war seine Pflicht, davon zu wissen, und wenn er es nicht wusste, hätte er als Erster zugeben müssen, dass er seine Pflicht verletzt hatte. Aber aus seinem eigenen Tonfall, wenn er über die Christen sprach, geht klar hervor, dass er sie nur aus Verleumdungen kannte; und wir hören nichts von Maßnahmen, die ergriffen wurden, um ihnen zumindest eine faire Anhörung zu gewähren. In dieser Hinsicht war Trajan besser als er.
Für einen nachdenklichen Geist war eine Religion wie die römische wenig befriedigend. Ihre Legenden waren oft kindisch oder unmöglich, ihre Lehren hatten wenig mit Moral zu tun. Die römische Religion war in Wirklichkeit eine Art Handel: Die Menschen brachten bestimmte Opfer dar und vollzogen bestimmte Riten, und die Götter gewährten ihnen ihre Gunst, unabhängig davon, ob sie Recht oder Unrecht hatten. In diesem Fall waren alle frommen Seelen auf die Philosophie angewiesen, wie es auch in Griechenland der Fall gewesen war, wenn auch in geringerem Maße. Unter dem frühen Kaiserreich gab es zwei rivalisierende Schulen, die sich das Feld praktisch untereinander aufteilten: den Stoizismus und den Epikureismus. Das Ideal, das sich beide setzten, war nominell weitgehend dasselbe. Die Stoiker strebten nach ἁπάθεια, der Unterdrückung aller Emotionen, und die Epikureer nach ἀταραξία, der Freiheit von allen Störungen; doch im Ergebnis ist das eine zum Synonym für hartnäckige Ausdauer geworden, das andere für zügellose Zügellosigkeit. Mit dem Epikureismus haben wir jetzt nichts zu tun; aber es lohnt sich, die Geschichte und die Lehren der stoischen Sekte zu skizzieren.
Zeno, der Begründer des Stoizismus, wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt auf Zypern geboren, aber man kann sagen, dass sein Leben ungefähr zwischen 350 und 250 v. Chr. lag. Zypern ist seit jeher ein Treffpunkt zwischen Ost und West, und obwohl wir einer möglichen phönizischen Abstammung seinerseits keine Bedeutung beimessen können (denn die Phönizier waren keine Philosophen), ist es doch sehr wahrscheinlich, dass er über Kleinasien mit dem Fernen Osten in Kontakt gekommen ist. Er studierte bei dem Kyniker Krates, vernachlässigte aber auch andere philosophische Systeme nicht . Nach vielen Jahren des Studiums eröffnete er seine eigene Schule in einer Säulenhalle in Athen, die „Gemalte Säulenhalle” oder „Stoa” genannt wurde und den Stoikern ihren Namen gab. Neben Zeno verdankt die Schule der Säulenhalle am meisten Chrysippos (280–207 v. Chr.), der den Stoizismus zu einem System organisierte. Über ihn wurde gesagt:
„Ohne Chrysippos hätte es keine Stoa gegeben.“
Die Stoiker betrachteten Spekulation als Mittel zum Zweck, und dieser Zweck bestand, wie Zeno es ausdrückte, darin, konsequent zu leben (ὁμολογουμένος ζῆν) oder, wie später erklärt wurde, im Einklang mit der Natur zu leben (ὁμολογουμένος τῇ φύσει ζῆν). Diese Anpassung des Lebens an die Natur war die stoische Vorstellung von Tugend. Diese Aussage könnte leicht so verstanden werden, dass Tugend darin besteht, jedem natürlichen Impuls nachzugeben; aber das war weit entfernt von der stoischen Bedeutung. Um im Einklang mit der Natur zu leben, muss man wissen, was Natur ist; zu diesem Zweck wird die Philosophie in drei Bereiche unterteilt: in die Physik, die sich mit dem Universum und seinen Gesetzen, den Problemen der göttlichen Regierung und der Teleologie befasst; in die Logik, die den Verstand schult, Wahres von Falschem zu unterscheiden; und in die Ethik, die das so gewonnene und erprobte Wissen auf das praktische Leben anwendet.
Das stoische System der Physik war Materialismus mit einer Prise Pantheismus. Im Widerspruch zu Platons Ansicht, dass nur die Ideen oder Prototypen der Phänomene wirklich existieren, vertraten die Stoiker die Auffassung, dass nur materielle Objekte existieren; aber im materiellen Universum war eine spirituelle Kraft immanent, die durch sie wirkte und sich in vielen Formen manifestierte, wie Feuer, Äther, Geist, Seele, Vernunft, das herrschende Prinzip.
Das Universum ist also Gott, von dem die populären Götter Manifestationen sind, während Legenden und Mythen allegorisch sind. Die Seele des Menschen ist somit eine Emanation der Gottheit, in die sie schließlich wieder aufgenommen wird. Das göttliche herrschende Prinzip lässt alle Dinge zum Guten zusammenwirken, aber zum Guten des Ganzen. Das höchste Gut des Menschen besteht darin, bewusst mit Gott für das Gemeinwohl zu arbeiten, und in diesem Sinne versuchten die Stoiker, im Einklang mit der Natur zu leben. Im Individuum ist es allein die Tugend, die ihn dazu befähigt; so wie die Vorsehung das Universum regiert, so muss die Tugend in der Seele den Menschen regieren.
In der Logik ist das stoische System wegen seiner Theorie zur Prüfung der Wahrheit, dem Kriterium, bemerkenswert. Sie verglichen die neugeborene Seele mit einem Blatt Papier, das zum Beschreiben bereit ist. Darauf schreiben die Sinne ihre Eindrücke (φαντασίαι), und durch die Erfahrung einer Reihe davon entwickelt die Seele unbewusst allgemeine Vorstellungen (κοιναὶ ἔννοιαι) oder Vorwegnahmen (προλήψεις). Wenn der Eindruck so stark war, dass man ihm nicht widerstehen konnte, wurde er als (καταληπτικὴ φαντασία) bezeichnet, als etwas, das festhält, oder, wie sie es erklärten, als etwas, das aus der Wahrheit hervorgeht. Ideen und Schlussfolgerungen, die künstlich durch Deduktion oder Ähnliches hervorgebracht wurden, wurden durch diese „festhaltende Wahrnehmung” geprüft. Über die ethische Anwendung habe ich bereits gesprochen. Das höchste Gut war das tugendhafte Leben. Nur Tugend ist Glück, und Laster ist Unglück. Diese Theorie auf die Spitze treibend, sagten die Stoiker, dass es keine Abstufungen zwischen Tugend und Laster geben könne, obwohl natürlich jedes seine besonderen Ausprägungen habe. Darüber hinaus ist nichts gut außer der Tugend, und nichts außer dem Laster ist schlecht. Die äußeren Dinge, die gemeinhin als gut oder schlecht bezeichnet werden, wie Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut, Freude und Schmerz, sind für ihn gleichgültig (ἀδιάφορα). All diese Dinge sind lediglich der Bereich, in dem die Tugend wirken kann. Der ideale Weise ist sich selbst in allen Dingen genug (αὐταρκής); und da er diese Wahrheiten kennt, wird er selbst dann glücklich sein, wenn er auf der Folterbank liegt ( ). Es ist wahrscheinlich, dass kein Stoiker für sich selbst behauptete, dieser Weise zu sein, sondern dass jeder danach als Ideal strebte, so wie der Christ danach strebt, Christus ähnlich zu sein. Die Übertreibung in dieser Aussage war jedoch so offensichtlich, dass die späteren Stoiker dazu veranlasst wurden, eine weitere Unterteilung der gleichgültigen Dinge in das Bevorzugte (προηγμένα) und das Unerwünschte (ἀποπροηγμένα) vorzunehmen. Sie vertraten auch die Auffassung, dass für denjenigen, der die vollkommene Weisheit noch nicht erreicht hatte, bestimmte Handlungen angemessen waren (καθήκοντα). Diese waren weder tugendhaft noch lasterhaft, sondern nahmen wie die gleichgültigen Dinge eine mittlere Position ein.
Zwei Punkte im stoischen System verdienen besondere Erwähnung. Der eine ist die sorgfältige Unterscheidung zwischen Dingen, die in unserer Macht stehen, und solchen, die es nicht tun. Begierde und Abneigung, Meinung und Zuneigung liegen in der Macht des Willens, während Gesundheit, Reichtum, Ehre und andere Dinge dies im Allgemeinen nicht tun. Der Stoiker war aufgefordert, seine Wünsche und Zuneigungen zu kontrollieren und seine Meinung zu lenken, sein ganzes Wesen unter die Herrschaft des Willens oder Leitprinzips zu bringen, so wie das Universum von der göttlichen Vorsehung gelenkt und regiert wird. Dies ist eine besondere Anwendung der beliebten griechischen Tugend der Mäßigung (σωφροσύνη) und hat auch ihre Entsprechung in der christlichen Ethik. Der zweite Punkt ist eine starke Betonung der Einheit des Universums und der Pflicht des Menschen als Teil eines großen Ganzen. Der Gemeinsinn war die großartigste politische Tugend der Antike und wird hier kosmopolitisch gemacht. Es ist wiederum lehrreich zu beachten, dass christliche Weise dasselbe betonten. Christen wird gelehrt, dass sie Mitglieder einer weltweiten Bruderschaft sind, in der es weder Griechen noch Hebräer, Sklaven noch Freie gibt, und dass sie ihr Leben als Mitarbeiter Gottes leben.
Dies ist das System, das den „Meditationen“ von Marcus Aurelius zugrunde liegt. Um das Buch richtig zu verstehen, sind gewisse Kenntnisse darüber erforderlich, aber für uns liegt das Hauptinteresse woanders. Wir wenden uns Marcus Aurelius nicht zu, um eine Abhandlung über den Stoizismus zu lesen. Er ist kein Schulleiter, der seinen Schülern eine Lehre vermittelt; er denkt nicht einmal daran, dass andere lesen sollten, was er schreibt. Seine Philosophie ist keine eifrige intellektuelle Suche, sondern eher das, was wir als religiöses Gefühl bezeichnen würden. Die kompromisslose Starrheit von Zeno oder Chrysippos wird durch eine ehrfürchtige und tolerante, sanfte und arglose Natur gemildert und verwandelt; die grimmige Resignation, die dem stoischen Weisen das Leben ermöglichte, wird bei ihm fast zu einer Stimmung der Sehnsucht. Sein Buch hält die innersten Gedanken seines Herzens fest, niedergeschrieben, um es zu erleichtern, mit moralischen Maximen und Reflexionen, die ihm helfen mögen, die Last der Pflicht und die unzähligen Ärgernisse eines geschäftigen Lebens zu ertragen.
Es ist aufschlussreich, die Meditationen mit einem anderen berühmten Buch zu vergleichen, der Nachfolge Christi. In beiden findet sich dasselbe Ideal der Selbstbeherrschung. Es sollte die Aufgabe eines Menschen sein, sagt die Nachfolge, „sich selbst zu überwinden und jeden Tag stärker zu sein als er selbst“. „Im Widerstehen der Leidenschaften liegt der wahre Friede des Herzens.“ „Lasst uns die Axt an die Wurzel legen, damit wir, von unseren Leidenschaften gereinigt, einen friedvollen Geist haben mögen.“ Zu diesem Zweck muss es eine ständige Selbstprüfung geben. „Wenn du dich nicht ständig sammeln kannst, dann tue es zumindest einmal am Tag, morgens oder abends. Nimm dir morgens vor, abends zu besprechen, wie du heute in Wort, Tat und Gedanke gewesen bist.“ Während der Römer jedoch eine bescheidene Selbstsicherheit an den Tag legt, strebt der Christ nach einer eher passiven Haltung, nach Demut und Sanftmut und vertraut auf die Gegenwart und persönliche Freundschaft Gottes. Der Römer hinterfragt seine Fehler streng, jedoch ohne die Selbstverachtung, die den Christen „in seinen eigenen Augen verachtenswert“ macht. Der Christ fordert, wie der Römer, „ “ (in der Nacht, wenn die Welt schläft), „dein Herz von der Liebe zu den sichtbaren Dingen zurückzuziehen“; aber er denkt dabei weniger an das geschäftige Leben der Pflicht als vielmehr an die Verachtung aller weltlichen Dinge und das „Abschneiden aller niederen Freuden“. Beide bewerten das Lob oder die Tadel der Menschen nach ihrem tatsächlichen Wert; „Lass deinen Frieden nicht in den Mündern der Menschen sein“, sagt der Christ. Aber der Christ appelliert an Gottes Urteil, der Römer an seine eigene Seele. Die kleinen Ärgernisse der Ungerechtigkeit oder Unfreundlichkeit werden von beiden mit derselben Großzügigkeit betrachtet. „Warum macht dich eine kleine Bemerkung oder Handlung gegen dich traurig? Das ist nichts Neues; es ist nicht das erste Mal und es wird auch nicht das letzte Mal sein, wenn du lange lebst. Ertrage es geduldig, wenn du es nicht freudig ertragen kannst.“ Der Christ sollte mehr über die Bosheit anderer Menschen traurig sein als über das eigene Unrecht; aber der Römer neigt dazu, seine Hände in Unschuld zu waschen. „Übe dich in Geduld, wenn du leidest, und ertrage die Fehler und Schwächen anderer Menschen“, sagt der Christ; aber der Römer hätte niemals daran gedacht, hinzuzufügen: „Wenn alle Menschen vollkommen wären, was hätten wir dann für Gott unter anderen Menschen zu leiden?“ Die Tugend des Leidens an sich ist ein Gedanke, der in den Meditationen nicht vorkommt. Beide erkennen, dass der Mensch Teil einer großen Gemeinschaft ist. „Kein Mensch ist sich selbst genug“, sagt der Christ; „wir müssen gemeinsam tragen, gemeinsam helfen, gemeinsam trösten.“ Aber während er die größte Bedeutung in Eifer, also in erhöhter Emotion, und in der Vermeidung von Lauheit sieht, dachte der Römer vor allem an die Pflicht, die so gut wie möglich zu erfüllen sei, und weniger an das Gefühl, das mit der Erfüllung dieser Pflicht einhergehen sollte. Sowohl für den Heiligen als auch für den Kaiser ist die Welt bestenfalls ein armseliges Ding. „Wahrlich, es ist ein Elend, auf der Erde zu leben“, sagt der Christ; die Tage des Menschen sind wenige und böse, sie vergehen plötzlich wie ein Schatten.
Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen den beiden Büchern, die wir betrachten. Die Nachfolge richtet sich an andere, die Meditationen des Autors an sich selbst. Aus der Nachfolge erfahren wir nichts über das Leben des Autors, außer dass man davon ausgehen kann, dass er seine eigenen Lehren praktiziert hat; die Meditationen spiegeln Stimmung für Stimmung die Gedanken desjenigen wider, der sie geschrieben hat. In ihrer Intimität und Offenheit liegt ihr großer Reiz. Diese Notizen sind keine Predigten, sie sind nicht einmal Bekenntnisse. Bekenntnisse haben immer einen Hauch von Selbstbewusstsein; bei solchen Enthüllungen besteht selbst für die besten Menschen immer die Gefahr der Schleimigkeit oder Vulgarität. Der heilige Augustinus ist nicht immer frei von Verfehlungen, und John Bunyan selbst übertreibt verzeihliche Sünden zu abscheulichen Vergehen. Marcus Aurelius ist jedoch weder vulgär noch schmierig; er beschönigt nichts, aber er schreibt auch nichts aus Boshaftigkeit nieder. Er posiert nie vor einem Publikum; er mag nicht tiefgründig sein, aber er ist immer aufrichtig. Und es ist eine erhabene und heitere Seele, die sich hier vor uns offenbart. Vulgäre Laster scheinen für ihn keine Versuchung zu sein; er ist nicht jemand, der mit Ketten gefesselt ist, die er zu sprengen versucht. Die Fehler, die er an sich selbst entdeckt, sind oft solche, die die meisten Menschen nicht sehen würden. Um dem göttlichen Geist zu dienen, der in ihm wohnt, muss ein Mensch „sich rein halten von allen heftigen Leidenschaften und bösen Neigungen, von aller Unbesonnenheit und Eitelkeit und von jeder Art von Unzufriedenheit, sei es gegenüber den Göttern oder den Menschen“; oder, wie er an anderer Stelle sagt: „unbefleckt von Vergnügen, unerschrocken gegenüber Schmerz“. Unerschütterliche Höflichkeit und Rücksichtnahme sind seine Ziele. „Was auch immer ein Mensch tut oder sagt, du musst gütig sein.“ „Beleidigt jemand? Er beleidigt sich selbst, warum sollte dich das beunruhigen?“ Der Täter braucht Mitleid, nicht Zorn; diejenigen, die korrigiert werden müssen, sollten mit Takt und Sanftmut behandelt werden, und man muss immer bereit sein, dazuzulernen. „Die beste Art der Rache ist, nicht so zu werden wie sie.“ Es gibt so viele Hinweise auf vergebene Vergehen, dass wir glauben können, dass die Notizen unmittelbar auf die Tatsachen folgten. Vielleicht hat er sein Ziel verfehlt und versucht daher, sich seine Prinzipien in Erinnerung zu rufen, und sich für die Zukunft zu stärken. Dass diese Worte nicht nur leere Worte sind, geht aus der Geschichte von Avidius Cassius hervor, der seinen Kaiserthron an sich reißen wollte. So setzt der Kaiser getreu sein eigenes Prinzip um, dass das Böse mit dem Guten überwunden werden muss. Für jeden Fehler anderer hat uns die Natur (so sagt er) eine gegenwirkende Tugend gegeben; „wie zum Beispiel gegen die Undankbaren hat sie Güte und Sanftmut als Gegenmittel gegeben.“
Wer so sanftmütig gegenüber einem Feind war, musste ein guter Freund sein; und tatsächlich sind seine Seiten voller großzügiger Dankbarkeit gegenüber denen, die ihm gedient hatten. In seinem ersten Buch rechnet er alle Schulden gegenüber seinen Verwandten und Lehrern auf. Seinem Großvater verdankte er seinen sanften Geist, seinem Vater Schamhaftigkeit und Mut; von seiner Mutter lernte er, fromm, großzügig und zielstrebig zu sein. Rusticus arbeitete nicht umsonst, wenn er seinem Schüler zeigte, dass sein Leben einer Besserung bedurfte. Apollonius lehrte ihn Einfachheit, Vernunft, Dankbarkeit und die Liebe zur wahren Freiheit. So geht die Liste weiter; jeder, mit dem er zu tun hatte, scheint ihm etwas Gutes gegeben zu haben, ein sicherer Beweis für die Güte seines Wesens, das nichts Böses dachte.
Wenn er dieses ehrliche und aufrichtige Herz hatte, das das christliche Ideal ist, dann ist dies umso wunderbarer, als ihm der Glaube fehlte, der die Christen stark macht. Er konnte zwar sagen: „Entweder gibt es einen Gott, und dann ist alles gut; oder wenn alle Dinge dem Zufall und dem Glück unterliegen, so kannst du doch deine eigene Vorsehung in den Dingen walten lassen, die dich selbst betreffen, und dann geht es dir gut.“ Oder auch: „Wir müssen zugeben, dass es eine Natur gibt, die das Universum regiert.“ Aber sein eigener Anteil am Gesamtgefüge ist so gering, dass er nicht auf persönliches Glück hofft, das über das hinausgeht, was eine heitere Seele in diesem sterblichen Leben gewinnen kann. „O meine Seele, ich vertraue darauf, dass die Zeit kommen wird, in der du gut, einfach, offener und sichtbarer sein wirst als der Körper, der dich umschließt.“ Dies bezieht sich jedoch auf die ruhige Zufriedenheit mit dem menschlichen Los, die er zu erreichen hofft, und nicht auf eine Zeit, in der die Fesseln des Körpers abgelegt werden. Im Übrigen sind die Welt und ihr Ruhm und Reichtum „alles Eitelkeit“. Die Götter mögen vielleicht eine besondere Fürsorge für ihn haben, aber ihre besondere Fürsorge gilt dem Universum als Ganzes: Das sollte genügen. Seine Götter sind besser als die stoischen Götter, die fernab von allen menschlichen Dingen sitzen, ungestört und gleichgültig, aber seine persönliche Hoffnung ist kaum stärker. Zu diesem Punkt sagt er wenig, obwohl es viele Anspielungen auf den Tod als natürliches Ende gibt; zweifellos erwartete er, dass seine Seele eines Tages in die universelle Seele aufgenommen werden würde, da nichts aus dem Nichts entsteht und nichts vernichtet werden kann. Seine Stimmung ist von anstrengender Müdigkeit geprägt; er tut seine Pflicht als guter Soldat und wartet auf den Klang der Trompete, die den Rückzug signalisieren wird; er hat nicht das fröhliche Selbstvertrauen, das Sokrates durch ein nicht minder edles Leben zu einem Tod führte, der ihn in die Gesellschaft der Götter, die er verehrt hatte, und der Menschen, die er verehrt hatte, bringen sollte.
Aber obwohl Marcus Aurelius intellektuell vielleicht davon überzeugt war, dass seine Seele dazu bestimmt war, absorbiert zu werden und ihr Bewusstsein zu verlieren, gab es Zeiten, in denen er, wie alle, die daran glauben, manchmal fühlen müssen, spürte, wie unbefriedigend ein solcher Glaube ist. Dann tastet er blind nach etwas weniger Leeren und Eitlem. „Du bist in ein Schiff gestiegen“, sagt er, „du bist gesegelt, du bist an Land gekommen, geh hinaus, wenn auch in ein anderes Leben, auch dort wirst du Götter finden, die überall sind.“ Dahinter steckt mehr als nur die Annahme einer rivalisierenden Theorie zum Zwecke der Argumentation. Wenn weltliche Dinge „nur wie ein Traum“ sind, ist der Gedanke nicht weit, dass es ein Erwachen zu dem gibt, was wirklich ist. Wenn er vom Tod als einer notwendigen Veränderung spricht und darauf hinweist, dass ohne Veränderung nichts Nützliches und Gewinnbringendes zustande kommen kann, dachte er dann vielleicht an die Veränderung in einem Weizenkorn, das nur dann zum Leben erwacht, wenn es stirbt? Die wunderbare Kraft der Natur, aus Verfall Neues zu schaffen, beschränkt sich sicherlich nicht auf körperliche Dinge. Viele seiner Gedanken klingen wie ferne Echos des heiligen Paulus; und es ist in der Tat seltsam, dass dieser christlichste aller Kaiser nichts Gutes über die Christen zu sagen hat. Für ihn sind sie nur Sektierer, die „gewaltsam und leidenschaftlich auf Widerstand aus sind“.
Diese Meditationen sind sicherlich nicht tiefgründig wie Philosophie, aber Marcus Aurelius war zu aufrichtig, um nicht das Wesentliche der Dinge zu erkennen, die er selbst erlebt hatte. Die alten Religionen beschäftigten sich größtenteils mit äußerlichen Dingen. Man musste die erforderlichen Rituale durchführen, um die Götter zu besänftigen, und diese Rituale waren oft trivial, verstießen manchmal gegen das richtige Empfinden oder sogar gegen die Moral. Selbst wenn die Götter auf der Seite der Gerechtigkeit standen, ging es ihnen mehr um die Tat als um die Absicht. Marcus Aurelius weiß jedoch, dass der Mensch das tut, wovon sein Herz erfüllt ist. „So wie deine Gedanken und gewöhnlichen Überlegungen sind“, sagt er, „so wird mit der Zeit auch dein Geist sein.“ Und jede Seite des Buches zeigt uns, dass er wusste, dass Gedanken unweigerlich zu Handlungen führen. Er drillt seine Seele sozusagen in den richtigen Prinzipien, damit sie, wenn die Zeit gekommen ist, von ihnen geleitet werden kann. Zu warten, bis der Notfall eintritt, ist zu spät.
Er erkennt auch das wahre Wesen des Glücks. „Wenn Glück aus Vergnügen bestünde, wie käme es dann, dass berüchtigte Räuber, unreine, abscheuliche Lebenskünstler, Vatermörder und Tyrannen in so großem Maße ihren Anteil am Vergnügen haben?“ Er, der alle Vergnügungen der Welt zur Verfügung hatte, kann schreiben: „Ein glückliches Los und ein glücklicher Anteil sind gute Neigungen der Seele, gute Wünsche, gute Taten.“
Durch eine Ironie des Schicksals wurde dieser so sanfte und gute Mann, der sich nach stillen Freuden und einem sorgenfreien Geist sehnte, an die Spitze des Römischen Reiches gestellt, als große Gefahren aus dem Osten und Westen drohten. Mehrere Jahre lang befehligte er selbst seine Armeen als Oberbefehlshaber. Im Lager vor den Quaden datiert er das erste Buch seiner Meditationen und zeigt, wie er sich inmitten des rauen Lärms der Waffen in sich selbst zurückziehen konnte. Der Prunk und Ruhm, den er verachtete, gehörte ganz ihm; was für die meisten Menschen ein Ehrgeiz oder ein Traum ist, war für ihn eine Reihe mühsamer Aufgaben, die er nur mit strengem Pflichtbewusstsein bewältigen konnte. Und er leistete gute Arbeit. Seine Kriege waren langsam und mühsam, aber erfolgreich. Mit der Weisheit eines Staatsmannes sah er die Gefahr, die die barbarischen Horden aus dem Norden für Rom darstellten, voraus und ergriff Maßnahmen, um ihr zu begegnen. So wie es war, verschaffte seine Regelung dem Römischen Reich zwei Jahrhunderte Aufschub; hätte er seinen Plan, die Reichsgrenzen bis zur Elbe vorzustoßen, der ihm offenbar vorschwebte, verwirklicht, hätte noch viel mehr erreicht werden können. Aber der Tod machte seinen Plänen ein Ende.
Marcus Aurelius wurde wahrlich eine seltene Gelegenheit gegeben, zu zeigen, wozu der Geist trotz widriger Umstände fähig ist. Als friedlichster aller Krieger, als großartiger Monarch, dessen Ideal ein ruhiges Familienleben war, als in die Unbekanntheit gedrängter, doch zur Größe geborener Mann, als liebevoller Vater von Kindern, die jung starben oder sich als hasserfüllt erwiesen, war sein Leben ein einziges Paradoxon. Damit es ihm an nichts fehlte, starb er im Lager vor den Augen des Feindes und ging an seinen eigenen Ort.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der wichtigsten englischen Übersetzungen von Marcus Aurelius: (1) Von Meric Casaubon, 1634; (2) Jeremy Collier, 1701; (3) James Thomson, 1747; (4) R. Graves, 1792; (5) H. McCormac, 1844; (6) George Long, 1862; (7) G. H. Rendall, 1898; und (8) J. Jackson, 1906. Renans „Marc-Aurèle“ – in seiner „Geschichte der Ursprünge des Christentums“, die 1882 erschien – ist das wichtigste und originellste Buch, das es über die Zeit von Marcus Aurelius gibt. Paters „Marius der Epikureer“ bildet einen weiteren externen Kommentar, der bei dem fantasievollen Versuch, diese Zeit wieder zum Leben zu erwecken, hilfreich ist.