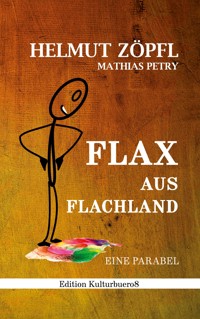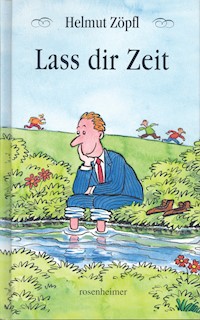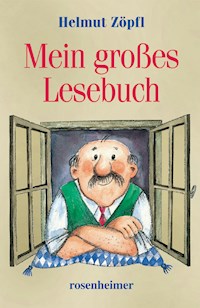
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warum gibt es Tage, an denen alles, aber auch wirklich alles schiefgeht? Wieso sollte man keinen Billig-Urlaub am Mittelmeer buchen? Und wie bringt man es fertig, dass man auch im vorgerückten Alter fit bleibt und gut aussieht? Oft sind es solche Fragen aus dem Alltag, die Helmut Zöpfl zu seinen lesenswerten Geschichten inspirieren. Sie glänzen durch ihren unverwechselbaren Humor und ihre ganz besondere Lebensweisheit. Wobei es gleich ist, ob die Akteure der altbekannte Münchner Rentner Alfons Igerl und seine Freunde sind oder sonstige Zeitgenossen wie du und ich. Dieser Band öffnet die Schatztruhe des beliebten Schriftstellers und vereint die besten von den kleinen Erzählungen und Gedankensplittern, die in vier Jahrzehnten entstanden sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dem lieben Stephan Müller zum 80. Geburtstag
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2008
© 2016 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelillustration: Traudl und Walter Reiner, Fischbachau
eISBN 978-3-475-54590-0 (epub)
Worum geht es im Buch?
Helmut Zöpfl
Mein großes Lesebuch
Warum gibt es Tage, an denen alles, aber auch wirklich alles schiefgeht? Wieso sollte man keinen Billig-Urlaub am Mittelmeer buchen? Und wie bringt man es fertig, dass man auch im vorgerückten Alter fit bleibt und gut aussieht?
Oft sind es solche Fragen aus dem Alltag, die Helmut Zöpfl zu seinen lesenswerten Geschichten inspirieren. Sie glänzen durch ihren unverwechselbaren Humor und ihre ganz besondere Lebensweisheit. Wobei es gleich ist, ob die Akteure der altbekannte Münchner Rentner Alfons Igerl und seine Freunde sind oder sonstige Zeitgenossen wie du und ich.
Dieser Band öffnet die Schatztruhe des beliebten Schriftstellers und vereint die besten von den kleinen Erzählungen und Gedankensplittern, die in vier Jahrzehnten entstanden sind.
Inhalt
Ein Lächeln schenkt Freude
Die Kur
Knapp verfehlt oder Igerl und das Double
Der Fußballfan
Geschichte ohne Pointe
Versteckte Kamera
Igerl und der Sittenstrenge
Die Geburtstagsfeier
Katharina entdeckt den Löwenzahn
Sportlich, sportlich!
Vergebliche Leibesmüh
Das Fitnessprogramm
Weltanschauungen
Falsche Idole
Der Kunstschuss
Der Ziegenkonflikt
Igerl und die Esoterik
Mille auf der Suche nach der Mitte
Kunst
Igerl und die Mundart
Wer den Kopf hängen lässt, sieht nicht viel
Eingeschaltet
Ein merkwürdiger Volksstamm
Das Kleine entdecken
Der kleine König und der Zufall
Von Vergangenheit und Zukunft
Nachholbedürfnis: Gegenwart
Mit Kanonen auf Spatzen schießen
Am Bach sitzen
Igerl und die Zeitverschiebung
Der kleine König beim Pädagogen
Meine Zeit im Gymnasium
Nichts mehr original
Nili und die Spinne Wabra
Heimat
Es ist halt, wie’s ist!
Igerl und der Pechvogel
Der Allergiker
Igerl und der Umweltschutz
Das kleine Krokodil Nili und die »anderen«
Igerl auf Reisen
Ausreden sind Gold wert
Igerl und die Beichte
Ein Tag, an dem fast alles schiefgeht
Wie man mit der Zeit geht
Der kleine König beim Zeitsparer
Igerl und der Liegestuhl
Spiele
Igerl und die Herkunft des Menschen
Spuren
Igerl und das Kunstwerk
Eine freundliche Welt
Andrea und die Zeit
Igerl und die Werbung
Die Weihnachtslesung
EIN LÄCHELN SCHENKT FREUDE
Die Kur
Der Alfons Igerl war es ja gewohnt, dass er wegen seines Wamperls, beziehungsweise seines Hendlfriedhofes alle Daumen lang irgendeine Stichelei ertragen musste. Davon war die, dass er jetzt bald mit dem Kugeln schneller vorankäme als mit dem Laufen, noch die harmloseste. Etwas betroffen wurde er allerdings, als er vor einiger Zeit auf eine Computerwaage stieg und aus dieser der Spruch erscholl: »Bitte immer nur eine Person.«
»Irgendwas muass i jetzt amal tun«, gestand er seinen Spezln bei seinem Stammtisch im Volkart-Eck selbstkritisch. »I hab allerweil gmeint, dass man ab zwanzge nimmer wachst, aber jetzt hab i festgstellt, dass bei mir wieder des Wachstum eingsetzt hat, aber nach vorn.«
Der Pflanzelt Maxe grinste boshaft und meinte: »Du, da weiß ich dir eine gute Adresse. Da hat vor kurzer Zeit neben mir ein Arzt seine Praxis eröffnet. Der könnt genau der Richtige für dich sein, sozusagen ein Spezialist, da steht nämlich ›Dr. med. vet.‹«
Nach einigen Überlegungen entschloss sich der Alfons schließlich, in eine Kur zu gehen. Auch wenn er von dem ehemaligen Trainer des FC Bayern, dem Tschik Cajkowski, vor kurzer Zeit den schönen Spruch gehört hatte: »In Kur ich habe gleich 20 Pfund abgenommen und seither bloß wieder 12 Kilo zugelegt.«
Ja und in dieser Kur beginnt nun eigentlich erst unsere Geschichte. Bisher war es sozusagen eigentlich nur eine Einleitung. Viel zu lang und zu wenig auf die Sache bezogen, hätte mein ehemaliger Deutschpauker wohl am Schluss dieser, meiner Geschichte geschrieben. Igerl lernte auf dieser Kur den Schriftsteller Ladislaus Anton Bätsch kennen, der, wie er stolz erzählte, schon mehrere Literaturpreise bekommen habe, unter anderem – wie er immer wieder beiläufig erklärte – den Bistumer Kutter, das goldene Elmshorner Horn, den Beilngrieser Juragriffel, den Burgwedeler Wedel sowie den Uelzener Lorbeerkranz. Der Alfons konnte sich lebhaft vorstellen, wie dieser Poeta laureatus ausgesehen haben mochte, als ihm dieser Preis auf sein Haupt gesetzt wurde, das weniger Haare aufwies, um mit Sigi Sommer zu sprechen, als eine Billardkugel oder ein Tischtennisball. Bätschs Spezialität waren, wie er immer sagte, die kleinen Aphorismen. Zwei-, Vier- und allenfalls Sechs- oder Achtzeiler. Wahrer Dichter ist eigentlich nur der, erklärte er dem Alfons Igerl, der es versteht, mit wenigen Worten, also im wahrsten Sinne des Wortes, dicht, das Wesentliche auszusagen. Da dies nur wenigen gegeben sei, fügte er hinzu, bin ich der Meinung, dass die meisten Dichter nicht ganz dicht sind, ha, ha, ha. Übrigens auch ein kleiner Ausspruch von mir, allerdings nicht in gereimter Form. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit zitierte er aus seiner Aphorismensammlung, die im Döbler-Verlag unter dem Titel herausgekommen war: »Was du nicht willst, dass man dir schreibt, das tu auch nicht aus Zeitvertreib.« Da gab es beispielsweise den Spruch: »Was du heut besorgen kannst, begreif es, eh du dich besannst.« Oder: »Des Glückes Missgunst drin besteht, dass sich der Fülle Last ergeht.« Da war aber auch noch der Spruch: »Die Dankbarkeit, das wisse wohl, stürzt oft das Volle, wenn es hohl.«
So ganz wollte es der Alfons natürlich nicht zugeben, dass er nicht alles von diesen Sprüchen verstand. Aber wenn jemand beispielsweise den Burgwedeler Wedel gewonnen hatte, dann wird sich die Jury schon etwas dabei gedacht haben, überlegte der Alfons. Er überlegte sich aber auch, was die Leute wohl sagen würden, wenn der Ladislaus Anton Bätsch einmal als Gastpoet bei einer Turmschreiber-Lesung am Podium sitzen würde. Und er erinnerte sich des boshaften Ausspruches, den er einmal vom Verlagsdirektor Förg gehört hatte: »Das Beste, was wir zur Verbreitung von dem seinen Werken tun können, war, dass wir Konfettis machen und sie unters Volk streuen.« Irgendwie imponierte ihm aber dennoch die selbstsichere Art des Ladislaus. Und eines Abends, als sie gerade bei der kargen Abmagerungskost, einem Löffel Topfen mit einem halben Radieserl, saßen, zu dem ein Gläschen so sauren Weines gereicht wurde, dass es einem fast die Zehennägel hochdrehte, verkündete Igerl dem Dichterfürsten: »Wissen S’, ich mach nämlich hin und wieder auch Gedichte. Allerdings«, meinte er, »nur für meinen Hausgebrauch und natürlich nicht so tiefgehende.«
»Ach, das ist ja interessant«, meinte Bätsch wohlwollend, »da müssen Sie mir aber einmal was zeigen.«
»Leider«, meinte Alfons Igerl, »hab ich nichts dabei.«
»Na, vielleicht«, meinte Bätsch, »können Sie etwas auswendig.«
»Nein«, entgegnete Alfons Igerl, »da hab ich mich in der Schul schon allweil schwer getan. Ich bin bei der Bürgschaft schon immer bei der zweiten oder dritten Zeile hängen geblieben. Aber schauen S’ her, ich hab da gestern gerade ein Gedichterl gemacht, das wo ich vielleicht am End von unserer Kur ins Gästebuch schreiben werde.« Und er las vor:
Koa Suppn, Vorspeis und dafür a Selterswasser statt am Bier, und wenn man statt dem Hauptgericht auf d’ Nachspeis und’s Dessert verzicht’, nimmt man, wie i erforscht hier hab, sogar beim schönsten Essen ab.
»Mhm«, meinte Bätsch wohlwollend, »mhm, Mundart, durchaus recht heiter. Nicht unbegabt, nicht unbegabt«, lobte er das Produkt.
»Passen Sie auf Igerl, ich mach Ihnen einen Vorschlag. Wir sind ja noch einige Tage hier, und übermorgen wird mich mein Verleger besuchen. Dem sollten Sie Ihre äh, Erzeugnisse, durchaus einmal vorlegen. Herr Döbler macht da vielleicht ein kleines Büchlein daraus.«
Das war natürlich eine gewaltige Aufmunterung für den Alfons Igerl.
Er rief sofort seine Zugehfrau, die Frau Rankl, an – die den Schlüssel für seine Wohnung hatte, um ihm seine Blumen zu gießen – und beauftragte sie, seine handgeschriebenen Gedichte, die in dem orangefarbenen Ringbuch auf seinem Schreibtisch lägen, per Eilboten herzuschicken. Die Frau Rankl war eine zuverlässige Person, und so erhielt Alfons Igerl am übernächsten Tag in der Früh per Eilboten seine gesammelten Opera, die er sofort mit dem Gedicht über das Essen bzw. Nichtessen ergänzte.
Tatsächlich besuchte am selben Abend der Verleger Döbler den Herrn Bätsch. Nach einiger Zeit und einem intensiven Gespräch rief Bätsch den Alfons Igerl herbei und stellte ihn dem Herrn Döbler vor. »Das ist der Herr Igerl, der so nette Mundartgedichte schreibt. Ich habe mich selber davon überzeugt. Wir machen eine Art Dichterwettbewerb, wenn es Ihnen recht ist, verehrter Herr Döbler. Ich lese Ihnen meine neuesten Opera vor, und dann können Sie auch das eine oder andere Gedichtchen von Herrn Igerl über sich ergehen äh … äh … auf sich einwirken lassen.« Bätsch las mit lyrischer Stimme:
Weil sich Gemeinsamkeiten im Trennenden berühren, wird man in welken Zeiten nicht nur Beliebtheit spüren.
Von seinen eigenen Zeilen ergriffen, schaute er Herrn Döbler gespannt in die Augen. »Moment, Herr Döbler, da hab ich noch eines:
Weil Krähen niemals virulent sich Augen selbst aushackten, drum gilt mein Kontra vehement auch allen Kontrafakten.«
»Moment einmal«, sagte er, »ich hab auch einige sehr zeitgemäße Themen aufgegriffen.« Und er las vor:
Beim Hauptverkehr sollt man auf Straßen nicht unbedingt noch Alphorn blasen.
Nun war Bätsch in seinem Element. Als dann Döbler schon auf die Uhr schaute, weil er ja seinen Zug noch erwischen wollte, hatte Alfons Igerl gerade noch Gelegenheit, ihm sein letztes Gedicht über das Essen vorzulesen. Er tat dies etwas aufgeregt, aber Herr Döbler schien sichtlich erheitert und meinte: »Geh, geben S’ mir doch einmal Ihre Gedichte mit, ich will sehen, was sich draus machen lässt.«
Ja, und jetzt stelle ich fest, dass ich eigentlich immer noch bei der Einleitung bin, denn da beginnt die eigentliche Geschichte erst. Oh je, hoffentlich fällt sie wirklich nicht meinem alten Lehrer in die Hand. Als Alfons Igerl seine Kur mit einem durchaus beachtlichen Gewichtsverlust von 9½ Kilo beendet hatte, fand er zu Hause einen Brief des Herrn Döbler vor, in dem er ihm schrieb: »Ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Bei der Rückfahrt habe ich bereits Ihre Gedichte gelesen und habe mich entschlossen, einen kleinen Band in meinem Verlag herauszubringen. Nach meinem Urlaub werden Sie wieder von mir hören.«
Igerl führte einen kleinen Freudentanz auf, was ihm durch den Gewichtsverlust der Kur wesentlich leichter fiel, als mit seinem Wamperl vor der Kur. Gespannt wartete er die Rückkunft des Herrn Döbler ab. Nun gibt es da einen Spruch von Werner Mitsch, der mir sehr gut gefällt: »Ereignisse, die er nicht begreift, nennt der Mensch Zufall.«
Man kann unterschiedlicher Meinung sein, ob das, was sich nun ereignete, Zufall, Glück oder auch Pech war. Vielleicht war es die Besinnung im Urlaub, vielleicht waren es aber auch irgendwelche anderen Dinge, die den Verleger Döbler dazu veranlassten, einen Plan, den er schon lange gehegt hatte, wahr zu machen und seinen Verlag seinem Sohn und seiner Tochter zu übertragen, sich aber selbst weitgehend nur mehr dem Ruhestand zu widmen. Dies ließ er in einem Brief auch den Alfons Igerl wissen, wobei er aber noch bemerkte, dass er die Gedichtsammlung Igerls seiner Tochter wärmstens ans Herz gelegt habe, da sie, wie er meinte, sehr gut in die Bavarica-Reihe seines Verlages passe. Als er zwei Monate nichts mehr hörte, entschloss sich Igerl, einmal einen Brief an den Döbler-Verlag zu schreiben und nachzufragen.
Die junge Frau, die sich aufgrund ihrer Ehe mit dem nicht mehr ganz taufrischen Junglyriker Sven Ruckdaschel nun Döbler-Ruckdaschel nannte, schrieb ihm nach einem Monat, dass er ihr nicht böse sein solle, der Umbruch des Verlages hätte aber so viel Arbeit gebracht, dass sie sich noch nicht intensiv aller Obliegenschaften widmen hätte können. Sie habe aber das Werk – Werk hatte sie in Anführungszeichen geschrieben, und Igerl wusste nicht, ob das positiv oder negativ zu werten sei – Igerls wohl gelesen, und ihr habe das eine und das andere ganz gut gefallen. Allerdings, schrieb sie weiter, denke sie, die Bavarica-Reihe des Verlages nicht fortzuführen und deshalb habe man sie bereits an den Deichgrafen-Verlag in Flensburg verkauft. Der Verlagstrend des Döbler-Verlages solle mehr in Richtung kritische Literatur gehen. Diesem Zweig würde sich besonders ihr Mann intensiv widmen, der ja eine anerkannte Kapazität sei. Sie stelle nun, schrieb Frau Döbler-Ruckdaschel weiter, Alfons Igerl frei, ob sie sein Heftchen gleich zur Begutachtung nach Flensburg schicken solle oder aber, und das sei ein besonderes Angebot, das sie ihm machen würde, schon ihrem lieben Vater zuliebe, der ihr die Verse besonders warm ans Herz gelegt habe, man könnte aus den Igerlschen Gedichten vielleicht etwas ganz Besonderes machen, das sie dann in ihr Verlagsprogramm übernehmen würde. Selbstverständlich müsse er dann zunächst einmal seine Gedichte in eine gut hochdeutsche Form bringen mit eventuellen Änderungen, über die man ihn aber gut beraten würde. Sie verwies wieder auf ihren Mann Sven Ruckdaschel, dem sie, das Einverständnis Igerls vorausgesetzt, die Igerlsche Literatur zur Reflexion überlassen werde. Vertrauen Sie sich meinem Mann an, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, beendete Frau Döbler-Ruckdaschel den Brief, mein Mann hat schon einigen Autoren zu Literaturpreisen verholfen. Igerl entschied sich spontan für die zweite Lösung und sagte sich, lieber einen Buchpreis für ein schriftdeutsches Buch in Bayern, als ein bayerisches Buch in Preißn.
Alfons teilte also seinen Entschluss dem Verlag mit, und prompt bekam er ein paar Wochen später ein Schreiben – diesmal schon von Herrn Ruckdaschel, der ihm mitteilte, er wolle sich ganz gern mit Herrn Igerl im Hinblick auf das neue Buch zu einem Arbeitsessen treffen. Igerl sollte ihm einen geeigneten Platz vorschlagen.
Das tat der Alfons, und so trafen sie sich an einem Freitagmittag im Volkart-Eck.
»Also«, begann Ruckdaschel nach den üblichen Begrüßungs- und Höflichkeitsfloskeln, »ich hab mir Ihre Gedichte gut durchgesehen. Ich glaube, da ist einiges drin. Allerdings muss ich Ihnen sagen, für eine Herausgabe wirklich empfehlenswert scheint mir nur jenes letzte Gedicht, das Sie über das Essen geschrieben haben.«
»Ja«, meinte Alfons Igerl, »aber gibt denn dieses eine Gedicht einen ganzen Band her?«
»Wenn wir es richtig anstellen«, erklärte Sven Ruckdaschel, »selbstverständlich. Ich werde Ihnen schon entsprechend zur Hand gehen. Passen Sie auf, Herr Igerl. Wenn Sie einen Blick auf die virulente Literatur, ich meine jetzt wirklich Literatur, die etwas zu sagen hat, lenken, werden Sie merken, dass die kritische, ich will aber auch sagen, problemhaltige Literatur den Markt beherrscht. Bücher ohne Probleme haben sozusagen heute Probleme, ha, ha, ha – Und sehen Sie Herr Igerl, mit Ihrem letzten Gedicht haben Sie schon eigentlich einen Problemhorizont aufgerissen, wenn er auch noch nicht das Zentrum trifft. Wir wissen ja alle, dass heute das Ernährungsproblem, Unterernährung, Hunger in der Welt usw. eines der größten Probleme aller Zeiten ist. Und da meine ich, sollten Sie mit Ihrem Werk zuschlagen.«
»Sie meinen also«, fragte Igerl, »ich soll ein Gedicht oder mehrere Gedichte oder ein ganz großes Gedicht über den Hunger in der Welt schreiben?«
»Ja und nein«, meinte Ruckdaschel. »Sagen Sie, Herr Igerl, haben Sie es eigentlich schon einmal mit Prosa versucht?«
»Mit was, ah so mit Prosa«, fragte Igerl. »Ja mei, Ansprachen hab ich schon einmal ein paar halten müssen, die wo sich dann nicht gereimt haben. Wissen Sie, ich bin nämlich Kassier beim Kleingartenverein Flora, und da trifft einen schon hin und wieder einmal irgendeine Pflicht, und wenn’s ein Kassenbericht ist.«
»Na also, da sehen Sie«, rief Ruckdaschel, »da sind Sie ja schon voll in der Übung. Beschreiben Sie doch einfach einmal, was sich bei uns auf den Partys so alles abspielt. Machen Sie sich so Ihre Gedanken über Ausbeutung, über politische Ungerechtigkeit usw., und dann werden wir schon weitersehen.«
So ganz abgeneigt dem Essen gegenüber schien Herr Sven Ruckdaschel allerdings nicht zu sein, denn er bestellte das teuerste Gericht, das es im Volkart-Eck gab, ein Wildgericht mit Reherln, dazu trank er drei Schoppen des teuersten Weines, der auf der Karte stand. Und als es dann ans Zahlen ging, schaute Ruckdaschel plötzlich entsetzt auf die Uhr und rief: »Also Herr Igerl, alles klar, ich muss mich beeilen, ich versäume sonst noch meinen Zug. Näheres machen wir dann schriftlich, alles klar.« Und schon war er draußen.
Nachdem Igerl alles bezahlt hatte, überlegte er noch bei einer halben Dunklen, wie hat der des jetzt bloß gmeint, mit dem Essen und dem Hunger und der Kritik. Mei, irgendwas wird mir schon einfallen, dachte er sich. Als die Kellnerin Anita vorbeikam und fragte: »Habn wir noch an Wunsch, Herr Igerl?«, fragte er sie gleich, ob sie nicht eine nette Geschichte oder einen Witz wüsste, worin etwas vom Essen vorkäme.
»Oh mei, Herr Igerl, da gibt es eine ganze Menge Witze«, meinte sie, »beispielsweise von dem Lokal, das grad aufgmacht hat. Wie dann der erste Gast gegangen ist, hat der neue Besitzer die Bedienung gefragt: Na, was hat denn unser Gast gsagt? Und die Bedienung meint: Mei, er hat gschimpft, dass des Essen a Katastrophe wäre, und wenn die Portionen net so klein wären, dann müsste er jetzt sicher glei ins Krankenhaus, um sich den Magen auspumpen zu lassen. Der Wein wäre völlig ungenießbar, die Bedienung so ungeschickt, dass man ihm seinen Anzug voll geschüttet habe, außerdem noch unfreundlich, und die Preise wären schlechterdings eine Unverschämtheit. Ja, meint der Besitzer auf den Bericht hin, wenn er sonst zufrieden war. Oder kennen S’ den von dem anderen Restaurant, wo der Gast zu der Bedienung gsagt hat: Sie, ich möcht bittschön nachbestellen. Wenn des da, was’ mir grad serviert habn, Kaffee war, dann bringen S’ mir bittschön jetzt einen Tee, wenn’s aber ein Tee gewesen sein sollte, dann bringen S’ mir an Kaffee. Wenn’s aber a Suppn gwesn is, dann sagen S’ mir bittschön des Rezept. Denn i hab demnächst eine Einladung bei uns, da möcht ich mich an ein paar Leutn rächn. Dann gibts doch da noch die etwas unappetitliche Geschichte mit dem Ober. Kennen S’ die? Der Kellner serviert die Suppe und hält dabei seinen Daumen voll hinein. Da beschwert sich der Gast. Sie, Sie halten ja Ihren Daumen in meine Suppe. Da entschuldigt sich der Ober und sagt: Des is wegen meinem Rheuma, wissen Sie, die Wärme tut meinem Daumen gut. Da wird der Gast bös und sagt: Sie, Ihr Rheuma interessiert mich überhaupt nicht, stecken Sie sich von mir aus Ihren Finger in den Hintern! Da antwortet der Kellner: Ja mei, des hab ich ja bis jetzt gmacht, aber die Suppe tut mir sicher besser.«
Ganz ohne Frage hatte da Igerl in ein Wespennest gestochen, und während er sich noch eine Halbe von dem guten Dunklen genehmigte, erzählte die Anita munter drauf los. Igerl machte sich nebenbei ein paar Notizen und trat dann endlich seinen Nachhauseweg an. Wie es der Zufall wollte, prangte ihm eine Knallüberschrift auf einer Münchner Boulevardzeitung entgegen, in der ein Bericht darüber stand, dass ein bekanntes Restaurant aufgrund von Beanstandungen der Gesundheitsbehörde habe schließen müssen. Igerl kaufte sich das Blatt, und nach einem ausgiebigen Mittagsschläfchen machte er sich daran, eine Geschichte zu schreiben, in der es um ein solches Lokal ging, wo es eben hint’ und vorn nicht stimmte und die Gäste übers Ohr gehauen wurden. Die Witze, die ihm die Anita erzählt hatte, brachte er teilweise auch unter. Nach ein paar Tagen hatte er tatsächlich eine Geschichte geschrieben, deren besondere Pointe darin bestand, dass die Frau Schlotterbeck ihrem Mann vorschwärmt: Du weißt doch, ich habe mich heute mit der Frau von Wexenstiel getroffen, und die hat mich in ein Super-Restaurant eingeladen. Ich kann dir nur sagen, da hat alles gestimmt. Exquisit, bestimmt fünf Sterne. Da müssen wir unbedingt auch einmal hingehen, wenn wir uns ein bisschen Geld gespart haben. Ja, ja, meint der Schlotterbeck, es gibt halt solche und solche Restaurants. Stell dir vor, heut Nachmittag haben wir eins inspizieren müssen, du kannst dir gar nicht vorstellen, was da alles los war. Wir haben’s sofort schließen lassen. Und dann stellt sich heraus, dass das, wo die Frau Schlotterbeck gegessen hat, und das, was der Schlotterbeck hat schließen lassen, dasselbe war. Igerl tippte diese Geschichte fein säuberlich auf seiner alten Adler-Schreibmaschine ab und schickte sie dem Herrn Ruckdaschel. Der reagierte auch prompt nach 14 Tagen und lud Igerl erneut zu einem Arbeitsessen ein.
»Bravo, Igerl«, begrüßte er ihn überschwänglich, »ich seh schon, Sie haben eine Menge dazugelernt. In Ihnen steckt tatsächlich eine literarische Potenz. Aus den Potenzen lässt sich sicher einiges machen.« Und nun redete er auf Alfons Igerl wie auf ein krankes Ross ein, dass diese Geschichte natürlich noch lange kein Buch ergäbe und dass es ganz entscheidend sei, dass er halt mehr Kritik einbrächte. »Ja, ich hab doch so viel Kritisches hineingeschrieben«, entschuldigte sich Igerl, »des mit dem schlechten Essen und dass die Gäste über’s Ohr ghaut werden und dass die Leute bei uns halt immer wieder recht unkritisch auf solch einen Blödsinn hineinfallen usw.«
»Ja«, meinte Ruckdaschel, »aber die Kritik, da meine ich etwas anderes. Kritik ist Gesellschaftskritik. Sie müssen das immer in größeren Gesamtzusammenhängen sehen. Der Besitzer des Lokals, Stangerl, wie Sie ihn genannt haben, steht doch nicht losgelöst in unserer Gesellschaftsstruktur. Ich würde Ihnen im Übrigen raten, hier einen anderen Namen einzuführen als den Namen Stangerl. Bringen Sie doch etwas mehr von unseren Ungerechtigkeiten in unserem System hinein. Stangerl, oder wie immer Sie ihn nennen wollen, ist doch lediglich ein Handlanger. Im Endeffekt ein kleiner Fisch. Da muss es doch um ganz etwas anderes gehen als um ein, na sagen wir einmal, ein unsauberes Lokal. Seien Sie mir nicht bös, Igerl, mit einem Haar in der Suppe oder einer Fliege oder einem Ober, wie Sie ihn schildern, der sich beim Servieren der Suppe nicht gerade appetitlich verhält, Sie sehen, Herr Igerl, ich habe Ihre Geschichte sehr genau studiert, mit so etwas lockt man doch keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Das ist heutzutage nicht einmal mehr ein Skandälchen. Wir wollen aber einen Skandal, wir wollen Kritik. Sie müssen Tabus brechen, Igerl, Tabus, ich sage Ihnen ja, schauen Sie sich die moderne Literatur, schauen Sie sich das moderne Theater an. Da geschehen auf der Bühne Dinge, die geradezu unerhört sind, die schockieren. Schocken Sie, Igerl, enttabuisieren Sie. Klagen Sie an, greifen Sie ruhig auch einige unserer Politiker an, vielleicht machen Sie so etwas wie einen Schlüsselroman daraus. Das Zeug dazu, Igerl, haben Sie, ich sage es Ihnen. Und dann schlagen wir zu. Im Übrigen, nur zu Ihrer Ermunterung, wir haben im nächsten Jahr das erste Mal von unserem Verlag einen Buchpreis für den erfolgreichsten Roman ausgesetzt, den Fürstenzeller Bamhacklpreis. Mit einer Hacke sollen Sie hineinschlagen, mit einer Hacke, verstehen Sie, Igerl. Nehmen Sie sich ruhig, sagen wir mal, einfach nochmals diese Gestalt des Obers vor, den Sie so meisterlich beschrieben haben. Sie wissen ja, den Mann, der die Suppe serviert und der wegen seines Rheumas den Daumen in der Suppe hat. Ich könnte mir vorstellen, das könnte so eine Art Schlüsselfigur in einem Roman werden, in dem es mehr um innen – und außen –, ja um weltpolitische Dinge geht. Lassen Sie die Drähte ruhig in diesem Lokal zusammenlaufen. Ein wenig Spionage ist natürlich immer gut. Sie wissen ja, welche Erfolge Simmel mit seinen Romanen hat. Denken Sie beispielsweise an ›Und Jimmy ging zum Regenbogen‹ usw., usf. … Mein Gott, Igerl, es wird Ihnen schon etwas einfallen.« Ruckdaschel blickte schon wieder nervös auf die Uhr und meinte: »Oh je, oh je, die Zeit«, und schon rannte er wieder, ohne gezahlt zu haben, davon. Er ließ einen völlig verwirrten Alfons Igerl zurück.
»Ja, was ist denn mit Ihnen heute?«, fragte die Anita den Alfons, als sie zum Abkassieren kam. »Oh mei, Anita«, meinte der und wackelte mit dem Kopf, »tät Ihnen da was einfallen mit einem Essenslokal, da wo’s um Spionage und Abhörgeräte geht?«
»Hörgeräte«, meinte die Anita, »da kann i Ihnen schon weiterhelfen. Passen S’ auf, da ist ein Gast völlig außer Rand und Band und schimpft: ›Das ist ja ekelhaft, was da in meiner Suppe liegt, das scheint ja ein völlig verdrecktes Hörgerät zu sein.‹ Da beugt sich der Kellner nach vorne und fragt: ›Was haben der Herr gesagt?‹«
In seinem desolaten Zustand verzichtete Igerl darauf, der Anita den Unterschied zwischen einem Hör- und einem Abhörgerät klarzumachen und verließ kopfschüttelnd das Lokal. Auf seinem Nachhauseweg begegnete ihm sein alter Spezi, der Pflanzelt Maxe. »Ja, was is’ denn mit dir los?«, fragte der ihn, »du schaust ja trübsinniger drein wie ein Uhu nach dem dritten Waldbrand. Geh weiter, jetzt kehrn mir noch einmal um und gehn noch einmal ins Volkart-Eck, und dann erzählst mir bei einer Halben, was los is’.«
Der Igerl erzählte dem Maxe die ganze Geschichte von vorn, und der meinte am Ende des Ganzen lapidar: »Ja und, schreib halt was.«
»Ja, du bist gut«, meinte der Alfons, »schreib halt was, i hab mich ja so schon fast leer gschriebn.«
»Pass auf, jetzt machst nix anders, Alfons, als wie dass d’ dir einmal a paar Wochen lang die ganzen Skandalblätter bsorgst und du dir die ganzen Gschichten über alle möglichen Leut sammelst. Über irgendwelche Leut aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft usw. usf. Des müsst doch mit ’m Teifel zugehn, wenns d’ da net eine Gschicht drum rum schreibn tätst.«
So aufgemuntert, folgte Alfons in den nächsten Wochen tatsächlich dem Rat des Pflanzelt Maxe. Und bei irgendeinem Stammtisch im Volkart-Eck, wo er am Nebentisch zwei etwas merkwürdige Gestalten, die sich flüsternd miteinander unterhielten, beobachtete, wie sie sich irgendwas zuzuschieben schienen, kam ihm plötzlich die Idee. Und ähnlich jenem griechischen Mathematiker Archimedes, der damals ›Heureka‹ gerufen hatte, rief der Alfons plötzlich: »I hab’s.« Möglicherweise gar keine so schlechte Übersetzung dieses Wortes Heureka, und rannte, ohne seine zwei Halbe bezahlt zu haben, nach Hause. Alfons Igerl wurde einige Tage nicht mehr gesehen. Er hatte sich darangemacht, mit dem ihm zur Verfügung stehenden Material einen Roman zu schreiben. Den baute er ganz geschickt auf: Ein harmloser Rentner namens Magerl (selbstverständlich identifizierte sich Igerl mit ihm) beobachtet und belauscht beim Essen zwei Männer, die sich geheimnisvolle Worte zuflüstern und seltsame Gebärden machen. Magerl schnappt ein paar verdächtige Worte auf und bringt sie mit einem Verbrechen, das sich kurz darauf ereignet, in Verbindung. Im Verlauf des Romanes kommt es zu allen möglichen Enthüllungen über gesellschaftliche und wirtschaftliche Zustände. Magerl deckt schließlich ein Kapitalverbrechen auf, in das Zeitgenossen verstrickt sind. Den Schlüssel zur Aufdeckung der ganzen Tat aber findet Magerl in dem Lokal, in dem er das erste Mal diese beiden Männer beobachtet hat. Er findet nämlich auf der Speisekarte wie weiland bei Agatha Christie, in der Geschichte von den zehn kleinen Negerlein, den Code, der alles offenbart. Auf der Speisekarte steht nämlich der schöne Werbespruch:
Hast Du in dem Lokal gespeist, dann bin ich sicher, dass Du weißt, nichts kann Dir jetzt mehr Deinen Glauben ans wirklich Gute in Dir rauben.
Keine Frage, dass in dem Roman von Igerl Spionage, Rauschgift usw. auch eine bedeutende Rolle spielten und natürlich, wie ihm Ruckdaschel geraten hatte, auch diverse Perversitäten unserer Gesellschaft. Igerl schrieb in einer so offenen Sprache, dass er selbst fast darüber errötete. Nach ein paar Wochen war es dann soweit. Er hatte etwa 400 Seiten eines Romanes fertig, den er gemäß der langen Mario-Simmel-Titel mit der Überschrift versah: »Es muss nicht immer Beuscherl sein.« Igerl schickte seinen Roman per Einschreiben an den Döbler-Verlag und wartete gespannt der Dinge, die da kommen würden. Im Geiste sah er sich bereits mit dem Waldschratpreis geschmückt. Die Antwort dauerte und dauerte. Nach 3 Monaten kam endlich ein Brief. Darin stand Folgendes:
Lieber Herr Igerl!
Sicher erinnern Sie sich noch an unsere Bekanntschaft. Ich freue mich, dass wir auf Umwegen wieder zusammengetroffen sind.
Der Döbler-Verlag ist leider in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Da ich in letzter Zeit einiges Glück hatte und sich ein großer Konzern für meine Vierzeiler als Werbung interessierte, habe ich, zudem der Verlag bei mir außerdem noch einiges ausstehen hatte, zugegriffen und den Verlag aufgekauft.
Da finde ich nun, lieber Herr Igerl, Ihren Roman vor. Ich erachte ihn als recht interessant und meine auch, dass da einiges drinsteckt. Aber wie schon das Wort drinsteckt ausdrückt, erinnern Sie sich noch an unser Gespräch: Das Wesentliche muss man sagen.
Sie sehen das an meinem derzeitigen Erfolg. So habe ich nun, Ihr Einverständnis voraussetzend, Folgendes gemacht: Ich habe die Kernaussage dieses Romans herausgenommen und sie bei dem großen Ausschreiben eines Nobelrestaurants eingeschickt.
Lieber, verehrter Herr Igerl, heute kann ich Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, Sie haben mit Ihrem Vierzeiler den ersten Preis gewonnen: Hast Du in dem Lokal gespeist ...
Sie haben einen 14-tägigen Wellness-Urlaub in dem großartigen »Thermen-Vital-Hotel Am Mühlbach« in Bad Füssing gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und auf baldiges Wiedersehen. Vielleicht bei einer gemeinsamen Abmagerungskur.
Ihr Ladislaus Anton Bätsch.
Knapp verfehlt oder Igerl und das Double
Da saßen sie wieder einmal an ihrem Stammtisch im »Volkart-Eck«.
Der Pfanzelt Maxe war gerade dabei, einen Witz zu erzählen: »Also, da kommt ein Hund aufs Arbeitsamt und fragt, ob man ihm nicht eine Stellung vermitteln könnte. Der Angestellte schaut ihn ganz erstaunt an und meint: ›Ja, so was, des hab i auch noch net gsehn, aber bei ei’m solchen Talent‹, meint er, ›da dürftens doch gar keine Schwierigkeiten habn, dass in ei’m Zirkus angestellt werdn.‹
›In ei’m Zirkus‹, meint der Hund, ›des glaub i net. In ei’m Zirkus, da brauchens doch keine Informatiker.« – Der Beifall für den Witz hielt sich in Grenzen.
»Aber, kennts ihr den«, meinte der Alfons Igerl, »da hat der Direktor von ei’m Internat zu den Buabn gsagt, ›passts bloß auf, wenn i ei’n von euch einmal im Schlafsaal bei den Madln derwisch, dann gibts eine saftige Straf. Beim ersten Mal zahlts 10 Euro, beim zweiten Mal 20 Euro, und den, den wo i zum drittn Mal derwisch, der zahlt sogar 40 Euro. – Alles klar?‹, hat der Direktor gfragt. ›Na, bittschön‹, hat sich einer gemeldet, ›was kostet das Jahresabonnement?‹«
Jetzt fühlte sich auch der Hirschvogel Ludwig berufen, einen kleinen Beitrag zu leisten. Er holte sein Heftchen heraus, was vom Pfanzelt Maxe mit einem boshaften, leisen »Auweh« quittiert wurde, und las vor: »Spruch der Woche 328«:
Reicht es, so fragt man manchmal sich, dem Menschen zur Erbauung, wenns Innenleben sich beschränkt allein auf die Verdauung?
Die Stammtischler ließen ein verlegenes, hüstelndes Lachen hören. Das war aber dem Hirschvogel zu wenig und er meinte: »Jede Woch les ich euch jetzt was am Stammtisch vor und ihr habts mir noch nie gsagt, was ihr von meiner schriftstellerischen Begabung haltet. Ihr könnts mir nämlich die Entscheidung schon a bissl leichter machen.«
»Welche Entscheidung?«, wollte der Alfons Igerl wissen. »Ja, ob ich jetzt Maler oder Schriftsteller werden soll?«
»Eindeutig Maler!«, rief der Pfanzelt Maxe, »auf alle Fälle Maler!«
»Wieso?«, fragte der Ludwig zurück. »Ihr habts doch noch gar keine Bilder von mir gsehn.«
»Bilder habn mir von dir no net gesehn«, lachte der Pfanzelt Maxe, »aber deine schriftstellerischen Ergüsse kennen mir.«
Der Ludwig schaute beleidigt. »Es is doch net so gmeint«, tröstete der Alfons Igerl, »du kennst doch an Maxe mit seine dummen Sprüch.« Dann schaute Igerl ihn lange sinnierend an und meinte: »Sagts einmal, Leut, ist euch noch nix aufgfalln, wenns den Ludwig so anschauts?« Alle Blicke richteten sich jetzt auf den Hirschvogel. Als Erstes äußerte sich der Scherm Maxi: »Ich glaub, er hat eine neue Krawattn an, der Ludwig.«
Der Pfanzelt Maxe konnte sich natürlich eine boshafte Bemerkung nicht verkneifen und meinte: »Meints ihr vielleicht den Unterschied zwischen dem Ludwig heut und dem Ludwig früher? Früher war der Ludwig jung und schön, jetzt is er bloß noch ›und‹.«
»Schmarrn«, meinte der Igerl, »schauts halt genauer hin.«
Aber auch bei sorgfältigster Betrachtung kam den Stammtischspezln keine Idee, was denn an dem Ludwig, der dasaß und schaute wie ein Schwaiberl, so besonders sein sollte. »Sagts einmal«, meinte jetzt der Alfons, »schauts ihr eigentlich nie fern? Habts ihr noch nie den zur Zeit erfolgreichsten deutschen Humoristen gsehn, den Didi?«
»Welchen Didi?«, wollte der Ludwig wissen.
»Net den, was du als kleiner Bua alleweil im Mund ghabt hast«, lachte der Pfanzelt Maxe, »sondern den Didi Hallervorden. Der is wirklich total in mit seine Witz und seine Sketche und Szenen.« Er schaute nun auch nachdenklich den Hirschvogel an. Nach einiger Zeit nickte er mit dem Kopf. »Stimmt«, sagte er, »des is mir fei noch nie aufgfallen. Fast wie aus dem Gsicht gschnittn.«
Die anderen schauten nun auch ganz erstaunt und einer nach dem anderen meinte: »Stimmt, zum Verwechseln ähnlich!«
Der Ludwig Hirschvogel wusste nicht, ob er das als ein Lob oder als eine neue Spitze seiner Spezln, insbesondere des Pfanzelt Maxe, deuten sollte, und wackelte zunächst einmal mit dem Kopf.
»Du, da kannst fei eine Menge Geld verdienen als Double«, meinte der Pfanzelt Maxe nach einiger Zeit. »Aber da müsstest dir fei schon ganz andere Witz ausdenkn als wie die, die wo d’ da in dei’m Bücherl hast. Ich könnt dir ja einmal einen Privatunterricht gebn«, lachte er, »was zahlst freiwillig?«
»Dir, für d’ Nachhilfe?«, meinte der Hirschvogel Ludwig, »allenfalls für d’ Stund 58 Minuten, und 2 Minuten für d’ Krankenkasse.«
»Sehr gut«, lobte ihn der Pfanzelt Maxe, »jetzt wirst allmählich witzig. Aber eins sag i dir, wennst einmal Karriere machst, denkst an uns, mir habn dich entdeckt!«
Ob man es glaubt oder nicht, dieser Abend war tatsächlich der Beginn einer ganz neuen Laufbahn für den Ludwig Hirschvogel. Der Ludwig kaufte sich jetzt ein Witzbuch nach dem anderen, besorgte sich die neuesten Witzzeitschriften, hörte jede Sendung vom »Gaudimax« und machte sich fleißig Notizen. Es kam ihm sogar ein seltener Zufall zu Hilfe. In der Laimer Stadtteilwoche wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben: »Wir suchen Doubles von Prominenten.« Der Ludwig meldete sich als Didi Hallervorden. Zu seinem Erstaunen bemerkte er, dass noch mehr dem Didi gleichsehen wollten, und so gab es eine Ausscheidung.
Im Stechen musste der Ludwig gegen einen gewissen Jaroslav Petrovic antreten, der folgenden Witz erzählte: »Woran merkst du, dass du Übergewicht hast? Wenn du am Strand liegst, ein Greenpeace-Team kommt und versucht dich ins Meer zu ziehen.« Hirschvogel konterte mit folgendem Witz: »Ein Wiener bekommt ein Angebot, in Deutschland eine Vertretung zu übernehmen. Man rät ihm, er solle einen Intensivkurs in Hochdeutsch machen. Das tut er auch und bereitet sich 4 Wochen auf seine neue Arbeit vor. Nach 4 Wochen bekommt er ein Diplom mit ›Hervorragend bestanden‹ überreicht. Er fährt nach München und geht in einen Laden. ›Geben Sie mir…‹, spricht er in lupenreinem Hochdeutsch, ›bitte 2 Paar Weißwürste und 2 Brezen‹. Die Verkäuferin schaut ihn groß an und sagt: ›Gell, Sie sind ein Österreicher?‹ Der ist noch erstaunter über diese Frage und meint: ›Sagen Sie, wie haben Sie denn das gemerkt?‹ Meint die: ›Wissen S’, Sie sind in ei’m Blumenladen‹.« Mit diesem Witz gewann der Hirschvogel das Stechen. Und wie das manchmal so ist, bald wurden einige Veranstalter auf ihn aufmerksam, und er durfte bei verschiedenen Gelegenheiten als der »andere Didi Hallervorden« auftreten.
So saßen sie also wieder mal beim Stammtisch und erzählten die neuesten Witze.
»Also«, begann der Pfanzelt Maxe, »da sagt der Arzt zu dem dicken Huber Max: ›Sie, schön langsam wird’s bei Ihnen fei gfährlich, mit dem Übergwicht.‹ – ›Mei‹, meint der, ›was soll i denn tun, i hab doch schon alles probiert.‹ – ›Des is gar net schwer‹, sagt der Doktor. ›30 kg können S’ spielend abnehmen, wenns 300 Tag lang jeden Tag 5 km laufn.‹ Nach 300 Tagen ruft der Huber Max seinen Doktor an und sagt ihm: ›Sie werdn’s net glaubn, Herr Doktor, grad hab i mi’ gwogn. I hab tatsächlich bis auf l g genau 30 kg abgnomma.‹
›Bravo‹, sagt da Doktor, ›des is ja wunderbar.‹
›Ja, net so wunderbar‹, meint der Huber Maxe, ›i hab da ein Riesenproblem, i weiß nämlich net, wie i wieder heimkommen soll. Denn i bin jetzt genau 1500 Kilometer von daheim weg.‹«
Der Hirschvogel hörte bei den Witzen eifrig zu und machte sich seine Notizen. »Geh weiter, Ludwig«, ermunterte ihn der Pfanzelt Maxe, »erzähl doch du auch einen. Du bist ja jetzt Profi.«
»Ja, ja«, sagte der Ludwig, »grad deswegn, jetzt hab ich’s nimmer notwendig, dass i mir eure saublödn Bemerkungen über meine Witze anhörn muss. Außerdem, ihr bei euren langen Leitungen kapierts es ja sowieso net.«
»Höh, ihn schau an!«, schimpfte der Alfons Igerl, »wie redst du mit dei’m Entdecker? Aber jetzt im Ernst, i hab dich neulich ghört, du bist fei tatsächlich riesig wordn, Ludwig. Allen Respekt, muss i sagn. Des hätt i dir nie zutraut. Weißt was, i gib dir den Rat, hör endlich einmal auf, im Schatten von diesem Didi zu stehn, du bist doch selber wer. Solang du den Didi nachmachst, spielst immer die 2. oder 3. Geige. Du musst du sei, Ich-Identität gewinnen, wie man heut so schön sagt.«
»Ja«, meinte der Pfanzelt Maxe, »da hat er eigentlich recht. I weiß des nämlich von meiner Cousine. Die hat eine wunderschöne Stimme, und alle Leut habn immer zu ihr gsagt, sie tät genauso singen wie die Nicole, und dann hat s’ auf Nicole gmacht und auch beachtliche Erfolge erzielt, aber im Grunde genommen is doch nix Bsonders aus ihr wordn, weil jeder gmeint hat, die Nicole wär doch besser. Du kannst als Double noch so gut sein, du wirst aber immer an dem gmessen, den wo du nachmachst. Da sagn die Leut immer, das Original is besser. Wie wärs denn? Du bist doch jetzt selber ein Original wordn, wennst du ein bissl dein Image veränderst, dir vielleicht an Schnurrbart wachsen lässt, oder aber eine andere Frisur machn lässt?«
Der Hirschvogel murmelte: »Geh weiter, des schaff i doch nie.«
Aber offensichtlich hatte die Idee vom Pfanzelt Maxe auf ihn doch nachhaltig gewirkt. Jedenfalls erschien er erst wieder nach ein paar Wochen am Stammtisch und veranlasste seine Spezln zu einem einstimmigen: »Ja, sag einmal, wie schaust denn du aus?« Der Ludwig hatte es tatsächlich geschafft, sich ein völlig neues Image zu geben. So nebenbei erzählte er seinen Freunden, dass er sich jetzt nicht mehr Ludwig Hirschvogel nannte, sondern Lu Hirsch-Vogel. »Und für was soll denn das gut sein?«, fragte der Pfanzelt Maxe boshaft, bekam aber keine Antwort auf diese Frage.
Im Laufe der nächsten Monate schaffte es der Lu, wie er sich jetzt nannte, tatsächlich nicht mehr als Double, sondern als Original, immer bekannter zu werden. Er bekam zunächst in einem kleinen Privatsender sogar eine eigene heitere Sendung »Lustig mit Lu«.
Und wie das so ist, wenn man einmal den Fuß ein wenig in die Türe gebracht hat, dann geht sie immer weiter auf. Weil offensichtlich gerade in unserer Zeit ein eindeutiger Überhang von Trübsalbläsern gegenüber den Heiteren und Zünftigen besteht, sprach es sich bald herum, dass man mit dem Lu ein recht breites Publikum ansprechen könne. Er setzte sich sogar mit einer Agentur in Verbindung, und der Leiter derselben, ein gewisser Bernd Seelos, hatte seine helle Freude mit dem Hirsch-Vogel.
So kam es, dass der Name Lu Hirsch-Vogel in recht kurzer Zeit zu einem durchaus bekannten Qualitätsbegriff wurde. Selbstverständlich waren natürlich jetzt aufgrund seiner diversen Fernsehauftritte die Stammtischbesuche seltener geworden, aber ganz vergaß er seine Spezln nicht, denen er ja, das betonte er immer wieder, doch einiges verdankte. Als er eines Tages wieder einmal im »Volkart-Eck» aufkreuzte, begrüßte ihn der Pfanzelt Maxe mit einem: »Respekt, Ludwig – entschuldige, Lu, du bist ja inzwischen net wenig in.«
»Wieso?«, meinte der.
»Ja, da schau her, was i da glesen hab«, sagte der Pfanzelt Maxe und zog den Neuhauser Anzeiger aus der Tasche. »Schau her, da steht eine Anzeige: ›Wir suchen den zweiten Lu Hirsch-Vogel. Wer kommt unserem Münchner Original Lu Hirsch-Vogel am nächsten? Dem Sieger winkt ein kleiner Sportwagen‹.«
Der Lu konnte es gar nicht glauben, dass man inzwischen schon ein Double für ihn suchen wolle. Stolz erzählte er an dem Abend seinen neuesten Witz: »Da kommt doch ein Norddeutscher nach Bad Füssing und erkundigt sich bei einem alten Mann, der ihm gerade über den Weg läuft: ›Sie, stimmt das, dass durch die Heilkraft des Wassers die Leute in Füssing so alt werden?‹ – ›Ja‹, meint der schluchzend, dabei laufen ihm die Tränen über die Augen. ›Ja, sagen Sie einmal‹, meint der Preuße, ›was weinen Sie denn so?‹ – ›Oh, mei, weil i mit meine 75 Jahr jetzt noch mal eine Ohrfeige kriegt hab.‹ – ›Ja, um Gottes willen‹, entrüstet sich sein Gegenüber, ›von wem denn?‹ – ›Ja, von meinem Vater halt‹, meint der. ›Von Ihrem Vater? Ja, wie alt ist denn der?‹ – ›97‹, antwortet der Mann. ›Ja, und warum hat er Sie denn geschlagen?‹ – ›Ja mei‹, meint der, ›wissen S’, mein Opa hätt heut Seniorensport ghabt, ich hätt ihn hinfahren solln und hab den Termin ganz vergessn. Da hat mir mein Vater einfach eine gwischt.‹ – ›Jetzt hören Sie mal auf‹, sagt der Preuße, ›Ihr Großvater, ja um Himmels willen, und wie alt soll denn der sein?‹ – ›Der Opa‹, meinte der Mann, ›der Opa werd nächstes Jahr 117.‹ – ›Also, guter Mann, jetzt tischen Sie mir aber ein Ammenmärchen auf‹, sagt der Norddeutsche. ›Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich Ihnen das abnehme.‹ – ›Mei‹, meint der andere, ›wenn Sie es net glaubn, fragen S’ die Frau da, die grad aus dem Haus rauskommt. Des is nämlich die Mutter von unserm Pfarrer. Und der hat mein’ Großvater tauft.‹«
»Respekt«, meinte der Pfanzelt Maxe, »Du bist wirklich immer besser wordn.« Man stieß an diesem Abend mehrmals auf den Lu an. Der Lu aber hatte sich den Neuhauser Anzeiger besorgt und hatte den lustigen Einfall, bei dem Double-Wettbewerb selber mitzumachen. Als er die Veranstaltung betrat, waren schon 15 Kandidaten gemeldet. Er war ganz erstaunt, wie viele Leute es offensichtlich gab, die meinten, ihm ähnlich zu sein, bzw. ihm wirklich einigermaßen ähnlich schauten. Irgendwie reagierte er darauf sogar mit einem gewissen Stolz. Der Lu zog die Startnummer 15 und war als Letzter dran. Während er sich in der Garderobe zurechtmachte, hörte er einen großen Applaus. Das war offensichtlich sein Vorgänger. Der Lu lugte auf die Bühne, sah sein vermeintliches Double jedoch lediglich von hinten. Aber was war das? Dieser Lu Hirsch-Vogel-Verschnitt erzählte gerade seinen Lieblingswitz mit dem Norddeutschen in Bad Füssing und dem hohen Alter, das man dort erreichen kann. Aber so leicht konnte man den Lu nicht aus der Ruhe bringen.
Nachdem sein Vorgänger mit großem Beifall verabschiedet worden war, begab er sich auf die Bühne. Er hatte ja noch einen Ersatzwitz parat: »Weil i grad was von Bad Füssing ghört hab«, erzählte er, »des Wasser soll ja wirklich eine enorme Heilkraft habn. Stellts Euch vor, da steigt doch einer mit bloß einem halben Haxn in das Wasser hinein, und wie er rauskommt, hat er zu seiner Verblüffung wieder einen kompletten Fuß dran. ›Ja, so was‹, sagt er zum Bademeister, ›gibt’s denn des auch?‹ – ›Ja, ja‹, sagt der, ›habn Sie des net gwusst, wie stark unser Wasser ist?‹ In dem Augenblick fährt einer mit einem Rollstuhl hinein. Und was meints, was passiert ist?« Der Lu schaute ins Publikum. »Ich wills Euch verraten«, sagte er, »der Rollstuhl hat neue Radl ghabt.«
Als ihm eine Viertelstunde später vom Veranstalter der 2. Preis überreicht wurde, tröstete der ihn mit den Worten:
»Also, was die Witze anbelangt, wards ihr zwei ja gleichwertig. Bei Ihnen kann man sogar sagn: ›In der Kürze liegt die Würze.‹ Aber im Aussehen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat der andere eindeutig die Nase vorn ghabt. Eine solche Ähnlichkeit, wie dem seine, mit dem echten Lu Hirsch-Vogel ist ja geradezu wirklich verblüffend. Und deswegen hat er auch das Auto gewonnen.«
Als der Lu dann in die Garderobe ging, hatte er erst richtig Gelegenheit, sein Ebenbild zu begutachten. Der Gewinner war gerade dabei sich abzuschminken. Mit offenem Mund schaute ihn der Lu an. Nach einiger Zeit presste er ein: »Des sieht dir ja gleich« heraus.
»Was heißt da: Des sieht dir gleich?«, entgegnete der andere. »I seh dir halt gleich. Und wenn man’s ganz genau betrachtet, sogar no a bissl gleicher als wie du dir selber. Also, nix für unguat«, lachte der Pfanzelt Maxe.
Der Fußballfan
»Geh, Anita, bring mir no amal a Maß«, rief Alfons Igerl der Bedienung im Volkart-Eck zu. »Habt’s die Maß gsehn, die wo der Dümpfi ’s letzte Mal fast von der Mittellinie dem Frankfurter Torwart neighaut hat?«, fragte der Eisendorf Schorsch.
»Aha«, stellte der Max fest, »der Schorsch ist wieder einmal bei sei’m Lieblingsthema, Fußball.«
Igerl versuchte, den Schorsch abzulenken und erzählte, dass er das letzte Mal von einer Cousine, die in Bad Kreuznach verheiratet wäre, ein paar Flaschen Wein vom Feinsten mitgebracht bekommen hätte, zu denen man eigentlich »Sie« sagen müsse.
Bei dem Wort Flasche riss es den Eisendorf, und er meinte: »Eine Flaschn Wein im Keller is relativ wenig, eine Flaschn beim FC Bayern is leider schon zu viel.«
»I kann ihn nicht mehr hörn«, schimpfte der Pfanzelt Maxe, »dem sein Fußballschmarrn. Redn mir wenigstens über eine andere Sportart. Hast des gsehn, wie der Tomba des letzte Mal des Slalom-Rennen gwonnen hat?«
»Ja und«, meint der Schorsch, »habts ihr gsehn, wie der Klinsi am letzten Samstag an Slalom durch die Abwehr vom VFB Stuttgart hinglegt hat?«
Igerl schaltete wieder auf ein anderes Thema um: »Zehntausend Mark hat der Dachdecker verlangt, bei unserm Nachbarn, für den Sturmschaden.«
»Der Tom«, jammerte der Eisendorf, »is halt auch keine Dauerlösung im Sturm vom FC Bayern. I tät an Wiggerl glei von Anfang an ollerweil aufstelln, net erst als Joker.«
»Fährst heuer wieder nach Italien, Maxe?«, fragte der Trögl Lulu, zum Pfanzelt Maxe gewandt.
»Hast es schon glesn«, schaltete sich der Eisendorf Schorsch ein, »jetzt wolln die Italiener den Lothar auch noch kaufn vom FC Bayern. Gspannt bin i, wie des mit der Meisterschaft in Italien heuer wird.«
Der Pfanzelt Maxe versuchte, das Gespräch wieder auf ein anderes Thema zu bringen und schwärmte seinen Freunden von den guten Wurstwaren vom Metzger Gastl vor. »Besonders die Gelbe müasst ihr einmal probiern, eine solche gute Gelbe wie beim Gastl hab i schon lang nimmer ’gessn.«
»Ha«, unterbricht ihn da der Eisendorf Schorsch, »wissts ihr, was des is: Es hat 22 Füaß, zwei Flügel und is gelb?«
Seine Stammtischspezln schauten ihn fragend an.
»Gell, haha, des habts net gwusst, des is die chinesische Fußballnationalmannschaft. Ha, ha, und apropos gelb: A Schiedsrichter hat seine Kartn vergessen, da sagt der Linienrichter zu ihm, des macht doch nichts, bei Gelb zeigst ihm deine Zähn und bei Rot streckst ihm einfach die Zunge raus.«
»Jetzt sag einmal«, meint Alfons Igerl, »Schorsch, dass du für Fußball begeistert warst, habn wir ja gewusst, aber seit einiger Zeit hast du überhaupt nichts mehr anderes im Kopf, des is ja richtig krankhaft.«
»Halt«, unterbrach ihn der Eisendorf Schorsch, »kennst du den, wo der Fußballer sei’m Freund erzählt: ›Mein Doktor hat mir verboten, dass i weiterhin Fußball spiel.‹
›Was‹, meint der, ›aus gesundheitlichen Gründen?‹
›Na, der Doktor hat mir zuagschaut beim Spieln.‹«
»Is schon recht«, meint der Maxe, »aber sag einmal, redn tust nur immer vom Fußball, träumst du eigentlich auch nur vom Fußball?«
»Ja, selbstverständlich«, entgegnete der Eisendorf Schorsch, »die ganze Nacht.«
Die Bedienung Anita hatte zugehört und meinte: »Ja, hörn S’ auf, Herr Eisendorf, des glauben S’ doch selber net. Sie träumen von gar nichts anders mehr als wie nur vom Fußball?«
»Mei, von was sollte ich denn sonst träumen«, sagte der Schorsch. »Wenn i von Ihnen träumen dürft, dann wär des natürlich schon was anders.«
»Ja, wenn es weiter nichts ist«, meinte die Anita, »meine Erlaubnis haben S’.«
»Also nachher, du alter Casanova«, ermunterten ihn die Spezln.
»Apropos Casanova«, rief der Schorsch. »Kennt ihr an Unterschied zwischen ei’m Casanova und ei’m Sturm von den Sechzgern? Net? Der Casanova wahrt jede Chance. Ha, ha, ha.«
»Also, wie wars?«, bestürmten die Stammtischspezln am nächsten Abend, als sie sich wieder im Volkart-Eck trafen, den Eisendorf Schorsch. »Hast an schönen Traum ghabt?«
Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Weitere E-Books von Helmut Zöpfl
Tiere kommen in den Himmel
eISBN 978-3-475-54410-1 (epub)
Kommen Tiere in den Himmel? Vor dieser Frage stehen Tierfreunde immer wieder, gerade wenn sie den Verlust ihres geliebten Haustiers zu bewältigen haben. Helmut Zöpfl, durch seine wissenschaftliche Arbeit in Theologie und Biologie gleichermaßen bewandert, widmet sich dem Thema in gewohnt vielschichtiger Weise. Er stellt Aussagen der Bibel und naturwissenschaftliche Theorien einander gegenüber und bezieht dabei auch philosophische Denkansätze mit ein. Auf diese Weise ist ein Buch entstanden, das Trost spendet, Hoffnung gibt und einen Blick in den Himmel gewährt, den wir uns alle wünschen.
Geh weiter, Zeit, bleib steh!
eISBN 978-3-475-54457-6 (epub)
Besinnlich, aber auch heiter geht es im vorliegenden Gedichtband zu, der erneut zeigt, wie breit das Schaffen Helmut Zöpfls aufgefächert ist. Es reicht von satirischer Zeitkritik über wundervolle jahreszeitliche Impressionen bis zum wehmütigen Rückblick auf die Kindertage. Nicht zuletzt wird auch das Leben selbst betrachtet, hinter dem sich trotz scheinbarer Ausweglosigkeit immer ein Sinn ahnen lässt.
Mit Zeichnungen von Hans Müller-Schnuttenbach.
Aber lebn, des möcht i bloß in Bayern
eISBN 978-3-475-54458-3 (epub)
Humorvoll, nachdenklich und mit pointiertem, enthüllendem Witz geleiten Helmut Zöpfls Gedichte durch die bayerischen Lande und Städte. Gemüt und Träume, Launen und Schwächen des bayerischen Volkes werden in ihnen ebenso lebendig wie Szenen aus kulturellem und schulischem Leben, das Zöpfl ja besonders vertraut ist.
Durch Hintergründigkeit und Hellsichtigkeit hindurch führen sie zu seinem heiteren Bekenntnis:
Aber lebn, des möcht i bloß in Bayern!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com