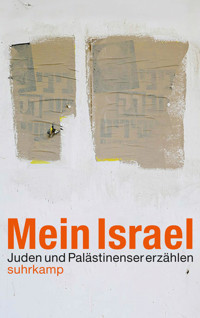
Mein Israel E-Book
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Berliner Fotograf Ali Ghandtschi machte sich auf den Weg nach Israel, um Schriftsteller und Künstler zu porträtieren und sich ein eigenes Urteil über das Land zu bilden. Irgendwann begann er – als Deutscher, Perser, Nichtjude in einer besonderen Position –, Fragen zu stellen und ein Tonbandgerät mitlaufen zu lassen. Um die Unterhaltung nicht gleich auf Politik zu lenken, bat er seine Gesprächspartner, ihm von ihrer Kindheit zu erzählen. Fast alle waren erfreut, dass sich jemand für persönliche Geschichten und nicht nur für die Politik interessierte. Und dennoch spannt sich der Bogen der Erinnerungen in diesem Band fast immer bis in die Gegenwart und berührt die derzeitige Lage. Da alles in Israel mit Politik zu tun hat, sind auch Kindheitserinnerungen politisch. Und auch die Bilder von Ali Ghandtschi zeugen von einem Alltag, der nur scheinbar alltäglich ist. Sie erzählen vom Übertönen, Ausstreichen und Rechthabenwollen. Von der Suche nach der einen Wahrheit. So ergibt sich aus der Vielzahl der unterschiedlichsten Stimmen - moderat religiöse, orthodoxe und säkulare Juden, Zionisten und palästinensische Israelis - ein Gesamtbild mit unerwarteten Perspektiven.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Der Berliner Fotograf Ali Ghandtschi machte sich auf den Weg nach Israel, um Schriftsteller und Künstler zu porträtieren und sich ein eigenes Urteil über das Land zu bilden. Irgendwann begann er – als Deutscher, Perser, Nichtjude in einer besonderen Position – Fragen zu stellen und ein Tonbandgerät mitlaufen zu lassen. Um die Unterhaltung nicht gleich auf Politik zu lenken, bat er seine Gesprächspartner, ihm von ihrer Kindheit zu erzählen. Fast alle waren erfreut, dass sich jemand für persönliche Geschichten und nicht nur für die Politik interessierte. Und dennoch spannt sich der Bogen der Erinnerungen in diesem Band fast immer bis in die Gegenwart und berührt die derzeitige Lage. Da alles in Israel mit Politik zu tun hat, sind auch Kindheitserinnerungen politisch.
Und auch die 32 Farbfotografien von Ali Ghandtschi zeugen von einem Alltag, der nur scheinbar alltäglich ist. Sie erzählen vom Übertönen, Ausstreichen und Recht-haben-Wollen. Von der Suche nach der einen Wahrheit.
So ergibt sich aus der Vielzahl der unterschiedlichsten Stimmen – moderat religiöse, orthodoxe und säkulare Juden, Zionisten und palästinensische Israelis kommen zu Wort – ein Gesamtbild mit unerwarteten Perspektiven.
Ali Ghandtschi wurde 1969 in Teheran, Iran, geboren. Seit 1995 arbeitet er als freier Fotograf. Ghandtschi fotografiert für nationale und internationale Musik- und Kulturmagazine, Theater und Museen, ist Fotograf der Berlinale und des Internationalen Literaturfestivals Berlin. Er lebt und arbeitet in Berlin.www.ghandtschi.de
Mein Israel
Juden und Palästinenser erzählen
Herausgegeben von Ali GhandtschiÜbersetzt von Eldad Stobezki undMirjam Pressler
Mit 32 Farbfotografien des Herausgebers
Für Laura, Elias und Maja
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4578.
© dieser Ausgabe: Suhrkamp Verlag Berlin 2015
© der Fotografien und der englischen Originaltexte: Ali Ghandtschi
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Der Verlag weist darauf hin, dass dieses Buch farbige Abbildungen enthält, deren Lesbarkeit auf Geräten, die keine Farbwiedergabe erlauben, eingeschränkt ist.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagfotos: Ali Ghandtschi
Ich erinnere mich, wie ich als Kind, im Teheran der siebziger Jahre, auf unserem Schwarzweißfernseher Moshe Dayan sah. Ich war beeindruckt von seiner Augenklappe und musste an Schlachten auf Seeräuberschiffen denken.
Später, nach der iranischen Revolution und unserer Übersiedlung nach Deutschland, zeigte unser neuer Farbfernseher die Bilder der Intifada: Jugendliche, die Steine schleuderten gegen Soldaten mit Maschinengewehren. Dann explodierende Busse, zerfetzte Körper, Drohungen von Politikern; 2005 schließlich Israels Rückzug aus Gaza.
In meiner Jugend hatte ich israelische Freunde, die nach dem Libanonkrieg von 1982 aus der Armee ausgeschieden waren und nun die Welt bereisten, um das Erlebte zu verarbeiten.
Israel hat mich immer begleitet, Diskussionen zum Thema Israel gehörten zu meinem Leben. Jeder hatte eine Meinung, auch ich. Gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, eigentlich viel zu wenig über dieses Land zu wissen.
Als Fotograf des internationalen Literaturfestivals in Berlin hatte ich Kontakt zu israelischen Lyrikern und Schriftstellern. Im April 2011 beschloss ich, nach Israel zu reisen, Porträts von Künstlern zu machen und diese in einer Ausstellung zu zeigen.
Am Flughafen Ben-Gurion befragten mich sieben Beamte mehrere Stunden lang, was ich – Deutscher, Perser, Nichtjude – in Israel wolle. Schließlich ließ man mich einreisen. Und plötzlich fühlte ich mich merkwürdig zu Hause. Die Freundlichkeit und der Umgang der Menschen miteinander erinnerten mich an den Iran. Ich war im Nahen Osten angekommen, in einem Land, dass sich von den umgebenden Ländern abgrenzte und dennoch von der Mentalität des Orients durchdrungen schien.
Am ersten Tag meiner Reise besuchte ich die Altstadt von Jerusalem. An der Klagemauer geriet ich in Feierlichkeiten von orthodoxen Juden zu Ehren eines reichen Amerikaners, der dem Rabbiner der Klagemauer eine neue Torarolle übergeben hatte. Hunderte tanzten ausgelassen zu den Klängen eines Kinderchors, der von verzerrten, ohrenbetäubenden E-Pianoklängen begleitet wurde. Ich fotografierte das Fest und wurde bald von den Feiernden aufgefordert, mitzutanzen. Mit meiner Pappkippa auf dem Kopf sah ich wahrscheinlich aus wie ein Diasporajude auf Heimatbesuch. Nach einer Weile fragte mich der Assistent des Rabbiners, woher ich käme. Als ich ihm von meiner Herkunft erzählte und auf Nachfrage verneinen musste, Jude zu sein, war die Party für mich vorbei. Ich wurde aufgefordert, die Veranstaltung zu verlassen.
Dann ging ich zum Felsendom. Als ich meinen islamischen Namen nannte, wurde ich eingelassen. Ein freundlicher Mann zeigte mir jede Ecke des Doms, zu dem wiederum Juden keinen Zutritt haben.
Israelische Freunde, denen ich am Abend von meinen Erlebnissen erzählte, bezeichneten mich – halb im Ernst, halb scherzhaft – als »Religionshure«. Für jemanden, der wie ich in einer Gesellschaft lebt, in der Religion im öffentlichen Raum so gut wie keine Rolle spielt, waren das ganz neue Erfahrungen.
Mir wurde bald klar, dass es nicht genügen würde, in Israel einfach nur Porträts zu machen. Dieses Land faszinierte mich, ich wollte einen anderen Zugang dazu finden. Ich hatte ein Aufnahmegerät dabei und begann, die Künstler zu interviewen. Um das Gespräch nicht gleich auf Politik zu lenken, bat ich sie, mir eine Kindheitserinnerung mit Bezug zu Israel beziehungsweise dem damaligen Palästina zu erzählen. Fast alle waren begeistert von der Idee, dass sich jemand für persönliche Geschichten interessierte und nicht zwingend über Politik sprechen wollte. Dennoch spannten die Erzähler den Bogen fast immer bis zur heutigen Zeit. Da alles in Israel mit Politik zu tun hat, sind auch Kindheitserinnerungen politisch.
Nach drei Wochen hatte ich achtzehn Interviews geführt und war von den Geschichten so gefangen, dass das fotografische Porträt in den Hintergrund trat. Es war etwas anderes, das ich im Bild festhalten wollte. Ich begann, Nachrichten, die Menschen in der Öffentlichkeit hinterlassen hatten, zu fotografieren: Wandzeitungen, Graffiti, Parolen.
Zurück in Deutschland zeigte ich eine Auswahl der Geschichten und Bilder im Rahmen einer Ausstellung während des internationalen Literaturfestivals im Haus der Berliner Festspiele, was auf reges Interesse stieß. Ich beschloss, das Projekt weiter zu verfolgen. Auf fünf mehrwöchigen Reisen nach Israel sammelte ich fast achtzig Geschichten verschiedenster Persönlichkeiten und machte zahllose Aufnahmen – insbesondere von Wänden und Mauern.
Mein Plan, ein ausgewogenes Bild Israels aufzuzeigen, ging allerdings nicht auf. Die israelische Gesellschaft ist weit vielfältiger, als wir sie durch die Medien wahrnehmen.
Viele Intellektuelle, insbesondere linke und moderate, stehen der israelischen Politik sehr kritisch gegenüber und sind für Gespräche offen. Ultranationalistische und ultraorthodoxe Juden sowie islamische Würdenträger dagegen waren meist gar nicht bereit, mit mir zu sprechen. Der Radiomoderator und Rechtsanwalt Yoram Sheftel zum Beispiel, der den ehemaligen KZ-Aufseher John Demjanjuk bei seinem Prozess 1986 in Israel verteidigte, beschimpfte mich am Telefon lauthals, was ich als Deutscher mir erlaube, ihn anzurufen.
Ich war froh, dass sich Israel Har'el bereit erklärte, mir seine Geschichte zu erzählen. Er gehört zu den Gründern der nationalistischen und messianischen Siedlerbewegung »Gush Emunim«. Außerdem veröffentlicht er seit vielen Jahren Kolumnen in der Tageszeitung Haaretz. Das macht ihn auch jenseits der rechten Kreise zu einer Stimme des öffentlichen Lebens.
Auch der kontrovers diskutierte Musiker Ariel Zilber wollte anfangs nicht mit mir sprechen. Erst als ich ihm sagte, dass ich den auch von Siedlern verehrten Rabbiner Adin Steinsaltz getroffen hatte, war er bereit, mir seine Geschichte zu erzählen. Linke und moderate Kräfte des Landes lehnen Ariel Zilber ab, weil er seit einigen Jahren extrem nationalistische Positionen einnimmt. Selbst die aktuelle Regierung unter Benjamin Netanjahu und Avigdor Lieberman findet er zu linksgerichtet. Als wir nach unserem Gespräch in einem schäbigen Café in einem Industriegebiet Tel Avivs auf die Straße traten, wurde er indes von jungen Bauarbeitern, die am Nachbargebäude beschäftigt waren, erkannt und frenetisch bejubelt.
Chaim Gouri, einer der beliebtesten Lyriker des Landes und bei weitem kein Extremist, sagte höflich ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg, so erzählte er mir am Telefon, half er, ehemalige KZ-Häftlinge zu betreuen, und begleitete als Journalist den Eichmann-Prozess. Dies mache es ihm bis heute unmöglich, an einem deutschen Projekt teilzunehmen. Er wisse, dass ich ein junger Mann und unschuldig sei, ich solle es ihm aber bitte nachsehen.
Einige arabische Israelis wiederum wollten sich nicht interviewen lassen, weil sie nicht zusammen mit Juden in einem Buch erscheinen wollten, auch aus der Angst heraus, dadurch in der arabischen Welt angefeindet zu werden. Wenn ich zwei Bücher herausbringen würde, eines mit Interviews von Juden, eines mit Interviews von Arabern – dann wären sie bereit, mit dabei zu sein.
Mein Israel? Wessen Israel ist also damit gemeint? Das Land ist voll der verschiedensten Biographien. Innerhalb der jüdischen Gesellschaft gibt es so viele verschiedene Strömungen: Juden aus dem europäischen und dem arabischen Raum, eritreische und persische Juden, moderat religiöse, messianische, orthodoxe und ultraorthodoxe. Es gibt säkulare Juden, Zionisten und absolute Antizionisten, die mit Holocaust-Leugnern gemeinsame Sache machen. Dazu gibt es die Siedler, und wer die richtig schlimm findet, der kennt noch nicht die Hilltop-Gangs. Dazwischen und darum herum gibt es natürlich noch Beduinen, Drusen und die mit 20% Bevölkerungsanteil nicht ganz kleine Gruppe der von den Juden »arabische Israelis« genannten moslemischen und christlichen Araber, die sich selbst aber als »palästinensische Israelis« bezeichnen. Und obwohl das Land so klein ist, ist es den einzelnen Gruppen möglich, ein Leben zu führen, ohne mit Mitgliedern der jeweils anderen Gruppierungen in Berührung zu kommen. Das war eine Erkenntnis, die mich mit am meisten irritierte.
Ein bisschen fühle ich mich wie in dem Witz, den mir der Rabbiner Adin Steinsaltz erzählte: Ein Journalist kommt nach Israel und wird gefragt, was er tue. Er schreibe an einem Buch, antwortet dieser. Seit wann er denn im Land sei? »Seit gestern.« Und wann er denn wieder abreise? »Morgen.« Und wie das Buch heißen soll? »Israel gestern, heute und morgen«. Das, was ich in den drei Jahren, in denen ich regelmäßig in Israel war, gehört und erfahren habe, kann nur ein winziger Einblick in die Komplexität dieses Landes sein, das sich in stetigem Wandel befindet. Es bleibt interessant, in welche Richtung es sich entwickeln wird.
Ali Ghandtschi
Die Gespräche wurden auf Englisch geführt, nur die mit Uri Avnery, Asher Reich, Micha Ullman und Ruth Peled-Ney auf Deutsch.
Alle Gespräche fanden vor dem Gazakrieg »Operation Protective Edge« vom Sommer 2014 statt.
Also hör zu, es ist nicht so, daß ich misstrauisch bin, aber ich werde dir nichts von meinen persönlichen Angelegenheiten erzählen. So ist es nun mal. Das hat mich das Leben gelehrt. Und ich bin ein vorsichtiger und aggressiver Optimist. Deshalb hoffe ich, dass eines Tages alles besser wird. Und weil ich Menschen respektiere, die Ideen für ein Projekt haben, hoffe ich, dass du das nicht als Entschuldigung missbrauchst und dass du die Lage so zeigst, wie sie ist, interessant und sehr komplex. Keine der Seiten hat recht oder unrecht. Es ist eine komplexe Situation, in der keine Seite schuldlos ist.
Was hier passiert, ist ziemlich traurig, und ich kann von keinem erwarten, das zu verstehen oder zu erklären, aber ich kann dir sagen: Es ist ein höchst aufregendes Land, und hier leben viele interessante Menschen. Hier ist nicht alles einfach schwarz und weiß, und möglicherweise gibt es keine Lösung, aber dieses Land zeigt, dass man mit Hoffnung leben kann, selbst wenn man weiß, dass es für den Konflikt darin keine Lösung gibt.
Micha Bar-Am
Im ParadiesAlex Anski
Meine Geschichte beginnt acht Monate vor meiner Geburt. Meine Eltern lebten in Sofia, und sie stritten ständig über den jüdischen Glauben in dieser Welt. Meine Mutter, eine Schauspielerin, war der Meinung, der Judaismus sei am Ende und der einzige Weg, dem grausamen Schicksal zu entkommen, das die Juden in ihrer Geschichte verfolgt hatte, bestünde darin, so zu tun, als wären wir keine Juden. Mein Vater glaubte genau das Gegenteil: Alles, was uns im Laufe der Geschichte widerfahren sei, komme daher, dass wir in aller Herren Länder verstreut seien, machtlos, ohne einen eigenen Staat. Wir waren immer nur Bettler, die von einem Ort zum anderen zogen, wir wurden nirgendwo sesshaft, wir bestellten nie das Feld, Landwirtschaft war nicht unsere Sache, Handwerk aber auch nicht. Juden tragen alles bei sich, damit sie leicht weiterziehen können. Deshalb müssen sie sich geistig entwickeln, ein Talent, das sie haben, sie müssen Sprachen lernen, Klavier oder Violine spielen, schreiben oder Diamanten bearbeiten … Wenn sie Diamanten besitzen und in Spanien etwas passiert, sind sie blitzschnell in Holland und können dort von vorn anfangen. Wir Juden kommen mit kleinem Gepäck. Unser Problem, sagte er, sei, dass wir ein Volk ohne Staat sind. Das sei der Grund, dass wir uns durch alle Länder der Welt manövrierten, wie ein Schiff auf hoher See, ohne Kapitän und ohne Motor.
Meine Mutter sagte, sie wolle im Jahr 1939 keinen Juden zur Welt bringen. Du bist Jude, ich bin Jude, unsere Religion verdammt uns also dazu, ein jüdisches Kind zu bekommen. Dieses Baby ist noch nicht auf der Welt. Lass uns alles in unserer Macht Stehende tun, damit niemand erfährt, dass es ein jüdisches Kind ist. Als Erstes werden wir seinen Namen ändern, es wird nicht unseren Namen tragen. Zweitens soll es nicht beschnitten werden. Und drittens will ich nicht, dass sein Name ins Geburtenregister von Sofia eingetragen wird. Man kann sich vorstellen, was das für meinen Vater bedeutete. Ich wurde geboren und bekam den Namen Alexander. Zusätzlich änderten sie meinen Nachnamen. Mit dem Namen Abarbanel würde man mich sofort als Jude erkennen. Meine Eltern entschieden sich für den Namen Anski, und so heiße ich noch heute.
Drei Monate vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs kam also ein Baby auf die Welt: ich. Ich wurde mitten in diesen Streit meiner Eltern hineingeboren, einen Streit, der mein Leben lang andauerte, bis zu ihrem Tod.
1945, als wir hierher kamen, war Israel voller Energie und Träume, doch abgesehen davon gab es nichts. Vom ersten Moment an wollte ich ein Teil dieses Landes werden. Nicht aus politischen oder ideologischen Gründen, dafür war ich zu jung. Aber ich fand es schön hier. Es bedeutete vor allem Freiheit. Die Eltern gingen morgens um sechs Uhr zur Arbeit und kamen abends um zehn Uhr zurück. Man war den ganzen Tag frei. Man spielte mit seinen Freunden, rannte auf den Straßen herum und durch die Wälder. Wenn man jung ist, macht es einem nichts aus, arm zu sein. Man klettert auf einen Baum, pflückt zwei Äpfel oder fünf Guaven und hat keinen Hunger mehr. Ich genoss diese Freiheit. Es war wie im Paradies.
Der verrückte MaxMoshe Dor
Ich habe mehrmals versucht, von zu Hause wegzulaufen. Dumm und naiv, wie ich war, rannte ich zum Meer. Ich lief über die festungsartigen Dünen, rutschte hinunter zum Strand und schaute mich nach einem Versteck um. Damals lebte am Strand ein Mann namens Max. Vermutlich war er ein deutscher Jude, der vor den Nazis geflohen war. Deshalb nehme ich an, dass er Mitte der dreißiger Jahre nach Palästina gekommen war. Schon bei seiner Ankunft muss er psychisch geschädigt gewesen sein. Er weigerte sich, in einem Haus zu wohnen, in einer Baracke oder wo auch immer, er lebte in einer Höhle oberhalb des Strandes. Er war bekannt als der verrückte Max. Er war sehr liebenswürdig, und die Leute gaben ihm immer etwas zu essen und abgetragene Kleidungsstücke. Für die Kinder bedeutete er ein ständiges Wunder. Eine Art Robinson Crusoe. Wenn er sprach, war das eine seltsame Mischung aus Deutsch und Hebräisch und was noch alles. Eines Tages fand man ihn tot in seiner Höhle.
Feuer in der Allenby-StraßeRuth Peled-Ney
Meine Eltern sind beide in Deutschland geboren. Mein Vater war unterm Kaiser in der Armee im Ersten Weltkrieg, und als er zurückkam, hat er studiert und wurde Zionist. Er hat sich in Deutschland irgendwie nicht wohl gefühlt – wegen des latenten Antisemitismus. Sein Vater war ein deutscher Nationalist, vollkommen assimiliert, der wusste nichts vom Judentum und hat gedacht, dass sein Sohn verrückt ist, weil er damals, 1920, nach Palästina ging. Aber auch mein Vater verstand nicht viel von der jüdischen Tradition und hat mich aus Versehen in einem religiösen Kindergarten angemeldet. Der war sehr religiös. Und so passierte Folgendes: Tischa beAw ist bei den Juden ein Fastentag, weil der Tempel in Jerusalem – die Klagemauer ist der Rest davon – an diesem Tag zerstört wurde, deshalb fasten alle Orthodoxen. Ich war fünf Jahre alt und ging in den Kindergarten und habe dort gelernt, dass man fasten muss. Als ich nach Hause kam, saß die ganze Familie beim Essen. Da habe ich gesagt, dass die Araber den Tempel verbrannt haben. »Wo?« »In Tel Aviv.« Mein Vater sagt: »Eigenartig, dass wir nichts davon gehört haben.« Darauf ich: »Nein, der Tempel ist abgebrannt, und ihr dürft nicht essen!« Meine Eltern: »Was heißt das, wir dürfen nicht essen? Woher hast du diese Geschichten?« – »Ja, alle Eltern der Kinder im Kindergarten essen nichts!« Ich habe furchtbar geweint darüber, dass sie essen, weil das eine Sünde ist und der liebe Gott uns bestrafen wird. Es war eine Deutsche dabei, eine Nichtjüdin, die meine Eltern als Kindermädchen mitgebracht hatten, und die hat mir dann versprochen, dass sie nichts zum Abendbrot essen wird. Und andere, die dabei waren, haben auch gesagt, dass sie kein Abendbrot essen würden. Ich ging schlafen. Ich hatte sie alle erwischt beim Abendbrotessen. Ich war vollkommen außer mir, konnte mich überhaupt nicht mehr beruhigen und hatte das Gefühl, in einer sündigen Familie zu leben. Daraufhin wurde ich religiös und habe versucht, koscher zu essen. Bis die Sache sich aufgeklärt hat. Ich hatte noch einen Bruder, und der hat dann einmal, als er aus der Schule kam, meinen Eltern erklärt, dass nicht die Synagoge in der Allenby-Straße von den Arabern verbrannt wurde, sondern dass der Tempel in Jerusalem vor 2000 Jahren von den Römern zerstört worden und davon die Klagemauer übriggeblieben ist. Das hatte er in der Schule gelernt, und so haben meine Eltern auch etwas von jüdischer Kultur erfahren.
Mit zweiundzwanzig Jahren ging ich nach Genf zum Studium, Psychologie, und da habe ich immer gesagt: »Ich bin keine Jüdin, ich bin Israelin, und das ist nicht dasselbe.« Und unter uns gesagt: bis heute weiß keiner, was ein Jude ist. Meine Eltern hatten mehr gemeinsam mit den Deutschen als mit den jemenitischen Juden. Sie fanden die jemenitischen Juden interessant, ein Unikum, wie soll ich sagen, außergewöhnlich, aber sie haben nichts gemeinsam gehabt, weder eine Sprache noch eine Tradition. Ich habe gesagt: »Ich bin Israelin.« Und bis heute weiß man auch nicht genau, was das ist. Ich habe einmal gehört, dass ein Jude jemand ist, der glaubt, dass er Jude ist, und von dem auch die anderen glauben, dass er Jude ist. Das ist ein Jude.
Mein Großvater hat mit meinem Vater gebrochen, als er nach Palästina ging. Er hat sieben Jahre lang auf keinen Brief geantwortet. Als der Holocaust kam, hat mein Vater versucht, ihn hierher nach Israel zu bringen und die Papiere zu besorgen. Aber mein Großvater hat ein Telegramm geschickt: Ich bin Deutscher, hier bin ich geboren, hier habe ich gelebt, und wenn ich hier zum Tode verurteilt bin, werde ich hier sterben. Er wurde nach Theresienstadt deportiert.
Juden und die DiasporaAbraham B. Jehoshua
Die Araber wollten nicht, dass die Juden hierher kamen, und das zu Recht. Warum sollten sie die Juden akzeptieren? Jedes andere Volk hätte sich ebenso verhalten. Aber sie waren nicht stark genug, uns hinauszuwerfen. Als wir es nach der ganzen Katastrophe geschafft hatten, hatte ich das Gefühl, die Anstrengung habe sich gelohnt, alles sei ganz normal. Das also ist mein Verhältnis zum Staat. Ich betrachte ihn als ein Wunder, denn das jüdische Volk hatte keinen Staat gewollt. Das jüdische Volk tat alles in seiner Macht Stehende, um in der Diaspora zu bleiben, doch die Diaspora wollte die Juden nicht. Man hat sie hierher getrieben. Es waren nur wenige, die kamen. Dieser Staat wurde von einer sehr kleinen Minderheit des jüdischen Volks gegründet, nur etwa ein Prozent waren Zionisten. Das Gute ist, dass diese Menschen unabhängig von der Erlaubnis des jüdischen Volks hierher kamen. Wenn man eine Revolution machen will, braucht man die Zustimmung des Volkes, aber sie haben nicht um Erlaubnis gefragt. Sie kamen hierher und bauten den Staat auf, gegen den Willen vieler Juden der verschiedensten Richtungen. Viele Orthodoxe, Sozialisten, Reformer und Assimilierte waren gegen den Zionismus. Doch diese wenigen Menschen kamen hierher, um ein normales Leben zu führen. Für mich war das eine moralische Haltung und auch der Grund für den Erfolg dieses Staates, die Tatsache, dass eine moralische Haltung dahinterstand. Ich will nicht die Welt verbessern, sondern mich selbst. Zionismus bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen.
Wir dachten, die Religion würde mit der Moderne aussterben. Das tat sie aber nicht. Das ist eine große Überraschung. Freud dachte, die Wissenschaft würde die Religion beseitigen. Unglaublich.
Einige der Orthodoxen gehören zum sehr rechten Flügel. Aber es ist nicht nur einfach ein rechter Flügel, es ist der rechte Flügel mit Gottes Erlaubnis, mit Gottes Segen, mit der Autorität Gottes. Das macht das Ganze sehr gefährlich.
Der IrgunUri Avnery
Ungefähr zu meinem fünfzehnten Geburtstag bin ich in eine Terrororganisation eingetreten, vielleicht sollte ich davon erzählen. Vorher ging ich zur Schule, in einem Dorf, aber dazu fällt mir nichts besonders Interessantes ein. Ich würde anfangen mit dem Irgun. Mit der Organisation. Ich muss überlegen, was am interessantesten sein könnte.
1936 ist der arabische Aufstand ausgebrochen. Da war ich noch in der Schule. Mein Vater, der normalerweise nie dorthin kam, hat mich an dem Tag abgeholt, weil die Leute alle Angst hatten. Der Aufstand war hier in Jaffa. Ein paar Dutzend Menschen sind dabei umgekommen. Juden. Das war natürlich eine große Aufregung. Jaffa und Tel Aviv: heute ist das eine Stadt. Damals war es auch eine Stadt, aber mit einer unsichtbaren Grenze mittendrin. In Wirklichkeit waren Jaffa und Tel Aviv total getrennt, zwei verschiedene Welten. Da kam also mein Vater zur Schule, andere Eltern auch, und sie haben ihre Kinder abgeholt. Ich war damals dreizehn. Der arabische Aufstand dauerte drei Jahre mit Unterbrechungen, während dieser drei Jahre haben arabische Freischärler jüdische Siedlungen angegriffen, und die Frage auf unserer Seite war: Was tun wir dagegen? Verlassen wir uns auf die Engländer? Die Polizei? Das Militär? Verteidigen wir uns? Oder unternehmen wir Gegenangriffe? Das war eine riesige Diskussion im Land, tagtäglich. Jeder hatte seine eigenen Ansichten. Ausdruck der zwei größten Gegensätze waren zwei Untergrundorganisationen. Die eine hieß Hagana (Verteidigung), das war praktisch die illegale Organisation der jüdischen Quasi-Regierung. Die jüdische Gemeinschaft hier im Lande war ein Staat im Staate mit ihrem eigenen Erziehungswesen, Gesundheitswesen und illegal auch einer bewaffneten Truppe. Die zweite Organisation war der Irgun. Irgun heißt Organisation, der volle Name war Nationale Militärische Organisation, kurz nannte man ihn den Irgun. Der Irgun war extrem gegen diese Selbstenthaltung eingestellt, so hieß die Verteidigungstheorie. Man greift nicht an, man verteidigt, wir verteidigen unsere Siedlungen. Gegen 1931 ungefähr hatte sich die Organisation gespalten. Auf der einen Seite gab es dann eine große Organisation, die Hagana. Alle politischen Kräfte, von der Linken bis Mitte bis gemäßigte Rechte. Und auf der anderen den Irgun, der viel viel kleiner war – ein paar tausend Menschen höchstens – und extrem rechts. Ich empfand tiefste Verachtung für unsere Führung, der die Hagana unterstand. Ich war absolut dafür, dass wir zum Gegenangriff übergehen. Und so war es eigentlich ganz natürlich, dass ich mich dem Irgun angeschlossen habe. In Deutschland waren wir ziemlich wohlhabend gewesen, und nach einem Jahr hier waren wir arm wie die Kirchenmäuse. So habe ich mit vierzehn Jahren die Schule verlassen, ich habe die Volksschule nicht beendet und bin arbeiten gegangen, um zum Familienunterhalt beizutragen. Ich habe angefangen, bei einem Rechtsanwalt zu arbeiten. Eines Tages beim Gericht trat ein Kollege auf mich zu und fragte: »Was denkst du über die Selbstenthaltung?« Ich habe ihm gesagt, was ich darüber denke, und er sagte: »Willst du einer Organisation beitreten, die dagegen kämpft?« Bis zu dem Augenblick hatte ich überhaupt nicht gewusst, dass es eine Organisation gibt. Sie war ja geheim. Und ich sagte, ich wollte mir das noch einen Tag überlegen. Dann habe ich es beschlossen, ich habe meinen Vater beiseitegenommen und habe gesagt, dass ich einer Untergrundorganisation beitreten will. Er war nicht dafür, aber er hat nicht nein gesagt. Dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt: »Ja, ich bin bereit.« Er sagte: »Gut, wir werden dich benachrichtigen.« Eines Tages kam ein Junge zu mir nach Hause und gab mir einen Zettel. Darauf stand, ich solle an dem und dem Tag am Abend in eine Schule in einem ganz armen Viertel von Tel Aviv kommen, am Eingang würde man mich nach der Parole fragen, »Samson und Dalila«, glaube ich. Als der Tag kam, war ich schrecklich aufgeregt. Viel zu früh war ich in der Nähe der Schule und bin hin und her gegangen, bis zum verabredeten Zeitpunkt. Dann, zur bestimmten Stunde, näherte ich mich der Schule. Sie lag ganz im Dunkeln und verlassen da. Ich dachte, ich hätte mich vielleicht geirrt, ging aber zum Eingang, und in der Dunkelheit standen ein Junge und ein Mädchen. Ich habe die Parole gesagt, sie haben mich reingelassen. In der Dunkelheit sagte man mir, ich solle die Treppen hinaufgehen und jemand würde mich dort erwarten. Ich kam in ein Zimmer und wartete. Ich sah überhaupt nichts, denn ein sehr starker Scheinwerfer blendete mich, und ich konnte nicht erkennen, mit wem ich sprach. Hinter dem Scheinwerfer saßen ein paar Menschen. Ich hörte eine Frauenstimme und einige Männerstimmen. Es war eine Art Verhör, und meine Antworten auf die Fragen müssen sie etwas bestürzt haben, denn ich habe nicht gesagt, was erwartet wurde. Man fragte, ob ich die Araber hasse, und ich sagte: »Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.« Sie waren verblüfft. Und dann fragte die Stimme: »Hasst du die Engländer?« Ich: »Nein, ganz im Gegenteil, ich liebe die englische Kultur. Ich arbeite bei einem englischen Rechtsanwalt.« Und so weiter und so weiter. Als ich rauskam, dachte ich, damit wäre die Sache erledigt. Aber scheinbar habe ich die Leute doch beeindruckt, denn nach ein paar Wochen bekam ich wieder einen Zettel: An dem und dem Tag kommst du zu deiner Kompanie. Ich stand damals ein paar Tage vor oder ein paar Tage nach meinem fünfzehnten Geburtstag. Das war alles ungeheuer aufregend. So habe ich drei Jahre lang eine Art Doppelleben geführt. Am Tag habe ich gearbeitet, wie gesagt bei einem jüdisch-englischen Rechtsanwalt, unsere Klienten waren zum großen Teil Engländer, die ich alle sehr gerne hatte – und abends und nachts war ich im Untergrund. Das war natürlich alles sehr aufregend. Meine Kompanie bestand aus hundertundzwanzig jungen Leuten meines Alters, achtzig Jungen und vierzig Mädchen, und wir trafen uns alle paar Tage. Wir hatten Waffenübungen mit Pistolen. Die Pistolen lagen bei mir zu Hause. Bei mir war das Waffenlager der Kompanie. Drei, vier Pistolen, Revolver, die wir zu bedienen gelernt haben, ohne jemals eine Kugel abzufeuern. Kugeln waren viel zu wertvoll. Wir haben gelernt, die Pistolen auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen, zu schießen ohne Patronen, zielen ohne Patronen und so weiter. Darauf stand damals die Todesstrafe. Wir waren zu jung, um hingerichtet zu werden, wahrscheinlich, aber wir hätten doch viele Jahre im Gefängnis verbracht, wenn man uns gefasst hätte, und wahrscheinlich wären wir auch gefoltert worden. Meine Aufgabe war unter anderem, diese Pistolen dorthin zu bringen, wo sie benötigt wurden. Es waren übrigens meistens deutsche Pistolen, es waren deutsche Parabellum und deutsche Mauser. Wir haben auch andere Auf





























