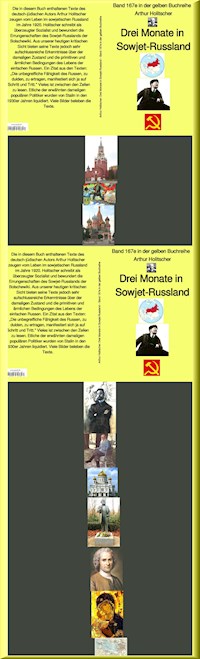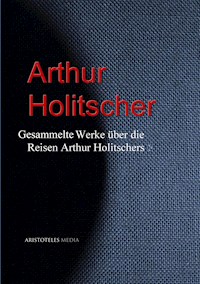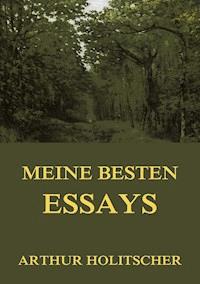
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der 1941 in Genf verstorbene Arthur Holitscher gehörte zu den bedeutendsten Essayisten seiner Zeit. Seine Schriften standen auf der "auszumerzenden Literatur" der Nationalsozialisten ganz oben. In diesem Werk finden sich seine bedeutendsten Essays, so zum Beispiel: Ideale an Wochentagen Es ist leider wieder Herbst Die Generation nach uns Die Macht der Friedfertigen Das Unvernünftige in den Weltgeschicken Wie die Leute von Oneida sich vertrugen Feuertaufe der Religionen Kenntnis fremder Völker Der Weg zur Zukunft Der neue Intellektuelle Das Taylor-System und der Sozialismus Politische Feiertage der Überkonfessionellen Spiegelgasse 14 / Zürich Lenin spricht und viele andere.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine besten Essays
Arthur Holitscher
Inhalt:
Vor einem Bild des Bauern-Brueghel
Charles Baudelaire
Frans Masereel
Der neue Intellektuelle
Rilkes Roman [Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge.] Leipzig, Insel-Verlag 1910
De Costers Tyll Ulenspiegel
Theater in China und Japan
Volksfilm und Volksbühne
Für Egon Erwin Kisch zum 50. Geburtstag
Ideale an Wochentagen
Es ist leider wieder Herbst
Mehr anonyme Briefe!
Die Generation nach uns
Die Macht der Friedfertigen
Das Unvernünftige in den Weltgeschicken
Wie die Leute von Oneida sich vertrugen
Feuertaufe der Religionen
Kenntnis fremder Völker
Der Weg zur Zukunft
Der neue Intellektuelle
Das Taylor-System und der Sozialismus
Politische Feiertage der Überkonfessionellen
Spiegelgasse 14 / Zürich
Lenin spricht
»... Des Heil'gen Stromes Well'n ...«
Besuch bei Gandhi
Nächster Krieg und nachher
Gullivers Reisen zu den Blähariern
Antworten auf eine Enquête der Moskauer »Literaturzeitung«
Grußschreiben an den Kongreß der sowjetischen Schriftsteller
Der Stierkampf
Meine besten Essays, A. Holitscher
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849643508
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Vor einem Bild des Bauern-Brueghel
Darf man in einem Kunstwerk Rechenschaft fordern für Unbill, die das Leben einem angetan hat? Wenn ein Buch das Leben, das man gelebt hat, behandelt, darf man dies wohl. Ja, man darf sich nicht gut darum herumdrücken. Es ist keine Rache, die man nimmt, wenn man die Wahrheit berichtet. Der Gesichtswinkel aber, unter dem man die Ergebnisse eines Lebens betrachtet, mag Schärfe und Intensität der Darstellung bedingen. Ist Leben Kampf, so habe ich keine andere Waffe, um in ihm zu bestehen, als meine Feder, mit der ich Wort an Wort reihe.
Die Anderen haben ihre Waffe. Ihr Geld. Ihre Zunge. Die Verbindung mit ihresgleichen, die Freimaurerei ihrer Gesinnungsgemeinschaft, Interessengemeinschaft, ihrer Gemeinheit. Die Dummheit, die große menschliche Dummheit, die sie, statt ihr durch eigene Klugheit und Weltgewandtheit abzuhelfen, schlau ausnützen, um sich Macht zu verschaffen.
Meine Feder ist im Feuer gesäubert. Ich brauche sie mit reinem Gewissen. »Mein ist die Rache, spricht der Herr«?? Jawohl, der Herr der Rache ist auch der meine. Kein »lieber Gott«. Wie oft hörte ich das Wort »mein ist die Rache«, wie oft hörte ich es vorwurfsvoll aus dem Munde von Schurken. Dem christlichen Menschen, der es gebraucht, zu seinem Schutz anführt, erwidere ich: bist du, lebst, fühlst, handelst du nach Christenart, Christengebot, so hast du nichts begangen, wovor du zittern mußt. Bist du ein Christ, bin ich es auch. Laß mich deine Stirn küssen, küsse mich auf Stirn und Wange. Bist du aber in deinem Handeln, Fühlen, deiner Tat das Gegenteil eines Christen gewesen, so werde ich dir beweisen, daß du es mit einem Bolschewik zu tun gehabt hast.
Nun wollen wir weiterreden. –
***
Der Plan zum Buch meines Lebens kam mir an einem Vormittag im Wiener Kunsthistorischen Museum vor einem Brueghel-Bild, das den Kampf der Fasten mit dem Fasching darstellt. Man blickt da irgendwoher von oben, aus einem Turmfenster etwa, auf den Markt hinunter, auf einen Platz zwischen Dom und Wirtshaus, auf dem sich eine närrische Menge in Bauerntracht und Mummenschanz tummelt. Da gibt es Masken von Königen und Ratsherren, Mönchen und Philosophen zu sehen. Die Fettwänste, die Krüppel und die Bettler haben es leichter, ihren Stand und Wesen erraten zu lassen. Die sind in ihrer Alltagstracht aufmarschiert. Über das ganze Bild sind Gruppen verstreut, voll Eifer und tiefem Ernst mit irgendeinem närrischen Tun beschäftigt. Auch sieht man zwischen den Gruppen hier und dort eine einschichtige Figur dahinwandeln oder irren, von einer Gruppe zur anderen, sich das Treiben jeder einzelnen ansehend, dann weitergehend, ohne in einer Fuß zu fassen.
Mir schiens, als blicke ich in dieses Bild selber wie auf mein irdisches Leben nieder, als erkenne ich mich selber inmitten einer oder der anderen Gruppe – oder unter dem Narrengewand eines oder des anderen Herumirrenden, als könnte ich wie der Bauern-Brueghel behaglich und sicher von so hohem Standort aus das Treiben unten auf dem Bild meines Menschenlebens schildern.
Das war gar kein schlechter Vergleich. Und es war auch kein schlechtes Buch, das ich damals geschrieben habe. Nur ... der Turm eben hielt nicht stand, und das war der fundamentale Fehler des Buches. Darum ist das Buch unter den Trümmern des Turmes begraben und ist verbrannt in der Explosion des Fundamentes. Ein Gutes aber war dabei: das Feuer hat manches Weiche, Unausgesprochene, Halbzuendegedachte und -gefühlte aus mir weggebrannt, und daraufhin hat es sich verlohnt, Welt und Leben noch einmal anzuschauen. Es geschieht in dieser zweiten Niederschrift, die ich aufs Papier setze, weil ich noch die volle Kraft des Auges besitze und auch die Festigkeit der Hand, die nachzuzeichnen versteht, was das Auge getreu wahrgenommen, das Herz erfaßt, der Verstand verarbeitet hat.
Und das ist nicht wenig.
Meine Welt ist nicht klein. Mein Leben war nicht arm. Ich habe es auch, besonders in seiner zweiten Hälfte, von der dieses Buch handelt, nicht blindlings in den Tag hinein gelebt, sondern es hat einen Sinn gehabt. Denn ich habe Freude nicht erlebt, um mich über die Traurigen zu erheben, und das Leid, das über mich ausgeschüttet worden ist, hat meine Seele nicht verhärtet gegen die Frohen. Alles hat sich in Gefühl und Willen verwandelt, und wenn ich sage: mein Leben ist reich geworden durch Niederdrückendes so gut wie durch Erhebendes, so ist das kein Geflunker, und nicht dies mein letztes Buch allein führt den Beweis!
Der Turm meiner eigenen gefestigten Welt ist in die Luft geflogen. Aber ist etwa dem Markt nicht dasselbe passiert? dieser Trümmerstätte einer zerschlagenen und vernichteten Zeit der Lebenden, in deren Mitte das Individuum heutigen Tages steht, Tränen und Blut schwitzend, bis ins Mark verbrannt, brüllend um sich schlagend??
***
Die Katastrophe des Weltkrieges hat die politischen und ökonomischen Grundfesten der Gesellschaft zertrümmert und die Trümmer durcheinandergeworfen, die moralischen vernichtet. Die westliche Menschheit insbesondere hat aus dem Weltkriege keine neue Erkenntnis geschöpft, sie hat nichts gelernt. Ökonomisch und politisch wirkt die Katastrophe nach – die Moral hat vergessen, daß es jemals Krieg gegeben hat.
Das Reine, Hohe lebt in wenigen. Wo es sich regt, aufzuraffen sucht, sinkt es bald aufs neue, verleumdet, verhöhnt und bespien zu Boden nieder. Ehrfurcht und Schrecken gebietend steht allein, unverändert seit je, erzbewährt und triumphierend das Böse, die Niedertracht, die große, augenscheinlich unbesiegliche Dummheit aufrecht vor dem Gewissen der Welt. Der Instinkt, der unverwüstliche Trieb der Bestie, der die Art augenscheinlich nicht anders zu erhalten weiß als durch schonungslose Vernichtung der Mitbestien, triumphiert über den Gedanken, wo er sein Haupt erhebt, nach Geltung ringt.
Seht, wie sie brüderlich beisammenstehen, wenn es gilt, Menschenliebe, Hilfsbereitschaft, Zukunftswillen zu besudeln, unterzukriegen, zu zerstampfen. Den Untergang des Reinen, Hohen, der Wahrheit rasend zu feiern, zu bejubeln!
Die Arbeit zur Fron erniedrigt. Eigennutz, Knechtsinn, wohin man blickt. Der typische Nutznießer, Verräter der Leistungen des Nächsten, des Gedankens, den der Nächste gedacht hat, der Mörder des Traumes, den der Nächste träumt. Vampire und Parasiten der zusammenbrechenden armseligen, von ihren Führern ewig genasführten Sklavenhorde, die um einen Stundenlohn das Erträgnis ihres Lebenstages verschachert – höchstens, daß sie in ein ersehntes Übermorgen hinaufäugt, wo ihre Führer bereits heimatberechtigt geworden sind, in das gepriesene Reich des Bürgers, in das die verelendete, längst unter die Untersten hinuntergesunkene Mittelschicht des Volkes sich, wie in das letzte unveräußerliche Gut ihres Standes, verzweifelt mit Zähnen und Krallen verbissen hat.
Es wird hier ein Wort geredet werden über die Geistigen im Volke. Die Träumer der hohen Träume, die Kämpfer für die hohen Ziele der Menschengemeinschaft! Sofern diese nicht als Bettler vor den Türen ihrer Verächter stehen, froh, wenn durch den vorsichtig geöffneten Spalt ein Knochen von der Tafel zu ihnen hinausfliegt, sind sie Verbündete ihrer Henker geworden, der Nutznießer ihres Verrates, lauern sie frech und triumphierend darauf, sich zum Feind zu schlagen, wenn der erst aufgehört haben wird, vor dem Sieg der Idee zu zittern, für die zu kämpfen sie in die Welt gesandt worden sind.
***
Ich schreibe dieses Buch fast wie ein Toter. Wie einer, der von dem äußeren Leben nichts mehr erwartet und dem, was er erlebt, nurmehr Material ist für seine Arbeit.
Viele, die in diesem Buche vorkommen, sind, während ich es schrieb, gestorben. Viele, die ich für meine Freunde hielt, sind unter meine Feinde gegangen, für mich so gut wie tot. Dies erleichtert meine Arbeit wesentlich. Aber, wenn ich von außen auch nichts mehr erwarte – um so mehr liebe ich meine Arbeit. Nichts weiter erwarte ich von meinem Leben als dies eine, wahr sein zu dürfen bei der Verrichtung und Erfüllung meiner Arbeit. Wahr zu sein gegen mich selbst und treu zu bleiben der großen, der einzigen Pflicht, bis das Licht anbricht.
***
Es wird sich, jawohl, bei dieser Arbeit als notwendig erweisen, daß ein paar menschenähnliche Gestalten auseinandergenommen, aufgetrennt werden, so daß die Sägespäne aus ihnen herausfallen und man, im Hintergrund, hinter diesen Figuren des Lebens das wahrnimmt, was aufzuzeichnen Zweck und Ziel dieses Buches ist, um dessentwillen ich dieses Buch schreibe, nämlich: die Zusammenhänge, das Gewebe der heutigen Gesellschaft.
Bin ich gut? Nein, ich bin es nicht. Müßte ich es sein, um das Recht in Anspruch zu nehmen, daß ich ein Buch schreibe wie dieses? Ich stehe nicht an, Gott anzuklagen darum, daß er den Guten, d. h. den Heiligen unter den Menschen mit Schwäche geschlagen hat, dergestalt, daß dieser zum Untergang im Fleisch vorbestimmt und verurteilt war von Anbeginn. Den Bösen, den Henker, die Bestie mit Säbel, goldklimpernden Hosentaschen, schielendem Blick, den Verräter, der das Maul hält, wenn er schreien, schreit, wenn er verstummen sollte – den hat der Herr mit Stärke gerüstet, er besteht. Warum muß der Gute Opfer seiner eigenen Schwäche werden, sie seinem Verderber offenbaren, vermeinend, dieser sei im Grunde gut und mild wie er selber? Warum?
In der kurzen Zeit, als der Krieg schwelend zu Ende zuckte und verlosch, die große Revolution zugleich flammend aufging im Osten, da glaubte mancher: nun sei die Bestie ersoffen in dem Blut der Millionen Unschuldigen, der Armen, der Toren, der Dummen, der Verratenen und Mißbrauchten der Welt – nun steige das Nordlicht der Vernunft empor. Irrtum. Irrtum. Sieh, wie das Gute, die Reinheit, wie der Heilige weiter gekreuzigt wird, um seiner Liebe, seiner Gerechtigkeit willen, zur Strafe für sein überströmendes Gefühl zur leidenden Kreatur, dem hilflos untergehenden Mitmenschen, den ewig verratenen Massen.
***
Wahrheit dessen, der glaubt. Den die Erfahrung nicht abtötet. Der fortfährt, zu kämpfen gegen Erbarmungslose.
Wahrheit gegen sich selbst, den Feind im eigenen Blut, den Verräter an dem eigenen Gefühl, den Verneiner des Willens zum Hohen, der im eigenen trägen Herzen sitzt und Verzicht brütet.
Wahr sein – letzte Freude von allen! Nach dem Untergang der Hoffnung letzte Freude, Liebe und Haß in einem. Lust an der Arbeit, magnetische Atmosphäre des lebendigen Gewissens. Trieb! Alles sagen, was das Herz, die Sinne, Nerven, was die okkulten Organe des Bewußtseins zu erfassen, wahrzunehmen vermögen; nichts verschweigen, was sich im Laufe eines Menschenlebens in den Gebieten zugetragen hat, in denen der Verstand, das Gefühl, die Ganglien, die Substanz des irdischen Körpers sich zurechtzufinden vermögen. Alles aussagen, was hilft, dem Menschen hilft, diese Mitwelt, dieses Gebilde, das sich menschliche Gesellschaft nennt, dieses irdische Dasein zu erkennen, vielleicht zu ertragen.
Nichts verschweigen als das, was Gott der Herr selbst dem Menschen verschwiegen hat. Was Gott abzuringen Aufgabe der Wissenschaft, der Religion, Lebensziel des Wahrheitssuchers auf Erden ist. Dessen, der sich unterfängt, eine Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht tätig zu erweisen, zu bestätigen: durch Arbeit; im Kampf; wenn es sein muß – und an einem bestimmten Wendepunkt des Lebens muß es sein! – im Kampf gegen Alle, trotz Allen, trotz Vereinsamung, Armut, Härte, Unverstand und Tod – immer, immer für die Gemeinschaft.
***
Maßstab des Weltgeschehens ist das eigene Schicksal. Dem Menschen ist keine andere Möglichkeit gegeben, das Weltall und seine geheimnisvolle Struktur zu erkennen, als: das eigene Leben, das ein Teil dieses Weltalls ist, den eigenen Lebenstrieb zu belauschen. Keine andere Parallele gibt es für das Leben des Weltalls als das eigene kleine, individuelle, zeitlich begrenzte Dasein. Dies zur Apologie dessen, der seine eigene Lebensgeschichte niederschreibt.
Die ewigen Gesetze spiegeln sich im Leben eines Menschen so sinnreich wider wie die Zeit, in der dieses Leben sich abrollt. Nein, es gibt keine gültigere Methode, die Gesetze, die das All regieren, den Einfluß, den die besondere Konstellation der erlebten Gegenwart auf den Ablauf der Gesetze ausübt, zu erfassen, als aufmerksamstes, bewußtestes Erleben des eigenen Lebens. Erkenntnis ohne Schmerz ist keine.
Es gibt für den bewußt lebenden Menschen aber nichts Schmerzhafteres, als wach zu sein. Die meisten Menschen werden es nie. Weckt ein Ereignis sie auf, so greinen sie wie Kinder, deren Schlaf man unterbricht. Und nun soll gar ein Leben so gelebt werden, daß, der es erlebt, stets wach sei, es wahrhaftig lebe! Wie muß der Wache sein Dasein hassen. Kann er es überhaupt ertragen, wenn er sich nicht widerstandslos durch die Instinkte von einem Tag zum andern, aus einer Nacht in die andere hinübertragen, entlangschaukeln läßt, wie über die Welle eines breiten Stromes – ohne Schiffbruch und Untergang zu erleiden?
Wer sein Leben niederschreibt, die Welt zu erkennen trachtet durch sein eigenes Leben, der befindet sich an dem anderen Pol. Fortgesetztes, aufmerksames Bewußtsein und Bewußtwerden; absolute Klarheit; Aufgabe: sich fest fühlen, den Strom an beiden Seiten an sich vorbeischäumen fühlen, wenn möglich ohne Wanken dastehen, standhaft sein, sich nicht fortschwemmen lassen vom um die Füße emporgischtenden Gewässer. Standhaft sein ohne Selbstbetrug, darauf kommt es an.
Dieser Zustand kann natürlich kein endgültiger sein. Für die Zeit, da man, sein Leben betrachtend, es beschreiben will, muß er aber unbedingt erkämpft werden, erreicht sein. Nachher wird sich der sich selbst Betrachtende wahrscheinlich dem Gesetz der Wandlung weiter fügen müssen. Aber diese Stabilität, dieser Zustand der Festigkeit und Ruhe ist notwendig. Ohne ihn erlangt zu haben, kannst du das Werk der Identifikation: Ich – Welt nicht vollbringen. Du mußt den Zweifel in dir niederkämpfen, den Zweifel an dir, an deinem eigenen Schicksal.
Haß und Bewunderung, alle extremen Gefühle, müssen auf die Formel des Fundamentalsatzes gebracht werden, in dem sie aufgehen wie in einem glücklichen Gleichnis, Erkennen der Natur, des Gesetzes selbst, ohne ihr Wesen zu fälschen, zu steigern, zu reduzieren. Schließlich weicht der Begriff Recht und Unrecht, Schuld und Strafe, die Grenze stürzt, und das Vergängliche löst sich aus dem Bereich des Gleichnisses und wird in die Sphäre der Wirklichkeit erhoben, d. h.: des Werkes.
***
Charles Baudelaire
Ame curieuse qui souffres Et vas cherchant ton paradis, Plains-moi! ... sinon, je te maudis!
Paris war seine Heimat, seine Heimat ist nicht zwischen Seine, Marne, Loire; die Zeit seines Lebens war erfüllt von den kleinen Katastrophen der Restauration, des Bürgerkönigtums, Zweiten Kaiserreichs, diese Zeit ist seiner Seele Heimat nicht. Zeitlos, heimatlos sind ja auch sie, die unbegreiflich Großen, die ihres Lebens Spanne durchschreiten mit Schritten, welche den Takt während der Ewigkeiten vor ihrer Geburt erworben zu haben scheinen, den Takt um keine Schwingung geändert haben, wenn sie, ihren Tod hinter sich lassend, neuen Ewigkeiten zuschreiten. Aber manches große Leben ist wie von einer ungeheuren, feindseligen Faust tief in den widerstrebenden Boden einer Nation, eines Zeitalters hineingetrieben, und nach Jahrzehnten, Jahrhunderten, wenn der Boden längst verebbt und das Fundament dieses Lebens sichtbar geworden ist, hält es noch schwer, in ihm lediglich den Fremdkörper zu erkennen, der es doch war, so viele feine Fasern, Wurzeln ähnlich, blieben an ihm haften. Man darf sagen: dieser Leben Heimat war so recht eigentlich der Schmerz, und ein Schleier von tiefem menschlichem Mitgefühl wird vor dem Auge stehn, das jene Leben aus der Ferne betrachtet.
Hugo, Balzac, Flaubert: es sind die Souveräne, unter denen Baudelaire gelebt hat; in ihrer Mitte mag sein Vaterland gezeichnet sein. Ihnen diente wohl die Welt, in der sie standen, keinem höheren Zwecke, als das mitgeborene Wissen um ewige Dinge an ihr zu kontrollieren. Breit und wuchtig fällt ihr Schatten vom Horizont noch in unsere Tage herein. Zwischen ihnen, die da ragen aufrecht und übergroß wie mächtige Granite – Hugo, den Seherblick über sein erbebendes Volk hinweg auf Wolkenzüge gerichtet, – Balzac, den stahlscharfen Blick, dem Irdischen grimmiger zugewandt, durch das Gewimmel der Zusammenhänge ins innerste Räderwerk der Grundleidenschaften versenkt, – Flaubert, den verschlossenen Blick, damit an dem Spiel der heimlichsten Reflexbewegungen Drang und Bedrängnis sich enthülle, grausam nach innen gekehrt – zwischen ihnen erscheint uns Baudelaire in der Gestalt des »sinnenden Mannes« von Rodin, menschenähnlicher, wiewohl aus einem Felsen losgerissen, nackt und in Krämpfen, die noch die Materie durchschüttern, den ganzen Leib vom schmerzhaften Aufruhr einer unverständlichen Verdammnis verkrümmt. Rings um ihn brausen die offenkundigen Gewalten, die die Welt erfüllen, ihren Lauf lenkend, sie sind zu einer fast greifbaren Gegenwärtigkeit geweckt durch jene großen Beschwörer, in Rhythmen gegossen, Sentenzen gepreßt, Rede und Gegenrede gezwungen, die Ewigkeit selbst scheint sie eingegeben zu haben, so überkräftig schwellen sie den Rahmen der Sprache – allein er horcht vor sich hin. Die Stimmen, die in ihm erklingen, spärlicher hineindringen von außen, einander zu verwegen schönen Akkorden ergänzen, in Dissonanzen zusammenschlagen, deren Weh schöner noch ist, die Stimmen, auf die er horcht, haben mit jenem Brausen um ihn nichts gemein. Unter ihnen vibriert heimlich und fremd ein Ton, es erfüllt ihn mit Schrecken, denn er erkennt sein tödliches Schicksal in dem Ton, mit Jubel, denn es ist der eigene Ton, den er erkannt hat. In Jahren, in denen das junge Herz und Hirn vor die harte, nicht selten zermalmende Notwendigkeit gestellt ist: sich zurechtzufinden in den verworrenen Wegen der äußeren Schicksale, die frohe Unbotmäßigkeit sich zu wahren gegenüber den mitlebenden geistigen Herrschern – in diesen Jahren erschließt sich ihm die Erkenntnis einer weit bitteren Aufgabe: sich zurechtzufinden in der eignen absonderlichen Natur. Sie ist keine von den siegreichen; unterliegen ward ihr Teil, ihre Eigenart; sie kann sich nur behaupten, indem sie unterliegt. Wohl fällt Hugos All in ihr Bereich, wie Balzacs mächtige diesseitige Welt. Aber beide sind für sie nur die gleiche Quelle des Leidens; denn mit der steten, rätselvollen Angst behaftet, auf den Pfaden der Höhe den Erdboden nicht unter den Füßen zu verlieren, auf den Pfaden der Tiefe den Sinn frei und hoch zu bewahren, fühlt sie sich auf keinem heimisch, vergeht in Sehnsucht, stirbt an Zwiespältigkeit; zudem ist ihr die verhängnisvolle Gabe der Analyse mitgegeben, und während sie Flauberts blinkende Waffe nervig und unerbittlich gegen sich selbst handhabt, legt sie vor ihrem Gewissen die Eigenschaften bloß, die sie von allem Glück, von Ruhe, Schönheit, Harmonie scheiden. Eine Welt gilts zu entbinden, der das Siegel des Duldens, der fruchtlosen Auflehnung aufgepreßt ist, es gilt, sie den Welten rings, die der Triumph über das Leben zu Tage förderte, zur Seite zu stellen. In dieser Anstrengung eines kranken Titanen werden sich die Nerven, Muskeln des Genius anspannen bis zum Zerreißen; das irdische Herz wird sich vor der Helle der Gefühle, die sich bis zur Intensität von Gesichten sublimieren, zusammenkrampfen, wie ein Auge schließen, in die künstlichen Grotten des Vergessens, tiefster Nacht flüchten – um nach teuer erkaufter Rast, in übermenschlichem Aufraffen wieder emporzufahren in die mörderische Gegenwart.
Es läßt sich ausdenken, zu welcher unverhältnismäßigen Bedeutung die äußeren Verhältnisse dem Menschen erwachsen können, müssen, der ein Schicksal so voll einsamer Tragik auszukämpfen haben wird. Und was kommt dem Schmerz gleich, der darin liegt: Schöpfer einer fremden, befremdlichen Welt sein zu müssen in einer Gegenwart, die den notwendigsten äußeren Bedingungen einer gesteigerten Existenz ihr höhnisches Nein entgegenstellt? Die Geschichte der Literatur ist ja eine lange Reihe von Exempeln, wie die Menschen jene zu foltern wußten, die sich selbst gefoltert haben, doch gingen wohl selten die Entwicklungslinien eines Zeitlaufs und der Besten, deren Dasein sich in ihm abspielte, so scharf auseinander wie zu Baudelaires Lebzeiten. Noch bedeutete der Name Napoleons mehr als eine Legende bloß, auf den Straßen, in den Gärten von Paris konnte man zerschossene Krüppel mit irrer Liebe von dem Manne reden hören, für dessen Ehrgeiz die Brüder und Kameraden ihr Leben lassen durften – aber es war, als seien in jenem kaum erloschenen Brande alle edlen Säfte der Nation verraucht.
In den Geschichtsbüchern jener Epoche steht zu lesen, daß eine schale, furchtsame und vernünftlerische Reaktion das öffentliche Leben jeder Größe entkleidete, daß der überstürzte Wechsel der Regime doch nur Namen zu Tage förderte, die alsbald Synonyme für Freiheit, Beschränktheit, niedre Kriecherei wurden. In diesem Frankreich, in dem stets nur der Adel und der Pöbel sich wahrhaft erhaben gezeigt, hatte die wirtschaftliche Erschütterung der Revolution einen Kleinbürgerstand jählings hochgebracht, dessen langunterdrückte Herrschsucht, Geldgier, trübe Instinkte mit explosiver Kraft, einer Flut von Gold und Kot alles überschwemmten.
Hierro! Eisen – die Parole, die Hugo seinen Leuten in die »Ernani«-Schlacht mitgab, blieb für die junge Romantische Schule die Losung, sich von der herrschenden Klasse (der sie zum größeren Teil entstammte) abzuwenden, zusammenzuschließen. Das Schlagwort »Fortschritt«, das im politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Leben allmählich identisch wurde mit Industrialismus, brutaler Nivellierung, Unterdrückung der Gegensätze mit Ausnahme jener des Besitzes, dieses Wort wurde den Künstlern ein Antrieb zur freiesten, ja ungezügelten Betonung, Unterstreichung des Andersgeartetseins. Die Menschenalter, die darüber vergangen sind, haben diese Divergenz, scheints, immer schärfer herausgearbeitet. Einer Dichtergeneration, die von den Romantikern herkommt, wurde der Name des Verfalls, der Dekadenz angeheftet, nicht etwa, weil sie gleich den ähnlich gekennzeichneten Schriftstellern der antiken Literaturen getreuer Spiegel ihrer hochentwickelten Zeit war, sondern offenbar: weil sie durch ihre Werke ihre tiefwurzelnde persönliche Kultur in schroffen Gegensatz stellte zur prahlerischen Civilisation ihrer eigentlich der Barbarei näherstehenden Zeit. Ihre Sonderstellung ist vielleicht nicht mehr allein durch ihr Anderssein bedingt, sondern durch eine der Notwehr entsprungene Erhitzung, Übertreibung dieses Andersseins, ein dem Selbsterhaltungstrieb gemäßes eindringliches Verweilen bei den Gegensätzen, die sie isolieren.
So wird die laute Anbetung der Sünde, das unbeschönigte sich zu einem Laster Bekennen, das unbedingte Kapitulieren vor scharfen, ätzenden, von der Natürlichkeit wegdrängenden Trieben, das Abweisen jener ausgleichenden Hypocrisie »Moral«, die Erhebung des Pessimismus zum Lebensregenten – als Revolte einsamer, von Überdruß und Verachtung erfüllter Seelen anzusehen sein, die vor dem Leben die Waffen strecken, weil sie den Kampf mit der Übermacht verschmähen.
***
Frans Masereel
Dieser Zeit den Spiegel vorhalten? Zu große Ehre! Vitriol in die Fratze dieser Zeit!
Weggeätzt, fortgefegt diese Grimasse eines Zeitalters vom Angesicht der Geschichte.
Dem parasitischen Ungeziefer der Verdiener durch den Krieg, die Revolution, durch Niederbruch, Aufbau, durch aktive Teilnahme und neutrales Zusehn, durch Aussaugen der Sieger und der Besiegten, der ewig Betrogenen des letzten Standes – den bombensicheren Generalstabshöhlen der Aufsichtsräte, Industriekonzerne, Finanzententen – den Bordellen der Meinungsfabriken, in denen behaglich der nächste furchtbarste aller Kriege vorbereitet wird – den Kerkern des freien Gedankens, der selbstlosen Empörung, des reinen Menschheitstraums – Vitriol in die Fratze der schamlosen Hure Welt und Heute und dann einen tiefen Atemzug und auf und davon. –
Der Künstler soll ...
Der Künstler soll gar nichts. Er tut, wozu es ihn treibt. Was dasteht, aus seinem Trieb geboren, erweist Wert und Wesen seines Menschenwerkes, die Tiefe seiner Erdenspur ist bleibender Maßstab seiner Kunst, es gibt keine Tat, die in der Luft schwebte, ein Gebild aus nichts wäre, selbst Fata Morgana ahmt die Stätten dieser Erde nach, dieses Daseins unterm rollenden Sternenzelt.
Sei ein Märtyrer zuende gegangener Zeiten. Strecke die Arme sehnsüchtig aus nach irgend etwas, das nicht wiederkommen wird. Sei der verspätete lächerliche Scharfrichter eines längst geköpften Monstrums. Suche auf abseitigen Wegen verschwundener Kulturbezirke Gesetze von Religionen, die Kanons mythischer Kunst. Oder stelle dich mit schluchzendem Blick auf den Hügel vor das Gewimmel, mit segnender Gebärde oder fluchender Gebärde auf den Hügel, wo dich niemand kreuzigen wird. Stelle dich doch auf den Hügel und schreie aus vollen Lungen, wenn auch wellig aus dem Innern heraus, das Wort Brüderlichkeit in die Runde – aber lebe dann danach, wenn auf der anderen Seite du heil und ungeschoren im Glanz deines Manifests zu deinesgleichen abwärts steigst!
Selbst Dante, Shelley, Poe tauchten in der Wirklichkeit unter, sahen mit wachem Blick unter den Fluten das nackte Ringen der Elemente um sich, selbst Michelangelo, Beethoven suchten die Brandung der Volksleidenschaft auf, wo sie am erregtesten in die Höhe zischte, streiften nicht den hohen Kothurn ab, um eine Zehe vorsichtig in die vorübereilende Welle zu tauchen und den Anschein zu erwecken, als hätten sie knietief im Sumpf der Zeitwirren gewatet. – Es gibt welche, die wollen mit Konstruktionen die Welt aus den Angeln heben und sie auf den richtigen Fleck setzen, Konstruktionen geometrischer Art, oder aus Tönen, oder aus Wortgebilden absonderlicher Art, aus der Absonderlichkeit der Epoche zusammengefügt. Emsig und vergeblich suchen diese den archimedischen Punkt, von dem aus sie dem renitenten Koloß beikommen könnten, aber das verborgene Gesetz entwischt höhnisch ihrer Anstrengung, lahm und mit hängendem Kinn sehen sie sich an.
Oder man stößt auf welche, in denen die Lust darüber: daß es eine Zeit und Figuren und Arabesken und Zustände dieses nie dagewesenen, nie wiederkehrenden, kostbaren Heute gibt, sich überschlägt, und diese jagen an dem Rande der Gesellschaft dahin, johlen und zetern sich heiser, und es gelingt ihnen nicht, die schrille Welt parodistisch noch zu überschrillen.
Es gehören schon ein paar tüchtige breite Füße dazu, in dem apokalyptischen Totentanz dieser Epoche mitteninne sein Gleichgewicht zu bewahren; es gehört ein guter kühler Schädel dazu, der es verhindert, daß das heiße Herz mit den übrigen Gliedmaßen durchbrenne; der Drang, dem unheimlich mächtigen Regen einer aus dem Chaos werdenden Welt nicht dummeraugusthaft, mit läppischen Scheingesten, sondern kräftigem Zupacken an der richtigen Stelle nachzuhelfen, erfordert ein paar harte, unmanikürte Fäuste; und erst wo schöpferische Rebellion und nicht im geringsten wehleidige Gerechtigkeit sich auf natürliche, unproblematische Art die Waage halten, gewinnt eine Tat, ein Werk, ein Mensch dieser Zeit Bestand. Bestand, das heißt: sein umzirkeltes Teil an dem komplizierten Geschehen dieser Periode, die ihre Lebenselemente aus bedachtem Vernichten des Überlebten ebenso wie aus wissenschaftlicher Arbeit an der Utopie herbezieht. In einer so sehr der Mechanisierung unterworfenen Periode der Weltauflösung, wie die es ist, die wir erleiden, gilt der Phantasiemensch mit dem soliden Boden des Möglichen unter den Füßen.
Ein solch erlesenes Individuum kann natürlich, einerlei, aus welcher innersten Berufsbetätigung er auch herstamme, nur der Mensch sein, in dem der Glaube an den sozialen Kampf als einzige Verheißung einer Neuschaffung der Welt alle Fähigkeiten, jegliches Handeln, sämtliche Instinkte bestimmt und lenkt. In dem Haß und Liebe zu dieser Zeitspanne derartig dosiert sind, daß die chemische Zusammensetzung die Explosivkraft des Organismus steigert. Im erlesenen, für den sozialen Kampf, den moralischen Erneuerungswillen der Welt auserlesenen Individuum dieser Art hat sich das die Art Erhaltende sublimiert. Die Tradition jagt strömend nach dem erst in den Umrissen erkannten Besseren durch seine Seele hindurch, so daß er, rätselhaft hingerissen, selber mitreißt. Wenn er auch nicht den Anstoß zur Höherentwicklung gibt, so wird die Entwicklung doch durch ihn getrieben und beschleunigt. Es ist fast gleichgültig, woher er kommt, er wird, auch wenn er seine Zeit noch so leidenschaftlich verneint, ihr Exponent bleiben. Von wo und wann man seine Erscheinung auch betrachten wird, er wird nie anachronistisch wirken durch seine Hingabe an das Zukünftige, weil seine Verbindung mit der Masse und dem, was die Bewegung der Massen bestimmt, nicht aus einer begrenzten Zeit erklärt werden kann.
Die Formel eines solchen, für alle Zeiten wesentlichen Menschen ist: was geschieht, geht ihn zutiefst an. Er nimmt nicht nur teil an dem, was geschieht: ob er es verdammen muß oder nicht, er bekennt sich zu dem, was geschieht: ob er es bekämpfen oder von Mitleid geschüttelt beklagen muß, er ist zu sehr aus dem Stoff der Zeit, des Lebens geschaffen, und wenn es nur das Närrische ist, was ihn an dem Geschehen reizt, er wird nicht die Zähne blecken wie ein zynischer Wolf, sondern lachen, wirklich, aus voller Kehle dazu lachen.
Aber im Guten und Bösen, bei allem wird er sein gutes Messer im Stiefelschaft behalten, es verläßt ihn nicht, und er weiß, wenn er es hervorziehen wird, so wird das nicht allein zur Selbstwehr sein.
***
Einige Künstler lenken heute die Kunst zum politischen Dienst an der Gegenwart hinüber. Sie hören keineswegs auf, Künstler zu sein, so wie sich ihre Kunst nichts vergibt dadurch, daß sie gelegentlich Agitation, Mittelsperson, Zweckbereitung wird. Im Grunde wird die Kunst eines Menschen dieser phantastisch aufgewühlten, heillos widerspruchsvollen Zeit – vorausgesetzt, daß er eben der in der höheren Sphäre seines Daseins lebende Mensch sei, als der der Künstler zu gelten hat – gar nicht anders können, als in einem religiösen Sinne der Zeit, ihren Zielen, der Gesamtheit der Menschen mit voller Kraft zu dienen, bewußt oder unbewußt. Es gibt aber trotzdem nicht viele Künstler dieser Art in der gefährlichen Epoche, die wir gegenwärtig durchleben. Einer der kleinen Schar ist Masereel.
Man müßte sagen, dann und dann geboren, dort und von Eltern dieser Rasse oder jener. Damit wäre wenig getan, weder zur Erklärung des Menschen noch der Zeit, des Landes, noch der Tradition und wie das alles zusammenhängt.
Der religiöse Trieb zur Gesamtheit, aus dem heraus jedes wirkliche Werk geschaffen ist und der Saft der Energie seines Schöpfers quillt, sucht sich auf die Vorstellungswelt seiner Umgebung, auf das Milieu zu verbreiten, in dem die Zufalls-Existenz des Künstlermenschen sich abspielt. Er findet hier die Kronzeugen, die Mithelfer, die zur Verdeutlichung seines Wollens geeignetsten Figuren seiner Vision, und so läßt er selbst sich lokalisieren.
Auf diese Weise hat der Bauernbrueghel die Landsknechte zu seinem betlehemitischen Kindermord ausgesucht; Grünewald nagelt seinen bäurischen Christus ans Kreuz und stellt ihm Marien und Jünger aus der Nachbargasse hin; Meuniers Mater Dolorosa kniet am Schachtausgang einer Borinage-Grube; Charles-Louis Philippe findet die Gestalten seiner Passionsgeschichte in den Zuhälterkneipen von Montparnasse. Sogar Bosch holt sich seine Fabelwesen und Höllenausgeburten aus der Vorstellungswelt seines Dorfkatecheten heraus, und die Phantastik der ins Abstruse überkugelnden Vision Ensors zeigt und enthüllt ganz genau den Untertan des über ein verjesuitertes Belgien regierenden Congo-Leopold, der den Überdruß an der Umwelt mit der Mystik des Kirchenglaubens in sich gesogen hat – an die ihn das Glockenspiel des nahen Belfrieds viermal vierundzwanzigmal am Tage erinnert.
Das soziale Individuum Masereel, den sehenden Menschen, dem's in den Fingern zuckt, darf man sich in einer jener kleinen Verbindungsgassen vorstellen, die in belgischen Seebädern von der vornehmen Digue zum gemeinen Hafenviertel führen. Enge, geräuschvolle Gasse, von Läden, billigen Logierhäusern, mittleren Wirtschaften belebt, in ihr schlägt die Brandung des Amüsements, des Geschäftes, des Müßigganges, des harten körperlichen Robots von beiden Seiten zusammen. Ginge er entschlossen nach links, zu den schweren beladenen Schuftern der Barken, Fischzügen, Teerern und Tonnenwälzern, dem mühseligen Sichschinden am Tage und der stampfenden, Bier und Schiedam vollen Geilheit der bunten Laternen bei Nacht – der Demagog hätte es leicht. Ginge er nach rechts, zu den Flaneuren, Flirtern, dem Flausenvolk der Luxushotels, wo aus dem Erwarten der Börsenkurse und dem Kasinospiel sich Tag und Nacht zum raffinierten Halbdunkel der unbekümmerten Genießerexistenz ineinanderwebt – der Karikaturist hätte es nicht minder leicht. Zwischen Luxus und Robot mischt und verwühlt sich das kleine Gewimmel der übereinander rollenden, ineinander prallenden Klassenschichten, dieser geschäftige, nimmer zur Ruhe kommende Pfuhl, durch den die trivialen Instinkte von rechts und links wie eine rinnende Gosse der niederen Bourgeoisie hindurchlaufen. Gier und Zufriedenheit, Nachahmungstrieb und Anspannung, Trinkgeld, durch das der rechter Hand Genießende den linker Hand Schuftenden korrumpiert, Neid und versteckt geballte Faust, nach dem fertiggemachten Bett des Gemästeten im Grandhotel geschüttelt, mitteninne in der kleinen Gasse des mittleren Pharisäertums steht der breitbeinige Flame, das solide Messer im Stiefelschaft.
Mit den Karikaturisten dieser Epoche hat es seine eigene Bewandtnis. Seht den gefährlichsten, angriffstüchtigsten unter den Lebenden, George Grosz, oder den, den die Dämonie der Zeit noch tiefer gepackt hat und mystisch schüttelt, den Amerikaner Art Young. Sie treiben ihre Groteskenherden peitschenknallend durch die Avenuen der herrschenden Klasse, die Fünfte in Neuyork, den Kurfürstendamm in Berlin – da öffnen sich alle Fenster, in den Fenstern erscheinen die Urbilder, die Urtypen des Angriffs in natura, sie beugen sich lachend, entzückt und Beifall rufend weit über die Brüstung, um besser zusehen zu können, wie die Geißel, die spitze Lanze, der scharfe Bleistift sie selber dort unten vorwärts treibt. Diese Zeit ist in ihrem Kern so burlesk verworfen, über jeden Begriff, daß der Angriff abprallt, die Kraft erlahmt, die Wut sich an der ehernen Selbstsicherheit des Gemeinen zuschanden stößt. Seht die Karikaturisten dieser Zeit – verblüfft bleiben sie stehen, wischen sich mit dem Handrücken den sauren Schweiß ihres ehrlichen Sadismus von der Stirn, während das dankbare Publikum, gerade die, die sie vernichtet wähnten, ihnen aus allen Fenstern zujubelt! Die Zeit verbraucht ihre Waffen, die schweren Geschütze, die leichten, den Lohn, den Geist. Bestand hat nur eines: und das ist, das Leben verflucht ernst, blutig und bitterernst nehmen. Ohne Voreingenommenheit, ohne Staunen, ohne Übermut, ohne Grauen, nicht aus der Verkürzung, nicht von oben, nicht von unten, nicht von der Seite, nicht um die Ecke, sondern voll ins Gesicht dieses Lebens von heute schauen, en face, mitten hinein in die blutvolle, strotzende Visage, in die stahlkalten, unzwinkernden Augen, in das fleischige Raubtiermaul zwischen den festen blaurasierten Backen.
Das Leben dieser Welt so verflucht ernst nehmen wie das eigene Schicksal. Jeder Ernst bewirkt, daß die Menschen aufhorchen. Das Tremolo des Satirikers kitzelt sich ihnen zum einen Ohr hinein, zum anderen hinaus – der bare, nackte Schmerz bleibt sitzen, innen. Der Lachende dort unten mit der Peitsche hinter seinen Grotesken widerlegt ja selber die Gefahr, es ist ja nicht so tragisch gemeint, aber ein einziger wilder Ton des innersten Grimmes, der tiefsten Pein von dort unten ist genug, daß die Fenster rasch zugemacht werden, in den Häusern Stille wird.
Das Schicksal der Massen, der großen, in ihrem Aufschwung wie im Versagen gleich hilflosen, hilfebedürftigen Massen des Volkes als sein eigenes fühlen, auf Leben und Tod, das bestimmt die Wirkung des Künstlers, der den sozialen Kampf kämpft; der in diese Zeit gesetzt, sich von ihr nicht unterkriegen läßt, die Distanz wahrt und doch in allen Manifestationen unlösliche Verbundenheit erkennen läßt.
Es bewahrt ihn vor der verhängnisvollsten Klippe, an der ein großes Künstlergeschick scheitern kann – das nie ins Volk hinein wirken durfte, aus dem es doch stammte, seinen Saft herzog –, diese Klippe ist: das Leid der Gegenwart allzu einseitig, wehleidig, monomanisch auf sich selbst allein zu beziehen. Daran ist die überwältigende Kampfenergie des großen Strindberg, eines durch und durch heutigen Menschen, zerschellt, dieser Motor trieb nicht das Werk der Allgemeinheit. Das heroische Leiden der Masse in seinem kleinen Schicksal mitspüren, nicht sein eigenes Leiden heroisieren und über dem der Masse empfinden! Der kollektiv fühlende, leidende, hoffende Kämpfer, der seine Befreiung nur in dem Sieg der Allgemeinheit begründet findet und erkennt, er ist der so erlesene Künstler, der Genosse, dem der brüderliche Arm gut um die Schultern paßt. Was hat Land und Rasse, Zeit und Partei, was die speziell vorgezeichnete Disziplin der Revolte zu bedeuten. In dem Werk eines Künstlers dieser Kategorie fließt alles zusammen im guten, soliden Allgemeinbegriff Mensch. –
Den Mittelpunkt fast aller Holzschnittfolgen, in denen Masereel sein Leben im Alltag, unter den Heutigen, sein Leben unter vielen darzustellen sich bemüht, bezeichnet dieselbe Figur: ein gesunder, lang aufgeschossener Bauernkerl mit einem sensitiven Kopf, der der derbknochigen Gestalt einigermaßen widerspricht.
Diese Holzschnittfolgen, das sei rasch gesagt, sind von keinem Text unterbrochen oder zusammengehalten, sie haben etwas vom Film, aber mehr noch von der Biblia Pauperum. Man kann sie in jedem Land, vor Menschen aller Sprachen abrollen lassen, sie werden überall verstanden sein; man kann sie in Himmelsgegenden, wo neunzig Prozent der Passanten Analphabeten sind, an die Mauern kleben – ich spreche gleich davon –, und man kann sie auf Büttenpapier gedruckt als Angebinde auf Boudoirtischen hinterlassen – ich komme darauf nicht mehr zurück –, kurz, sie bewähren sich an manchem Ort: das ist auch ein Witz dieser außergewöhnlichen Kunst.
Der lange Bursche geht in einer Attitüde, als hätte er immer die Hände in den Hosentaschen, nein, er geht