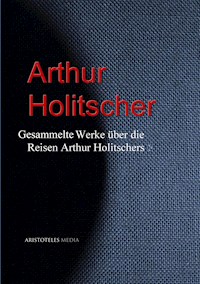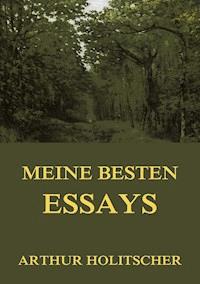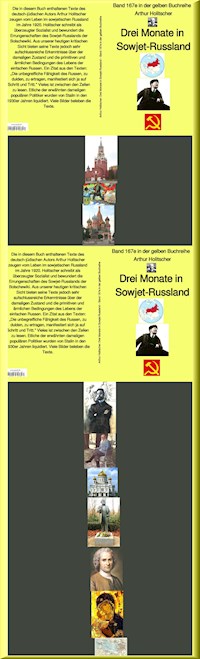
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: gelbe Buchreihe
- Sprache: Deutsch
Die in diesem Buch enthaltenen Texte des deutsch-jüdischen Autors Arthur Holitscher zeugen vom Leben im sowjetischen Russland im Jahre 1920. Holitscher schreibt als überzeugter Sozialist und bewundert die Errungenschaften des Sowjet-Russlands der Bolschewiki. Aus unserer heutigen kritischen Sicht bieten seine Texte jedoch sehr aufschlussreiche Erkenntnisse über der damaligen Zustand und die primitiven und ärmlichen Bedingungen des Lebens der einfachen Russen. Ein Zitat aus den Texten: "Die unbegreifliche Fähigkeit des Russen, zu dulden, zu ertragen, manifestiert sich ja auf Schritt und Tritt." Vieles ist zwischen den Zeilen zu lesen. Etliche der erwähnten damaligen populären Politiker wurden von Stalin in den 1930er Jahren liquidiert. Viele Bilder beleben die Texte. - Rezension zur maritimen gelben Reihe: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arthur Holitscher
Arthur Holitscher: Drei Monate in Sowjet-Russland
Band 167 in der gelben Buchreihe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Der Autor Arthur Holitscher
Vorbemerkung zu Sowjet-Russland
Arthur Holitscher: Drei Monate in Sowjet-Russland
Das Arbeiter-Volk
Subbotnik
Das Rote Heer
Propaganda
Von der Arbeitsschule
Proletkult
Chaos der Künste
Der Untergang der Intellektuellen
Schaljappin
Das Leben der Städte
Bourgeois
Der weiße Terror und der rote
Religion
Weltrevolution
Die gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.
Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.
Hamburg, 2021 Jürgen Ruszkowski
Ruhestands-Arbeitsplatz
Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers
* * *
Der Autor Arthur Holitscher
Der Autor Arthur Holitscher
https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/holitsch.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Holitscher
Geboren am 22.8.1869 in Budapest; gestorben am 14.10.1941 in Genf. Der Spross einer Budapester großbürgerlichen jüdischen Kaufmannsfamilie war nach dem Abitur sechs Jahre lang Bankangestellter in Budapest, Fiume und Wien. Er selbst sah sich immer als Österreicher oder Deutschen, aber nicht als ungarischen Juden. 1895 ging er als freier Autor nach Paris; 1897 wurde er Redakteur des „Simplicissimus“ in München. Nach Jahren eines unsteten Reiselebens zwischen Paris, Budapest, Brüssel, Rom, Neapel und München übersiedelte er 1907 nach Berlin, wo er Lektor von Cassirer wurde. Als Reiseschriftsteller besuchte er die USA, die UdSSR, Indien, China, Japan. 1933 wurden seine Bücher von den Nationalsozialisten verbrannt, er nahm seinen Wohnsitz in Paris, Ascona und zuletzt in Genf, wo er 1941 verarmt, verlassen und fast erblindet starb – seine Grabrede hielt Robert Musil.
Robert Musil – 1880 – 1942
Quelle: Killy Literaturlexikon
* * *
Vorbemerkung zu Sowjet-Russland
Vorbemerkung zu Sowjet-Russland
Wladimir Iljitsch Lenin – Владимир Ильич Ленин – 1870 – 1924
https://www.dhm.de/lemo/biografie/wladimir-lenin
In den „Aprilthesen“ formuliert Lenin sein radikalrevolutionäres Programm, worin er den sofortigen Frieden, eine einschneidende Landreform und eine Räteregierung fordert.
Juli: Der von den Bolschewiken mitgetragene Juliaufstand scheitert, Lenin flieht nach Finnland.
7. November: Der von Leo D. Trotzki organisierte Putsch bringt die Bolschewiken an die Macht, Lenin ruft daraufhin die Räterepublik aus.
* * *
https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetrussland
Als Sowjetrussland wurde die Russische Sowjetrepublik vor Errichtung der Sowjetunion (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) bezeichnet, also etwa in der Zeit von der Oktoberrevolution 1917 über den Russischen Bürgerkrieg bis zur Unionsverfassung von 1922 (auch informelle Bezeichnung der russischen Regierung vor Gründung der Sowjetunion).
https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/47918/revolutionaere-neuordnung-und-stalin-diktatur-1918-1953
Die revolutionäre Neuordnung von Staat und Gesellschaft vollzog sich allerdings unter extremen Bedingungen. Bereits im Frühjahr 1918 kam es zwischen „Weißen“, Gegnern des Oktoberumsturzes, von denen manche die alte zarische Ordnung wiederherstellen wollten, und „Roten“, den Bolschewiki, zu heftigen Kämpfen. Großbritannien, die USA, Japan und Frankreich entsandten Interventionstruppen, die die Weißen gegen die sowjetische Seite unterstützten.
Boris Kustodijew: „Der Bolschewik“
In einer ungeheuren Kraftanstrengung organisierten die Bolschewiki den Widerstand und bauten eine mit massiver Repression verbundene, rigide Versorgungsdiktatur auf. Der „Kommunismus“ der Bürgerkriegsphase mit Hochinflation und gewaltsamer Beschlagnahmung lebensnotwendiger Güter war eine überbürokratisierte Organisation des Mangels, die im ganzen Land Unzufriedenheit und Widerstand hervorrief. Die Industrieproduktion sank im Bürgerkrieg auf ein Minimum, der Schwarzmarkt blühte. In nur zwei Jahren gelang es den Bolschewiki, ihre soziale Basis zu ruinieren: Die Arbeiterschaft befand sich durch den Zerfall der Industrie im Zustand der Auflösung, die bäuerliche Bevölkerungsmehrheit, ursprünglich durch das Bodendekret 1917 für die Sowjetmacht gewonnen, befand sich 1920 im Aufstand. Das System des „Kriegskommunismus“ war trotz des militärischen Sieges bankrott und konnte nur durch massive Repressionen gegen Bauern, streikende Arbeiter und Oppositionelle aufrechterhalten werden.
Nach der Niederschlagung der „Weißen“ entschied sich die sowjetische Führung unter Lenin zu einer politischen Wende. Sie ersetzte im März 1921 die Ablieferungspflicht durch eine Naturalsteuer und gab den Handel mit Überschüssen frei. Damit öffnete sie den Weg für die Entstehung eines Agrarmarktes, der sich rasch entfaltete und zu einer deutlichen Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion führte. Da die sowjetische Führung nach Vertreibung der Weißen und Unterdrückung aller konkurrierenden linken Parteien wie Menschewiki und Sozialrevolutionäre ein politisches Monopol innehatte, konnte sie sich die Verfügung über Großindustrie, Banken und Außenhandel vorbehalten und so weiterhin die Wirtschaftsentwicklung kontrollieren.
Lenin inspiziert auf dem Roten Platz in Moskau zusammen mit Kommandeuren allgemeine Truppen der Roten Armee (25. Mai 1919)
Ziel der „Neuen Ökonomischen Politik“ (NÖP) war einerseits die Steigerung der Wirtschaftsleistung, andererseits die Versöhnung der Gesellschaft mit dem Regime und damit die Überwindung der Folgen von Bürgerkrieg und Versorgungsdiktatur. Von 1921 bis 1928 herrschte ein fragiles soziales Einvernehmen, das es ermöglichte, die Wirtschaftsleistung der Vorkriegszeit wieder zu erreichen und die Basis für die weitere Industrialisierung des Landes zu schaffen.
An der Spitze der „Russischen Kommunistischen Partei“ (der Bolschewiki) kam es indessen zu heftigen Führungskämpfen, in denen sich letztlich Generalsekretär Iosif Wissarionowitsch Stalin (1879-1953) durchsetzte.
Josef Wissarionowitsch Stalin – Иосиф Виссарионович Сталин – 1879 – 1953
Er verstand es, die emotionale Reaktion auf den Tod Lenins am 24. Januar 1924 auszunutzen und einen Lenin-Kult zu organisieren, der vom Aufbau einer bürokratischen Organisation flankiert wurde. Dieser Apparat war die Machtbasis, mit deren Hilfe Stalin nach der Ausschaltung seiner Gegner Ende der Zwanzigerjahre die dominierende Figur wurde. In Fortentwicklung des Lenin-Kults wurde nun auch Stalin das Objekt kultischer Verehrung. Aus der Mythisierung seiner Person erwuchs ihm zusätzliche Macht.
* * *
Arthur Holitscher: Drei Monate in Sowjet-Russland
Arthur Holitscher: Drei Monate in Sowjet-Russland
Arthur Holitscher – Clara Zetkin – Claude McKay – in Moskau
https://www.projekt-gutenberg.org/holitsch/3monate/3monate.html
1921 in Berlin im Verlag S. Fischer erschienen
* * *
Und nun sage ich euch: Lasset ab von diesen Menschen,
und lasset sie fahren.
Ist der Rat oder das Werk aus den Menschen,
so wird’s untergehen;
Ist’s aber aus Gott, so könnt ihrs nicht dämpfen;
Auf dass ihr nicht erfunden werdet,
als die wider Gott streiten wollen.
Apostelgeschichte 5, 38-39
* * *
„Die Wahrheit über Sowjetrussland“
In der ersten Septemberwoche des Jahres 1920 schickte Karl Radek, der damals im Gefängnis Moabit saß, einen Sendboten zu mir mit der Frage, ob ich mich einer Kommission anschließen wolle, die zusammen mit ihm nach Russland reisen würde. Diese Kommission bestand aus Sachverständigen für die Landwirtschaft, die Industrie, einem ehemaligen Staatssekretär als Fachkundigen für das Verwaltungswesen, einem Vertreter der Berliner radikalen Arbeiterschaft und dem Polizeipräsidenten einer großen Schweizer Stadt. Ich sollte die Ergebnisse dieser Reise in einem Buche niederlegen. Ich sagte sofort zu und traf dann im Laufe des Herbstes wiederholt mit Mitgliedern dieser Kommission im Empfangszimmer des Moabiter Gefängnisses zusammen, wo wir mit Radek unter Aufsicht eines Inspektors sprechen durften.
Karl Radek – Карл Бернгардович Радек – 1885 – 1939
Journalist und Politiker, der in Polen, Deutschland und der Sowjetunion wirkte
Die Abreise der Kommission, die Radek vonseiten der deutschen Regierung gewährleistet zu sein schien, verzögerte sich von Woche zu Woche. Radek wurde dann im Januar des laufenden Jahres allein und heimlich über die Grenze gebracht.
Je weiter unsere Abreise hinausgeschoben wurde, umso enttäuschter wurde ich in Bezug auf die Möglichkeit, den Bolschewismus in seiner ursprünglichen, wie mir schien stärksten und definitiven Form in Wirksamkeit zu sehen. Die „Schritte nach rechts“, die in Lenins Broschüre von den „Nächsten Aufgaben der Sowjet-Macht“ ausführlich behandelt sind, wurden getan; das Taylorsystem, das Prämiensystem in das Programm des wirtschaftlichen Aufbaus aufgenommen; die Stellung der Bolschewiki zum Bauernstand, zumal zu den Mittelbauern, gab uns zu denken; es kamen Nachrichten über die Arbeitsarmee und den Arbeitszwang, Nachrichten, die uns verstimmten, und ich fragte Radek beim Abschied, ob es denn überhaupt noch Zweck habe, für mich wie für uns alle, nach Russland zu reisen, da die vielen Kompromisse und Konzessionen das Bild des Bolschewismus doch schon, wenn auch nicht unkenntlich gemacht, doch in verhängnisvoller Weise gefälscht hätten. Radek beruhigte mich mit seinem hellen, sarkastischen Lächeln und sagte, wenn ich nicht irre: es komme wenig darauf an, dass man Kompromisse schließe, alles darauf, dass man es verstehe, sie im geeigneten Augenblick wieder rückgängig zu machen, und dass er der Überzeugung sei, dies würde geschehen.
Meines Wissens bin ich das einzige Mitglied dieser Kommission, das seit Radeks Abschied von Berlin den Boden Russlands betreten hat, und zwar auf den Tag genau ein Jahr nach dem Erscheinen jenes Sendboten in meiner Wohnung. In diesem Jahre hatte sich das Bild des Bolschewismus, d. h. der praktischen Durchführung der kommunistischen Prinzipien in Russland fortwährend gewandelt und verschoben. Die Todesstrafe z. B. wurde abgeschafft, dann infolge eines versuchten Anschlags der Gegenrevolution wieder eingeführt. Lawinen von Lügen, bewussten Fälschungen und phantastischen Verzerrungen stürzten vor den Augen der Welt über das Werk der Kommunisten in Russland nieder. Schließlich kannte sich in dem Wust der Widersprüche, Gerüchte und Dementis, der Behauptungen und Manifeste niemand mehr aus. Der zweite Kongress der Dritten Internationale, die Delegationen, die ihn besuchten, und die über das, was sie gesehen hatten, Bericht gaben, halfen nicht, den Nebel zu zerstreuen. Auf manchem qualmenden Scheiterhaufen, der den Männern der Sowjet-Regierung errichtet wurde, brodelte brenzlig das eigene heimische Parteisüppchen. Ich war ziemlich entmutigt, wankend und unsicher geworden, als mich im Sommer dieses Jahres ein Zeitungskonzern aufforderte, nach Russland zu fahren und über meine Erfahrungen ein Buch zu schreiben.
Wie sind die Berichterstatter beschaffen, die die Welt in das belagerte, vielverleumdete und vielgepriesene Land entsendet? Und auf welche Art und Weise kann man in Russland das Wesentliche erfahren? Das Mitglied der Partei kommt hier nicht in Frage – es betritt und verlässt Russland natürlich mit gebundener Marschroute. Ich kenne einige Bücher, eine Reihe von Aufsätzen über Sowjet-Russland, bin auch mit einem und dem anderen Berichterstatter persönlich bekannt und infolgedessen fähig, den Mann mit seiner Meinung wie mit den tatsächlichen Verhältnissen zu konfrontieren. Allerhand ehrgeizige Gesellen, heimliche Geschäftemacher, tückische Verräter tummeln sich auf dem heißen und bunten Boden herum. Der Wahrheitsbegierigen, der in gutem Sinne Wissensdurstigen, der Befugten und Berufenen, der Ernsten und Getreuen gibt es nicht gar viele. – (Von dem wüsten Chaos gröblicher Makulatur stechen da die Bücher einiger Engländer und eines Deutschen, Alfons Paquet, aus der ersten Zeit der bolschewistischen Revolution erfreulich ab.)
Alfons Paquet – 1881 – 1944
Es lässt sich kaum beschreiben, mit welcher Verachtung die führenden Männer Russlands über jene spekulativ Verzückten urteilen, die in ihnen herrliche Heroen ohne Makel erblicken, auf speichelleckerische Art und Weise ihr Werk bewedeln und beräuchern. Für jene anderen, die aus schlotteriger Angst in Russland Begeisterung simulieren, um dann, über die Grenze zurück, in ihrer Heimat vor Verleumdung und Geifer überzufließen, hat man in Russland selbstverständlich nichts weiter als das Viertellächeln der Geringschätzung, wie sich's gebührt.
Wahr ist es, dass jeder, der im Auftrage bürgerlicher Zeitungen, Zeitschriften oder Verbände nach Russland kommt, ohne sonderliche Liebe, dagegen mit unverhohlenem Argwohn empfangen wird. Eine gewisse, in entscheidenden Situationen erprobte Gesinnung gegenüber dem Sozialismus kann als Grundbedingung für die Gewährung der Einreise gelten. Aber ich habe es selber erfahren, auf welche Weise sich einer und der andere diese Einreiseerlaubnis erschlichen hat, der dann, kaum über die Grenze geraten, von den Russen erkannt und mit heftigem Griff in Gewahrsam genommen wurde. Besonders einigen mir gut bekannten Leuten, Herren und Damen, darunter Amerikanern, war es so ergangen. Ich war entsetzt, als ich bald nach dem Betreten russischen Bodens von ihrer Festnahme unterrichtet wurde. Kurz darauf erhielt ich untrügliche Beweise für das Doppelspiel, das sie getrieben hatten, und dessen sie überführt worden waren.
Es kann wohl nur eine Meinung, nur ein Urteil geben über Menschen, die sich mit sorgfältig verheimlichten Aufträgen in ein blockiertes, von inneren Krämpfen und erbarmungslosem äußeren Krieg durchschütteltes Land, in dem eine neue Welt sich vorbereitet, in dem 150 Millionen Menschen geistig befreit worden sind von jahrhundertelanger dumpfer Unwissenheit, einschleichen, um ihre kleinen privaten Interessen zu befriedigen. Zehnfach aber, hundertfach muss man solches Treiben verurteilen, wenn sich Publizisten seiner schuldig machen. Die Publizistik dieser Zeit hat die Aufgabe, Klarheit zu verbreiten, schonungslos und getreu das Sublime wie das Entsetzliche, aus dem diese Zeit sich zusammensetzt, darzustellen und zu verkünden. Wer heute nicht wahr und klar zu reden weiß, mit geheimen Plänen und Instruktionen in der Tasche lächelnden Mundes sich unter ein gequältes Volk mengt, begeht das Verbrechen wider den Geist, für das Kerker nur eine gelinde Strafe ist. All dies muss ich voraussenden, weil ich selbst im Auftrage eines bürgerlichen Konzerns, des „United Telegraph“, der der großen amerikanischen Zeitungsorganisation „United Press“ affiliiert ist, nach Russland kam und die Zweideutigkeit, in die manche Vorgänger uns Nachfolgenden versetzt hatten, lange Zeit zu spüren bekam und zu büßen hatte.
Hindernisse anderer Art türmten sich mir noch in den Weg. Ich will eines kurz schildern, weil es charakteristisch ist für die unvorhergesehenen Verquickungen und Verstrickungen, in die der ausländische Publizist gerät, der seinen rechten Weg gehen möchte. Mancher Schriftsteller gibt einem wohlfeilen feuilletonistischen Spieltrieb allzu willig nach, würzt seinen Bericht mit kleinen intimen Anekdoten, Witzen oder Seitenhieben, die der eine Mann im Kreml über den anderen Mann im Kreml dem Journalistenohr in einem Augenblick der guten Laune preisgegeben hat. Ich könnte ein Lied davon singen, in welche Kalamitäten mich noch vor dem Betreten Russlands und dann in den ersten Moskauer Wochen die scharfgespitzte Zunge Radeks gebracht hat. Radek hatte einem meiner entfernteren Vorgänger, einem Engländer gegenüber sich über ein großes Tier im russischen Auswärtigen Amt näher ausgelassen; er hatte dieses Tier unter die Langohrigen eingereiht. Der Vorgänger brachte die Äußerung wortgetreu und mit Nennung aller Namen in sein vielgelesenes Buch, und da ich als ausländischer Publizist dem Auswärtigen Amt unterstellt war, hatte ich als „Protégé Radeks“ natürlich die Folgen zu tragen. (Nicht ich allein.)
Manch' einer hat sich eine Woche lang in Petersburg oder Moskau aufgehalten, ist dann nach Hause gefahren und hat ein Buch über Russland geschrieben. Es muss gesagt werden, dass die wenigsten unter uns, die Bücher über Russland geschrieben haben, der Sprache des Landes mächtig sind. Wie viele waren imstande, ihre Erfahrungen direkt aus dem Verkehr mit dem Volk zu schöpfen? Offizielle Vertreter der Staatsgewalt sind es zumeist, die den Fremdling über das System, die Zusammenhänge belehren. Die Volkskommissäre sind fast ausnahmslos ehemalige Emigranten und beherrschen die europäischen Sprachen glänzend. Sie sind mit Arbeit überbürdet, und man dringt nur zu kurzen Unterredungen bis zu ihnen vor. Der nächste Kreis um diese Führer ist aus verlässlichen Kommunisten gebildet, die zum überwiegenden Teil nur russisch sprechen. Man gerät nicht selten, und dies trifft besonders auf Ämter zu, die die sogenannten „Spezialisten“ beherbergen, an wortkarge, misstrauische und unwillige Funktionäre, aber auch an solche, die die Anwesenheit des Fremden gerne dazu benutzen, ihrem Groll gegen das System, dem sie sich, um leben zu können, zur Verfügung gestellt haben, einmal freien Lauf zu lassen. Viele unter diesen haben im Ausland gelebt und schweifen gerne vom Thema, das zu erörtern man zu ihnen kam, ab, um gierig Nachricht über das verschlossene Europa zu fordern. Lenkt man sie dann an die Stelle zurück, von der man ausgegangen war, da öffnet sich zuweilen ein Ventil, durch das lange zurückgepresster Dampf zischend hervorspringt. Aber dieses Ventil bleibt nicht lange offen. Die erschrockene Seele klappt es bald zu, und man erhält aus angstvoll verzerrtem Gesicht nichtssagende vage Redensarten.
Solche Psychose verfehlt nicht ihre Wirkung auf den Fremdling, der sich, wenn auch nur für kurze Zeit, in Russland aufhält. In diesem von Not, Begeisterung und Verzweiflung geschüttelten Land erlebt jeder einzelne das Schicksal der unsicheren Zukunft, der brennend gefährlichen Gegenwart. Gleich nach dem Überschreiten der Grenze spürt man eine gewissermaßen atmosphärische Last der Unfreiheit und des Misstrauens sich drückend auf die Seele niedersenken. Wie gerechtfertigt dieses Misstrauen ist, welch' guten Gründe die Kontrolle hat, erwähnte ich bereits. Immerhin ist der Zustand, in dem zu leben man gezwungen ist, oft schwer, zu Zeiten vollkommen unerträglich. Und das liegt nicht an der Kontrollbehörde allein, sondern an den Scharen der zum Teil ganz zweifelhaften Elemente, deren sie sich bedient, um die nötige Kontrolle auszuüben. Leute der Ochrana (der inoffizielle Oberbegriff für die verschiedenen Geheimdienste und die Geheimpolizei im zaristischen Russland) befinden sich unter ihnen; aber auch manchem neugebackenen Spür- und Bluthund bin ich begegnet.
Der Publizist mit ausländischem Auftrag lebt in Häusern unter militärischer Bewachung. Filzpantofflige Schufte schleichen durch die Korridore, und um das Schlüsselloch sammelt sich der fettige Abdruck ungewaschener Ohren. Man ist irgendwelchen Winkeltorquemadas ausgeliefert. Einmal hatte ich im Zimmer einer Dame ein Lehrbuch für erwachsene Analphabeten hinterlassen. Als die Dame verhaftet, ihr Zimmer versiegelt wurde, reklamierte ich bei der mir unmittelbar vorgesetzten Behörde, nämlich dem sogenannten Hauskommandanten, dieses Buch, das ich zu meiner Arbeit benötigte. Tags darauf wurde das Zimmer durch die Beamten jener Kontrollbehörde, der „Allrussischen Außerordentlichen Kommission zur Bekämpfung der Gegenrevolution und des Wuchers“ (nach den Anfangsbuchstaben Wetscheka genannt), geöffnet, die Habseligkeiten der Dame durchkramt, und als ich mein Lehrbuch zurückforderte, wurde mir mit höhnischer Miene erklärt: dass die Dame das „Buch für Anarchisten“, das ich ihr gegeben hatte, sehr sicher verwahrt habe, denn man könne es nicht finden. Dies ist nur ein kleines Missverständnis, aber an solchem Haken ist schon manch' einer hängen geblieben.
Da alles, was man an Geschriebenem und Gedrucktem bei sich führt, vor dem Verlassen des Landes der Wetscheka zur Kontrolle vorgelegt werden muss, und da man mit diesem Material dann drei Grenzen zu passieren hat, ehe man wieder daheim ist, stellen die Notizbücher, die man bei sich trägt, natürlich hohle Attrappen vor. Das Wesentliche, ob es nun günstig oder ungünstig für eines der drei Länder lautet, verbirgt man ängstlich im Gedächtnis, um es vor Missverständnis, Unverstand, Spitzeln und Grenzbehörden zu schützen. Dieser Zustand der geistigen Notwehr ist es, der allmählich jenen seelischen Druck, jene spezifische Moskauer Psychose erzeugt, die schwerer zu ertragen ist als alle anderen Nöte, die man in Russland am eigenen Leibe erfährt. Der bare Selbsterhaltungstrieb, die Revolte des guten Gewissens fälscht und entstellt dir das Bild der Wahrheit, das zu enthüllen du unter das große, rätselhafte Volk des Ostens gekommen bist.
Immer wieder erklärte man mir: Was wir hier brauchen, sind Leute mit Phantasie; keine kleinen klebrigen Matteroffact-Gehirne, deren Horizont auf den Dunstkreis um ihre Nase beschränkt ist. Ich machte den einen und den anderen, der so zu mir sprach, darauf aufmerksam, dass die Führer der Bolschewiki es ja heftig leugneten, ihr Ziel sei die Utopie – und dass dieser oft wiederholte Wunsch nach phantasiebegabten Fremdlingen doch die Suggestion einschließe: der Betrachter möge durch das Gegenwärtige, das Gegebene, durch das Werdende hindurch des leuchtenden Zieles der Utopie gewahr werden, es nie aus den Augen verlieren. Und so ist es auch. Aus den Theorien der Führenden, der Gläubigen, der sich Opfernden, durch all den entsetzlichen Wust der halb und ganz vernichteten Möglichkeiten, durch das unsägliche Wirrsal der Widersprüche, des Provisorischen wie des überhaupt nie zu Verwirklichenden, den Widerstreit von papierner Verordnung und blutigem Daseinskampf, durch die Resultate der erbarmungslosen Kriege, der Blockade, der Sabotage durch die inneren Feinde hindurch das schon Verwirklichte und in einer helleren Zukunft zu Verwirklichende zu erfühlen und zu erblicken – dies ist und bleibt das Wesentliche in Sowjet-Russland.
Was man erfährt, sind indes Bruchteile von Bruchteilen.
* * *
Ich suchte in Russland eine Religion und fand eine Partei. Eine Partei aber, die allerdings eine große Idee, die größte vielleicht, die Menschen je gedacht haben, mit allen Mitteln der politischen Macht und sogar der diplomatischen Schlauheit durchzusetzen bestrebt ist. Ein Franzose sagte mir: „Wir leben hier im Zeitalter der ersten Christenverfolgungen.“ Ein Engländer sagte mir: „Wir in England, in Amerika, wir mutigen und energischen Menschen hätten den Kampf gegen derartige Hindernisse längst aufgegeben.“ Wer aus den Bolschewiki Teufel macht, ist ein Verbrecher, wer aus ihnen Engel macht, ein Narr. Es sind lebendige Menschen, in Gefängnissen, im Exil hart geschmiedete Gehirne, gestählt durch Gefahren, gewaltige, für das Leiden der Unterdrückten offene Herzen, die selber am tiefsten unter der Notwendigkeit leiden, nun wiederum ihrerseits andere unterdrücken zu müssen.
Wie verhält es sich mit dem, der, ohne einer Partei anzugehören, aus Menschheitsdrang, aus innerer Bedrängnis – wenn auch mit ausgesprochen bürgerlichem Auftrag nach Russland fährt? Mein seelisch gerichteter Kommunismus ist durch die russische Prüfung unversehrt mit mir nach Deutschland zurückgekommen. So wenig der Mensch vor der Revolution beim Baron anfing, so wenig fängt er heute beim Kommunisten an. Da mein Menschheitsideal das herrschaftlose Beisammenleben in voller Freiheit auf Erden bedeutet, darf ich, aus diesem Gesichtswinkel gesehen, den Kommunismus wohl als eine Stufe zu diesem Ziel, mehr noch seiner Durchführbarkeit als seiner baren Theorie nach, einer Kritik unterwerfen. Und in diesem Sinne hatte der „Kommandant“ meines Hauses in Moskau wohl recht, wenn er das Lehrbuch für Analphabeten mit einem Handbuch für Anarchisten verwechselte.
„Freiheit ist ein Vorurteil der Intellektuellen.“ Dies steht irgendwo bei Lenin zu lesen. Wenn man nun, in einem Zustand der äußersten persönlichen Unfreiheit von einer Übergangszeit sprechen hört, einer zeitlich beschränkten Diktatur des Proletariats, die eine zeitlich abgeschlossene Diktaturperiode der imperialistischen, kapitalistischen Bourgeoisie ablösen soll und nach der sich alles in eitel Liebe und Gleichheit auflösen wird – wenn man die abgestandene Sentimentalität von den Enkeln, „die es einst besser haben werden“, aus dem Munde der konsequent und konkret denkenden Führer der Bolschewiki zu hören bekommt: dann kann man darauf ruhig erwidern: ihr gebraucht hier die Phrasen von 1914. Es gibt keine Übergangszeit, weil eine Zeit eine andere, keine Übergangsaktion, weil eine Aktion eine andere Aktion gebiert und so fort. Ebenso wenig gibt es Enkel; denn jeder Enkel ist seinerseits wieder Großvater. Es gibt nur einen ewigen Fluss der Dinge, und es gibt jawohl eine verhängnisvolle Verantwortung für die Gegenwart, den blutvoll schrecklichen Augenblick. Ihr selbst wisst es am besten, welche Schlagfertigkeit des Gewissens vonnöten ist, will man die Herrschaft einer Idee aufrichten. Es ist also nicht am Platze, von der allumfassenden Wahrheit zu sprechen, die nur aus den opalnen Fernen der Utopie herüberschimmert, und die nur das phantasiebegabte Auge zu erkennen vermag. Dasselbe Auge, das das Erreichbare betrachtet, muss hart und kühl die Ursache der Widerstände zu ergründen suchen. Wenn sich der Bolschewismus im Flusse befindet, so gibt es eherne Hindernisse, welche sich aus seinem eigenen Wesen emporrecken und seinen Lauf behindern.
In den letzten Tagen vor meiner Abreise erzählte man mir, dass Trotzki eine Artikelreihe des Inhaltes vorbereite: auf welche Weise den lokalen Sowjets wieder mehr Macht zugewiesen werden könne, die ihnen durch die übertriebene Zentralisation zu entschwinden angefangen hat.
Leo Trotzki
Wenn diese Artikelreihe geschrieben worden ist, wird sie von ungeheurer Tragweite für die Entwicklung des Kommunismus in Russland wie in der Welt sein. Unter allem Vorbehalt und mit größter Vorsicht gebe ich ein Gerücht wieder, das um dieselbe Zeit in Petersburg aufgetaucht war, und das, auch wenn es sich nicht bewahrheitet haben sollte, den Beweis dafür liefert, dass der Bolschewismus ein lebendes Gebilde ist und seine Führer als kluge und den Notwendigkeiten des Tages gewachsene Menschen gelten dürfen.
Der Anarchist (siehe Band 157e in dieser gelben Buchreihe: Anarchisten) Machnow, von den Bolschewiki als wilder Räuberhauptmann und Partisanenanführer zuerst in Acht und Bann erklärt, später freilich zum Bündnis aufgefordert, hat einen wichtigen, ja, wie es heißt, einen entscheidenden Anteil an dem Niederringen und der Erledigung Wrangels in Südrussland gehabt.
Nestor Machno – Нестор Іванович Махно – 1888 – 1934
Als Entgelt für seine Hilfe forderte er und wurde ihm gewährt: die Befreiung der um ihrer Gesinnung willen eingekerkerten Anarchisten und die Wiederherstellung der Rede- und Pressefreiheit in näher bezeichneten Gebieten Südrusslands.
Ein Gerücht, wie gesagt.
* * *
Die Wahrheit! Wer es sich leicht machen wollte, könnte Ziffern an Ziffern reihen. Aber stülpe die ganze Statistik um – findest du in dem Haufen auch nur ein Körnchen Wahrheit? Die Naphthaproduktion bildet die Grundlage des russischen Verkehrswesens, aller inneren Möglichkeiten für den wirtschaftlichen Aufbau Russlands.
Rückte Wrangel in den letzten Monaten 100 Werst vorwärts, so versiegte die Quelle; wurde er 200 Werst zurückgeworfen, triumphierte der Statistiker. Ähnlich ging es mit der Baumwollproduktion und der Belieferung der Textilzentren durch Turkestan. Wir fuhren, durch die Statistik deprimiert, eines Tages aus Moskau nach dem Fabrikort Iwanowo-Wosnessensk im Gouvernement Wladimir. Wir wussten, dass dort die Fabriken eben wieder geöffnet waren, um vor Beginn des Krieges aufgestapelte Rohstoffe zu verarbeiten.
Baron Pjotr Nikolajewitsch Wrangel –Барон Пётр Николаевич Врангель
1878 – 1928
Als ich eine Woche später nach Moskau zurückkehrte, berichteten mir Delegierte der Turkestaner Sowjets, die in meinem Hause untergebracht waren, dass tags zuvor einige hundert Waggons mit Baumwolle aus Turkestan nach den nördlichen Gouvernements abgegangen seien. In den offiziellen Zeitungen Russlands begegnet man immer häufiger Aufsätzen, die gegen die Lügenwissenschaft der Statistik zu Felde ziehen, allen Ernstes die Einstellung statistischer Untersuchungen beantragen, nicht etwa, weil man die Not des Landes verschleiern müsse, sondern im Gegenteil, weil die Not den Menschen durch die Mittel der Statistik nicht als ein bald vorübergehender Zustand dargestellt werden dürfe. Eine merkwürdige Tafel wird mir stets vor Augen stehen, wenn ich mich jemals noch an pathetische Zahlen stoßen werde im Leben. Diese Tafel war im Garten des Narkompross, d. h. des Volkskommissariats für Volksaufklärung und Erziehung aufgestellt. Mit dieser Holztafel würde ich, ginge es nach mir, sofort in dem kalten Empfangszimmer Lunatscharskis, des Volkskommissärs, einheizen.
Anatoli Lunatscharski – Анатолий Васильевич Луначарский – 1875 – 1933
Eine graphische Darstellung wies in schwarzen, dann in roten Strichen und Säulen Rubelmengen, nämlich für Zwecke der Volkserziehung ausgeworfene Rubel in den Jahren von 1900 bis 1920 auf. Das Erziehungsbudget von 1900 war ein kleiner waagerechter Strich von der Dicke eines Fingers. 1904 war's der Finger eines kleinen Kindes geworden, so wenig war für den Zweck im Staatsbudget vorgesehen. 1910 war der Finger, wenn ich mich recht entsinne, der Finger eines normalen Bauern, aber immerhin noch ein Finger. 1918 schoss plötzlich eine rote Säule bis zur Mitte der Tafel in die Höhe, das war schon nach der Oktoberrevolution. Eine zweite rote Säule vom Jahre 1920 erreichte aber bereits den höchsten Rand der Tafel. Kein Mensch, der sich im Narkompross auch nur eine Stunde aufgehalten hat, wird das Ungeheure, das über die Jahrhunderte hinaus Gültige und Wirkende leugnen, das die Bolschewiki für die Erziehung des russischen Volkes geleistet haben. Wozu dieser veraltete schwindelhafte Behelf der graphischen Darstellung von Rubelauslagen? Jedes Kind weiß ja, dass die Kaufkraft einer Million Rubel 1920 der Kaufkraft von 1.000 oder gar 500 unter dem letzten Zaren entspricht. Fort mit der Statistik...
Aus Gegenwärtigem, Künftigem, aus der Gesinnung und der Leidensfähigkeit der Massen, aus meinem Gefühl, meinem Verstand, der Erfahrung meines ganzen Lebens, die mir Theorien, Menschen, Ergebnisse durchleuchtet, muss mir die Wahrheit über Sowjet-Russland erstehen. Ich setze mich hin, um mein Buch zu schreiben. Gott helfe mir.
* * *
Das Arbeiter-Volk
Das Arbeiter-Volk
Es ist oft gesagt worden, dass der Ausspruch von Marx: das Land mit dem höchst entwickelten Kapitalismus sei berufen, zuerst die proletarische Revolution siegreich durchzuführen, sich nicht bewahrheitet habe.
Karl Marx
Denn gerade Russland, das Agrarland mit einem nur in den ersten Stadien befindlichen Industriekapitalismus hat die proletarische Diktatur zum Siege geführt. Ein anderer Ausspruch aber von Marx hat sich als wahr und folgerichtig erwiesen: dass nämlich das organisierte städtische Proletariat vor allem berufen sei, das Rückgrat jeder antikapitalistischen Revolution zu bilden. (In Deutschland haben die Kieler Matrosen, d. h. organisierte Metallarbeiter das Gebäude des Imperialismus zu Falle gebracht.)
Der organisierte Arbeiter, den Marx meint, ist aber nicht nur der Teil des klassenbewussten Proletariats, der den Sinn des Sozialismus erfasst hat und das proletarische Wirtschafts- und Verwaltungssystem begreifen, stützen und ihm zum Siege verhelfen muss, sondern vor allen Dingen ruht auf ihm die Pflicht, einen eben zertrümmerten Apparat durch eisernen Fleiß aufzubauen und alle nichtorganisierten, nicht klassenbewussten, alle unwilligen Elemente, die die neu aufzubauende Organisation auf die Dauer nicht entbehren und von sich abhalten kann, zu kontrollieren, zu disziplinieren, anzufeuern, wenn es sein muss zu unterdrücken.
Das Problem des Kommunismus ist: arbeiten; mit vollster Hingabe, unter Anstrengung aller Kräfte auf eine nicht mehr dem kapitalistischen Zwang der Selbsterhaltung, sondern dem freien menschlichen Streben nach Hingabe an die Gemeinschaft unterworfene Weise arbeiten. Das Problem des bolschewistischen Aufbaues, der Diktatur des Proletariats beruht darauf, dass mit einem wuchtigen Griff, einem harten Zupacken, Umbiegen und Abbrechen zugleich mit dem Kapitalismus der Trieb des Eigennutzes, der Habgier vernichtet werde und die Produktion, die Arbeitswütigkeit dabei nicht nur keinen Schaden erleide, sondern durch unerhörte Opferwilligkeit, angespanntes Pflichtbewusstsein auf dem eben zertrümmerten Gebäude der neue Zustand auferstehe. Es ist also, wie man sieht, ein psychologisches Problem. Es ist kein rein ökonomisches, sondern ein Gesinnungsproblem. Es ist ein Problem, bei dem die Psychologie der Massen wie des Individuums eine große Rolle zu spielen hat, eine entscheidendere Rolle vielleicht als die Routine.
Unter welchen Bedingungen nun hat der russische Kommunismus dieses verhängnisvolle Experiment begonnen? Er fand eine durch 16 Jahre Krieg geschwächte, verwahrloste und demoralisierte Menschenmasse vor, einen total verlotterten Produktionsapparat, einen erschrecklichen Mangel an den notwendigsten Rohstoffen. Fortwährende Bedrohung durch den an den Grenzen des Landes sich düster zusammenballenden Weltkapitalismus, der, der ungeheuren Gefahr bewusst, immer neue Heere vorwärts schob, den ganzen papierenen Apparat der Feindseligkeit, der Verleumdung, der Verdächtigungen in ein rasendes Tempo versetzte, der durch tausend unterirdische Kanäle Zwietracht, Verrat und Ärgeres in das hart geschlagene, wie eine Festung blockierte Land sandte. Aber schlimmere Hindernisse noch als diese rein äußerlichen erwuchsen dem Bolschewismus und seinen Führern aus den seelischen Vorbedingungen der Menschen, die sie fanden, um mit ihnen ihre Ideale aufzurichten. Ein Volkskommissar erklärte mir mit traurigem Lächeln: der russische Arbeiter habe in den Zeiten vor der Oktoberrevolution zu wenig kapitalistische Prügel erhalten, sei also niemals für eine angestrengte systematische Produktion vorgebildet gewesen. Die besten und verlässlichsten Arbeiter seien die Litauer, die Polen und die Juden.
Es gibt Leute, die den Bolschewiki den Vorwurf machen, dass sie mit einem ungeeigneten Volkskörper ein so radikales Experiment gemacht hätten. Und es sind nicht zuletzt die aufrichtigen Sozialisten, die diesen Vorwurf erheben; denn sie befürchten beim Scheitern dessen, was sie das bolschewistische Experiment nennen, ein weltweites Erstarken des Kapitalismus und eine Diskreditierung des sozialistischen Gedankens auf unabsehbare Zeit.
Nach drei Monaten, die ich in Russland verbracht habe, kann ich ein ähnliches, wenn auch viel leichteres Bedenken nicht von mir weisen. Das Volk ist müde, der Arbeiter entnervt, der Kapitalismus hat an der Gesinnung der Menschen, an dem Trieb zur Gemeinschaft Jahrtausende lang gesündigt, und der treu ergebenen opferwilligen Genossen sind verhältnismäßig wenige. Die Opferwilligkeit dieser Treuen und Gerechten führt sie – an den roten Fronten – zur Preisgabe ihres Lebens und damit zur Vernichtung der wesentlichen und wichtigen Stütze der Gesinnung bei den schwankenden Massen und der Kontrolle aller der Disziplin Unfähigen, bewusst das Getriebe Zerstörenden.
* * *
Ich habe einige Fabriken besichtigt, in denen ich die Produktionsweise des heutigen Russlands, fragmentarisch zwar, wie es sich von selbst versteht, aber doch in seinen Konturen zu verfolgen vermochte. Es waren dies: eine Textilfabrik in der Nähe Moskaus, eine Kattunfabrik in Iwanowo-Wosnessensk, außerdem Fabriken verschiedener Art in Petersburg, Werkstätten, Bekleidungsindustrien, Brotfabriken usw. In mancher Fabrik fanden wir Rohstoffe vor, die noch aus der Zeit vor dem Kriege stammten. In anderen lag schon neues Material aus den unerschöpflichen Vorratskammern des weiten Landes bereit, jedoch wurden da auch Verarbeitungsstoffe verwendet, die die Blockade nicht herein ließ, z. B. Farben für den Musteraufdruck des Kattuns, die im Frieden aus Bayern importiert wurden, und deren Versiegen die Fabrikation wieder vor ein schwieriges Problem stellen wird.
Die Fabriken, die wir sahen, waren bereits in der Zeit vor dem Kriege erbaut und eingerichtet worden. Alles, was wir zu beobachten hatten, um das Wirken des neuen Arbeitssystems zu erkennen, war: in welchem Zustand sich die Fabrik befand, auf welche Weise man die vorhandenen Maschinen und Stoffe behandelte, seit der Arbeiter selber Herr des Betriebes geworden war, und zuletzt das Wichtigste: auf welche Art man den zugrunde gehenden Apparat, die abgenutzten Maschinen, die unersetzbaren Maschinenbestandteile arbeitsfähig erhielt, durch sorgfältige Behandlung, durch Erfindungsgabe, durch Hingabe und Verständnis für die Notwendigkeit der Produktion, nicht nur für die äußeren Bedürfnisse des Volkes, sondern für die Stärkung und Aufrechterhaltung der großen politischen Idee.
Ich bedaure es sehr, dass wir keinen Kodak zur Hand hatten, als wir die große Tuchfabrik in der Nähe von Moskau besuchten. Sie fabrizierte Militärtuch, außerdem Tuche für Männerbekleidung und das sogenannte „technische Filztuch“ für die Papierfabrikation. Die Herstellung dieses letzteren – eines schweren weißen Filzes von zwei Finger Dicke, der eine endlose Rolle darstellt – erfordert eine bestimmte Maschine zum Aufrauen des Stoffes. Diese Maschine heißt Rollkardenmaschine und stellt einen Zylinder aus Metall dar, an dem distelförmige biegsame Stachelspulen befestigt sind. Das Tuch wird über diese Disteln gezogen, die die Fasern des Tuches aufrauen. Die Maschinen, die aus Bury in England bezogen worden waren, waren nicht mehr zu gebrauchen. Die Arbeiter in der Fabrik zimmerten nun aus Holz ähnliche Zylinder zusammen und befestigten an ihnen wirkliche Disteln, die aus einem entfernten Gouvernement herbeigeschafft und natürlich einer raschen Abnutzung ausgesetzt waren. Diese Maschine, primitiv, naiv, wie von irgendeinem Robinson Crusoe zusammengesetzt, kam mir als rührendes Symbol der Not und der Tugend des neuen Russlands vor.
Ich besuchte diese Fabrik mit dem ehemaligen Volkskommissar der ungarischen kommunistischen Regierung, dem ausgezeichneten Volkswirtschaftslehrer Professor Varga.
Varga Jenő – 1879 – 1964
Wir fuhren unangemeldet dort hinaus und konnten einen genauen Einblick in das Getriebe so der Arbeit wie der Verwaltung gewinnen. Von 6.100 Spindeln arbeiteten zurzeit nur 3.000. 1.600 Arbeiter lebten mit ihren Familien auf dem Gebiet um die Fabrik. Viele Maschinen standen still, weil es an Werkzeugen mangelte, die fehlenden Bestandteile zu erneuern. So z. B. musste der endlose Filz, von dem ich sprach, da die Maschinen zum Zusammenweben des Filzes nicht funktionierten und nicht zu ersetzen waren, von Hunderten von Arbeiterinnen zusammengewebt werden. Da saßen sie nun auf langen Bänken in einer Reihe und fügten mühselig Faden um Faden der beiden Enden des Tuches zusammen. Eine unendlich monotone und mühselige Arbeit, bei der es zu vermeiden war, dass Knoten in das Tuch gelangten, weil dann das Papier, das über diese Tuche laufen muss, natürlich zerrissen wäre. Mir fiel bei dieser Verrichtung ein Wort ein, das ich in Moskau gehört hatte: „Wenig Maschinen, viel Menschen – viel Maschinen, wenig Menschen. Unser Problem ist einfach: wir haben enorme Mengen Menschen, wir brauchen die Maschinen nicht.“
Die Arbeiterinnen dieser Fabrik hatten pro Tag ein Minimum von 7½ Arschin Gewebe abzuliefern, erhielten dafür einen Minimaltagelohn von 121 Rubeln 20 Kopeken. Um die Produktion zu heben, wurde ein Prämiensystem eingeführt, welches die Bezüge bis zu 400 Prozent des Lohnes steigern konnte. Zu Zeiten der erhöhten Produktionsnotwendigkeit wurden 40 Überstunden monatlich bei 25 monatlichen Achtstundentagen geleistet. Vor der Einführung des Prämiensystems hatte bei den männlichen Arbeitern die tägliche Produktion einen Durchschnitt von 12 Arschin betragen, nach der Einführung des Prämiensystems betrug der Durchschnitt 15 bis 17 Arschin. Jeder Beamte und Arbeiter hat pro Kopf seiner Familie Anspruch auf 11 Szazn Landes zur eigenen Bebauung im nächsten Umkreis der Fabrikniederlassung. Das hatte seine Vorzüge und Nachteile. Da die Lebensmittelbelieferung oft eine gänzlich ungenügende war und zumal die Arbeiterinnen vor Unterernährung und Müdigkeit kaum mehr zu arbeiten vermochten, durfte man nichts dagegen haben, dass sich ein Teil des Betriebspersonals halbe Tage lang unentschuldigt auf den Feldern umhertrieb, um Rüben, Kartoffeln und andere Erdfrüchte anzubauen, zu pflegen und einzuheimsen. Gegen diese notgedrungene Sabotage der Produktion half nur das mechanisch erhöhte Prämiensystem. Doch war die Stimmung unter der Arbeiterschaft eine vorzügliche. Sie wussten ja, dass etwas sich geändert hatte, dass sie für sich arbeiteten, und das half ihnen über manche Entbehrung, Müdigkeit und Kummer hinweg.