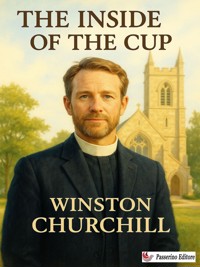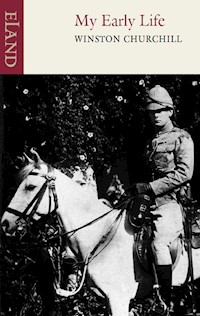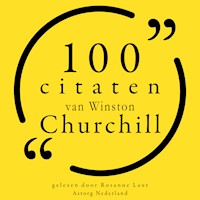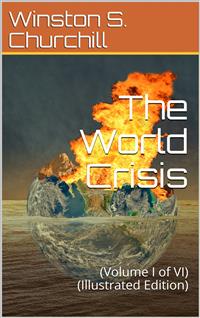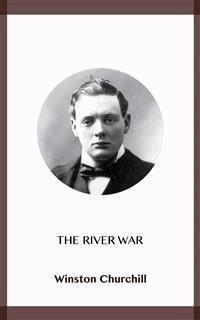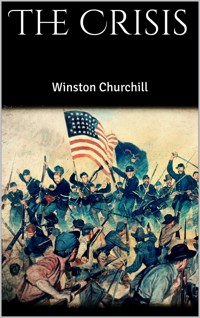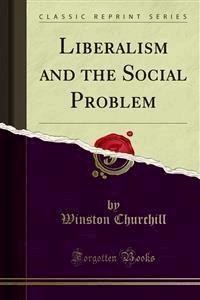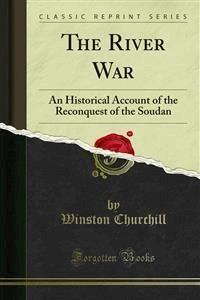Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Kampa VerlagHörbuch-Herausgeber: Hierax Medien
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Gatsby
- Sprache: Deutsch
»Ich hatte einen herrlichen Monat - ich habe ein Häuschen gebaut und ein Buch diktiert: 200 Ziegelsteine und 2000 Wörter am Tag«, erzählte Churchill Stanley Baldwin über seine Parlamentsferien 1928. Entstanden ist ein Buch, in dem die Erzählfreude des Autors auf jeder Seite spürbar ist: Churchills Erinnerungen an seine ersten dreißig Lebensjahre, geschrieben aus einer »jeweils meinem Lebensalter angemessenen Sichtweise«. Tatsächlich schönt Churchill nichts - weder seine miserablen Leistungen in der Schule noch seine peinliche Kriegsbegeisterung an der Militärakademie. Umso lebendiger, ehrlicher und aufschlussreicher liest sich sein Bericht: Churchill, dem nicht ohne Grund der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde, fühlt sich in sein junges Ich ein wie in eine Romanfigur, und die Pleiten des jungen Winston wie auch die waghalsige Flucht vor den Buren, die ihn auf die Titelseiten der Boulevardpresse brachte, ergeben einen echten Abenteuerroman - geschrieben mit dem typisch Churchillschen Witz und einer gehörigen Prise Ironie. Zugleich wird der bedeutendste Staatsmann des 20. Jahrhunderts seinem Anspruch gerecht, »das Bild eines verschwundenen Zeitalters« zu zeichnen: Er betrachtet die politischen Ereignisse seiner Jugend und die Kriege, an denen er als Soldat und Kriegsberichterstatter teilgenommen hat, mit den Augen eines Zeitgenossen. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die Churchill und seine Zeit besser verstehen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Winston S. Churchill
Meine frühen Jahre
Aus dem Englischen von Dagobert von Mikusch
Gatsby
Einer neuen Generation
Vorwort zur Originalausgabe
Da schon so mancherlei hier und da über die Begebenheiten und Abenteuer der Frühzeit meines Lebens veröffentlicht worden ist und ich auch selbst die Feldzüge, an denen ich teilnahm, sowie einzelne besondere Episoden beschrieben habe, hielt ich es für angebracht, die Teile in ein Ganzes zu bringen und die Geschehnisse, so wie sie sich abspielten, zusammenfassend neu zu erzählen. Zu diesem Zweck habe ich sowohl in meinen Erinnerungen nachgeforscht als auch die Tatsachen anhand der Dokumente, die ich besitze, sorgfältig überprüft. Bei der Darstellung der einzelnen Perioden dieses Vierteljahrhunderts, in dem die Geschichte spielt, war ich bemüht, die jeweils meinem Lebensalter angemessene Sichtweise einzunehmen, sei es die des Kindes, des Schülers, des Kadetten, des Offiziers, des Kriegsberichterstatters oder des jungen Politikers. Wenn diese Sichtweisen mit den heute allgemein anerkannten vielfach im Widerspruch stehen, so ist immer zu bedenken, dass sie lediglich meine Denkweise in diesen früheren Lebensphasen spiegeln und keine Stellungnahmen aus heutiger Sicht sind.
Wenn ich das Ganze dieses Werks überblicke, so muss ich feststellen, dass ich das Bild einer versunkenen Epoche gezeichnet habe. Die Struktur der Gesellschaft, die Grundlagen der Politik, die Kriegsführung, die Einstellung der Jugend, die Wertmaßstäbe, alles hat sich verändert, und das in einem Umfang, wie ich es in einem so kurzen Zeitraum ohne eine gewaltsame Revolution nicht für möglich gehalten hätte. Ich kann nicht behaupten, dass mir diese Veränderungen in jeder Hinsicht als Verbesserungen erscheinen. Ich war ein Kind des Viktorianischen Zeitalters, wo das Gefüge unseres Landes unerschütterlich erschien, unsere Vormachtstellung im Welthandel und auf dem Meer unbestritten war und der Glaube an die Größe unseres Reichs wie an unsere Pflicht, sie zu wahren, nur noch wuchs. In jenen Tagen waren die herrschenden Kräfte Großbritanniens sich ihrer selbst und ihrer Maximen völlig sicher. Sie meinten, sie könnten die Welt Regierungskunst und Ökonomie lehren. Sie waren von ihrer Überlegenheit zur See und folglich auch von der Unangreifbarkeit ihres Landes überzeugt. Gelassen ruhten sie in ihrem Glauben an Macht und Sicherheit. Wie weit entfernt davon ist die Gegenwart mit ihren Wirren und Zweifeln! All diese Veränderungen mögen die geneigten Leser sich immer vor Augen halten.
In Erwägung, dass die neue Generation vielleicht Anteil nehmen möchte an einer Geschichte jugendlichen Strebens und Bemühens, habe ich meine persönlichen Geschicke so schlicht wie möglich und mit aller Offenheit niedergeschrieben.
Winston Spencer Churchill
Chartwell Manor,
August 1930
IKindheit
Wann beginnt das Erinnern? Wann prägen sich die schwankenden Lichter und Schatten des dämmernden Bewusstseins zuerst dem Geist des Kindes ein? Meine frühesten Eindrücke stammen aus Irland. Ich erinnere mich deutlich an Örtlichkeiten und Ereignisse in diesem Land, verschwommen auch an einzelne Menschen. Ich wurde am 30. November 1874 geboren, und ich verließ Irland im Jahr 1879. Mein Vater war als Sekretär seines Vaters, des siebten Herzogs von Marlborough – von Benjamin Disraeli 1876 zum Vizekönig ernannt –, nach Irland gegangen. Wir wohnten in einem Haus, »das kleine Landhaus« genannt, das einen Katzensprung entfernt vom vizeköniglichen Landhaus lag. Dort verbrachte ich etwa drei Jahre meiner Kindheit. Einzelne Begebenheiten stehen mir klar und lebendig vor Augen. Ich sehe noch meinen Großvater, den Vizekönig, bei der Enthüllung des Denkmals für Lord Gough[1] im Jahr 1878. Eine dichte, dunkle Menschenmasse, rotröckige Soldaten zu Pferd, eine bräunlich glänzende Umhüllung wird von Schnüren weggezogen, und dann der alte Herzog, der gewaltige Großpapa, wie er mit lauter Stimme zur Menge spricht. Ein Satz aus seiner Rede ist mir haften geblieben: »… und mit einer knatternden Salve sprengte er die feindliche Front.« Ich verstand, dass von Krieg und Schlacht die Rede war, und mit »Salve« war offenbar das gemeint, was die schwarzröckigen Soldaten (Scharfschützen) so oft mit lautem Krachen im Phoenix-Park taten, wo ich vormittags immer spazieren geführt wurde. Das ist, scheint mir, meine erste zusammenhängende Erinnerung.
Andere Geschehnisse sind mir noch deutlicher in Erinnerung geblieben. Einmal sollten wir eine Pantomime besuchen. Das große Ereignis verursachte viel Aufregung. Der lang ersehnte Nachmittag kam. Vom vizeköniglichen Landhaus fuhren wir zum Schloss Dublin Castle, wo wir wohl noch andere Kinder mitnehmen sollten. Innerhalb des Schlosses war ein großer viereckiger Hof, mit schmalen länglichen Steinen gepflastert. Es regnete. Fast immer regnete es – ganz wie heute. Aus den Eingängen des Schlosses kamen Leute, und überall herrschte große Unruhe. Dann wurde uns gesagt, dass wir die Pantomime nicht sehen könnten, da das Theater abgebrannt sei. Die einzigen Überreste, die man von dem Theaterdirektor fand, waren die Schlüssel, die er in der Tasche gehabt hatte. Als Ersatz für die entgangene Pantomime sollten wir am nächsten Tag die Brandstätte besichtigen dürfen. Ich hätte mir sehr gern die Schlüssel angesehen, aber dieser Wunsch stieß auf wenig Verständnis.
Einmal während dieser Jahre machten wir einen Besuch in Emo Park, dem Landsitz von Lord Portarlington, einer Art Onkel von mir, wie mir erklärt wurde. Den Ort kann ich noch genau beschreiben, obwohl ich seit damals – ich war vier oder viereinhalb – nie wieder dort gewesen bin. Der Mittelpunkt meiner Erinnerungen ist ein hoher Turm aus weißem Stein, den wir nach einer ziemlich langen Wagenfahrt erreichten. Man erzählte mir, Oliver Cromwell habe den Turm einst in die Luft gesprengt. Wie es schien, hatte er alle möglichen Dinge in die Luft gesprengt. Er musste also ein großer Mann gewesen sein.
Meine Kinderfrau, Mrs Everest, war immer sehr besorgt wegen der Feniers.[2] Das waren, wie ich aus den Reden entnahm, gottlose Menschen, die noch wer weiß was für Unheil anrichten würden, wenn man sie gewähren ließe. Einmal, als ich auf meinem Esel spazieren ritt, sahen wir einen langen schwarzen Zug herankommen und hielten sie für Feniers. Heute ist mir klar, dass es die Schützenbrigade auf einem Übungsmarsch war. Aber wir waren alle höchst beunruhigt, insbesondere mein Esel, der seine Angst durch Bocken äußerte. Ich flog aus dem Sattel und zog mir eine Gehirnerschütterung zu. Das war meine erste Berührung mit irischer Politik.
Im Phoenix Park gab es eine große kreisförmige Baumgruppe, mit einem Haus darin. Dort wohnte jemand, der entweder Ober- oder Untersekretär betitelt wurde, genau weiß ich es nicht mehr. Jedenfalls kam ein Herr, genannt Mr Burke, aus dem Haus heraus. Er schenkte mir eine Trommel. An sein Aussehen erinnere ich mich nicht mehr, aber umso besser an die Trommel. Zwei Jahre später, als wir wieder in England waren, sagte man mir, dass er von den Feniern ermordet worden sei, und zwar in ebenjenem Phoenix Park, wo wir jeden Tag spazieren gegangen waren. Darüber schienen alle sehr aufgebracht, und ich war froh, dass mich die Fenier nicht erwischt hatten, als ich von meinem Esel gefallen war.
Im »Kleinen Landhaus« wurde ich auch zum ersten Mal mit den Schrecken des Lernens bedroht. Die Ankunft einer unheilvollen Person namens »Gouvernante« wurde verkündet. Ihr Eintreffen war auf einen bestimmten Tag festgesetzt. Damit ich für diesen Tag entsprechend gewappnet wäre, holte Mrs Everest ein Buch hervor: Lesen lernen ohne Tränen, ein Titel, der sich bei mir jedenfalls nicht bewahrheitete. Mir wurde eröffnet, dass ich bis zur Ankunft der Gouvernante ohne Tränen lesen können müsse. Jeden Tag mühten wir uns ab. Meine Kinderfrau zeigte mit dem Bleistift auf die einzelnen Buchstaben. Ich langweilte mich. Wir waren noch längst nicht fertig mit unseren Vorbereitungen, als die schicksalsvolle Stunde schlug, in der die Gouvernante ankommen sollte. Ich machte es, wie es bedrängte Völker in ähnlichen Lagen oft getan haben: Ich entwich in die Wälder. Ich versteckte mich in den Büschen, die das »Kleine Landhaus« rings umgaben und die mir wie ein riesiger Wald erschienen. Es dauerte Stunden, bis ich entdeckt und der »Gouvernante« übergeben wurde. Wir mühten uns nun weiter jeden Tag ab, aber nicht bloß mit Buchstaben, sondern auch mit Worten und, was am schlimmsten war, mit Zahlen. Buchstaben brauchte man sich schließlich nur zu merken, und wenn sie in einer gewisser Reihenfolge beieinanderstanden, erkannte man die Gebilde ungefähr und wusste, dass sie bestimmte Laute oder Wörter bedeuteten, die man bei genügendem Druck von sich gab. Zahlen hingegen wurden zu allen möglichen Knäueln verknüpft und taten sich gegenseitig Dinge an, die exakt vorherzusehen äußerst schwierig war. Man musste sagen, was sie in der jeweiligen Verknüpfung einander antaten, und die Gouvernante legte größten Wert darauf, dass die Antwort exakt richtig war. War die Antwort nicht exakt richtig, war sie eben falsch. »Ungefähr richtig«, das nützte einem nichts. Manchmal machten die Zahlen Schulden untereinander: Man musste eine Eins borgen oder im Sinn behalten, und nachher musste man das Geborgte wieder zurückzahlen.
Diese Zumutungen warfen einen erheblichen Schatten auf mein Dasein. Sie hielten einen von all den schönen Dingen ab, die man in der Kinderstube oder im Garten unternehmen konnte. Man wurde durch sie in seiner Freiheit beschränkt und fand für die wirklich wichtigen Dinge kaum noch Zeit. Das Lernen wurden mehr und mehr zu einer Plage und einer Fron.
Meine Mutter nahm persönlich an diesen Veranstaltungen nicht teil, gab mir aber zu verstehen, dass sie sie guthieß, und stellte sich fast stets auf die Seite der Gouvernante. In Irland sehe ich meine Mutter immer im Reitkleid vor mir, das sich hauteng an ihren Körper schmiegte und oft herrlich mit Schlamm bespritzt war. Sie und mein Vater ritten ständig Jagden auf ihren hochbeinigen Pferden, und oft gab es große Aufregung im Haus, weil einer der beiden erst Stunden nach der angegebenen Zeit heimkehrte.
Meine Mutter erschien mir immer wie eine Märchenprinzessin: ein strahlendes Wesen im Besitz unendlicher Machtfülle und grenzenlosen Reichtums. Lord D’Abernon hat sie aus jener irischen Zeit mit Worten geschildert, für die ich ihm stets dankbar sein werde.
Ich erinnere mich noch genau, wie ich sie zum ersten Mal sah. Es war im vizeköniglichen Landhaus in Dublin. Sie stand links seitlich vom Eingang. Am andern Ende des Saals bemerkte man den Vizekönig auf einer Estrade, umgeben von glänzendem Gefolge. Aber die Blicke richteten sich nicht auf ihn oder seine Gattin, sondern auf die dunkle biegsame Gestalt, die sich ein wenig abseits hielt und aus anderem Stoff gemacht schien als die Umstehenden: strahlend, wie von innen her leuchtend, sprühend von Leben. In ihrem Haar ein Brillantstern, ihr Lieblingsschmuck – sein Feuer gedämpft durch die blitzende Pracht der Augen. Der Blick war mehr der eines Panthers als der einer Frau, aber von einer edlen Geistigkeit, die dem Dschungel fremd ist. Sie war ebenso beherzt und mutig wie ihr Mann – ganz die Mutter für Nachkommen des großen Herzogs. Bei allem Glanz ihrer Erscheinung zugleich von einer Güte und Heiterkeit, die ihr allgemeine Zuneigung erwarben. Ihr Wunsch zu gefallen, ihre Freude am Dasein, ihr instinktives Bestreben, andern ihren frohen Glauben an das Leben zu übermitteln, machten sie zum Mittelpunkt eines ihr ergebenen Kreises.
Auch auf mich als Kind machte meine Mutter diesen glanzvollen Eindruck. Sie leuchtete für mich wie der Abendstern. Ich liebte sie zärtlich – aber von fern. Die Vertraute meiner frühen Jahre war meine Kinderfrau. Mrs Everest sorgte für mich und kümmerte sich um all meine Bedürfnisse. Ihr teilte ich mit, wenn mich etwas bedrückte, damals und während der Schulzeit. Bevor sie zu uns kam, hatte sie zwölf Jahre ein kleines Mädchen namens Ella aufgezogen, die Tochter eines Geistlichen in Cumberland. »Klein Ella« wurde zu einer vertrauten Gestalt meiner Kinderjahre, obwohl ich sie nie gesehen habe. Ich kannte sie ganz genau, wusste, was sie gern aß, wie sie ihre Gebete sprach, wann sie ungezogen zu sein pflegte und wann brav. Ihr Heim im Norden Englands sah ich im Geiste vor mir. Auch eine große Liebe für Kent brachte mir Mrs Everest bei, den »Garten Englands«, wie sie sagte. Sie stammte aus Chatham und war ungeheuer stolz auf Kent. Keine Grafschaft war mit Kent zu vergleichen, so wenig wie irgendein anderes Land mit England zu vergleichen war. Irland zum Beispiel war nicht entfernt so schön. Und von Frankreich, wo Mrs Everest mich eine Zeit lang im Kinderwagen auf den – wie sie es nannte – »Shams Elizzie« spazieren gefahren hatte, dachte sie sehr gering. Kent war der schönste Ort auf Erden. Seine Hauptstadt war Maidstone, und rings um Maidstone wuchsen Erdbeeren und Kirschen, Himbeeren und Pflaumen. Wie herrlich! Ich wollte nirgendwo anders leben als in Kent.
Im Winter 1900, als ich in Dublin Vorträge über den Burenkrieg hielt, sah ich das »Kleine Landhaus« wieder. Ich hatte es als ein langes, niedriges weißes Gebäude in Erinnerung, mit Veranden und grünen Läden, davor ein Rasenplatz so groß wie der Trafalgar Square und rings von tiefen Wäldern umgeben. Nach meiner Vorstellung musste es wenigstens eine Meile vom vizeköniglichen Landhaus entfernt liegen. Nun aber fand ich zu meinem Erstaunen, dass der Rasenplatz höchstens fünfzig Meter im Quadrat maß, die Wälder kaum mehr als Buschwerk waren und man nur wenige Minuten von der vizeköniglichen Residenz, wo ich wohnte, bis zum »Kleinen Landhaus« brauchte.
Meine nächste Erinnerung knüpft sich an Ventnor.[3] Ich mochte Ventnor sehr gern. Dort lebte eine Schwester von Mrs Everest, deren Mann nahezu dreißig Jahre Gefängniswärter gewesen war. Damals und auch später nahm er mich oft zu langen Spaziergängen über die Kreidefelsen und durch die Erosionstäler mit. Er erzählte mir viele Geschichten von Gefangenenrevolten und wie er mehrfach von den Sträflingen angegriffen und verletzt worden war. Als ich mich zum ersten Mal in Ventnor aufhielt, standen wir gerade im Krieg mit den Zulus. Die Zeitungen brachten Bilder von ihnen: schwarze, nackte Männer, mit Speeren bewaffnet, »assegais« genannt, die sie sehr geschickt zu werfen verstanden. Sie töteten sehr viele von unseren Soldaten, aber – nach den Bildern zu urteilen – doch nicht annähernd so viele, wie unsere Soldaten von ihnen töteten. Ich war sehr böse auf die Zulus und freute mich, dass sie umgebracht wurden, und mein Freund, der Gefängniswärter, war der gleichen Meinung. Irgendwann mussten sie wohl alle umgebracht worden sein, denn der Krieg ging zu Ende, die Zeitungen brachten keine Bilder mehr, und kein Mensch kümmerte sich mehr um sie.
Einmal, als wir draußen auf den Klippen bei Ventnor waren, sahen wir ein großes prächtiges Schiff unter vollen Segeln nur ein bis zwei Meilen von der Küste entfernt vorübergleiten. »Das ist ein Truppentransportschiff«, erklärte man mir, »es bringt unsere Soldaten aus dem Krieg heim.« Aber es mochte auch von Indien kommen, ich weiß nicht mehr genau.[4] Dann plötzlich standen schwarze Wolken am Himmel, Wind kam auf, und die ersten Tropfen eines heraufziehenden Unwetters fielen. Wir gelangten gerade noch nach Hause, ohne völlig durchnässt zu werden. Als wir das nächste Mal auf die Klippen gingen, war kein prächtiges Schiff mit vollen Segeln zu sehen, aber man zeigte mir drei schwarze Masten, die starr aus dem Wasser herausragten. Es war die Eurydice.[5] Sie war in ebenjenem Sturm gekentert und mit dreihundert Soldaten an Bord gesunken. Taucher gingen hinunter, um die Leichen zu bergen. Man erzählte mir – und das hinterließ eine seelische Narbe in mir –, dass einige der Taucher vor Grauen ohnmächtig geworden seien, als sie sahen, wie die Fische sich gütlich taten an den Leichen der armen Soldaten, die ertrunken waren, gerade als sie nach all den Mühen und Gefahren der Kämpfe gegen wilde Völkerschaften heimkehrten. Ich muss wohl gesehen haben, wie einzelne dieser Toten von Booten aus behutsam heraufgezogen wurden. Auf den Klippen standen viele Leute, und wir alle nahmen, von Trauer bewegt, unsere Hüte ab.
Zu ebenjener Zeit kam es auch zum großen Zugunglück in Schottland. Während eines heftigen Sturms stürzte die Brücke über dem Firth-of-Tay zusammen, gerade während ein Zug darüberfuhr, und alle Reisenden ertranken. Ich vermutete, sie hatten es nicht rechtzeitig durch die Wagenfenster hinausgeschafft. Es erschien mir auch sehr schwierig, ein solches Fenster zu öffnen, wo man erst an einer langen Schnur ziehen musste, ehe man es herunterlassen konnte. Kein Wunder, dass sie alle umgekommen waren. Die Menschen waren sehr aufgebracht über die Regierung, weil sie es zugelassen hatte, dass diese Brücke so mir nichts, dir nichts einstürzte. Auch ich hielt es für ein schlimmes Vergehen, und ich wunderte mich nicht, dass die Menschen erklärten, sie würden bei den kommenden Wahlen gegen die Regierung stimmen, weil sie aus Trägheit und Nachlässigkeit etwas so Schreckliches hatte geschehen lassen.
Im Jahr 1880 wurde unsere Familie durch Mr Gladstone[6] aus ihren Ämtern entfernt. Gladstone war ein sehr gefährlicher Mann, der umherging und die Leute aufhetzte und in Wut brachte, sodass sie gegen die Konservativen stimmten und meinen Großvater um das Vizekönigtum von Irland brachten. Er liebte diese Stellung weit weniger als das Amt des Lordpräsidenten des Kronrats, das er unter Lord Beaconsfields früherer Regierung innegehabt hatte. Als Vizekönig musste er sein ganzes Geld für die Vergnügungen der Iren in Dublin ausgeben, und meine Großmutter hatte eigens eine Stiftung ins Leben gerufen, die »Hungerhilfe« hieß. Aber die Iren – das prägte sie mir ein – waren ein sehr undankbares Volk: Sie sagten nicht einmal Danke für die Vergnügungen und ebenso wenig für die Hungerhilfe. Der Herzog wäre weit lieber in England geblieben, wo er auf seinem eigenen Schloss, Blenheim Castle, leben und regelmäßig den Kabinettssitzungen beiwohnen konnte. Aber er hatte stets getan, was Lord Beaconsfield von ihm erwartete. Lord Beaconsfield war der große Gegner von Mr Gladstone, und alle Welt nannte ihn »Dizzy«. Diesmal jedoch hatte Mr Gladstone »Dizzy« wirklich geschlagen. Wir alle wurden dadurch in die Opposition getrieben, und mit dem Land ging es rasch bergab. »Es geht vor die Hunde«, sagten die Leute. Zu allem Überfluss wurde Lord Beaconsfield auch noch schwer krank. Die Krankheit dauerte sehr lange, und da er schon sehr alt war, starb er daran. Ich verfolgte die Krankheit Tag für Tag mit großer Besorgnis, denn alle sagten, sein Hinscheiden bedeute für das Land einen unersetzlichen Verlust und außer ihm gäbe es keinen, der Mr Gladstone daran hindern könne, uns allen seinen unheilvollen Willen aufzuzwingen. Ich war von Anfang an überzeugt, dass Lord Beaconsfield sterben würde. Und zuletzt kam denn auch der Tag, an dem alle mit traurigen Gesichtern umhergingen, und sie sagten, ein großer und glänzender Staatsmann, der unser Land geliebt und den Russen Trotz geboten habe, sei an gebrochenem Herzen gestorben, wegen der Undankbarkeit, die er von den Radikalen habe erfahren müssen.
Wie der Schrecken in Gestalt der »Gouvernante« Einzug hielt in meine Welt, habe ich bereits erzählt. Aber nun drohte eine weit schlimmere Gefahr: Ich sollte in die Schule kommen. Ich war sieben Jahre alt und war das, was die Erwachsenen in ihrer vorschnellen Art ein »schwieriges Kind« nannten. Nun sollte ich Monate hindurch ohne Unterbrechung von zu Hause fort sein, um unter gehöriger Aufsicht zu lernen. Das Trimester hatte bereits angefangen, aber es blieben immer noch sieben lange Wochen, bis ich zu Weihnachten nach Hause durfte. Wenn auch vieles, was ich über die Schule gehört hatte, einen ausgesprochen unerfreulichen Eindruck auf mich machte – der sich, wie ich hinzufügen möchte, durch die Erfahrung auch bestätigen sollte –, so war ich doch auch in einer gewissen freudigen Aufregung über die große Veränderung in meinem Leben. Ich dachte mir, trotz der Schulstunden würde es lustig sein mit all den anderen Jungen zusammen, man würde Freundschaften schließen und allerlei Abenteuerliches erleben. Auch versicherte man mir, die Schulzeit wäre immer die glücklichste des ganzen Lebens. Der eine oder andere Erwachsene fügte dann wohl hinzu, dass es zu seiner Zeit, als sie jung gewesen wären, auf der Schule oft recht rau zugegangen sei, man wäre geschunden worden, hätte nicht genug zu essen bekommen, und morgens hätte man immer erst »das Eis in der Waschschüssel aufbrechen müssen«. (Ein Vorkommnis, das mir mein ganzes Leben lang nicht begegnet ist.) Jetzt aber sei alles anders geworden. Zur Schule zu gehen sei heutzutage das reinste Vergnügen. Alle Jungen hätten ihre Freude dran. Einige meiner Vettern, etwas älter als ich, seien (so erzählte man mir) sehr traurig gewesen, dass sie in den Ferien hätten nach Hause fahren müssen. Die Vettern, unter Kreuzverhör genommen, bestätigten das nicht. Sie grinsten bloß. Wie dem auch sei, jedenfalls war ich völlig machtlos. Strömungen, denen man sich nicht widersetzen konnte, rissen mich weiter. Das Haus zu verlassen, war wie geboren werden: Man wurde nicht gefragt.
Sehr interessant war es, all die Sachen einzukaufen, die man für die Schule benötigte. Nicht weniger als vierzehn Paar Socken standen auf der Liste. Mrs Everest hielt das für Verschwendung. Sie meinte, zehn Paar würden bei einiger Sorgfalt vollauf genügen. Aber es war doch ganz gut, eine Reserve zu haben, um besser gewappnet zu sein gegen die Gefahren, die »nasse Füße« unweigerlich mit sich brachten.
Dann kam der verhängnisvolle Tag. Meine Mutter fuhr mit mir in einem Hansom-Cab zum Bahnhof. Unterwegs gab sie mir drei Halbkronenstücke, die ich prompt auf den Boden fallen ließ. Wir mussten lange im Stroh der Kutsche herumsuchen, bis wir sie gefunden hatten. Nur mit knapper Not erreichten wir den Zug. Hätten wir ihn verpasst, hätte die Welt stillgestanden. Aber das geschah nun nicht, und die Welt lief weiter.
Die Schule, die meine Eltern für mich ausgesucht hatten, war eine der renommiertesten und teuersten des Landes. Ihr Vorbild war Eton, und es war ihr Hauptbestreben, als eine Vorbereitung auf dieses Institut angesehen zu werden. Sie galt auch als die modernste ihrer Art. Nur zehn Schüler in jeder Klasse, elektrisches Licht (damals etwas Unerhörtes), ein Schwimmbecken, weitläufige Fußball- und Kricketplätze, zwei- oder dreimal im Trimester Schulausflüge, die Lehrer alle Professoren in Talar und »Mörtelbrett«[7], eigene Kapelle. »Fresspakete« von zu Hause waren nicht erlaubt, die Schule sorgte für alles.
An einem trüben Novembernachmittag erreichten wir das Institut. Wir tranken Tee mit dem Direktor, und meine Mutter unterhielt sich sehr lebhaft und ungezwungen mit ihm. Ich war ständig in Sorge, meine Tasse umzustoßen, was gewiss »ein schlechter Start« gewesen wäre. Auch war mir ganz elend zumute bei dem Gedanken, in diesem großen, unwirtlichen und beängstigenden Gebäude mit den fremden Menschen allein gelassen zu werden. Schließlich war ich erst sieben Jahre alt und immer so glücklich gewesen in meiner Kinderstube mit all meinen Spielsachen. Ich besaß die herrlichsten Dinge: eine richtige Dampflokomotive, eine Laterna magica und eine Sammlung von Zinnsoldaten, fast tausend Mann stark. Nun hieß es nur noch lernen. Sieben bis acht Stunden am Tag, ausgenommen die wenigen freien Nachmittage, dazu noch Fußball und Kricket.
Als das Geräusch der Räder des Wagens, der meine Mutter davonführte, verklungen war, forderte mich der Direktor auf, ihm alles Geld, das ich besaß, auszuhändigen. Ich zog meine drei Halbkronenstücke hervor. Der Betrag wurde ordnungsgemäß in ein Buch eingetragen, und mir wurde gesagt, von Zeit zu Zeit finde ein Verkauf in der Schule statt, bei dem man alles bekomme könne, was man sich wünsche, und ich könne mir nach Belieben Sachen aussuchen, bis zum Gesamtpreis von 7 ½ Schilling. Dann verließen wir das Zimmer des Direktors und den behaglichen Privatflügel des Hauses und betraten die frostigen Schul- und Wohnräume der Zöglinge. Ich wurde in ein Klassenzimmer geführt und musste mich an ein Pult setzen. Die anderen Jungens waren alle draußen, und ich fand mich allein mit dem Klassenlehrer. Er zog ein dünnes Buch in grünlich-braunem Umschlag hervor, angefüllt mit Wörtern in verschiedenen Schriftarten.
»Latein hast du bisher noch nicht gehabt, nicht wahr?«, sagte er.
»Nein, Sir.«
»Dies ist eine lateinische Grammatik.« Er schlug eine stark abgegriffene Seite auf und wies auf zwei Reihen eingerahmter Wörter. »Das musst du lernen«, sagte er. »In einer halben Stunde komme ich wieder und hör dich ab.«
So saß ich denn an einem trübseligen Spätnachmittag mit wehem Herzen vor der ersten Deklination.
mensa
der Tisch
mensa
o Tisch
mensam
den Tisch
mensae
des Tisches
mensae
dem Tisch
mensa
von oder mit dem Tisch
Was um alles in der Welt sollte das bedeuten? Was ergab das für einen Sinn? Das schien mir der reinste Kauderwelsch zu sein. Nun, wenn ich eins gut konnte, dann auswendig lernen. Also nahm ich denn, soweit es meine privaten Kümmernisse gestatteten, die rätselhafte Aufgabe in Angriff.
Zur gehörigen Zeit erschien der Lehrer wieder.
»Hast du’s gelernt?«, fragte er.
»Ich glaube, ich kann es aufsagen«, antwortete ich und schnurrte die Lektion herunter.
Er schien sehr befriedigt, und das gab mir den Mut zu einer Frage.
»Was bedeutet das, Sir?«
»Das, was da steht. Mensa, der Tisch. Mensa ist ein Nomen der ersten Deklination. Es gibt fünf Deklinationen. Du hast den Singular der ersten Deklination gelernt.«
»Aber«, wiederholte ich, »was bedeutet das?«
»Mensa bedeutet der Tisch«, war die Antwort.
»Warum bedeutet dann aber ›mensa‹ auch ›o Tisch‹?«, forschte ich weiter. »Und was heißt das, ›o Tisch‹?«
»Mensa, o Tisch, ist der Vokativ.«
»Aber wieso ›o Tisch‹?« Meine angeborene Neugierde ließ mir keine Ruhe.
»O Tisch – das wird gebraucht, wenn man sich an einen Tisch wendet oder ihn anruft.« Und als er fortfuhr, merkte ich, dass ich ihm nicht folgen konnte: »Du gebrauchst es eben, wenn du mit einem Tisch sprichst.«
»Aber das tu ich doch nicht«, fuhr es mir in ehrlichem Erstaunen heraus.
»Wenn du frech wirst, wirst du bestraft, und zwar ganz gehörig, das kann ich dir versichern«, lautete seine endgültige Antwort.
Dies war meine erste Einführung in die Klassiker, aus denen, wie man mir gesagt hatte, unsere hervorragendsten Männer so viel Nutzen und Kraft geschöpft haben.
Der Hinweis des Klassenlehrers auf Bestrafung war im Übrigen kein leeres Gerede. Prügel mit der Birkenrute nach Eton-Manier waren groß in Mode in der St James’s School.[8] Aber ich bin überzeugt, dass kein Schüler von Eton und ganz bestimmt keiner in Harrow zu meiner Zeit je so furchtbare Schläge bekommen hat, wie sie der Direktor den seiner Obhut und Gewalt anvertrauten kleinen Jungen verabreichen ließ. Die Härte der Behandlung übertraf alles, was selbst in staatlichen Besserungsanstalten geduldet worden wäre. Die Lektüre späterer Jahre hat mir Aufschlüsse gegeben über die möglichen Hintergründe solcher Grausamkeit. Regelmäßig ein- oder zweimal im Monat wurde die ganze Schule in der Bibliothek versammelt. Dann wurden ein oder mehrere Delinquenten von zwei Klassenältesten in einen Nebenraum gezerrt und dort geprügelt, bis das helle Blut herunterlief, während wir anderen zitternd und auf die Schreie horchend beisammensaßen.
Diese Form der Besserungsmethode wurde ergänzt durch häufige Andachten in der Kapelle nach hochkirchlichem Ritus. Mrs Everest war eine entschiedene Gegnerin des Papstes. Er unterstütze, erklärte sie, insgeheim die Fenier. Sie selbst war Anhängerin der Low Church.[9] Ihre Abneigung gegen Prunk und Priesterschaft, wie allgemein ihre äußerst ungünstige Meinung vom Pontifex Maximus, hatten mir ein entschiedenes Vorurteil gegen diese Persönlichkeit und alle nur entfernt an ihn erinnernden religiösen Praktiken eingeflößt. Unter diesen Umständen vermochte mich die geistliche Seite meiner Erziehung nicht zu berühren. Die Heilsmittel des weltlichen Arms waren dafür umso schmerzhafter zu spüren.
Wie hasste ich diese Schule, in der ich mehr als zwei Jahre ein Leben voller Ängste lebte! Ich machte nur geringe Fortschritte im Lernen und gar keine im Sport. Tage und Stunden zählte ich bis zu den Ferien, wenn ich aus dieser verhassten Knechtschaft entlassen würde und zu Hause meine Zinnsoldaten auf dem Boden der Kinderstube in Schlachtreihen aufstellen konnte.
Meine größte Freude in jener Zeit war das Lesen. Mit neuneinhalb Jahren schenkte mir mein Vater Die Schatzinsel. Ich weiß noch, mit welcher Begeisterung ich das Buch verschlang. Meine Lehrer stellten Rückgang der Leistungen und Frühreife fest, da ich Bücher las, die meinem Alter nicht entsprachen, und dabei der Letzte in der Klasse war. Das ging ihnen gegen den Strich. Sie hatten Zwangsmittel in reichem Maße zur Verfügung, aber ich war stur. Wo nicht mein Interesse geweckt, meine Vernunft und Vorstellungskraft beteiligt waren, da wollte oder konnte ich nicht lernen. In den ganzen zwölf Jahren meiner Schulzeit hat es niemand vermocht mir beizubringen, wie man einen richtigen lateinischen Satz schreibt, und vom Griechischen lernte ich nicht mehr als das Alphabet.
Ich will mich keineswegs für diese törichte Versäumnis all der Möglichkeiten entschuldigen, die mir meine Eltern unter hohen Kosten verschafften und die mir meine Erzieher eindringlich ans Herz legten. Aber vielleicht hätte ich bessere Erfolge erzielt, wenn man mir die Alten durch ihre Geschichte und Kultur, anstatt durch ihre Grammatik und Syntax vermittelt hätte.
Mein Gesundheitszustand verschlechterte sich, und nach einer ernstlichen Erkrankung nahmen mich meine Eltern endlich von der Schule. Unser Hausarzt, der bekannte Robson Roose, praktizierte damals in Brighton, und da ich nun für ein zartes Kind galt, wurde es für wünschenswert gehalten, dass ich ständig unter seiner Aufsicht blieb. So kam ich 1883 in eine Schule nach Brighton, die von zwei Damen geleitet wurde. Sie war kleiner als die St James’s School, auch billiger und weniger anspruchsvoll. Aber ich fand dort eine Atmosphäre von Güte und Verständnis, woran es bei meiner frühesten Schulerfahrung so offenkundig gefehlt hatte. Ich blieb dort drei Jahre, und obwohl mich eine doppelseitige Lungenentzündung beinahe das Leben gekostet hätte, wurde ich doch in der stärkenden Luft und wohltuenden Umgebung ständig kräftiger. In dieser Schule durfte ich Dinge lernen, die mich interessierten: Französisch, Geschichte, Poesie (ich konnte eine Menge Gedichte auswendig) und vor allem Reiten und Schwimmen. Diese Jahre stehen als ein freundliches Bild in meiner Erinnerung, ganz im Gegensatz zu meiner ersten Schulzeit.
Meine Vorliebe für die Prinzipien der Low Church, die dem Einfluss von Mrs Everest zuzuschreiben war, brachte mich einmal in einen Konflikt. Wir besuchten den Gottesdienst in der Chapel Royal in Brighton. Dort mussten wir Schüler in Bänken Platz nehmen, die nach Norden beziehungsweise Süden wiesen. Als nun das Apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen wurde, mussten sich alle nach Osten umwenden. Ich war überzeugt, Mrs Everest hätte dieses Ritual als papistisch angesehen, und hielt es für meine Pflicht, dagegen Zeugnis abzulegen. So hielt ich denn standhaft den Blick geradeaus gerichtet. Ich glaubte, damit eine Sensation verursacht zu haben, und machte mich auf ein Martyrium gefasst. Aber kein Wort fiel über mein Verhalten, als wir wieder zu Hause waren. Ich war geradezu enttäuscht und wartete auf eine neue Gelegenheit, um meinen Glauben offen zu bekennen. Das nächste Mal wurden wir jedoch in andere, nach Osten gerichtete Bänke gesetzt, sodass das Credo für niemanden mit einer Handlungsaufforderung verbunden war. Ich war in Verlegenheit, wie ich meiner Glaubenspflicht in rechter Weise genügen sollte. Mich von Osten abzuwenden, das schien mir denn doch übertrieben und, wenn ich ehrlich war, auch wirklich nicht gerechtfertigt. Auf diese Weise wurde ich nolens volens zu einem passiven Anhänger der High Church.
Die beiden alten Damen begegneten meinen Skrupeln mit viel Einsicht und Zartheit. Diese geschickte Behandlung trug Früchte. Religiöse Fragen können mich seither nicht mehr beunruhigen. Da ich keinerlei Zwang oder Unduldsamkeit erfuhr, gelangte ich ganz von selbst zu einer weitherzigen Toleranz in allen Glaubenssachen.
IIHarrow
Ich hatte kaum mein zwölftes Lebensjahr vollendet, als ich die unwirtliche Wüstenei der Examen betrat, die ich die nächsten sieben Jahre lang durchwandern sollte. Prüfungen bedeuteten immer eine schwere Heimsuchung für mich. Die von den Examinatoren bevorzugten Fächer waren für gewöhnlich solche, denen ich am wenigsten Geschmack abgewinnen konnte. Ich wäre gern in Geschichte, Literatur und Aufsatz geprüft worden. Meine Lehrer hingegen versteiften sich auf Latein und Mathematik, und ihr Wille war Gesetz. Die in diesen beiden Fächern gestellten Fragen waren unweigerlich solche, auf die ich absolut keine befriedigende Antwort zu finden vermochte. Ich hätte mir gewünscht, dass man mir zu sagen erlaubt hätte, was ich wusste. Sie aber bemühten sich zu fragen, was ich nicht wusste. Wie gern hätte ich ihnen meine Kenntnisse präsentiert, doch ihnen gefiel es besser, meine Unwissenheit bloßzulegen. Ein solches Verfahren hatte verständlicherweise zur Folge, dass ich bei den Prüfungen schlecht abschnitt.
Das galt besonders für meine Aufnahmeprüfung für Harrow.[10] Der Direktor, Mr Welldon, sah jedoch über meine Lateinkünste großzügig hinweg und bewies entschieden Scharfsinn in der Beurteilung meiner allgemeinen Befähigung. Das war umso verdienstvoller von ihm, als ich nicht imstande war, in der Lateinprüfung auch nur eine einzige Frage zu beantworten. Oben auf das Blatt setzte ich meinen Namen. Dann schrieb ich die Ziffer der ersten Frage hin: »I«. Nach langer Überlegung setzte ich sie in Klammern: »(I)«. Und dann fiel mir nichts mehr ein, was irgendwie in Beziehung zu der gestellten Frage gestanden hätte. Irgendwann gerieten, man weiß nicht wie, ein Tintenklecks und mehrere Schmutzflecken auf das Papier. Zwei Stunden lang starrte ich auf das traurige Elaborat. Dann wurde das Blatt gnädigerweise mitsamt allen anderen eingesammelt und zum Tisch des Direktors gebracht. Ein sehr unzulängliches Zeugnis meiner Fähigkeiten, und doch schloss Mr Welldon aus ihm, dass ich zur Aufnahme in der Schule von Harrow befähigt war. Das ist ihm hoch anzurechnen. Er bewies damit, dass er die Gabe besaß, unter die Oberfläche zu blicken. Ein Mann, der sich in seinem Urteil nicht auf Papierkram verließ. Ich habe ihm immer große Dankbarkeit bewahrt.
Seiner Entscheidung gemäß kam ich in die dritte oder unterste Abteilung der vierten, also letzten Klasse. In der Schulliste wurden die Namen der neuen Schüler alphabetisch angeordnet. Da mein voller Name – Spencer-Churchill – mit einem »S« begann, rangierte ich auch hier nicht höher als in der Welt der Gelehrsamkeit. Ich war in der Tat der Drittletzte der ganzen Schule, und bedauerlicherweise verschwanden auch die beiden unter mir Stehenden sehr bald wegen Krankheit oder aus sonst einem Grunde.
In Harrow erfolgte das öffentliche Verlesen der Namen auf andere Weise als in Eton. In Eton standen die Schüler in Haufen beieinander und lüpften bei Nennung ihres Namens die Mütze. In Harrow dagegen musste man im Schulhof an dem Lehrer vorbeigehen, wenn man aufgerufen wurde. Dadurch wurde auf eine höchst demütigende Art offenbar, wie es mit mir stand. Es war im Jahr 1887. Lord Randolph Churchill, mein Vater, war gerade erst von seinem Posten als Schatzkanzler und Führer des Unterhauses zurückgetreten, war aber noch immer sehr präsent auf der politischen Bühne. Daher fanden sich immer viele Besucher beiderlei Geschlechts auf der Schultreppe ein, um mich vorbeimarschieren zu sehen. Und oft hörte ich die recht wenig ehrerbietige Äußerung: »Aber er ist ja der Letzte von allen!«
In dieser unerquicklichen Lage blieb ich fast ein Jahr lang. Immerhin, da ich so lange in der untersten Klasse saß, genoss ich doch einen außerordentlichen Vorteil gegenüber den rascher vorwärtskommenden Schülern. Diese mussten Latein und Griechisch und andere herrliche Dinge lernen. Mir aber wurde Englisch beigebracht. Man hielt uns für solche Dummköpfe, dass wir nur die eigene Sprache zu lernen vermochten. Mr Somervell – ein ganz prachtvoller Mensch, dem ich viel verdanke – war mit der Aufgabe betraut, den beschränktesten Jungen das gemeinhin am meisten Missachtete beizubringen – nämlich ein korrektes Englisch. Darauf verstand er sich. Er lehrte es, wie kein anderer es je gelehrt hat. Wir lernten nicht nur die englische Grammatik, sondern übten unablässig Satzbestimmung. Mr Somervell hatte dafür sein eigenes System. Er nahm einen hübsch langen Satz und zerlegte ihn in seine Bestandteile mithilfe von schwarzer, roter, blauer und grüner Tinte: Subjekt, Prädikat, Objekt, Relativsätze, Bedingungssätze, Parataxe, Hypotaxe! Alles hatte seine Farbe und seine Klammer. Es war eine Art Drill. Wir exerzierten das fast jeden Tag. Da ich dreimal so lang wie jeder andere in der »Dritten Vierten« (β) saß, bekam ich das Ganze dreimal so oft eingetrichtert und lernte es gründlichst. Der Aufbau eines gewöhnlichen englischen Satzes – ein ehrwürdiges Gebilde – ging mir in Fleisch und Blut über. Und wenn meine Schulkameraden, die für das Abfassen eines gelungenen lateinischen Gedichts oder eines markigen griechischen Epigramms Preise und Auszeichnungen erhalten hatten, in späteren Jahren wieder auf das gewöhnliche Englisch zurückzugreifen genötigt waren, um ihr Brot zu verdienen oder vorwärtszukommen, dann fühlte ich mich ihnen gegenüber keineswegs im Nachteil. Natürlich bin ich parteiisch, wenn es um das Erlernen von Sprachen geht. Ich würde allen Jungen erst einmal ordentlich Englisch beibringen, und danach würde ich die begabteren Lateinisch lernen lassen, zur Belohnung, und Griechisch, zum bloßen Vergnügen. Prügeln würde ich nur diejenigen, die nicht Englisch können. Die aber gehörig.
Mein erstes Trimester in Harrow fiel in den Sommer. Die Schule besaß das größte Schwimmbecken, das ich je gesehen habe. Es war wie ein breiter Fluss, der von zwei Brücken überquert wurde. Dort in der Badeanstalt hielten wir uns stundenlang auf, sonnten uns zwischen dem Schwimmen auf dem heißen Asphaltrand und aßen riesige Milchbrötchen. Natürlich bedeutete es einen Hauptspaß, sich hinter einen Freund oder auch Feind zu schleichen und ihn ins Wasser zu stoßen. Einmal – ich war erst zwei Monate in der Schule – sah ich einen Jungen, in ein Badetuch gewickelt, in Gedanken versunken gerade an der äußersten Kante stehen. Er war nicht größer als ich, und ich dachte, ich könnt es riskieren. Ich stahl mich leise hinter ihn und stieß ihn hinein, dabei aus Menschlichkeit sein Tuch festhaltend, damit es nicht nass würde. Zu meinem Schrecken sah ich ein wütendes Gesicht aus der Gischt auftauchen, und ein offenbar ungemein starker Kerl arbeitete sich mit kräftigen Zügen ans Ufer. Ich entfloh, aber vergebens. Schneller als der Wind hatte mich mein Verfolger eingeholt, packte mich mit festem Griff und schleuderte mich ins Wasser, da wo es am tiefsten war. Ich krabbelte an der entgegengesetzten Seite heraus und fand mich von einer aufgeregten Schar kleiner Jungen umgeben. »Schön dumm von dir«, riefen sie. »Ist dir klar, was du getan hast? Das war Amery aus der sechsten Klasse. Er ist Hausvorstand und der beste Turner, im Fußball hat er das Sportabzeichen bekommen!« Sie fuhren fort, alle seine Ruhmestaten und Ehrentitel aufzuzählen, und ergingen sich lang und breit über die furchtbare Vergeltung, die mir bevorstand. Ich war wie vom Schlag gerührt, nicht nur vor Furcht, sondern mehr noch, weil ich mich einer Majestätsbeleidigung schuldig gemacht hatte. Wie hätte ich seinen hohen Rang aber auch erkennen können, wo er doch nur im Badetuch dagestanden hatte und dazu noch so klein war. Ich beschloss, mich unverzüglich zu entschuldigen. Zitternd näherte ich mich dem hohen Herrn. »Ich bitte um Entschuldigung«, sagte ich, »aber ich dachte, du wärst ein Viertklässler. Du bist so klein.« Das schien ihn keineswegs zu besänftigen, und so fügte ich mit dem Mut der Verzweiflung hinzu: »Mein Vater ist ein großer Mann, und der ist auch klein.« Darauf lachte er, und nach einigen allgemeinen Bemerkungen über meine Frechheit und Ermahnungen, mich in Zukunft besser vorzusehen, bedeutete er mir, dass die Sache erledigt wäre.
Ich hatte das Glück, ihm im späteren Leben, wo die Altersunterschiede nicht mehr so bedeutungsvoll wie auf der Schule sind, noch oft zu begegnen. Mehrere Jahre lang war er mein Kollege im Kabinett.
Dass ich, der ich doch offenbar in der untersten Klasse festsaß, in einem jahrgangsübergreifenden Wettbewerb den ersten Platz belegte für das fehlerlose Rezitieren von zwölfhundert Zeilen aus Macaulays Altrömischen Balladen, wurde als widersinnig erachtet. Ebenso gelang mir die Vorprüfung für den späteren Eintritt ins Heer, zu einer Zeit, da ich immer noch so ziemlich der Letzte der ganzen Schule war. Für diese Prüfung habe ich mich anscheinend besonders angestrengt, denn viele, die weit über mir waren, fielen dabei durch. Aber ich hatte auch Glück. Wir wussten, dass uns unter anderem die Aufgabe gestellt werden würde, die Karte irgendeines Landes zu zeichnen. Den Abend zuvor schrieb ich mir bei der letzten Vorbereitung die Namen sämtlicher Karten aus dem Atlas auf Zettel, tat diese in einen Hut und zog Neuseeland. Mit meinem guten Gedächtnis prägte ich mir die Geographie dieses Dominions genau ein. Und siehe da, die erste Aufgabe des Fragebogens lautete: »Zeichnung einer Landkarte von Neuseeland«. Das ist, was man in Monte Carlo »en plein«spielen nennt, und ich hätte das Fünfunddreißigfache herausbekommen sollen. Nun, ich erhielt jedenfalls sehr hohe Noten auf meinen Einsatz.
Damit war ich in die militärische Laufbahn eingebogen. Schuld daran war eigentlich meine Zinnsoldatensammlung. Zuletzt besaß ich annähernd fünfzehnhundert, alle von derselben Größe, alles Briten, eine ganze Infanteriedivision nebst Kavalleriebrigade.
Mein Bruder Jack kommandierte die feindliche Armee. Aber infolge eines Abkommens über Rüstungsbeschränkung durfte er nur über farbige Truppen verfügen und auch keine Artillerie haben. Sehr wichtig! Ich meinerseits konnte nur achtzehn Feldgeschütze aufbringen – abgesehen von der Festungsartillerie. Alle anderen Waffengattungen waren vollzählig, bis auf eine, mit der es zumeist in Armeen mangelhaft bestellt ist – nämlich den Train.[11] Ein alter Freund meines Vaters, Sir Henry Drummond Wolff, war voller Anerkennung über die Schlachtordnung meiner Truppen, bemerkte jedoch den Mangel und stellte einen Fonds zur Verfügung, aus dem das Fehlende bis zu gewissem Grade beschafft wurde.
Der Tag kam, an dem mein Vater zur offiziellen Besichtigung erschien. Die Truppen waren in vorschriftsmäßiger Angriffsstellung aufgebaut. Zwanzig Minuten lang betrachtete mein Vater mit interessiertem Blick und wohlwollendem Lächeln das wirklich eindrucksvolle Bild. Schließlich fragte er mich, ob ich ins Heer eintreten wolle. Ich stellte es mir großartig vor, eine Armee zu kommandieren, sagte umgehend Ja und wurde sofort beim Wort genommen. Jahrelang glaubte ich, Erfahrung und Scharfblick meines Vaters hätten in mir das militärische Talent entdeckt. Später erfuhr ich, dass er nur zu der Überzeugung gekommen war, ich sei zum Jurastudium nicht begabt genug. Wie dem auch sei, jedenfalls haben die Zinnsoldaten mein weiteres Schicksal bestimmt. Von nun ab war meine Ausbildung ganz auf die Vorbereitung für Sandhurst ausgerichtet, wozu später noch die Spezialkenntnisse im Waffenhandwerk kamen. Alles andere hatte ich mir selbst anzueignen.
Ich verbrachte etwa viereinhalb Jahre in Harrow, davon drei in dem sogenannten Armeekursus, zu dem ich dank der bestandenen Vorprüfung zugelassen wurde. Es waren Schüler sehr verschiedenen Alters aus den mittleren und höheren Klassen dabei. Alle wurden auf die Aufnahmeprüfung für Sandhurst oder Woolwich vorbereitet. Den Aufstieg in den gewöhnlichen Schulklassen machten wir nicht mit. Auf diese Weise erhielt ich keine oder nur geringe Vergünstigungen und blieb eigentlich immer am Ende der Schulliste. Offiziell kam ich nie über die Unterschule hinaus und erwarb daher auch nicht das Privileg, mir einen »Fuchs« zu halten. Im Laufe der Zeit wurde ich ein sogenannter »Dreijähriger«. Damit brauchte ich nicht mehr selbst »Fuchs« zu sein, und da ich an Jahren älter war als die anderen meines Ranges, wurde ich zum »Obmann der Füchse« in meinem Hause ernannt. Es war meine erste verantwortungsvolle Stellung. Zu meinen – natürlich ehrenamtlichen – Aufgaben gehört es, das Verzeichnis der Füchse auf dem Laufenden zu halten, Listen über ihre Pflichten mit einer entsprechenden Zeiteinteilung anzufertigen und Abschriften davon in den Stuben der Präfekten, der Fußball- und Kricketmeister und anderer Mitglieder unserer Aristokratie anzuheften. Ich verwaltete dieses Amt über ein Jahr, und alles in allem war ich mit meinem Los zufrieden.
Inzwischen hatte ich eine großartige Methode zur Vorbereitung auf die lateinische Übersetzung herausgefunden. Im Gebrauch des Wörterbuchs war ich immer sehr langsam. Es ging einem dabei wie beim Fernsprechverzeichnis. Das Aufschlagen annähernd beim richtigen Buchstaben ist nicht schwer, aber dann muss man ständig Seiten vor- oder zurückzublättern und die Spalten runter- und wieder rauffahren, nur um schließlich festzustellen, dass man das Wort auf der verkehrten Seite gesucht hat. Kurzum, ich fand das höchst beschwerlich, während es den anderen keine Mühe zu machen schien. Daher schloss ich ein Bündnis mit einem von der sechsten Klasse. Er war sehr begabt und konnte Latein so leicht lesen wie Englisch. Ob Cäsar, Ovid, Virgil, Horaz oder sogar Martials Epigramme, für ihn bedeutete das keinen Unterschied. Ich hatte täglich etwa zehn bis fünfzehn Zeilen vorzubereiten. Die Entzifferung des Textes hätte mich eine bis anderthalb Stunden gekostet, und dann wäre es wahrscheinlich noch falsch gewesen. Aber mein Freund konnte den Text in fünf Minuten wortgetreu für mich präparieren, und wenn ich die Übersetzung einmal gesagt bekommen hatte, behielt ich sie auch. Meinem Kollegen von der Sechsten machten hingegen die englischen Aufsätze, die er für den Direktor zu schreiben hatte, ebenso viele Schwierigkeiten wie mir die lateinischen Kreuzworträtsel. Wir trafen nun das Abkommen, dass er meine lateinische Übersetzung machen sollte, während ich dafür seine Aufsätze abfasste. Die Einrichtung bewährte sich glänzend. Mein Lateinlehrer schien mit meinen Leistungen zufrieden, und ich hatte in den Morgenstunden mehr Zeit für mich. Ein- oder zweimal in der Woche hatte ich für meinen Freund aus der Sechsten den Aufsatz zu schreiben. Ich ging im Zimmer diktierend auf und ab – genau so, wie ich es jetzt tue – und er schrieb, am Tisch sitzend, mit. Das ging so mehrere Monate. Aber einmal wären wir fast ertappt worden. Einer dieser Aufsätze wurde als besonders gelungen anerkannt und dem Direktor vorgelegt. Dieser ließ meinen Freund kommen, lobte ihn wegen seiner Arbeit und begann mit ihm eine angeregte Erörterung des Themas. »Die Frage, die Sie da angeschnitten haben, interessiert mich sehr. Mir scheint, Sie hätten noch weiter darauf eingehen können. Erklären Sie mir näher, was Sie dabei im Sinn hatten?« Trotz völlig unzulänglicher Antworten fuhr Mr Welldon, zur großen Bestürzung meines Verbündeten, in dieser Weise eine ganze Weile fort. Schließlich aber entließ ihn der Direktor, der einen Anlass zur Anerkennung nicht durch einen Tadel beeinträchtigen wollte, mit der Bemerkung: »Schriftlich scheinen Sie sich besser ausdrücken zu können als mündlich.« Mein Freund kam wie ein begossener Pudel zurück, und in Zukunft war ich sorgfältig darauf bedacht, bei den Aufsätzen lieber nicht die ausgetretenen Pfade zu verlassen.
Mr Welldon nahm freundliches Interesse an mir, und da er wusste, wie schwer ich mich mit den klassischen Sprachen tat, beschloss er, mir persönlich zu helfen. Er hatte am Tag wirklich genug zu tun, dennoch nahm er sich dreimal in der Woche eine Viertelstunde vor dem Abendgebet Zeit, um mir Nachhilfe zu geben. Das war sehr gütig von dem Direktor, denn selbstverständlich unterrichtete er ausschließlich die Präfekten und Schüler der obersten Klasse. Die Ehre machte mich stolz, doch die Marter schreckte mich. Wer von meinen verehrten Lesern je Latein gelernt hat, der weiß, dass man bereits in einem frühen Stadium auf den Ablativus absolutus stößt sowie auf die, zugegeben, nicht sehr gut beleumdete Alternative: »cum plus Konjunktiv«. Ich habe immer »cum« bevorzugt. Die Konstruktion war etwas umständlicher und entbehrte daher der viel gerühmten Eleganz und Knappheit des Lateinischen. Andererseits aber vermied man auf diese Weise eine Menge gefährlicher Fallen. Ich war sehr oft im Zweifel, ob der Ablativus absolutus auf e, i, o, is oder ibus zu enden habe, und auf die genaue Wahl wurde ungemein großen Wert gelegt. Ein Missgriff bei diesen Endungen schien Mr Welldon geradezu körperlichen Schmerz zu verursachen. Ich erinnere mich, dass in späteren Jahren H.H. Asquith[12] auf sehr ähnliche Weise das Gesicht verzog, wenn ich eine Debatte im Kabinett mit einem meiner seltenen, aber wortgetreuen lateinischen Zitate zierte. Es war mehr als Pein, es war wie ein Schlag, den man versetzt bekommt. Schuldirektoren stehen allerdings Machtmittel zur Verfügung, wie man sie Premierministern noch niemals anvertraut hat. Diese abendlichen Viertelstunden mit Mr Welldon vermehrten daher um ein Beträchtliches die Betrübnisse meines Daseins. Ich war wie erlöst, als der Direktor nach etwa halbjährigem geduldigen Bemühen seine wohlgemeinten, aber nutzlosen Versuche aufgab.
Ich möchte hier einige grundsätzliche Gedanken zum Thema Latein anfügen, die wohl auch für das Altgriechische gelten. In einer vernünftigen Sprache wie Englisch werden alle wichtigen Wörter durch zusätzliche kleine Wörter aneinandergereiht und in Beziehung gesetzt. Die Römer in ihrer klassischen Verbohrtheit hielten diese Methode für zu schwach und würdelos. Sie bestanden darauf, dass die Form jedes Wortes durch sein Nachbarwort verändert werde, und dies nach ausgeklügelten Regeln, um den verschiedenen Bedingungen Rechnungen zu tragen, unter denen ein Wort jeweils verwendet werden kann. Es besteht keine Frage, dass diese Methode imposanter daherkommt und vornehmer klingt als unsere eigene. Die Sätze fügen sich ineinander wie Teile einer auf Hochglanz polierten Maschine. Jeder Satzteil kann bis zum Äußersten mit Sinn beladen werden. Die Sprache zu sprechen, muss sehr mühsam gewesen sein, selbst wenn man damit aufgewachsen war. Aber auf diese Weise gelang es den Römern, und auch den alten Griechen, auf geschickte Weise, sich ihren späteren Ruhm zu sichern. Sie waren die ersten Dichter und Denker, und als sie zu den üblichen Einsichten gelangten zum Thema Leben und Lieben, Krieg und Schicksal, Sitten und Gebräuche, prägten sie ihre Sprüche und Epigramme, für die ihre Sprache wie gemacht schien, und halten darauf seither die Patentrechte. Daher der Ruhm der Alten. Das hat mir in der Schule niemand gesagt. Ich lernte es erst viel später, durch eigenes Nachdenken.
Aber selbst als Schüler fragte ich mich und andere, ob die klassischen Sprachen wirklich angemessen seien für die Anfangsgründe unserer Bildung. Nun, man antwortete mir, dass W.E. Gladstone Homer zum Vergnügen lese, und ich dachte, geschieht ihm recht, und dass ich dieses Vergnügen frühestens im nächsten Leben mit ihm teilen werde. Wenn ich meine Skepsis zeigte, wurde angefügt, dass die klassischen Sprachen eine gute Hilfe seien, wenn es darum gehe, Englisch zu lesen und zu sprechen. Es wurde daran erinnert, wie viele englische Wörter aus dem Griechischen und Lateinischen stammten. Er ist unbestreitbar sinnvoll, den Ursprung dieser Wörter zu kennen, wenn man sie verwenden will. Ich war durchaus geneigt, diesen praktischen Nutzen anzuerkennen. Doch heute geht es um ganz andere Dinge. Ausländische Wissenschaftler haben sich mit den Schotten verbündet, um eine neue Aussprache des klassischen Latein in den Schulen einzuführen, die uns Engländer endgültig von dieser Sprache entfremden wird. Sie wollen, dass wir statt »civis«, »kiwis« sagen, und einer der berühmtesten und unverwüstlichen Aussprüche aller Zeiten – »veni, vidi, vici« – lautet bei ihnen »weni, widi, wiki«. Menschen, die für dieses Übel verantwortlich sind, gehören bestraft.
Wir werden bei Gelegenheit des Indien-Kapitels dieses Buches auf derartige Pedanterien zurückkommen. Als ich ein Kind war, schrieb und sagte jedermann: »Punjaub«, »Pundit«, »Umbala« etc. Doch dann kamen kluge Köpfe daher und sagten: »Nein, ihr müsst es korrekt aussprechen.« Und seither sagen alle: »Panjab« oder »der Pandit so und so« oder »die Unruhen in Ambala«. Wenn die Inder dies hören, wundern sie sich über die ausländische Aussprache – und das ist die einzig angemessene Reaktion auf diese Form von Altklugheit. Ich bin sehr konservativ in diesen Dingen. Ich werde »czar« immer »czar«[13] aussprechen. Die revidierte Fassung der King James Bible und die Überarbeitung des Common Book of Prayer und vor allem die Trauungsliturgie – sie sind grauenvoll.
IIIPrüfungen
Ich brauchte drei Anläufe, um nach Sandhurst zu kommen. Bei den Prüfungen wurden fünf Fächer verlangt. Mathematik, Latein und Englisch waren obligatorisch. Ich wählte noch Französisch und Chemie. Damit hatte ich zwei Könige in der Hand: Englisch und Chemie. Aber ich brauchte drei, um an den Jackpot heranzukommen. Also hatte ich noch eine entsprechende dritte Karte nötig. Latein schied aus. Mein tief sitzendes Misstrauen gegen die Sprache versperrte mir jeden Zugang. Für Latein wurden zweitausend Punkte gegeben. Ich hätte es höchstens auf vierhundert gebracht. Französisch war verlockend, hatte aber seine Tücken und war in England schwer zu erlernen. Blieb also nur Mathematik. Als die erste Prüfung vorüber war und ich das Schlachtfeld überschaute, zeigte es sich, dass ich den Krieg nur durch Heranbringen einer weiteren Armee gewinnen konnte. Mathematik war die einzige noch verfügbare Reserve. Verzweifelt stürzte ich mich darauf. Ich bin immer wieder in meinem Leben in die Lage gekommen, unangenehme Dinge in kürzester Zeit bewältigen zu müssen, aber dass ich binnen sechs Monaten Mathematik lernte, betrachte ich als einen wahren Triumph, moralisch wie technisch. Bei der ersten dieser drei Leidensstationen bekam ich für Mathematik 500 Punkte von 2500. Bei der zweiten fast 2000. Diese Erfolge verdanke ich nicht nur meiner verzweifelten Entschlossenheit – für die keine Anerkennung zu groß ist –, sondern ebenso der hilfsbereiten Anteilnahme, die ein sehr geschätzter Lehrer in Harrow, C.H.P. Mayo, an meiner Lage nahm. Er überzeugte mich davon, dass Mathematik keineswegs ein bodenloser Sumpf von Ungereimtheiten sei, dass hinter den merkwürdigen Hieroglyphen Sinn und Ordnung stecke und dass ich wohl fähig sei, wenigstens einiges davon auch zu begreifen.
Unter Mathematik verstehe ich in diesem Fall natürlich nur die sehr rudimentären Kenntnisse, die die Staatsvertreter bei den Prüfungen verlangten. In den Augen eines Mathematikstudenten in Cambridge, oder wo auch immer, mögen die Wasser, in denen ich schwamm, nur als ein Entenpfuhl im Vergleich zum Atlantischen Ozean erschienen sein. Und doch: Selbst in diesen seichten Gewässern verlor ich rasch den Boden unter den Füßen. Wenn ich heute zurückblicke auf die sorgenvollen Monate, so stehen sie vor mir wie eine bizarre Landschaft. Natürlich hatten wir das Gebiet der gemeinen Brüche und des Dezimalsystems bald hinter uns gelassen. Wir gelangten in eine Alice-im-Wunderland-Welt, an deren Toren »quadratische Gleichungen« standen. Mit sonderbaren Grimassen wiesen sie uns den Weg zur »algebraischen Analysis«, wo der Fremdling alsbald den Unbilden der »binomischen Formeln« ausgesetzt war. In einiger Entfernung gab es angeblich von übel riechenden Fackeln trüb beleuchtete Kammern, in denen ein Drache namens »Differenzialrechnung« hauste, aber dieses Ungeheuer lag außerhalb des von der Prüfungskommission abgesteckten Terrains, das der arme Pilgrim auf seinem Gewaltmarsch zu durchmessen hatte. Wir gingen nach links, nicht in Richtung der »lieblichen Berge« und ihrer Anhöhen, sondern in einen Korridor voller sonderbarer Anagramme und Akrosticha, genannt Sinus, Kosinus und Tangens. Sie waren offenbar sehr bedeutsam, vor allem, wenn man sie miteinander multiplizierte oder mit sich selbst! Das Gute an ihnen war: Man konnte viele der geheimnisvollen Ableitungen auswendig lernen. Bei meiner dritten und letzten Prüfung handelte eine Frage von diesen Kosinussen und Tangenten in hochquadratwurzeligem Zustand. Mein ganzes fernere Leben schien von ihr abzuhängen. Sie war eine Sphinx. Aber zum Glück war mir ihr garstiges Antlitz erst wenige Tage vorher vor Augen gekommen, und ich erkannte sie auf den ersten Blick wieder.
Seitdem bin ich all diesen Wesen nie wieder begegnet. Mit meiner dritten und erfolgreichen Prüfung schwanden sie hinweg, gleich den Phantasmen eines Fiebertraums. Ich weiß, sie sind sehr nützlich für die Technik, die Astronomie und ähnliche Dinge. Es ist wichtig, Brücken und Kanäle zu bauen und all die Gesetze der Materie zu kennen, ganz zu schweigen von dem Zählen der Sterne und selbst der Welten und dem Messen ihrer Entfernungen und dem Voraussagen von eintretenden Sonnen- und Mondfinsternissen und dem Erscheinen von Kometen und dergleichen mehr. Ich bin sehr froh, dass es Menschen gibt, die die angeborene Gabe und die Neigung haben, sich mit der Mathematik zu beschäftigen – ähnlich Schachgroßmeistern, die sechzehn Partien gleichzeitig und mit verbundenen Augen spielen – bis sie plötzlich und unerwartet an Epilepsie sterben. Selbst schuld! Aber ich hoffe, die Mathematiker werden gut bezahlt, und ich verspreche, nie als Streikbrecher bei ihnen aufzutreten, noch ihnen das Wasser abzugraben.
Einmal hatte ich indes das Gefühl, als erschaute ich die Mathematik als ein Ganzes – Tiefe auf Tiefe enthüllte sich mir – Gründe und Abgründe. Ich sah es, wie man etwa den Durchgang der Venus betrachtet – oder auch den jährlichen Lord-Mayor-Umzug: Eine endliche Größe bewegt sich durch die Unendlichkeit und wechselt dabei sein Vorzeichen von Plus zu Minus. Ich sah genau, wie es geschah und warum der Richtungswechsel unvermeidbar war und wie der eine Schritt alle weiteren nach sich zog. Ganz wie in der Politik. Aber das war unmittelbar nach dem Mittagessen, und ich ließ die Sache in der Folge auf sich beruhen!
Die praktische Seite der Sache ist die: Wenn der bejahrte und müde Herr von der Prüfungskommission nicht just diese eine Frage über Kosinus und Tangente gestellt hätte, die ich zufällig kaum acht Tage zuvor gelernt hatte, so wären alle folgenden Kapitel dieses Buches nie geschrieben worden. Ich wäre vielleicht Geistlicher geworden und hätte in kühnen Strafpredigten die Irrungen der Gegenwart gegeißelt. Oder ich hätte mich in der City niedergelassen und mir ein Vermögen geschaffen. Oder ich wäre in die Kolonien – »Dominions«, wie man heutzutage sagt – gegangen in der Hoffnung, sie zu befrieden oder wenigstens zu beruhigen, und hätte womöglich eine sensationelle Karriere à la Lindsay Gordon[14] oder Cecil Rhodes[15] absolviert. Vielleicht hätte ich mich auch dem Rechtswesen zugewandt, und aufgrund meiner Anklage wären Verbrecher gehängt worden, die jetzt selbstzufrieden ihren Lebensabend genießen. Jedenfalls hätte sich mein ganzes Leben anders gestaltet, und dadurch hätte sich vermutlich das Leben vieler anderer anders gestaltet, die ihrerseits wiederum … und so weiter.
Hier scheinen wir wieder ins Gebiet der Mathematik zu geraten, das ich im Jahr 1894 ein für alle Mal verlassen hatte. Das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass der Angehörige der Prüfungskommission mit seiner unverfänglichen Frage alle weiteren Ereignisse – zumindest soweit sie mich betrafen – in eine bestimmte Richtung lenkte. Ich kenne Staatsbeamte. Ich habe Umgang mit ihnen. Ich bin gewissermaßen ihr oberster Chef.[16] Ich bewundere sie. Ich ehre sie. Wir alle tun das. Aber niemand, sie selbst am wenigsten, sollte doch vermuten, dass sie eine derart entscheidende, ja fatale Rolle im Leben eines Menschen spielen können. Was mich zum Thema freier Wille beziehungsweise Vorsehung führt, denn ich bin durch meine Erfahrung zu der Einsicht gelangt, dass beide identisch sind.
Ich liebe Schmetterlinge. In Uganda habe ich prächtige Exemplare gesehen. Ihre Flügel changierten von dunklem Rostbraun zu strahlendem Blau, je nachdem, aus welchem Winkel man sie betrachtete. Der Kontrast ist unglaublich. Man kann sich keinen extremeren farblichen Gegensatz denken bei ein- und demselben Schmetterling. Der leuchtende, flatternde Schmetterling ist eine gegebene Tatsache – kurz hält er inne und breitet seine Flügel in voller Größer in der Sonne aus, dann entschwindet er in den Schatten des Waldes. Ob man an den freien Willen glaubt oder an die Vorsehung: Alles hängt von dem Blickwinkel ab, aus dem man die Farbe der Schmetterlingsflügel sieht – die tatsächlich mindestens zwei Farben zur selben Zeit sind. Aber ich habe nicht die Mathematik an den Nagel gehängt, um mich mit Metaphysik zu beschäftigen. Kehren wir also wieder auf den Pfad der Erzählung zurück.
Als mir zum zweiten Mal der Übergang nach Sandhurst misslang, sagte ich Harrow Lebewohl und wurde in eine »Presse« gesteckt, das letzte Rettungsmittel. Hauptmann James leitete zusammen mit seinen hochbegabten Mitarbeitern eine solche Drillanstalt in der Cromwell Road. Es hieß, dass unweigerlich jeder – wenn er kein kompletter Idiot war – von dort aus in die Armee gelangte. Das Institut hatte die Geistesart des gemeinen Prüfungskommissars gleichsam wissenschaftlich erforscht. Man wusste dort mit nahezu päpstlicher Unfehlbarkeit, welche Fragen ein solcher Mann einfach aus seinem Charakter heraus in sämtlichen Prüfungsfächern für gewöhnlich stellte. Sie spezialisierten sich auf diese Fragen und auf die Antworten darauf. Sie feuerten gleichsam eine große Anzahl Schrotschüsse in Richtung eines Vogelschwarms und erzielten damit einen hohen und gleichbleibenden Trefferdurchschnitt. Hauptmann James war – natürlich ohne es zu ahnen – der geniale Vorläufer der Erfinder des Artilleriesperrfeuers im Weltkrieg. Von sorgfältig gewählten Stellungen aus legte er ein Gebiet unter Feuer, auf dem sich nach seiner Kenntnis starke Truppen des Feindes angesammelt haben mussten. Er hatte lediglich eine bestimmte Anzahl Granaten per Quadratmeter und Stunde abzuschießen, um seines Erfolges sicher zu sein. Die feindlichen Soldaten brauchte er gar nicht zu sehen. Er musste seine Kanoniere lediglich gut drillen, das war alles. Auf diese Weise hielt er mindesten zwei Jahrzehnte lang das »Blaue Band« unter den »Pressen«. Er glich jenen Leuten, die ein sicheres System zur Sprengung der Bank in Monte Carlo besitzen, mit dem großen Unterschied, dass sein System in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle Erfolg zeitigte. Selbst die hoffnungslosesten Fälle konnten behandelt werden. Absolute Garantie wurde nicht gegeben, aber ein regelrechter Blindgänger war auch nicht zu erwarten.
Doch als ich eben im Begriff war, mich der Vorteile dieses neuen Systems intensiver Kükenzucht zu erfreuen, kam es zu einem sehr ernstlichen Unfall.
Meine Tante, Lady Wimborne, hatte uns ihren schönen Besitz in Bournemouth für den Winter überlassen. Ein vierzig bis fünfzig Morgen großer Kiefernwald senkte sich in sandigen Hügelwellen bis zu den Klippen, die den flachen Strand des englischen Kanals umsäumen. Mitten durch dieses kleine öde Waldstück zog sich eine tiefe Schlucht, eine »Klamm«, wie wir sagten. Diese Klamm wurde von einer einfachen hölzernen Brücke, etwa vierzig Meter lang, überquert. Ich war eben achtzehn und auf Ferien. Mein jüngerer Bruder von zwölf Jahren und mein vierzehnjähriger Vetter schlugen vor, in jenem Waldstück »Fangen« mit mir zu spielen. Nachdem ich zwanzig Minuten gehetzt worden und ziemlich außer Atem gekommen war, beschloss ich, über die Brücke zu entweichen. Auf der Mitte angekommen, sah ich zu meiner Bestürzung, dass meine Verfolger ihre Kräfte geteilt hatten. An jedem Ende der Brücke stand einer. Gefangennahme schien sicher. Doch im selben Moment kam mir ein großartiger Gedanke. Die Klamm, über die die Brücke lief, war