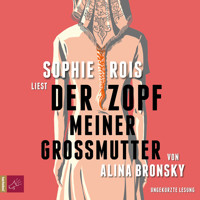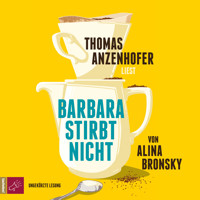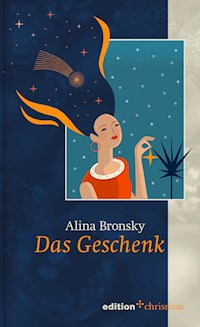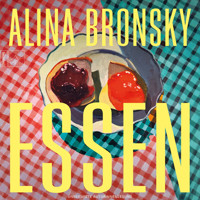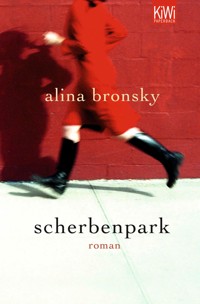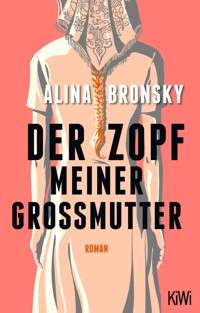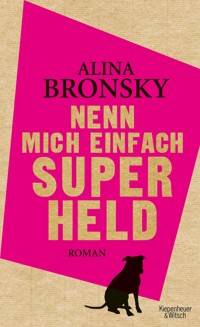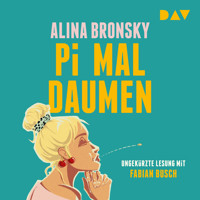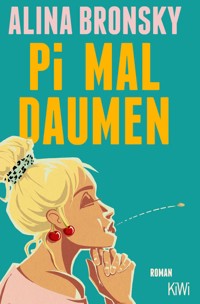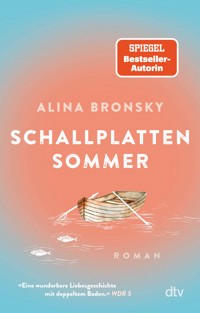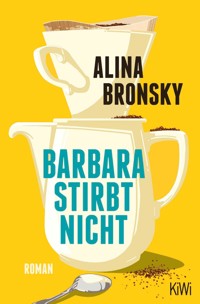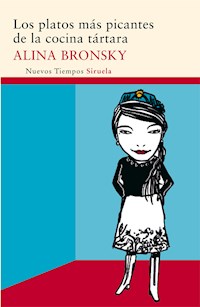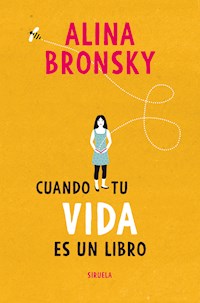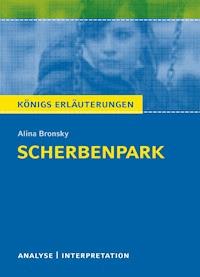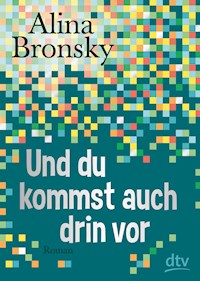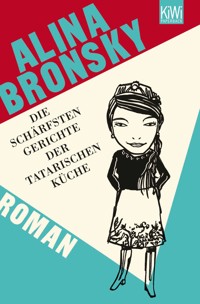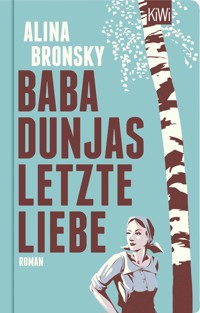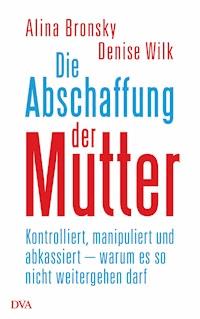Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Hanser Berlin LEBEN
- Sprache: Deutsch
Wenn Bestsellerautorin Alina Bronsky über Essen schreibt, geht es ans Eingemachte: Um Liebe, Hass, Verführung und Erpressung. Nur wenige Dinge sind so privat und so öffentlich, so zelebriert oder verheimlicht, so omnipräsent und zugleich verdrängt wie die Speisen, die wir zu uns nehmen. Jeder könnte ein Buch über Essen schreiben, das genauso einzigartig wäre wie sein Fingerabdruck, behauptet Alina Bronsky, und schreibt nun ihres: Eine höchst subjektive Erzählung über ihre persönliche Beziehung zu Porridge, Schokolade, Butterbrot, Borschtsch oder der Vogelmilchtorte. Denn für sie sind diese Speisen nicht einfach nur Nahrung, sondern ein Mittel der Fürsorge, Emanzipation, emotionalen Erpressung, das mal nach Heimat schmeckt, mal nach Liebe, Hemmungslosigkeit oder Askese. Ein bittersüßes kulinarisches Lesevergnügen: manchmal komisch und manchmal melancholisch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Wenn Bestsellerautorin Alina Bronsky über Essen schreibt, geht es ans Eingemachte: Um Liebe, Hass, Verführung und Erpressung.Nur wenige Dinge sind so privat und so öffentlich, so zelebriert oder verheimlicht, so omnipräsent und zugleich verdrängt wie die Speisen, die wir zu uns nehmen. Jeder könnte ein Buch über Essen schreiben, das genauso einzigartig wäre wie sein Fingerabdruck, behauptet Alina Bronsky, und schreibt nun ihres: Eine höchst subjektive Erzählung über ihre persönliche Beziehung zu Porridge, Schokolade, Butterbrot, Borschtsch oder der Vogelmilchtorte. Denn für sie sind diese Speisen nicht einfach nur Nahrung, sondern ein Mittel der Fürsorge, Emanzipation, emotionalen Erpressung, das mal nach Heimat schmeckt, mal nach Liebe, Hemmungslosigkeit oder Askese. Ein bittersüßes kulinarisches Lesevergnügen: manchmal komisch und manchmal melancholisch.
Alina Bronsky
Essen
Hanser Berlin
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Alina Bronsky
Impressum
Inhalt
Worum es in diesem Buch geht: Eine Art Vorspeise
1 Porridge oder das Heimweh
2 Borschtsch oder die Reifeprüfung
3 Schokokuss oder Frau Müllers Lektionen
4 Eiswürfel oder der ewige Frost
5 Grüne Soße oder die neue Heimat
6 Kaffee oder der Geistesblitz
7 Frikadellen oder die Verführung
8 Quarkauflauf oder Mamas Liebling
9 Die Stulle oder Trost im Gepäck
10 Die Napoleon-Torte oder die schönste Erzählung
11 Johannisbeeren oder die Vertreibung aus dem Paradies
12 Früchtebrot oder die Dankbarkeit
Schlusswort oder eine Art Nachspeise
Worum es in diesem Buch geht: Eine Art Vorspeise
Essen ist ein Thema, zu dem so ziemlich jeder etwas zu sagen hat. Nur wenige Dinge sind so privat und so öffentlich, so zelebriert oder verheimlicht, so omnipräsent und zugleich verdrängt wie Essen.
»Du kochst wirklich jeden Tag?«, hatte ich mit Anfang zwanzig eine ältere Dame aus der damals angeheirateten Verwandtschaft gefragt. »Wie hältst du das nur aus?«
»Ich habe eben jeden Tag Hunger«, antwortete ihr Mann für sie.
Letzteres gilt, mehr oder weniger, für jeden von uns. Fast alle essen mehrmals am Tag, und obwohl es eventuell doch nicht das Wichtigste im Leben ist, denken wir erschreckend oft daran. Zubereitete Lebensmittel werden meiner Beobachtung nach sogar noch öfter fotografiert als Babys oder Hundewelpen. Manchmal ist der kulinarische Exhibitionismus in den sozialen Netzwerken so erdrückend, dass ich mich frage, welche Geltungssehnsucht dahinterstecken könnte. Nicht, dass ich nicht auch schon meinen Suppenteller gepostet hätte, in der Hoffnung auf Aufmerksamkeit. Vielleicht ist es aber auch einfach die pure, unschuldige Freude, seine Mahlzeit zumindest auf diesem Wege mit anderen Menschen zu teilen: Schließlich essen viele von uns nicht gern allein. Und wenn wir allein essen, sind wir dabei oft ganz anders als in Gesellschaft. Dies gilt nicht nur für die Schönheit des benutzten Porzellans, sondern ganz besonders für die Frage, was überhaupt auf den Teller kommt, wenn wir uns unbeobachtet fühlen.
Bei schön ausgeleuchteten Körpern auf Fotos kalkulieren wir die Pose und die Nachbearbeitung automatisch ein. Diese Unterscheidung darf genauso bei veröffentlichten Mittagstischen gelten. Jeder Mensch hat nicht nur das Recht, mit der Schönheit seiner Mahlzeiten anzugeben, sondern auch darauf, über sein Essverhalten zu lügen.
Den eigenen Kühlschrank für andere zu öffnen, kann manchmal mehr Überwindung kosten, als jemanden ins Schlafzimmer, an den Medikamentenschrank oder an die Dokumentenschublade zu lassen. Ich kenne eine Frau, die sich aus genau diesem Grund gegen eine Wohngemeinschaft entschieden hatte. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, sich beim Essen beobachtet zu fühlen: »Jeder Gast meiner Mitbewohner würde dann sehen, was ich frühstücke.«
Was man isst, erlaubt also Rückschlüsse, die man manchmal lieber verhindern würde. Die größtmögliche Öffentlichkeit geht beim Essen mit der tiefsten Intimität einher. Die schnelle Aufmerksamkeit kann man für eigene Zwecke nutzen, das Persönliche darf man beschützen wollen.
Essen kann ein mächtiges Werkzeug sein — um jemanden bis in die tiefsten Schichten seiner Persönlichkeit kennenzulernen oder gar zu manipulieren. Der Geschmack, der Duft, oft schon die Erwähnung einer Speise kann einen Menschen in die schönsten oder auch in die schlimmsten Stunden seines Lebens katapultieren. Essen hat einen prominenten Anteil in der Malerei, in der Literatur und in aller Art von bewegten Bildern. Besonders spannend wird es, wenn es nicht nur als schmückendes Beiwerk, sondern als eigener Protagonist eingesetzt wird.
Wie tief alles rund um die Ernährung in unserem Unterbewusstsein verankert ist, lässt sich an der Vielzahl entsprechender Sprachbilder ablesen. Im Deutschen kann man jemanden zum Anbeißen gernhaben. Körperliche Attraktivität wird mit kulinarischen Attributen wie lecker und knackig beschrieben. Eine Leidenschaft, die jedes gesunde Maß verloren hat, kann einen Menschen schon mal verschlingen, auch Sorgen können uns auffressen. Auch jenseits der Küche ist das Essen tief in unserem Unterbewusstsein verankert und meldet sich mit allerhand Anspielungen und Metaphern. Man denke nur an Geschmacksfragen, die gar nichts mit dem ursprünglichen Geschmackssinn zu tun haben.
Ich werde in diesem Buch das Abschmecken größtenteils wörtlich nehmen. Das ist schon anspruchsvoll genug: Wie man genau kocht, salzt und würzt, ist schließlich eine Wissenschaft für sich, die von zahlreichen individuellen Erfahrungen konterkariert wird. Über die richtige Art kann man sich einig sein oder herrlich streiten — wenn man keine Angst vor den Gräben hat, die sich darüber auftun können. Doch wer bereit ist, den Geschichten hinter bestimmten Vorlieben zuzuhören, versteht sein Gegenüber am Ende besser als zuvor.
Ich werde auf den folgenden Seiten zwölf Gerichte, Getränke, manchmal auch einzelne Lebensmittel vorstellen. Jedes davon macht einen Teil meiner Welt aus. Und weil man in der Küche am besten ins Reden kommt, spreche ich beim Gemüseschneiden und Käsereiben über meine Kindheit, Auswanderung, Erwachsenwerden, Askese und Hemmungslosigkeit, über Familie und Freunde, über längst Vergangenes und doch Unvergessenes. Obwohl dieses Buch kein Kochbuch ist, kommen Rezepte darin vor. Und obwohl ich mich wirklich für keine große Köchin halte, erlaube ich mir, manche Dinge besser zu wissen.
Jeder Mensch könnte ein Buch über Essen schreiben, das genauso einzigartig wäre wie sein Fingerabdruck. Selbst eine unvollständige kulinarische Biografie wäre aussagekräftiger als jeder noch so lückenlose Lebenslauf. Diese hier ist meine: eine höchst subjektive Erzählung über meine persönliche Beziehung zu Porridge, Schokolade, Eintöpfen und der Napoleon-Torte.
1 Porridge oder das Heimweh
Es sind die frühen Neunzigerjahre, und es ist mein erster Herbst in Deutschland. Nur wenige Tage nachdem ich in die neue Klasse gekommen bin, steht das erste Schullandheim an. Meine Gefühle ähneln denen von Greg aus der berühmten Comic-Buchreihe, und zwar in dem Teil, in dem der Ich-Erzähler zur Fahrt auf die sogenannte »Schweiß-und-Fleiß-Farm« gezwungen wird. Greg wundert sich, warum alle anderen Teilnehmer im Gegensatz zu ihm große Reisetaschen dabeihaben. Während sie nachts in den mitgebrachten Schlafsäcken schlummern, muss er sich mit einem kleinen Handtuch zudecken.
Genau wie Greg bin ich erstens komplett unvorbereitet, zweitens gruseln mich fremde Gruppen, mit denen ich Schlafräume teilen muss. Das Schlimmste aber für Greg (und mich): die Mahlzeiten. Ich war, damals vielleicht mehr als heute, ein dauerhungriger Mensch. Ich wartete immer darauf, wann es endlich etwas zu essen geben würde. Ich versprach mir gerade in ungemütlichen Lebenslagen viel davon. Doch schon das erste Frühstück in der Jugendherberge gab mir den Rest.
Weiße Brötchen. Butter. Milch. Braunes Pulver mit dem seltsamen Namen Kaba. Kalte, seelenlose Objekte. Ich frage mich, wie verzweifelt Menschen sein müssen, die so etwas essbar finden. Ich misstraue einem Frühstück, für dessen Verzehr man kein Besteck braucht. Die erste Mahlzeit des Tages hat schließlich warm zu sein und muss gelöffelt werden. Mir wird bange: Wir sind doch Kinder, wir wachsen noch, warum hasst man uns hier so?
Dieses traurige Missverständnis ist gut dokumentiert: Viele Jahre später, bei der Pressearbeit für meinen zweiten Roman, erzählte ich einer Mitarbeiterin des Tagesspiegels von meiner ersten deutschen Klassenfahrt. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, so tief in die eigene Vergangenheit einzutauchen. Nach der Horrorfahrt im ersten Jahr hatte es später viel bessere Schulreisen gegeben, auf die ich mich vernünftig vorbereitet hatte, etwa durch einen Schokoriegel-Vorrat.
Die Journalistin und ich saßen bei einer Portion polnischer Teigtaschen zusammen, als sie mich nach meinem Verhältnis zur deutschen Küche fragte. Vielleicht, weil mein zweiter Roman aufgrund des Titels immer wieder für ein Kochbuch gehalten wurde. Und als ich krampfhaft überlegte, was ich ihr erzählen könnte, wurde plötzlich der Klassenfahrt-Albtraum aus meinem dreizehnten Lebensjahr wieder lebendig. Als der Text dann erschien, begann er mit dem Satz: »Alina Bronsky war schockiert.«
Ich muss gestehen: Das ist wahrscheinlich nicht einmal übertrieben. Bis zu dieser Klassenfahrt war mir gar nicht klar gewesen, wie viel mir ein Teller Haferbrei am Morgen bedeutet hatte. Geschmeckt hat er mir nämlich nie. Porridge hat bekanntlich weder Geschmack noch eine nennenswerte Farbe, und als Kind musste ich mit meinen Eltern um jeden Zusatzlöffel Honig feilschen. Die Hafer-Sehnsucht an diesem ersten Morgen im Schullandheim traf mich daher genauso unvorbereitet wie die kratzigen Decken auf den Hochbetten. Ich war nicht nur allein unter noch fremden Mitschülern, ich konnte mich nicht nur schlecht ausdrücken, ich hatte auch noch keinen Haferbrei zum Frühstück: Home is where your porridge is.
Ich war, bis dahin, von der noch frischen Migrationserfahrung meiner Familie eher positiv überrascht gewesen. Ich hatte mich mit meiner ganzen jugendlichen Begeisterung in ein neues Leben gestürzt, in dem vieles bunter, vielfältiger und vor allem verfügbarer war als das, was ich aus meinem Geburtsland kannte. Wer in jener Zeit aus der Sowjetunion ausreiste, hatte in der Regel mit Patriotismus und Heimweh eher wenig am Hut.
Ich war auch an diesem ersten Klassenfahrtmorgen bereit, den Culture Clash lachend zu überbrücken. Ich wollte nicht zulassen, dass ausgerechnet eine warme Grütze mich ausbremste. Todesmutig biss ich in das weiße Brötchen, das in einer Krümelwolke explodierte und mich mit Mehlpartikeln beschneite. Runterschlucken fand ich dann wirklich zu viel verlangt.
Mit etwas mehr Abstand lässt sich sagen, dass ich hier zum ersten Mal eine Zugehörigkeit zu einem kulinarischen Kulturraum wahrnahm. Auch Menschen, die keine slawische Sprache beherrschen, können in der Regel das Wort »Kascha« auf einer Speisekarte korrekt einem Brei oder einer Grütze zuordnen. Und in osteuropäischen Speisekarten findet es sich erstaunlich oft. Leider kann dieses russische Nationalgericht mit den ikonischen internationalen Lieblingen anderer Länder, etwa Pizza oder Paella, nicht mithalten. Kascha macht optisch wenig her, und ihr Ruf außerhalb ihres Kerngebiets liegt irgendwo zwischen Krankenhaus-Schonkost und klebriger Langeweile.
Doch wer Kaschas Understatement auf den Leim geht, verpasst etwas. Man kann es in dieser Frage beim erstbesten Google-Treffer nachlesen, in historischen Kochbüchern recherchieren oder einfach auf den gesunden Menschenverstand vertrauen. Allem Image zum Trotz hat jeglicher Brei aus zerkleinertem oder ganzem Getreide die besten Gründe, als Basis der täglichen Ernährung zu gelten. Er kann so vielfältig sein wie die Auswahl der Körner, wird stundenlang in der Restwärme eines Lehmofens gedämpft oder auf dem Induktionsherd rasch gekocht und kann sich sowohl in einer Betriebskantine als auch in einem Sterne-Restaurant behaupten. Er kann mit kandierten Äpfeln oder frischen Steinpilzen serviert werden, als Beilage, Hauptgericht und Dessert, und dies morgens, mittags und abends. Nicht zuletzt ist er der hochlebendige Erbe einer uralten Tradition: Der Getreidebrei brachte Generationen von Menschen durch Jahrhunderte eisiger ost- und nordeuropäischer Winter, stärkte sie für harte körperliche Arbeit und sorgte danach für geruhsamen Schlaf. Nicht umsonst heißen Feldköche auf Russisch »kaschewary«, was so viel wie Breikocher bedeutet. Es ist eine der einfachsten und günstigsten Varianten, viele Menschen auf einmal satt zu kriegen.
Eines der bekanntesten russischen Märchen heißt Der Brei aus einer Axt und erzählt davon, wie ein pfiffiger Soldat für eine Nacht bei einer geizigen Alten einkehrt und ihr mit List ein leckeres Abendessen abringt. Als die Gastgeberin behauptet, sie hätte nichts zu essen im Haus, entdeckt der Soldat eine Axt unter der Küchenbank und bietet an, daraus einen Brei zu kochen. Die verblüffte Frau sieht zu, wie der Soldat die Axt in Wasser aufkocht und zum Abschmecken um ein wenig Salz bittet. Wenig später sagt er, es sei schon köstlich, nur eine Handvoll Getreide und ein wenig Butter würden noch fehlen. Am Ende sitzen die beiden bei einem schmackhaften Brei beisammen, und die Alte fragt, wann sie denn endlich die Axt essen würden. Die sei doch noch gar nicht durch, sagt der gesättigte Soldat und nimmt das Werkzeug am Ende auch noch mit.
Kein Wunder, dass mein erstes Frühstück ohne Brei mich wie ein brutal abgerissenes Glied einer Kette fühlen ließ. Ich war in einem Land angekommen, das seine eigene Grützentradition längst vergessen, den einst omnipräsenten bäuerlichen Brei vor vielen Jahren durch Toast, Pumpernickel und Laugenzopf ersetzt hatte. Wäre meine Familie weiter im Süden gelandet, hätte ich zum Kakao wenigstens ein Croissant gekriegt.
»Wir haben als Kinder morgens selbstverständlich auch Haferflocken mit Milch gegessen«, protestiert ein deutschstämmiges angeheiratetes Familienmitglied, das die Vereinnahmung des Haferbreis durch mich ungern akzeptieren will. Aber in der Küche kommt es eben auf jedes Detail an. Die Haferflocken seiner Kindheit waren kalt, anschließend musste auch kein Topf geschrubbt werden. Man war damit vielleicht auf dem richtigen Weg, blieb aber aus unerfindlichen Gründen auf halber Strecke stehen.